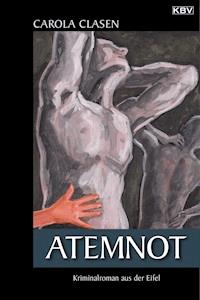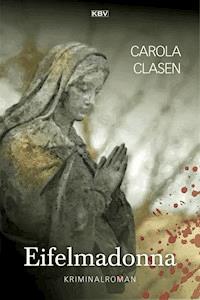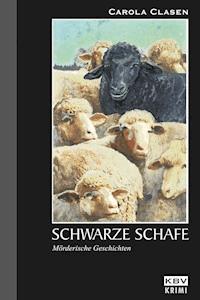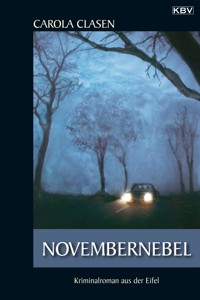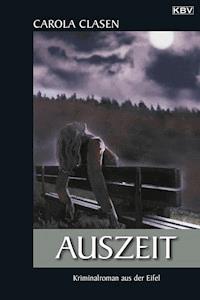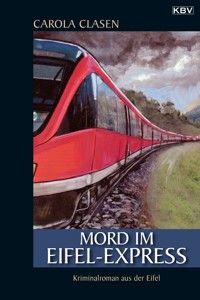Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sonja Senger
- Sprache: Deutsch
Hauptkommissarin Sonja Senger vom Kriminalkommissariat Euskirchen weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Am Morgen liegt ein neuer Fall auf ihrem Schreibtisch: ein unbekannter, misshandelter, toter Mann, der in Gemünd in einem Müllcontainer gefunden wurde. Am Abend dann folgt ein Date mit dem deutlich jüngeren, unwiderstehlichen Harry Konelly aus Köln, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Aber das Glück ist nur von kurzer Dauer. Als seine Frau Melinda mitsamt Kleinkind und Unterhaltsforderungen in Sonjas Forsthaus am Ende der Stromleitung auftaucht, erfährt sie, dass Harry sie betrogen und belogen hat. Sie jagt ihn zum Teufel. Aber Harry bleibt in der Nähe. Auf der Suche nach einer neuen Geldquelle gerät er in Tondorf in einer Kneipe in eine hitzige Diskussion um Windkraftanlagen und lässt sich auf ein Spiel ein, bei dem er alles auf eine Karte setzt. Es ist der Wind, der Sonja einen knappen Monat später Harry erneut in die Hände spielt und ihr die Gelegenheit gibt, es ihm heimzuzahlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carola ClasenSpiel mir das Lied vom Wind
Bisher von der Autorin bei KBV erschienen:
»Novembernebel«
»Das Fenster zum Zoo«
»Tot und begraben«
»Auszeit«
»Schwarze Schafe«
»Wildflug«
»Mord im Eifel-Express«
»Spiel mir das Lied vom Wind«
»Tote gehen nicht den Eifelsteig«
Seit 1998 schreibt Carola Clasen Kriminalromane, die in der Eifel spielen. »Spiel mir das Lied vom Wind« ist ihr sechster Roman mit der eigenwilligen Kommissarin Sonja Senger. Auch mit ihren Kurzgeschichten und Lesungen hat Carola Clasen sich einen Namen in der Region gemacht. Die »Queen of Eifel-Crime« ist Mitglied im Syndikat, lebt und arbeitet in Hürth.
Carola Clasen
Spiel mir dasLied vom Wind
1. Auflage November 20092. Auflage Mai 2011
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 99 86 68
Fax: 0 65 93 - 99 87 01
Umschlagillustration: Ralf Kramp
Redaktion: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-940077-68-4
E-Book-ISBN 978-3-95441-025-5
»Welche Riesen?«, fragte Sancho Panza.
(aus Don Quijote von Miguel de Cervantes)
1. Kapitel
Noch acht Stunden und elf Minuten. Ausgerechnet heute Morgen hatte Hauptkommissar Hans Roggenmeier, Leiter des Kriminalkommissariats Euskirchen, seiner Mitarbeiterin Sonja Senger eine Leiche auf den Tisch gelegt. Nicht in persona natürlich, sondern in Form eines Berichts aus der Rechtsmedizin Bonn, der mit schauerlichen Fotos gespickt war. »Sie haben doch was übrig für tote Männer«, hatte er spöttisch hinzugefügt.
Zu seinen Gunsten ging sie davon aus, dass er auf seine charmante Art ihre frühere Tätigkeit für die Trierer Mordkommission andeuten wollte. Sie ahnte aber auch, dass der Spott in seiner Stimme ihrer derzeitigen Arbeitsmoral galt. Völlig unnötige Bemerkung, denn sie wusste selbst, dass sie schon engagierter gewesen war. Aber sie war keine Maschine. Sie hatte derzeit Wichtigeres im Kopf.
Sie bedankte sich artig, dass er an sie gedacht hatte, und begann, die Unterlagen durchzublättern. Kaum hatte Roggenmeier ihr Büro verlassen, klappte sie den Aktendeckel zu und sah wieder auf die Uhr.
Noch acht Stunden.
Nichts gegen einen Mordfall. Mord war die Königsdisziplin. Aber das Timing war schlecht. In spätestens einer Stunde musste Sonja nach Hause fahren, um sich dort sorgfältig vorzubereiten. Die Kleiderordnung für den Abend war noch nicht entschieden. Etwas Kühles oder Warmes? Der Mai war unberechenbar, niemand wusste, wie das Wetter sich im Laufe eines Tages entwickeln würde. Himmel, wie sollte sie sich da auf einen Mord konzentrieren können?
Widerwillig schlug sie die Akte nochmals auf. Bei der Leiche handelte es sich um einen unbekannten Mann, von dem der Bonner Rechtsmediziner Dr. Gehring nach der genetischen und toxikologischen Untersuchung behauptete, dass weder Gift in seinen Blutbahnen noch Wasser in seiner Lunge zu seinem plötzlichen Ableben geführt hatten. Auch Alkohol, nicht mehr als 1,2 Promille, konnte nicht die Todesursache gewesen sein. Der Mann war im Müll erstickt. Wie das Gesicht des Mannes ursprünglich ausgesehen haben mochte, war nicht mehr zu erkennen.
Sein Alter schätzte Dr. Gehring auf vierzig Jahre. Seine Körpergröße betrug zirka 186 Zentimeter, sein Gewicht etwa 89 Kilogramm. Dunkles, kinnlanges Haar, dunkle Augen, helle Haut. Ansonsten keine besonderen Merkmale, bis auf eine alte Blinddarmnarbe. Der Körper war von vielen Wunden übersät. Nahezu kein Körperteil war verschont geblieben, Quetschungen und Hämatome, Schürf- und Kratzwunden zogen sich vom Kopf bis zu den Füßen. Beim Todeszeitpunkt legte sich der Rechtsmediziner auf die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai fest.
Eine ganze Reihe sogenannter anhaftender Spuren hatte die Kriminaltechnik bereits vorab sichergestellt. Im letzten Punkt auf der langen Liste war die Rede von mehreren Knutschflecken im Schulter- und Halsbereich. Moment! Sonja musste den letzten Punkt zweimal lesen. Knutschflecke. War er ein Opfer häuslicher Gewalt geworden?
Seit dem letzten hochdramatischen Fall, den Kollege Michelsen eher zufällig hatte aufdecken können, war sie sensibilisiert.
Michelsen hatte zum Abschluss seiner Ermittlungen im Trierer Verein Talisman, einem sogenannten Männerbüro, ein Seminar abgehalten. Er war, gelinde gesagt, irritiert gewesen, als er zurückkehrte. Seine Erfahrungen hatten im Kommissariat schnell die Runde gemacht. Wissen, das nicht neu für die Kollegen war, wurde durch den aktuellen und detaillierten Bericht allen noch einmal ins Bewusstsein gerufen. Ein Thema, bei dem sich alle gleich schwer taten. Die männlichen Kollegen griffen es mit spitzen Fingern auf, es war ihnen nicht geheuer. Den Polizistinnen schien es peinlich. Wer von ihnen hatte nicht schon einmal einen Schuh oder einen Teller geworfen?
Sonja Senger müsste sich bei diesem Thema eingestehen, dass sie wohl eher der verbale Typ war, der nur mit Worten handgreiflich wurde. – Nur? Das machte es nicht besser. Sicherer war es, keine Angriffsfläche zu haben. Und das war zurzeit der Fall.
Wie lange noch? Sie sah auf die Uhr. Noch sieben Stunden und zwanzig Minuten.
Sonja fühlte sich zwischen Pflicht und Kür hin und her gerissen. Während der magere Inhalt ihres Kleiderschranks vor ihrem inneren Auge an ihr vorbeizog, ohne dass sie bei einem Teil mit Überzeugung hätte »Stopp« sagen können, versuchte sie sich auf den Bericht des Rechtsmediziners zu konzentrieren. Er führte von der Beschreibung des Toten zum Fundort, der laut Kriminaltechnik nicht der Tatort sein konnte. Wie auch – der Mann ohne Namen war erst heute, am frühen Morgen des 4. Mai, in einem halbvollen Müllcontainer gefunden worden, in den eigentlich nur Verpackungsabfall mit grünem Punkt gehörte. Er war einfach entsorgt worden, wie ein Joghurtbecher.
Der Müllcontainer stand zwischen zwei anderen Müllcontainern – einer für Papier und einer für allgemeinen Hausmüll – in Gemünd auf dem Parkplatz hinter einer Spielhalle. Die Fläche diente als Privatparkplatz für Gäste der Spielhalle und die Bewohner des anliegenden Hauses. Das Tor zur Einfahrt habe in der bewussten Nacht, wie so oft, offen gestanden. Es zeigt zur Urftseestraße.
Der Mann im Müll war nackt, als er gefunden wurde. Kleidungsstücke oder Ausweispapiere lagen nicht unter oder neben ihm im stinkenden Müll. Auch nicht in den beiden anderen Müllcontainern, die sichergestellt worden waren. Er konnte bislang nicht identifiziert werden, weil niemand ihn vermisste. Keine der in letzter Zeit eingegangenen Vermisstenanzeigen wollte auf ihn passen.
Gefunden hatte ihn die Putzfrau der Spielhalle, Anna Resch, 54 Jahre, wohnhaft ebenfalls in Gemünd, die vom 1. bis zum 3. Mai Urlaub hatte. Sie hatte gegen fünf Uhr in der Frühe die Papierkörbe leeren wollen, da habe er da zusammengekrümmt im Müll gelegen. Sie habe noch nie einen Toten gesehen. Angeblich stand sie noch unter Schock. Sonja fragte sich, woran Anna Resch sofort erkannt hatte, dass der Tote tot und nicht nur bewusstlos war? Denn Anna Resch hatte nicht den Krankenwagen, sondern sofort die Polizei gerufen.
Was hatte sich in der Nacht abgespielt? Ein Tanz in den Mai der besonderen Art? Dagegen sprach, dass er nicht vermisst wurde. Niemand tanzte allein in den Mai. Dagegen sprach außerdem, dass er auffallend wenig Alkohol im Blut hatte. War er in der Spielhalle gewesen? In Spielhallen war Alkoholausschank verboten. Hatte er in der Nacht nicht gefeiert, sondern gespielt? Einsam und allein? Hatte er gewonnen und war anschließend ausgeraubt und ermordet worden?
Sonja notierte die offenen Fragen, die ihr bei der ersten Durchsicht aufgefallen waren, auf ein DIN-A4-Blatt, legte es auf den Bericht des Rechtsmediziners und das Protokoll der Kollegen und schob alles zusammen in einen weiteren Aktendeckel, zurrte ihn fest und überlegte, ob sie Müllmann oder Maikönig darauf schreiben sollte. Das Kind brauchte einen Namen. Sie entschied sich für Mann im Müll und ließ die Akte auf ihrem Schreibtisch liegen.
Sofort morgen früh wollte sie nach Gemünd fahren und mit den Nachforschungen beginnen. Morgen, ach was, heute Abend würde sie wissen, was es mit ihrem dubiosen Termin auf sich hatte, und sie könnte sich wieder voll und ganz in die Arbeit stürzen.
Ein wenig hoffte sie fast, der Abend würde ein Reinfall werden. Nicht um sich seelisch auf eine böse Überraschung einzustellen, sie kannte sich zu gut. Sie würde es kaum schaffen, Herz und Hirn reibungslos miteinander zu verbinden. Sie sah wieder auf die Uhr.
Noch sieben Stunden.
Sie schob die Schubladen ihres Schreibtisches zu, sie schloss das Fenster, löschte die Lichter der Schreibtisch- und der Deckenlampe, sie nahm ihre Tasche. Als sie an Roggenmeiers Büro vorüberging, dachte sie, er solle sich bloß nicht aufspielen.
Als sie die Glastür des Gebäudes aufschob, fragte sie sich, wer sie vermissen würde, wenn …? Roggenmeier! Darauf konnte sie verzichten. Wesseling! Seit Neuestem befördert zum Oberstaatsanwalt. Je nun. Wenn er wüsste, was sie heute Abend vorhatte, stünden ihm die Haare rund um seinen akkuraten Mittelscheitel zu Berge. Wer noch? Davis und West! Hund und Katze. Sie würden trauern. Aber auch bei ihnen stand der Eigennutz im Vordergrund. Wer sollte sie füttern?
Zu Hause duschte Sonja ausgiebig. Sie legte Make-up auf. Sie drehte ihre Haare auf und frisierte sie mal so, mal so. Sie zog sich vierundzwanzigmal an und wieder aus. Sie bekam einen Hitzeanfall. Ihre Hände zitterten. Egal, was sie anstellte, sie gefiel sich nicht. Sie schaltete ihr Handy ein, wollte die gespeicherte Nummer wählen und absagen, aber im letzten Moment ließ sie es sein.
Noch drei Stunden.
Sie machte sich Kaffee, rauchte draußen auf der Ofenbank einen Zigarillo und traf eine Entscheidung. In der Ruhe liegt die Kraft. Alle Zeiger auf Null. Die Zeremonie begann von vorn. Duschen, Make-up, Haare, Kleidung. Das Ergebnis war besser, aber nicht gut. Doch das Konzept war gut. So gut, dass sie das Ritual ein weiteres Mal zelebrierte.
Sie kochte Kaffee, rauchte noch einen Zigarillo, und Modenschau Nummer drei folgte. Das Ergebnis übertraf die ersten beiden um Längen. Jeans, T-Shirt, Leinenblazer. Nicht gerade aufregend oder unkonventionell, es musste reichen. Es war keine Zeit mehr für einen neuen Durchgang, sie musste in Kall den Eifelexpress erwischen.
An ihrer eingeschränkten Mobilität hatte sich noch nichts geändert. Immer noch ächzte sich jeden Tag der Woche ihr alter VW Polo bis zum Kaller Bahnhof und wieder zurück. Obwohl sie wiederholt zu spät zum Dienst erschien, was ganz klar der ÖPNV zu verantworten hatte, ließ der vom Kriminalkommissariat Euskirchen angekündigte Dienstwagen auf sich warten, als müsse er extra für sie konstruiert werden.
Der Sülzburger Hof war eine typische Kölner Eckkneipe. Sie lag an einer Straßenkreuzung. Die Fensterscheiben bestanden aus dunklem Buntglas. An der Hauswand warben zwei Brauereien, Bitburger und Gaffel, um die Gunst durstiger Passanten. Es gab keine Außengastronomie, obwohl draußen Platz für ein paar Stühle und Tische war und im Mai die frühen Abende lau sein konnten.
An der Eingangstür zum Sülzburger Hof stand Raucherclub, und Sonja bereute, die Zigarillos im Forsthaus liegen gelassen zu haben. Immerhin hatte sie an das vermaledeite Handy gedacht und es eingeschaltet, für den Fall, dass der Termin wieder einmal verschoben werden sollte.
Sie stieß die Pendeltür bis zum Anschlag auf, und jemand sprang mit einem »Au« beiseite. Der Türknauf hatte einen Spieler am Automaten erwischt. Anklagend legte er die rechte Hand auf seinen Hintern. Er trug enge Jeans und ein weißes T-Shirt unter einer Lederjacke. Er verzog das Gesicht und brachte ein schiefes Lächeln zustande. Mit links warf er bereits die nächsten Münzen ein. Vielleicht hatte er einen Lauf.
Sonja bezog Posten auf einem gepolsterten Hocker an der Theke. Sie war mindestens ebenso erschöpft wie aufgeregt und atmete einmal tief durch. Aber die Luft in der Kneipe war noch stickiger als sie im Eifelexpress gewesen war.
Die letzte Bahn nach Kall fuhr um 22.05 Uhr. Wenn sie die Straßenbahnfahrt bis zum Kölner Hauptbahnhof einkalkulierte, musste sie spätestens um 21.30 Uhr dieses trostlose Etablissement wieder verlassen haben. Oder machte sie sich besser sofort wieder auf und davon? War sie verrückt geworden? Was machte sie hier eigentlich?
Nach der Maxime Warum eigentlich nicht? hatte Sonja der zweifelhaften Vision einer Kartenlegerin nicht widerstehen können und Ende letzten Jahres einem wanderfreudigen, kochenden, reisenden, rotweintrinkenden 57-jährigen Kölner Büchernarren geschrieben, der im Kölner Stadt-Anzeiger ein Kontaktinserat geschaltet hatte. Obwohl ihre Zeilen an ihn kryptisch und kaum lesbar gewesen waren, hatte er postwendend geantwortet. Zu einem Treffen war es bis heute aber nicht gekommen.
Unfassbare sechs Monate lang hatten die Kandidaten in unregelmäßigen Abständen telefoniert, Nettigkeiten ausgetauscht, Termine ausgemacht und wieder verschoben. Mal war es Sonja, die im letzten Moment der Mut verließ, mal war ihm etwas dazwischengekommen. Einmal erreichte seine Absage sie, kurz bevor sie – ebenso umständlich in Schale geworfen wie heute – das Forsthaus verlassen wollte, ein anderes Mal, als der Eifelexpress gerade in den Bahnhof Euskirchen einfuhr.
Danach war eine längere Funkstille zwischen den Kandidaten eingetreten, weil Sonja es leid war. Aber er ließ nicht locker. Charmant und eloquent umgarnte er sie und sprach von der tieferen, geradezu schicksalhaften Bedeutung, die dem Nichtzustandekommen der gegenseitigen Inaugenscheinnahme innewohne. Sonja musste sich eingestehen, dass sie ebenfalls gern daran glauben wollte, und räumte ihm eine letzte Chance ein. Sie hatten sich auf den 4. Mai (18 Uhr) geeinigt. Das war heute. In einer halben Stunde.
Dieses Mal endgültig, wie es schien, denn Sonjas Handy schwieg beharrlich. Zu früh am vereinbarten Ort zu sein, hatte nicht der Eifelexpress zu verantworten. Dies entsprach einem raffinierten Plan. Sie wollte noch die Möglichkeit zu einem Gang auf die Toilette haben, wo sie letzte Hand an ihr Äußeres legen konnte, und einem ersten Kölsch, bevor es zur gefürchteten Gegenüberstellung kam.
Harry Konelly hieß ihr Termin.
Das war fast alles, was sie von ihm wusste. Sie wusste nicht, wie Harry Konelly aussah. Harry Konelly wusste nicht, wie Sonja Senger aussah, obwohl einige Male von einem Foto-Austausch die Rede gewesen war. Ein Bild sage mehr als tausend Worte, hatte Sonja ihn aufgefordert. Er sei nicht besonders fotogen, war Harrys Antwort gewesen. Nicht bedenklich klang das in Sonjas Ohren, sondern bescheiden.
Sie hatte sich längst im Kopf ein Bild von ihm gemacht. Er schien nicht humorlos oder verklemmt, er plauderte drauflos, als seien sie alte Bekannte. Sie sagte ihm nicht, dass sie Kommissarin war. Sie erzählte – ohne Wolfgarten namentlich zu erwähnen – von ihrem Leben in einem Forsthaus am Ende der Stromleitung und von der Eifel an sich. Und er davon, wie sehr er diese Region mochte, und wo er überall schon gewesen sei, um Objekte zu finden, anzusehen, zu bewerten und zu vermitteln. Er war Immobilienmakler. Seine Stimme klang angenehm. Sein Name klang angenehm. Hielt beides, was es versprach?
Die Wirtin im Sülzburger Hof, eine Rothaarige, die vor lauter Haarspray den Kopf kaum bewegen konnte, sah Sonja fragend an.
»Ein Kölsch«, bestellte Sonja.
»Ein Kölsch«, wiederholte die Wirtin und hielt das Glas schräg unter den Zapfhahn.
Kölsch, das war Zuhause. Und Kölsch ging schneller als Pils. Kaum hatte Sonja den Gedanken zu Ende gedacht, stand das Glas vor ihr auf dem Deckel.
»Zum Wohl!«, wünschte man ihr.
Ein kräftiger Schluck und das Glas war halbleer.
Sie hatten kein Erkennungszeichen verabredet. Keine Rose, keine Zeitung. Nicht nötig, hatte Harry Konelly behauptet, er wisse sofort, welches Gesicht zu dieser betörenden Stimme passe. Im Übrigen glaube er, sie am suchenden Blick erkennen zu können.
Sonja sah auf die Uhr. Noch zwanzig Minuten. Höchste Zeit für die Gesichtskontrolle. In der sparsamen Beleuchtung des Waschraums sah sie besser aus, als sie befürchtet hatte.
Zurück auf ihrem Hocker blickte sie sich um. Über der Eingangstür liefen stumme Sportnachrichten im DSF auf einem Flachbildschirm. Der Spieler geriet wieder in ihr Blickfeld. Ein unruhiger Typ, der von einem Bein aufs andere wechselte und zwischen Theke und Spielautomat hin und her pendelte. Mal wollte er Kleingeld, mal ein Bier. Er schien mit sich selbst zu sprechen, denn seine Lippen bewegten sich ohne Unterlass.
Außer ihm und der Wirtin hielten sich vier weitere Männer, fortgeschritten in Alter und Bauchumfang, in dem halbdunklen, verräucherten Gastraum auf. Sie standen nebeneinander an der Theke, hielten sich an ihren Gläsern fest, rauchten und redeten. Übers Wetter, das im März eingestürzte Stadtarchiv, den U-Bahnbau, die Suche nach einem neuen Bürgermeister und über den FC. Vor allem über den FC, der offensichtlich am Vortag überraschend Werder Bremen mit 1:0 geschlagen hatte. Wohl deswegen, weil Werder nur mit der B-Mannschaft angereist war, weil die Guten sich für den UEFA-Cup schonen wollten. In der 61. Minute erzielte ein gewisser Novakovic den entscheidenden Treffer. Es folgte eine Einzelkritik der Kölner. Es fiel kein einziger deutscher Name, wunderte sich Sonja.
Keiner dieser Kenner und Könner war Harry Konelly. Keiner schenkte Sonja einen suchenden Blick. Die Wirtin hieß Gerda und duzte alle. Sie fragte nach dem Hund, nach der kranken Schwiegermutter und der defekten Spülmaschine. Alle waren einer Meinung, früher sei alles besser gewesen. Im Hintergrund sang eine weibliche Stimme schon zum zweiten Mal:
Gib dem Wind eine Chance sich zu drehen,
hab die Sonne so lange nicht gesehen …
In der Glasvitrine hingen Fotos aus besseren Zeiten. Die lachende Gerda, damals jung, schunkelnd und trinkend mit Karnevalisten.
Es war 18 Uhr. Sonja hypnotisierte die Eingangstür.
»Darf ich mich zu Ihnen setzen?« Eine Stimme aus dem Off.
Sonja fuhr zusammen. Sie drehte sich um und erstarrte. Manches wusste man nie, manches sofort. Dieser Mann in ihrem Forsthaus, auf ihrem Sofa, in ihren Armen, in ihrem Bett – nie. Er konnte tun und sagen, was er wollte, er hatte bereits verloren. Er würde es nicht werden, der Mann an ihrer Seite. Niemals.
Der Mann, der von seinem Todesurteil nichts wusste und sich, ohne ihr Einverständnis abzuwarten, neben sie auf einen Barhocker schob, hatte ein Glas Rotwein in der Hand. Sein Körperbau war auf die einfache Formel zu bringen: Höhe und Breite entsprachen der Tiefe. Der Bauch, den er angesetzt hatte und der offensichtlich seiner Wanderfreude trotzte, sprach für seine Kochkünste. Dass er Kölner war, war schon in den ersten sechs Worten nicht zu überhören gewesen. Seiner Reiselust hatte er offenbar die gesunde Gesichtsfarbe zu verdanken.
Allein seine Stimme erinnerte sie noch vage an das Bild, das sie sich von ihm am Telefon gemacht hatte. An diesem Punkt angekommen, wollte Sonja nur noch weg. Hastig leerte sie ihr Glas, aber Harry Konelly winkte ein neues für sie herbei und stellte die Frage aller Fragen: »Sind Sie öfter hier?«
»Sollte ich?«, fragte Sonja kampfeslustig zurück.
»Ist doch gemütlich hier, oder?«
Gerda brachte das neue Kölsch, Konelly bedeutete ihr, einen Strich auf seinem eigenen Deckel zu machen.
»Kommt nicht infrage!«, protestierte Sonja.
Gerda blickte erstaunt von ihm zu ihr und machte einen weiteren Strich auf Sonjas Deckel. Konelly störte das nicht. Er hatte auch Besseres zu tun. Er begutachtete Sonja wie eine zugelaufene Katze. Behalte ich sie oder bringe ich sie ins Tierheim? Interessiert verfolgten die Thekenbrüder die Szene. Sonja schob das Kölsch weg und starrte darauf wie auf einen vergifteten Becher.
»Sie gefallen mir«, beschloss Konelly seine Analyse.
Sie hatte es geahnt. Sie hatte ein Talent, den falschen Männern zu gefallen. Sie verfluchte die Idee, auf eine und insbesondere seine Bekanntschaftsanzeige geantwortet zu haben. Das war das Dümmste, das sie je in ihrem Leben angestellt hatte. Kerstin Warenka, die Kartenlegerin, gehörte an den Pranger. Sie verstand von der Hellseherei so viel wie Davis und West vom Fußball. Zeit zu gehen.
Was Sonja auf dem Hocker hielt, war nur noch Neugier. Wie weit würde dieser Konelly gehen?
»Nun trinken Sie schon«, forderte er sie auf. »Wir zwei machen uns en schönen Abend, ne?«
»Vergessen Sie es.«
»Wenn es Ihnen hier drin nicht gefällt, können wir auch woanders hingehen.«
Konelly kapierte es einfach nicht. »Zu dir oder zu mir?«, fragte Sonja bissig zurück.
Er zuckte mit den Schultern und lächelte irritiert. »Ich wohne gleich um die Ecke.«
»Wie praktisch.«
»Nicht wahr?« Konelly ließ seinen linken Arm sinken und herumbaumeln, bis seine Hand zufällig auf Sonjas Rücken landete und dort zu tätscheln begann.
Sonja stellten sich die Nackenhaare auf.
»He! Mann!«, rief einer der Thekenbrüder herüber, den die anderen Theo nannten. »Lass die Frau in Ruh.«
Konelly drehte den Kopf zu ihm. »Was geht dich das an?« Er legte seine Hand auf Sonjas Hand. »Na, na. Stell dich ma nich so an. Ich beiß doch nich.«
Sonja presste die Lippen aufeinander. Sie schloss die Augen. Sie konzentrierte sich. Konelly wusste nicht, dass er sich am Abgrund befand. Sie zählte. Drei - zwei - eins - jetzt. Seine Hand, darunter ihre Hand, die zur Faust geworden war, schnellten gemeinsam hoch bis zu dem Punkt, an dem Konelly sich selbst einen Kinnhaken verpasste. Als er dabei vom Hocker rutschte und in die Knie ging, lag Sonjas Hand bereits wieder seelenruhig auf der Theke. Als Konelly sich aufrappelte, das Kinn hielt und seinen Kiefer kontrollierte, griff Sonjas Hand zum Kölschglas.
»Prost, meine Herren!«, rief sie den vier Thekenbrüdern zu. Anerkennend hoben sie ihr Glas. »Dat haste jut jemacht, Mädchen!«
»Eingebildete Ziege!«, schimpfte Konelly. »Meinste, du wärst was Besseres? He?«
»Halt bloß die Schnauze!«, rief Theo. »Sonst kristet met uns ze dunn.«
»Ihr habt se ja nich mehr alle!« Konelly zeigte allen einen Vogel.
Gerda mischte sich nur insofern ein, als sie Konellys Bierdeckel abrechnete. »Macht 13,70 Euro. Aber dalli! Und nix wie raus hier!« Sie wies unmissverständlich zur Tür.
Konelly warf einen 20-Euro-Schein auf die Theke. »Ihr könnt mich mal.«
»Gerne!«, riefen ihm die Thekenbrüder nach.
Der Spieler stellte ihm ein Bein. Konelly stolperte hinaus. Die Tür fiel hinter ihm zu. Alle atmeten auf.
»Komm, Mädchen«, forderte Theo Sonja auf. »Wir spendier‘n dir ein Kölsch.«
Sonja rückte auf. Sie schnorrte eine Zigarette.
»Den hab ich hier noch nie gesehen«, meinte Gerda mit grimmiger Miene, während sie zapfte. »Und der kommt mir hier auch nicht wieder rein.«
»Guter Schlag«, lobte Theo Sonja. »Selbstverteidigungskurs, was?«
»Mehr als einen.«
»Den sollten Sie glatt anzeigen wegen Nötigung oder wie das heißt.«
»Ja«, sagte Sonja und nippte am Kölsch. »Hätte ich machen können. Aber er hat seine Lektion ja bekommen.«
»Sie kannten den Mann nich’ – oder etwa doch?«
»Kennen ist zu viel gesagt. Wir waren hier verabredet. Ich kenne ihn nur vom Telefon.«
»Ah!«, machte Theo. Seine Freunde schwiegen und beugten sich vor, um das Gespräch verfolgen zu können. Gerda stellte den CD-Player leiser. »Was Geschäftliches?«
»Genau.« Sonja griff den Vorschlag erleichtert auf. »Was Geschäftliches. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Mit so einem mach ich keine Geschäfte.«
»Auf keinen Fall«, meldete sich Theo.
Die Frage nach der Art des Geschäftes, das Sonja und dieses Ekel zusammengeführt hatte, lag in der Luft. Die Männer warteten, ob Sonja sie vielleicht von selbst beantwortete. Sie warteten, bis ihre Gläser leer waren. Danach hielten sie es nicht mehr aus.
»Darf man fragen, was für ein Geschäft das war?« Wieder Theo.
»Klar«, erwiderte Sonja. »Er ist Immobilienmakler. Er wollte mir eine Wohnung besorgen.«
»Sie suchen ‘ne Wohnung? Warum sagen Sie das nicht gleich? In meinem Haus wird eine frei. Zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad, Balkon.«
»Danke, danke. Nicht heute. Für heute hab ich erst mal genug.«
»Das können wir uns denken.« Sie nickten alle gleichzeitig, im Takt, wie Marionetten. »Wenn Sie Ihre Meinung ändern, Sie treffen mich hier bei Gerda jeden Tag um dieselbe Zeit«, versprach Theo.
»Uns auch«, bestätigten die anderen.
»Das ist nett von Ihnen«, sagte Sonja. »Jetzt muss ich aber los.«
Gerda winkte ab, als Sonja ihren Deckel bezahlen wollte.
»Ach, eins noch!«, bettelte Theo.
Sie mochte es ihm nicht abschlagen. Von Kall nach Wolfgarten wurde nachts erfahrungsgemäß nicht kontrolliert. Es war noch lange nicht 21 Uhr, aber es war alles gesagt, und Sonja wäre gern allein, um das Abenteuer zu verdauen. Sie war mit Hoffnungen hierher gekommen, die größer gewesen waren als ihre Zweifel. Eine vage Wut nahm langsam Gestalt an, mehr über sich selbst als über Harry Konelly. Wie hatte sie sich nur auf ein Blind Date einlassen können?
Gerda stellte die Musik wieder lauter.
Frei wie der Wind, komm flieg dorthin,
wo deine Träume sind, frei wie der Wind …
Gedankenverloren schienen die Gäste des Sülzburger Hofs zuzuhören. Gerda verschränkte die Arme vor der Brust und wippte im Takt mit den Hüften. Sonja klopfte ihn mit dem Glas auf dem Bierdeckel. Die Gäste hielten ihn mit den Füßen.
Plötzlich brachte ein Scheppern und Klirren sie alle aus dem Takt. Ein Geräusch, das nicht aufhören wollte und von der Tür herkam. Köpfe fuhren herum. Der Spielautomat. Aus dem breiten Schlitz rasselten die Münzen heraus, quollen über die Hände des Spielers, glitten über seine Schuhe auf den Boden und sprangen umher.
Während Sonja fasziniert auf den nicht enden wollenden Geldregen starrte, sprangen die Thekenbrüder geistesgegenwärtig auf, stellten sich auf die Münzen, bückten sich, hoben sie auf und lieferten sie ab. Gerda verließ ihre Theke und schlug mit Fäusten auf den Automaten ein. Er jaulte auf. Die Münzen rollten weiter. Hektisch stopfte sich der Spieler die Jacken- und Hosentaschen voll. Jedes Mal, wenn er sich bückte, fielen ein paar Münzen wieder heraus. Seine kinnlangen, welligen Haare fielen ihm über das Gesicht. Gerda stellte ihm eine kleine Plastiktüte zur Verfügung.
Goldgräberstimmung im Sülzburger Hof.
Als der Spielautomat sich verdunkelte, als gebe er seinen Geist auf, als er nur noch quietschte und rumpelte und keine einzige Münze mehr ausspuckte, kehrten die Gäste mit roten Gesichtern an die Theke zurück.
Der Spieler aber beobachtete, wie der Automat allmählich wieder auf Touren kam, als die bunten Lichtkreise wieder erschienen und lockend die Symbole und Zahlen durchliefen. Er tätschelte den schwarzen Kasten wie einen guten, treuen Freund.
Schwer beladen schlurfte er mit hellem Glanz in den Augen auf Sonja zu. Er warf die Plastiktüte auf die Theke. Die Kölschstangen vibrierten. Die Tüte sackte nach allen Seiten durch. Er knotete sie zu. »Ich geb ‘ne Runde!«, rief er, strich sich die Haare aus dem Gesicht, strahlte alle an und breitete die Arme aus. »Schampus für alle!«
Sonja musterte die Geldtüte und fragte sich, wie viel er wohl gewonnen haben mochte. Fünfzig Euro? Hundert Euro? Das würde knapp werden für Champagner. Er überschätzte seinen Gewinn. Auf charmante, naive Weise. Er war nicht ihr Jahrgang. Sinnlos, dass er ihr gefiel. Und überhaupt, hatte sie nicht gerade einen auf die Nase bekommen?
Auf ihr blieb sein Blick zuletzt ruhen. Er musterte sie amüsiert und nickte ein wenig mit schiefem Kopf, als erinnere er sich gern an ihren gelungenen Verteidigungsschlag gegen den zudringlichen Verehrer. Unter seinem Hemdkragen kam ein dünnes, schwarzes Lederband zum Vorschein. Wenn er einen weiteren Knopf geöffnet hätte, hätte sie sehen können, welchen Glücksbringer er daran trug.
Er zog ohne Hinzusehen eine Zwei-Euro Münze aus der Jackentasche und legte sie auf den Handrücken.
»Kopf oder Zahl?«, fragte er Sonja.
»Kopf.«
Er warf die Münze in die Luft und fing sie mit der Hand auf, umschloss sie mit den Fingern und öffnete die Faust.
»Kopf!«, rief Sonja erfreut. »Und was habe ich gewonnen?« Sie schielte auf die Plastiktüte voller Geld.
Er steckte die Münze wieder ein, beugte sich vor, tippte sich an die Stirn und sagte leise: »Mich, denn ich bin Harry Konelly.«
2. Kapitel
Ausnahmsweise hat sie heute Morgen daran gedacht, mich zu füttern. Sie muss in Gedanken anderswo gewesen sein, denn sie hat mir mehr in meinen Napf gelöffelt als üblich. Dafür war das Futter älter und schon angetrocknet. Aber der Hunger treibt es rein. Ich bin von Haus aus ein Straßenkater. Ich bin nicht wählerisch, was das Futter angeht. Sonst schon.
Nach dem Fressen gehe ich vor die Türe, gähne, strecke und recke mich und zähle eine Weile die Vögel auf den beiden Bäumen. Ich verliere den Überblick. Es sind zu viele. Ich überlege, wie ich da hochkommen könnte, ohne von ihnen gesehen zu werden. Als mir nichts einfällt, scheuche ich zum Spaß ein paar Bienen, Schmetterlinge und Fliegen durchs hohe Gras. Eine Art Verdauungsspaziergang.
Für den Rest des Tages werde ich mich auszuruhen versuchen. Aber da laufen mir zwei junge Feldmäuse zwischen die Beine. Typisch, entweder gibt es tagelang nix zu fressen oder viel zu viel für einen Tag. Davis hätte es vergraben. Ich mache so was nicht.
Ich liebe dieses Spiel, fangen, laufen lassen, fangen, laufen lassen. Wie sie dann piepsen vor Angst. Wenn sie nicht mehr können, verleibe ich sie mir bis auf die Schwanzspitze ein, mit Haut und Knochen. Die zweite schmeckt nicht ganz so gut wie die erste. Ich spüle mit ein paar Schlucken aus der Regentonne nach.
Jetzt bin ich endgültig reif für ein Schläfchen. Ich springe auf meine Bank, rolle mich auf den Rücken und strecke der Sonne meinen dicken Bauch entgegen. Mir fallen die Augen zu. Ein laues Lüftchen streift mein Fell, in meinen Ohren raschelt, summt und zirpt es. Verlockende Geräusche. Ich könnte schon wieder, ach nein, später, mir laufen die Mäuse nicht weg.
Bis auf die großen Vögel bin ich der Einzige, der sie jagt. Die Viecher schnappen sie mir manchmal vor der Nase weg, indem sie sich einfach aus dem Himmel auf sie herunterstürzen. Rums! Wie unfair. Da hat unsereins keine Chance. Ansonsten habe ich keine Konkurrenz. Meine Artgenossen habe ich erfolgreich vergrault. Und Davis ist nicht schnell genug.
Ich bin der unumstrittene König in meinem Revier. Da kann ich auch mal in Ruhe ein Nickerchen machen.
Ich führe hier – zwischen Wald und Feld – ein wunderbares Leben. Aber das täuscht. Mein eigentliches Zuhause, und damit meine ich das Haus, das in meinem Revier liegt und das mir noch im letzten Winter ein idealer Zufluchtsort gegen Hunger und Kälte und Langeweile und Einsamkeit war, ist nicht mehr das, was es einmal war. Der Wind hat sich gedreht.
Vor allem sie, meine zweibeinige Dosenöffnerin, ist nicht mehr die, die sie einmal war. Wenn sie ein Kater wäre, würde ich sagen, sie hat Gift gefressen. So nennen wir das, wenn einer von uns völlig durchgedreht ist und die Orientierung verloren hat.
Wenn ich nur daran denke, sträuben sich mir die Rückenhaare. Davis ergeht es nicht besser. Er tut, was er kann. Er knurrt, fletscht die Zähne und legt die Ohren an. Auch ich kann so viele Buckel machen, wie ich will, und den Schwanz bedrohlich aufrichten, es stört sie nicht. Sie sieht es nicht einmal. Das ist der Punkt. Wir existieren nicht mehr für sie.
Darin sind Davis und ich uns endlich einmal einig. Unsere Vorstellungen von einem schönen Leben sind sonst sehr unterschiedlich. Außerdem sprechen wir nicht dieselbe Sprache. Davis ist ein Hund, und ich bin ein Kater. Aber ich war zuerst da. Und das zählt.
Paaf! Die Haustür fällt zu. Sie geht an mir vorbei ohne ein Wort an mich zu richten und ohne mich zu kraulen. Sie holt ihr altes Auto aus der neuen Garage und fährt davon. Davis sieht ihr nach und wedelt mit dem Schwanz. Auch von ihm hat sie sich nicht verabschiedet.
Zuerst war ich in solchen Momenten traurig und wusste nichts mit mir anzufangen. Mittlerweile bin ich geradezu erleichtert, wenn sie fort ist. Ich springe von meiner Bank, klettere sofort durch das Loch in der Tür ins Haus hinein und mache es mir auf dem großen Sessel bequem. Ich nutze die Zeit. Wer weiß, wann sie wiederkommt. Davis legt sich zu mir auf den Boden, neben den Ofen. Nicht lange, und er schnarcht.
Zum hundertsten Mal denke ich darüber nach, wie unser Unglück begann. Es fing auf jeden Fall alles ganz harmlos an.
Als das große Auto zum ersten Mal auf unser Haus zugefahren kommt, denke ich nur: Besuch. Hoffentlich fährt er bald wieder weg. Ein fremder Mann steigt aus, lässt die Autotür offen und geht ins Haus. Ich springe ins Auto, sicherheitshalber, um alles zu kontrollieren. So ein Auto habe ich noch nie gesehen. Interessant. Groß. Voller Kisten und Decken und Pullover und Krimskrams und Essensresten. Es gibt sogar ein Bett darin. Allerdings riecht alles komisch. Nicht nach einem anderen Kater. Auch nicht nach Hund. Ich bin mit meiner Inspektion nicht ganz fertig, als der Mann das Haus wieder verlässt. Ich, nichts wie raus. Draußen schüttele ich mich, um den Geruch loszuwerden und mache um den Mann einen großen Bogen.
Davis nicht. Er hängt sich gut gelaunt an die Fersen des Fremden, obwohl der versucht, ihn abzuschütteln. Sie sieht zu, ist ganz zappelig, lacht laut, fährt sich ständig durch die Haare und zieht an ihren Kleidern. Sie winkt dem Fremden nach, bis das Auto vom Feldweg verschwunden ist. Danach beginnt sie zu singen. Sie fängt mich ein, drückt mich an sich und sagt: »Ach, West, ist er nicht wunderbar?« Ich springe von ihrem Arm und denke nur, hoffentlich kommt dieser Fremde nicht wieder. Er verwandelt sie in einen anderen Menschen.
Er nennt sie »Engel«. Ich dachte immer, sie heißt Sonja. Sie nennt ihn Harry. Mal sehen, wann er einen neuen Namen bekommt. Namen ständig zu wechseln ist wohl typisch Mensch. Harry klingt noch viel schrecklicher als die Namen, die Davis und ich schon alle hatten. Harry klingt noch viel schrecklicher als Tiger, Voltaire, Max oder Balzac zusammen. Ich wollte jedenfalls nicht so heißen. Aber wenn ich es mir recht überlege, der Name passt zu ihm, er ist ein Scheusal. Darin sind Davis und ich uns auch bald einig. Aber ich habe es zuerst bemerkt. Und das zählt.
Schnell habe ich raus, wann er kommt. Nämlich, wenn sie ganz aus dem Häuschen ist, uns zu füttern vergisst, treppauf, treppab rennt wie ein aufgescheuchtes Huhn, nach einer ganzen Blumenwiese riecht, über mich fällt, mich anschnauzt, weil ich angeblich alles schmutzig mache. Davis ergeht es nicht besser, nur er kapiert die Zusammenhänge nicht. Ein Hund eben.
Kaum ist dieser Harry da, verjagt sie uns, weil sie ihre Ruhe haben will. Kaum ist er weg, sind wir wieder gut genug, da will sie mit uns kuscheln und wissen, wie wir Harry finden. »Nun sagt doch mal selbst, ist er nicht süß?«
Wie sollen wir Harry schon finden? Er stört. Außerdem mag er keine Tiere, das hätte ich Davis gleich sagen können. Aber da wir nicht die gleiche Sprache sprechen, hat er es am eigenen Leib erfahren müssen und trotzdem keine Lehre daraus gezogen.
Harry tritt nach Davis! Immer wieder. Aber immer nur, wenn sie gerade nicht da ist. Absichtlich. Mit einem seiner spitzen Schuhe. Davis jault und läuft weg, oder knurrt so gefährlich, wie er nur kann, und fletscht die Zähne. Aber wie Hunde so sind, beim nächsten Mal hat er es wieder vergessen und will wieder mit Harry spielen. Jedes Mal bekommt er wieder eine gewischt. Harry zieht ihm auch die Ohren lang und verdreht ihm den Schwanz. Aber Davis rafft es einfach nicht.
Einmal bleibt dieser Harry so lange im Forsthaus, bis es dunkel ist. Keine Ahnung, was sie und er die ganze Zeit machen. Davis und ich sind ausgesperrt. Wir hören ihr Lachen und sehen ihre Schatten. Gläser klirren. Er muss gekocht haben, herrliche Düfte ziehen uns um die Schnauzen.
Wenn sie kocht, das kann man getrost vergessen. Das riecht nach nichts. Das schmeckt nach nichts.
Später singt er sogar und macht Musik mit den Händen. Schrecklich. Katzenjammer ist nichts dagegen.
Endlich wird es still im Haus. Aber Harry fährt nicht davon, sondern klettert durch die Hintertür in sein Auto und kommt nicht wieder zum Vorschein. Das Auto bleibt die ganze Nacht da stehen. Davis und ich machen kein Auge zu. Drinnen macht Harry weiter Musik – dieses Mal ohne zu singen. Als er schnarcht, dass das Auto wackelt, düsen Davis und ich ins Haus und lecken in der Küche alle Teller und Töpfe aus. Also, kochen kann er ja.
Am anderen Morgen verdirbt uns Harry das Frühstück. Wir bekommen nichts ab. Rein gar nichts.
Aber es kommt noch schlimmer.
Als Davis und ich wieder einmal nachts hinter dem Auto Wache schieben, kommt sie heraus, klopft an die Autotür, zieht sie auf und klettert zu Harry ins Auto und kommt die ganze Nacht nicht heraus. Eine schöne Geschichte. Aber sie wird noch besser.
In der nächsten Nacht klettert sie nicht ins Auto, sondern redet so lange auf Harry ein, bis er herauskommt und mit ihr ins Forsthaus geht. Er darf auf dem großen Sessel schlafen. Auf meinem Platz!
Und das ist nur das erste Mal. Immer wenn Harry kommt, bleibt er und schläft auf dem großen Sessel. Auf meinem Platz!
Wenn Harry auf meinem Sessel schläft, dürfen Davis und ich zum Trost in ihrem Bett schlafen, müssen uns allerdings die halbe Nacht dämliche Fragen über Harry anhören. Ich schalte auf Durchzug. Aber ich gestehe, jedes Mal, wenn das Wort Harry fällt, zuckte ich unwillkürlich zusammen.
Dann kommt die Nacht der Nächte. Ich werde sie nicht vergessen. Mein Sessel ist nicht belegt, obwohl Harrys Auto vor der Tür steht. Im Auto ist er auch nicht, es ist mucksmäuschenstill darin. Leise, wie nur ein Kater sein kann, schleiche ich die Stiege empor. Davis im Schlepptau. Die Tür ist nur angelehnt, ich stecke als Erster meinen Kopf hindurch und springe lautlos mit einem Satz auf die Kommode unter dem Fenster, einem meiner Lieblingsplätze, und sehe die Bescherung: Es gibt vier Füße und zwei Köpfe im Bett.
Davis hätte mein Entsetzen in meinen gelben Augen sehen können. Und meinen Buckel. Er hätte gewarnt sein müssen. Aber nein, er sieht nichts, springt aufs Bett und will sich das Dilemma selbst erschnüffeln. Ich weiß, Hunde können schlecht sehen. Aber denken können sie offensichtlich auch nicht.
Keine zwei Augenblicke später und Harry schnappt sich Davis und wirft ihn im hohen Bogen aus dem Bett. Davis kann von Glück sagen, dass er nicht gegen eine Wand prallt, sondern auf einem weichen Teppich landet. Das Gejaule ist groß. Er leckt sich seine Wunden.
Und sie? Nichts, sage ich. Rein nichts. Sie tut, als ob sie schläft. Das nenne ich eine zuverlässige, loyale Freundin! Ich springe von der Kommode und suche das Weite. Ich habe genug gesehen. Davis humpelt hinter mir her.