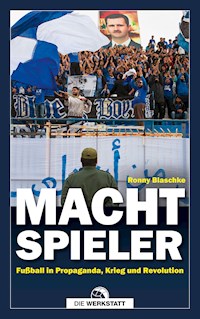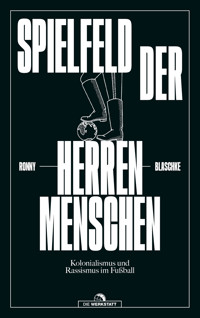
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Die Werkstatt
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Europäisches Überlegenheitsdenken: Kolonialismus im Fußball Rassismus wird im Fußball oft auf Neonazis reduziert. Doch wer die Ursachen verstehen will, muss viel weiter zurückgehen: Kolonialmächte wie England, Frankreich, Portugal aber auch Deutschland wollten durch Sport ihre Untertanen "zivilisieren". Ihre "Rassenlehre" ist längst widerlegt, doch bis heute hält sich ein europäisches Überlegenheitsdenken. Für die Reportagen in diesem Buch war der Journalist Ronny Blaschke auf fünf Kontinenten unterwegs. Und er analysiert strukturellen Rassismus in Europa: Schwarze Menschen gelten als kraftvolle Athleten, aber als Trainer oder Vorstände erhalten sie kaum Chancen. Blaschke erklärt neokoloniales Denken in Talentförderung, Sponsoring, Medien. Und er stellt Menschen vor, die den Antirassismus auf ein neues Niveau heben wollen. • Das erste Buch zum brandaktuellen Thema • Mehr als 120 Interviews bilden die Basis des Buches • Wie prägt rassistisches Denken bis heute den europäischen Fußball? Wie lässt sich der Fußball dekolonisieren? Mit "Spielfeld der Herrenmenschen" möchte Autor Ronny Blaschke eine Debatte anstoßen Dank vieler Reisen und über 120 Gesprächen ist Autor Ronny Blaschke ein Buch mit vielen lebendigen Reportagen aus ganz unterschiedlichen Ländern gelungen: Er war in Brasilien, Portugal, USA, Indien, Namibia, Chile sowie in Frankreich, England und Deutschland unterwegs. Fußball als politische Bildung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ronny Blaschke
Spielfeld der Herrenmenschen
Kolonialismus und Rassismus im Fußball
Ronny Blaschke, geboren 1981 in Rostock, studierte Sport- und Politikwissenschaft in Rostock. Als Journalist und Autor befasst er sich mit politischen Themen im Sport, vor allem für den Deutschlandfunk, die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau. Die Recherchen für seine Bücher lässt Blaschke in Vorträge und Workshops einfließen. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.
www.ronnyblaschke.de | [email protected]
1. Auflage 2024
© Verlag Die Werkstatt GmbH, Bielefeld
Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:
ISBN 978-3-7307-0686-2 (Print)
ISBN 978-3-7307-0700-5 (Epub)
Fotos: Stadtarchiv Nieder-Olm (S. 12), alle anderen: Ronny Blaschke
Umschlaggestaltung: Lukas Niehaus
Satz und Gestaltung: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen
Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH
Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
www.werkstatt-verlag.de
INHALT
EINLEITUNG
DAS SYSTEM IST DER SKANDAL, NICHT DER EINZELFALL
KAPITEL 1
EXOTISCHE TROMMELN FÜR DAS TOR DES MONATS
Hartnäckig halten sich Stereotype, wonach Schwarze und weiße Spieler unterschiedliche Veranlagungen haben. Ein Blick in die Geschichte des Rassismus im deutschen Fußball – und in die Gegenwart
KAPITEL 2
DAS VERMÄCHTNIS DER WINDRUSH-GENERATION
In England symbolisieren Fußballer aus der Karibik die Errungenschaften von Einwanderer*innen. Doch sobald sie sich politisch äußern, schlägt die Zuneigung für sie in Ablehnung um
KAPITEL 3
VOM MYTHOS DER HARMONISCHEN UNTERDRÜCKUNG
In Portugal ist die Wahrnehmung verbreitet, dass die Seefahrernation einen milderen Imperialismus pflegte. Der Fußball stützt diese Romantisierung und überdeckt den alltäglichen Rassismus
KAPITEL 4
AUSSÄTZIGE IM EIGENEN LAND
Britische Kolonialherren wollten ihre Untergebenen auch mit Fußball „zivilisieren“ und aufwiegeln. Besonders deutlich lässt sich ihre Gewaltherrschaft in Indien nachzeichnen
KAPITEL 5
IM KOFFERRAUM INS EXIL
In Namibia hielt die herrschende weiße Minderheit Schwarze Fußballer aus ihren Ligen fern. Heute, mehr drei Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit, besteht die soziale Ungleichheit fort
KAPITEL 6
SCHWARZE TRIKOTS FÜR DAS GEDENKEN
Für den Freiheitskampf ging eine algerische Mannschaft auf Tournee und warb für die Unabhängigkeit von Frankreich. Ihre Symbolik prägt das Land bis heute
KAPITEL 7
TRADITION DER VERLEUGNUNG
Die angebliche „Rassendemokratie“ in Brasilien sieht vor, dass Schwarze Menschen im Fußball eine natürliche Begabung für das Spiel haben, nicht aber für Führungsaufgaben
KAPITEL 8
FOLKLORE MIT FEDERSCHMUCK
Vereine in Lateinamerika vereinnahmen Bruchstücke indigener Geschichte und geben sich kämpferisch. Ureinwohner*innen sehen darin eine Verharmlosung von Landraub und Ausbeutung
KAPITEL 9
VIVA LOS ANGELES
Die Kosten für den Jugendfußball der USA sind hoch. Latinos, die sich das seltener leisten können, sind als Nationalspieler*innen und Trainer*innen unterrepräsentiert
AUSBLICK
DECOLONIZE FOOTBALL
LITERATUR
EINLEITUNG
DAS SYSTEM IST DER SKANDAL, NICHT DER EINZELFALL
Das Spiel im Estadio Mestalla von Valencia gerät außer Kontrolle. Zum wiederholten Mal wird Vinícius Júnior von Fans rassistisch beleidigt. Der Spieler von Real Madrid steht mit aufgerissenen Augen an der Seitenlinie und deutet auf die Tribüne, wo die mutmaßlichen Täter sitzen. Das heimische Publikum verhöhnt Vinícius Júnior weiter. Gegnerische Spieler eilen herbei und geben ihm zu verstehen, er solle aus einer Kleinigkeit kein Drama machen. Der Schiedsrichter wirkt überfordert und lässt weiterspielen. In den Wochen danach, im Frühjahr 2023, wird Vinícius Júnior abermals diskriminiert, bedroht, eingeschüchtert.
Der brasilianische Nationalspieler setzt sich zur Wehr und bezeichnet Spanien in den sozialen Medien als „Land der Rassisten“. Immer wieder fordert er härtere Strafen gegen Täter und eine bessere Prävention. Vinícius Júnior erfährt in jenen Wochen auch viel Unterstützung und Solidarität. Internationale Medien greifen das Thema auf. Politiker*innen laden zu Gesprächsrunden ein. Und der Weltfußballverband FIFA kündigt neue Maßnahmen an. Für einige Wochen steht Rassismus im Fußball im Fokus einer großen Öffentlichkeit. Für einige Wochen, doch dann kehrt Ruhe ein. Wieder einmal.
Es ist ein Muster, das sich seit den 1990er-Jahren wiederholt. Schwarze Fußballer stehen als Opfer für einige Tage oder Wochen im Zentrum von „Rassismus-Skandalen“, wie es Boulevardmedien gern formulieren. Funktionäre sprechen von „Schande“, von „so genannten Fans“ und von „gesellschaftlichen Problemen“, die der Fußball „ausbaden“ müsse. Als hätten wir es mit einer losen Folge von Einzelfällen zu tun, ohne historischen Kontext. Tatsächlich aber wird auch die Fußballindustrie von rassistischen Strukturen zusammengehalten. Das System ist der Skandal, und nicht der einzelne Vorfall.
Auch in Spanien wird das nach den Angriffen gegen Vinícius Júnior deutlich. Javier Tebas, Präsident der spanischen Liga, macht aus dem Opfer einen Täter, indem er sagt, dass Vinícius Júnior sich besser informieren solle, bevor er den Fußball verleumde. Tebas könne es nicht zulassen, dass der Ruf eines Wettbewerbs geschädigt werde, „der ein Symbol der Vereinigung zwischen den Völkern“ sei. An anderer Stelle wird Tebas von Journalisten gefragt, ob in der Geschäftsstelle von La Liga Schwarze Mitarbeitende tätig sind. Tebas lacht, druckst, zögert. Er sagt, dass er auf die Hautfarbe nicht achten und Schwarze Menschen nicht zählen würde. Auch das ein bekanntes Muster: Funktionäre wie Tebas wollen sich „farbenblind“ und bewusst tolerant geben. Tatsächlich überdecken sie ihre Ignoranz und Inkompetenz.
Für ein tieferes Verständnis von rassistischen Strukturen müssen wir uns intensiver mit dem Kolonialismus befassen. Spätestens seit dem Mord an George Floyd 2020 in den USA und dem Erstarken von Black Lives Matter haben Netzwerke in mehreren Regionen der Welt Debatten angestoßen. Sie erinnern auch daran, wie die europäischen Kolonialmächte ab dem 16. Jahrhundert viele Millionen Menschen versklavten, ihre Kulturschätze raubten und ihnen ihre Religion aufzwangen. Politiker*innen in London oder Paris geben inzwischen dem öffentlichen Druck nach und befassen sich mit den Gewaltherrschaften, die in ihren Ländern noch nicht allzu lange zurückliegen. Berühmte Museen in Berlin oder Amsterdam erwägen Maßnahmen, die vor zehn Jahren noch unrealistisch erschienen: die Rückgabe gestohlener Objekte in die Herkunftsländer.
„Spielfeld der Herrenmenschen“ soll diese Diskussion fortführen und nimmt dafür die wohl einflussreichste Alltagskultur unserer Zeit in den Blick. Denn auch die globale Verbreitung des Fußballs wäre ohne den Kolonialismus undenkbar gewesen. Über Generationen wurden romantisierende Beschreibungen des Sports weitergetragen. England gilt bis heute als ehrbares „Mutterland des Fußballs“. Französische Funktionäre wie Jules Rimet, einst FIFA-Präsident und Initiator der Weltmeisterschaft, wollten mit Hilfe des Fußballs die „Verständigung zwischen den Völkern“ stärken. Eine Phrase, die etliche Sportfunktionäre noch heute nutzen.
Hinter dieser idealisierenden Fassade stoßen wir auf Gewalt, Ausbeutung, Überlegenheitsdenken. Dieses Buch beschreibt anhand von Reportagen in früheren Kolonien, wie sehr Menschen unter dem Siegeszug des Fußballs gelitten haben. In Indien etwa wollten britische Kolonialherren im 19. Jahrhundert ihre „Untertanen“ durch Sport „zivilisieren“. In Algerien ließen französische Soldaten lange nur wenige Muslime mitspielen, um Neid zwischen den Einheimischen zu provozieren. In Mosambik rekrutierten portugiesische Behörden Schwarze Männer für ihre Armee und ihre Fußballklubs, um im internationalen Vergleich als freundlicheres Kolonialreich durchzugehen. Und in Namibia konnten sich Vereine der deutschsprachigen Minderheit besser entwickeln, weil die Schwarze Mehrheit über Jahrzehnte unterdrückt worden war.
Die Kolonialisten folgten der damaligen Wissenschaft und glaubten an die Idee von „Menschenrassen“. In ihren Augen waren Schwarze Menschen intellektuell unterlegen und körperlich überlegen. Dieses Buch analysiert im Detail, wie sehr die kolonialen Praktiken aus jener Zeit den Fußball noch heute prägen: Schwarze Fußballer sind als Spielgestalter, denen man Weitsicht und Intelligenz nachsagt, häufig unterrepräsentiert. Auf Positionen, die mit Kraft und Körperlichkeit verknüpft werden, sind sie überrepräsentiert. Neokoloniale Denkmuster finden wir in Fangesängen, Fernsehkommentaren und sogar in Videospielen.
Es ist wichtig, den lauten Rassismus in den Stadien zu thematisieren. Aber es ist auch wichtig, über die lautlose Ausgrenzung zu sprechen. In Deutschland hat mehr als ein Viertel der Menschen eine Einwanderungsgeschichte. Doch dieser Anteil ist in Fankurven, Sportredaktionen und Schiedsgerichten niedriger und geht zum Teil gegen null. Auf der Entscheidungsebene erhalten nicht-weiße Trainer*innen, Funktionär*innen oder Schiedsrichter*innen selten eine Chance. Wie müssten sich Verbandswesen, Marketing und Berichterstattung wandeln, damit der Fußball die europäischen Einwanderungsgesellschaften spiegelt?
Seit etwa 150 Jahren wird die Geschichte des Fußballs von weißen Männern geschrieben. Auch der Autor dieses Buches ist weiß und muss sich nicht vor rassistischen Kommentaren und musternden Blicken fürchten. Die neun vorliegenden Kapitel sollen nüchtern und differenziert über Ursachen von Rassismus im Fußball aufklären. Das Buch basiert auf Recherchen in neun Ländern auf fünf Kontinenten, mit mehr als 120 Interviews in den Jahren 2020 bis 2023. Ein globaler Fokus ist notwendig, um die Hierarchie zwischen den Erdteilen, die auch nach dem Kolonialismus fortdauert, im Fußball besser zu erfassen.
Rassistische Sprache und Bilder sollen in diesem Buch nicht reproduziert werden, aber auch die Kontexte und Schilderungen der Betroffenen können auf Leser*innen verstörend wirken. Das Adjektiv Schwarz wird durchgängig großgeschrieben. Denn es geht dabei nicht um eine tatsächliche Hautfarbe, sondern um eine politische Kategorie. Gemeint sind Menschen, die aufgrund ihres Aussehens von anderen markiert und abgewertet werden.
Im Zentrum des Buches stehen jene Menschen, die sich mit Mut und Expertise gegen Diskriminierung stellen: In England vernetzen sich Schwarze Schiedsrichter, um gemeinsam eine stärkere Stimme zu haben. In Brasilien produzieren Reporter*innen einen Podcast für afrobrasilianische Themen im Sport. In den USA streiten Trainer*innen für eine größere Beteiligung von Latinos in Verbänden. Und in Lateinamerika wollen indigene Gruppen nicht mehr für die Symbolik von mehrheitlich weißen Sportklubs herhalten. Die Biografien all dieser Menschen stehen für ein kreatives, konstruktives Engagement gegen Rassismus, das sogar Spaß machen darf.
In Deutschland konzentrierten sich Medien seit den 1990er-Jahren immer wieder auf die extreme Rechte: auf die NPD, auf Hooligans oder den rechten Flügel der AfD. Darüber hinaus sollten wir noch mehr auf rassistische Einstellungen in der Gesellschaft schauen, durch die sich Rechtsextreme ja auch legitimiert fühlen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichte 2023 abermals mit der Universität Bielefeld die so genannte „Mitte-Studie“ zu menschenfeindlichen Einstellungen in Deutschland. Demnach war rund ein Drittel der Befragten der Meinung, dass Geflüchtete nur ins Land kämen, um das Sozialsystem auszunutzen. 16 Prozent stimmten folgender Aussage zu: „Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet.“
Die Ergebnisse der Studie legen auch nahe, dass befragte Mitglieder von Fußballvereinen häufiger rassistisch eingestellt sind als Mitglieder anderer Sportvereine und auch häufiger als Befragte ohne Sportmitgliedschaft. Was sind die Ursachen? Männlichkeitskult und Freund-Feind-Denken? Enthemmungen in der anonymen Fankurve und das Bekenntnis zu Kampfkraft, Ehre, Heimat? Dieses Buch sucht nach Antworten und zieht eine Linie bis in die Kolonialzeit.
Die Diskussion dürfte weiter an Fahrt gewinnen. Aktivist*innen wollen ihre Umgebung „dekolonisieren“. Sie stoßen Denkmäler von historischen Figuren um, die einst von Rassismus profitiert haben. Sie streiten für die Umbenennung von Straßennamen und werben für mehr Sensibilität im Schulunterricht. Der Fußball, der seit Jahrzehnten eine gesellschaftliche Sonderrolle beansprucht, benötigt ebenfalls eine „Dekolonisierung“. Wie könnte dieser Prozess aussehen? Dieses Buch stellt Argumente bereit. #DecolonizeFootball: unter diesem Hashtag sollen Ideen in sozialen Medien gesammelt werden. Die Debatte ist eröffnet.
Vorbild in der Gemeinde: Der Fußballer Heinz Kerz (links) wurde von den Nazis verhaftet und zwangssterilisiert. Als Trainer setzte er sich nach dem Krieg noch viele Jahre für den Nachwuchs in Nieder-Olm sein.
KAPITEL 1
EXOTISCHE TROMMELN FÜR DAS TOR DES MONATS
Viele Fans und Funktionäre halten Rassismus erst für ein Problem, wenn es zu Angriffen oder Affenlauten kommt. Doch gerade der Fußball zeigt, dass sich Diskriminierung auch versteckt äußern kann. Hartnäckig halten sich Stereotype, wonach Schwarze und weiße Spieler unterschiedliche Veranlagungen haben. Diese Mikroaggressionen können bei Betroffenen langfristig zu Depressionen führen. Wie lässt sich das rassistische Machtgefälle überwinden? Und wie lässt sich Diversität bis in Spitzenämter ausweiten? Ein Blick in die Geschichte des deutschen Fußballs – und in die Gegenwart.
Ein alternatives Kunstzentrum in Pforzheim, im Südwesten Deutschlands. Der Boden ist mit einem grünen, grasähnlichen Teppich ausgelegt. An den rissigen Wänden hängen Fotos und Biografien von Gastarbeitern, die in Katar gestorben sind. Im Treppenhaus baumeln Trikots mit politischen Botschaften, daneben werden Kurzfilme gezeigt. In der Mitte des größten Raumes wurden Paletten zu einer kleinen Tribüne aufgetürmt. Darauf sind alte Stadionsitzschalen montiert. Der Raum ist gut gefüllt. Es ist ein Publikum, das sich für Kunst und Politik interessiert. Das Thema des Abends ist davon nicht allzu weit entfernt: Es geht um die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs.
Shary Reeves scheint sich wohlzufühlen. Die ehemalige Bundesligaspielerin sitzt mit drei anderen Podiumsgästen vor einem kleinen Fußballtor aus Holz. Die Themen, die sie in die Diskussion einbringt, sind vielfältig: Die Beziehungen von Diego Maradona zur italienischen Mafia. Die Besuche der Bundeskanzlerin in der Umkleidekabine. Das rasante Offensivspiel in der Champions League.
Die Veranstaltung dauert fast 40 Minuten, als die Moderatorin sie auf das Thema Rassismus anspricht. Das wirkt im ersten Moment etwas unvermittelt, aber Reeves kann damit gut leben. Sie hat sich längst einen Namen als Journalistin und Schauspielerin gemacht, bekannt wurde sie vor allem als TV-Moderatorin des Jugendformats „Wissen macht Ah!“. Und ja, zu ihrer Biografie gehört auch der Fußball. Die Tore und der Zusammenhalt, aber auch die Anfeindungen und die Ausgrenzung.
Shary Reeves möchte nicht auf ihre Rassismus-Erfahrungen reduziert werden, sie will das Thema aber auch nicht ausklammern. Mit ihren Schilderungen wirbt sie für einen breiteren Blick auf das Thema, über Betroffenheit, Mitleid und Empörung hinaus. Ihr geht es auch um die Frage, wer welche Chancen erhält und in machtvolle Positionen vordringt, kurzum: wer mitmachen darf. In Fußball, Medien oder Kultur. An diesem Abend in Pforzheim ist Reeves die einzige Schwarze Frau im Raum.
In ihrer Jugend hatte es nicht allzu viele Orte gegeben, an denen sich Shary Reeves willkommen fühlte. Die Tochter eines Philosophie-Professors aus Kenia und einer Krankenschwester aus Tansania wuchs bei Pflegeeltern in Köln auf. Einige Familien in der Nachbarschaft untersagten ihren Kindern den Kontakt zu Schwarzen Gleichaltrigen. Auch auf dem Internat fühlte sich Reeves als Schülerin an den Rand gedrängt. Sie wunderte sich, warum in Filmen und Serien niemand so aussah wie sie. Sie glaubte, dass Schwarze Menschen nicht schauspielern konnten. In ihren schlimmsten Momenten hoffte sie, dass sie sich mit Kernseife weißwaschen könne.
„Ich musste irgendwohin flüchten und mir eine Ersatzfamilie suchen“, sagt Reeves und kommt auf den Fußball zu sprechen. Gegen den Willen ihrer Mutter schloss sie sich in Köln schon als Kind dem Verein Borussia Kalk an. Reeves freundete sich mit Spielerinnen an, die ebenfalls aus schwierigen Lebenslagen kamen. Sie unterstützten sich gegenseitig. Vielleicht war das einer der Gründe, warum es Reeves – trotz ihrer Rassismus-Erfahrungen – in die erste Liga schaffte.
Wenn in Veranstaltungen Rassismus im Fußball zur Sprache kommt, dann geht es oft um Neonazis oder Affenlaute in Fankurven, also um die auffälligen Ausprägungen. Shary Reeves geht in Pforzheim auch auf „Mikroaggressionen“ ein, auf jene Angriffe, die für Außenstehende nicht wahrnehmbar sind, die Betroffene aber nachhaltig prägen können.
Auf den Sportplätzen war Reeves meist die einzige Schwarze Spielerin. Sie bemühte sich, die Reaktionen des Publikums auf ihre Anwesenheit nicht wahrzunehmen, die abfälligen oder verängstigten Blicke, die Neugier auf eine „exotische“ Spielerin. Es kam vor, dass Gegnerinnen sie auf dem Feld mit leisen, herablassenden Kommentaren provozierten. Einmal hielt sie es nicht mehr aus und rempelte zurück. Der Schiedsrichter, der danebenstand und alles gehört haben musste, stellte nur eine Spielerin vom Platz: Shary Reeves.
Es ist das eine, diese Vorfälle zu benennen, zu dokumentieren, zu verurteilen. Doch es ist auch wichtig, über die psychologischen Konsequenzen für die Betroffenen nachzudenken. Ein halbes Jahr nach der Diskussion in Pforzheim treffe ich Reeves für ein Interview in ihrer Heimatstadt Köln. Sie erzählt mir, wie rassistische Stereotype Schwarze Menschen in die Rolle der Außenseiter drängen. Und wie sie dann mitunter bemüht sind, diese Stereotype mit ihrem Verhalten nicht zu bestätigen, bewusst oder unbewusst.
Studien legen nahe, dass Rassismus-Erfahrungen bei Opfern zu Stress-Symptomen führen können, zu Verspannung, Erschöpfung, Depressionen. „Das macht einen extrem müde“, sagt Reeves über die ständige Sorge, im nächsten Moment erniedrigt werden zu können. Die meisten Diskriminierungen seien von der Seitenlinie gekommen, von Zuschauenden und Eltern anderer Spielerinnen. „Ich habe das lange unterdrückt und versucht, mit guten Leistungen dagegenzuhalten.“ Auch das komme laut Psycholog*innen häufig vor: Menschen, die von Rassismus betroffen sind, schenken eigenen Bedürfnissen und Gefühlen wenig Beachtung. Das kann die Leistungsfähigkeit mindern.
Shary Reeves drang in den Kreis der Jugendnationalteams vor und spielte Anfang der Neunzigerjahre für den SC Bad Neuenahr in der Bundesliga. Mehrfach wurde sie zu Lehrgängen des A-Nationalteams eingeladen. Einmal warf ihr der damalige Bundestrainer Gero Bisanz die Worte entgegen: „Du wirst sowieso nie in der Bundesliga spielen, du hast ja nicht mal einen deutschen Pass.“ Reeves ist in Deutschland aufgewachsen, aber immer wieder wurde ihr „Deutsch-Sein“ an Bedingungen geknüpft. Irgendwann wollte sie sich das nicht mehr antun und verzichtete auf weitere Lehrgänge beim DFB.
Als Spielerin mit Anfang, Mitte zwanzig kam es für Reeves nicht in Frage, öffentlich über Rassismus zu sprechen. Es existierten noch keine Anlaufstellen und Kampagnen im Fußball. Nun, mit Mitte fünfzig, geht sie umso mehr in die Offensive. Sie spricht in Fernsehdokus wie „Schwarze Adler“, in Podcasts oder in Podiumsrunden. Und sie möchte auf interessante Biografien hinweisen, zum Beispiel auf die ihres Vaters: Joseph Major Nyasani lernte zehn Sprachen und schrieb seine Dissertation in Philosophie auf Latein, was in Köln nur wenige Wissenschaftler geschafft hatten. „Darauf kann man sehr stolz sein“, sagt Reeves. „Und trotzdem hängt an der Uni noch immer kein Bild von ihm.“
Rassismus ist im Fußball besonders verwurzelt
Heute lebt in Deutschland rund eine Million Menschen afrikanischer Herkunft, das geht aus Recherchen der „Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland“ hervor, einem 1986 gegründeten Verein. Sie bilden keine homogene Gruppe, ihre Erfahrungen sind verschieden, manchmal widersprüchlich. In einem Punkt aber gibt es Gemeinsamkeiten: 76 Prozent der Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland erleben im Alltag Rassismus. Das ergab die Umfrage „Being Black in the EU“. Unter den 13 Ländern, in denen Menschen befragt wurden, schnitt Deutschland in vielen Bereichen am schlechtesten ab, teilte die Agentur der EU für Grundrechte im Oktober 2023 mit.
Viele Menschen in Deutschland haben trotz allem eine einseitige Vorstellung von antischwarzem Rassismus. Sie reduzieren das Thema auf gewaltsame Übergriffe, auf Beschimpfungen und Hetze in sozialen Medien. Sie glauben, dass Rassismus von einer kleinen, extremistischen Minderheit ausgeht. Von einer Minderheit, mit der sie nichts zu tun haben. Der Fußball jedoch verdeutlicht, dass rassistische Einstellungen tief in der Gesellschaft verankert sind. Häufig äußert sich Rassismus subtil und versteckt. Aber wie genau? Und was sind die historischen Ursachen?
Rassistische Denkmuster existieren seit Jahrtausenden, vor allem aber seit dem Kolonialismus. Ab dem 18. Jahrhundert diskutierten europäische Philosophen über universelle Menschenrechte. Zu ihrer christlich geprägten „Aufklärung“ passte es nicht, Menschen wie Aussätzige zu behandeln. Daher entwickelten Mediziner, Ethnologen und Geografen eine Hierarchie der „Menschenrassen“.
Immanuel Kant sah die „größte Vollkommenheit“ in der „weißen Rasse“. Angeblich waren Weiße mit ihrer intellektuellen und charakterlichen Überlegenheit nicht auf körperliche Fähigkeiten angewiesen. Unten in der Hierarchie: die von Natur aus „kräftigen“ und „leidensfähigen“ Schwarzen, die sich ihre Existenz mit körperlicher Arbeit sichern sollten. So rechtfertigten die europäischen Kolonialmächte die Versklavung und Ausbeutung Afrikas.
Diese Rangordnung wurde bis weit ins 20. Jahrhundert hinein kaum angezweifelt. Doch mittlerweile ist durch Studien längst nachgewiesen: Physische Unterschiede wie „Hautfarbe“, Haare oder Körpergröße haben keinerlei Auswirkung auf Intelligenz, Begabungen, Emotionen. Es gibt keine Menschenrassen – und trotzdem hält sich bei vielen die Annahme, dass ethnische Gruppen unterschiedliche Veranlagungen haben, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Der Mythos der „weißen Vorherrschaft“ prägt bis heute Machtgefälle und Körperbilder, sagt Tina Nobis: „Wir nehmen bisweilen gar nicht mehr wahr, dass es sich dabei um rassistisches Wissen handelt. Dieses Wissen prägt Strukturen und ist auch in unsere Institutionen diffundiert.“
Am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM, haben sich Tina Nobis und ihre Kolleg*innen mit den Folgen für den Fußball befasst. 2022 veröffentlichten sie Forschungsergebnisse über „Stacking“. Dieser Ansatz sucht nach Befunden für eine vorurteilsbehaftete Zusammensetzung von Mannschaften. Einige ihrer Ergebnisse für die 1. und 2. Bundesliga: Auf den Spielpositionen im zentralen und defensiven Mittelfeld waren überproportional häufig weiße Spieler vertreten, also auf Positionen, die allgemein mit Führungsqualitäten, Spielintelligenz und Weitsicht verknüpft werden. Im Sturm und auf den laufintensiven Außenbahnen waren überproportional häufig Schwarze Spieler vertreten. Es sind Positionen, die eher mit Kraft, Ausdauer und Temperament verbunden werden. Und von den 123 Torhütern war kein einziger Schwarz.
Diese Befunde wurden unter anderem von Spiegel Online und „Sport Inside“ im WDR aufgegriffen. In den sozialen Netzwerken beider Medienhäuser äußerten sich einige Kommentator*innen kritisch zur Studie, denn sie sahen darin anscheinend einen Rassismus-Vorwurf gegen ihre Lieblingsklubs. „Wir würden nie behaupten, dass der Trainer X oder der Manager Y rassistisch ist“, sagt Tina Nobis. „Aber rassistische Zuschreibungen spielen offenbar eine Rolle dabei, welche Spieler bereits im Nachwuchsbereich für bestimmte Positionen ausgebildet werden. Wir gehen davon aus, dass es sich meist um unbewusste Stereotype handelt, die sich seit Jahrhunderten in unser Denken eingeschrieben haben.“
Die „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung zu rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland kommt zu ähnlichen Befunden. Für diese repräsentative Studie, an der die Universität Bielefeld maßgeblich beteiligt war, waren Anfang 2023 etwa 2.000 Menschen befragt worden, zum Teil auch mit einem Fokus auf Fußball. Ein Ergebnis: Rassistische Einstellungen sind im Umfeld von Fußballvereinen offenbar stärker ausgeprägt als in anderen Bereichen der deutschen Gesellschaft.
„Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt“: Dieser Aussage stimmten unter Befragten mit einer Fußballvereinsmitgliedschaft 16 Prozent zu. Bei Befragten ohne Sportmitgliedschaft waren es nur 8,5 Prozent. „Schwarze Menschen sind im Sport besonders talentiert“: 49,2 Prozent der befragten Fußballmitglieder stimmten zu. Bei Befragten ohne Sportbezug waren es zehn Prozent weniger.
„Außerhalb des Sports haben Schwarze Menschen aus gutem Grund weniger Erfolg“: 17,2 Prozent der befragten Mitglieder aus dem Fußball stimmten zu. Bei fußballfernen Befragten: 6,9 Prozent. Diese Zahlen legen nahe, dass der Fußball neokoloniale Denkmuster besonders stark transportiert.
Wie konnte es so weit kommen? Jahrzehntelang waren rassistische Stereotype im Sport nicht diskutiert worden, doch das änderte sich 2020 nach dem Mord an George Floyd und dem Aufbruch von Black Lives Matter. Seither lösen Kommentare von prominenten Fußballgrößen intensive Debatten aus. Im November 2020 verknüpfte der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund in der Sendung „Doppelpass“ die sportlichen Probleme beim FC Schalke 04 mit der Herkunft einiger Spieler. Freund sagte: „Nabil Bentaleb kenne ich persönlich, Tottenham Hotspur, war dort Spieler, ist dort groß geworden, unglaublich viel Talent, einer der besten Spieler dann auch. Und im Endeffekt bei Schalke gelandet, aber ist französisch-algerischer Herkunft, Charakter.“
Über den marokkanischen Nationalspieler Amine Harit fügte Freund hinzu: „Auch er kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln. Also: Falsche Spieler gekauft – nicht von der individuellen Klasse her.“ Steffen Freund setzte die nordafrikanische Herkunft offenbar mit Disziplinlosigkeit gleich. Weiße Spieler wie Stefan Effenberg, Mario Basler oder Max Kruse mussten sich bei Vergehen nie für ihre Herkunft rechtfertigen, sondern wurden oft als „authentisch“ und „unangepasst“ beschrieben.
Doch Stereotype verbergen sich nicht nur in Kritik. Im April 2021 bewertete Friedhelm Funkel als Trainer des 1. FC Köln die Leistung von zwei Schwarzen Spielern des Gegners Bayer Leverkusen, von Leon Bailey und Moussa Diaby. Funkel sagte: „Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, äh, ja, den ein oder anderen Ausdruck darf man ja nicht mehr sagen. Durch ihre Spieler, die halt so schnell sind.“ Funkel vermutete bei Bailey und Diaby offensichtlich athletische Vorteile. Auf die Kritik an seinen Aussagen reagierte er später mit Verwunderung. „Und das hat mich auch ein Stück weit traurig gemacht“, sagte er. „Wenn ich da missverstanden worden bin, tut es mir leid.“ Missverstanden? Das klang so, als habe die Verantwortung nicht nur bei Funkel gelegen, sondern auch beim Publikum.
Schwarze Läufer, weiße Spielmacher – Mythen im Sport
Seit Jahrzehnten gehören zum Spitzensport biologistische Vorstellungen, die von Verbänden, Medien oder Forschung lange nicht erkannt wurden. In den USA und Großbritannien sind dazu aufschlussreiche Studien erschienen. Besonders aufgefallen in der Recherche ist mir das Buch „Skin Deep“. Darin analysiert der südafrikanische Historiker und Politikwissenschaftler Gavin Evans den wissenschaftlichen Rassismus der vergangenen drei Jahrhunderte. Evans, der auch als Journalist für die BBC arbeitet, berücksichtigt unter anderem Erkenntnisse aus der Biologie, Genetik, Neurologie und Archäologie. Mit diesem breiten Ansatz nimmt er in „Skin Deep“ auch Stereotype im Sport auseinander.
In unserem Videointerview möchte Evans gleich zu Beginn etwas klarstellen: „Die physiologischen Unterschiede werden im Sport viel zu stark betont. Bei der Analyse von Spitzenleistungen sollten wir mehr auf soziale und kulturelle Hintergründe schauen.“ Innerhalb einer Bevölkerungsgruppe sind Unterschiede wesentlich größer als zwischen verschiedenen Gruppen. Ob Menschen in Ostafrika, Westasien oder Osteuropa: In jeder Bevölkerungsgruppe finden sich schnelle und langsame, kräftige und schwächere, große und kleine Menschen. Evans sagt: „Die Genetik allein ist für sportlichen Erfolg nie ausschlaggebend. Wir müssen viel mehr Faktoren einbeziehen.“
Ich spreche ihn auf Mythen im Spitzensport an. Warum etwa dominieren seit den 1990er-Jahren Läufer aus Ostafrika die mittleren und langen Distanzen? Evans spricht nicht von Muskelfasern oder leichten Knochen, sondern von der Umgebung. Einige kenianische Läufer lebten im Hochland, wo sie beim Ausdauertraining einen Vorteil hatten. Zudem erhofften sie sich in der Leichtathletik, die keine teure Ausrüstung verlangt, einen Weg aus der Armut. So begründeten Läufer in Kenia oder Äthiopien eine Tradition und motivierten Jugendliche für ihren Sport. Mehr Konkurrenten trieben sich zu besseren Leistungen an. So entstand eine „kritische Masse“, wie es Evans formuliert.
Eine solche „kritische Masse“ hatte es in den Achtzigerjahren auch in Großbritannien gegeben, im damals führenden Land der Mittelstreckenläufer. „In England hat aber niemand nach genetischen Vorteilen von weißen Menschen gesucht“, sagt Evans. Das Aufkommen von Trendsportarten, die Dominanz des Fußballs, die Schwächung des Schulsports und die zunehmende Konzentration auf soziale Medien sind nur einige Gründe, warum die Laufkultur in Großbritannien einen Rückschlag erlitt.
Mythos Nummer zwei: Bei der Verschleppung von Sklaven aus Westafrika in die Karibik haben nur die Stärksten überlebt. So wuchs später angeblich auch im kleinen Inselstaat Jamaika die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfahren der Sklaven durch Genetik überproportional kraftvoll und schnell seien. Sprinter wie der achtmalige Olympiasieger Usain Bolt schienen dieses Vorurteil zu bestätigen. „Doch so funktioniert natürliche Selektion nicht“, sagt Gavin Evans. Die Weitergabe von Erbanlagen dauert tausende Jahre – die Versklavung westafrikanischer Menschen aber begann im 16. Jahrhundert.
Mythos Nummer drei: In den USA können Afroamerikaner*innen aus genetischen Gründen angeblich schlechter schwimmen als ihre weißen Mitbürger*innen. Dafür sollen sie eine bessere Sprungkraft haben und schneller in der Basketballliga NBA landen. „Über Jahrzehnte wurde Afroamerikaner*innen der Zugang zu Stränden, Schwimmhallen und zu einem angemessenen Sportunterricht verwehrt“, wendet Evans ein. Wegen dieser Traumata zögern Schwarze Eltern mitunter noch heute, ihre Kinder zum Schwimmunterricht zu schicken. Und das in einem Land, in dem sie seit 400 Jahren schlechter gestellt sind als die weiße Bevölkerungsmehrheit.
In der NBA sind rund 80 Prozent der Spieler Schwarz. „Basketball gehört für viele Afroamerikaner*innen zu einer Popkultur, mit der sie seit der Kindheit sozialisiert werden“, sagt Evans. Zu dieser urbanen Kultur gehören Streetball und schwerreiche Vorbilder wie Magic Johnson, Michael Jordan oder LeBron James. Dazu gehören Rapmusik, Kleidungsstile und Hollywood-Komödien wie „White Men Can’t Jump“. Aber Genetik? Mitnichten. Die Olympiasieger im Hochsprung etwa waren mit wenigen Ausnahmen weiß.
Sportmedien verbreiten Klischees
Im besten Fall erkennen Medien Stereotype im Sport und klären darüber auf. Doch seit langem tragen sie auch zu deren Verbreitung bei. Ich selbst habe in einigen Zeitungsredaktionen in den Nullerjahren mehrfach das N-Wort für interne Abläufe gehört. Ein Beispiel: Bei Fußballspielen an späten Abenden, etwa in der Champions League, gerieten Reporter wegen des nahenden Redaktionsschlusses unter Zeitdruck. Schließlich sollte in der Ausgabe des nächsten Tages ein Spielbericht enthalten sein. So kam es zur Arbeitsteilung: Ein Reporter saß im Stadion auf der Pressetribüne und gab per Telefon Torschützen und taktische Informationen in die Redaktion durch. Dort saß ein Kollege am Schreibtisch und verfasste einen Spielbericht. In der Autorenzeile des Artikels wurde in der Regel nur der Journalist im Stadion erwähnt. Oft hieß es intern: Das Spiel wurde gen…t. Warum das N-Wort? Weil es einen Kollegen gab, der einen weniger angenehmen Job hatte, um den anderen glänzen zu lassen.
Kaum jemand der meist männlichen weißen Redakteure hinterfragte diese Wortwahl. Ein Phänomen, das wir auch aus anderen Kontexten rund um das N-Wort kennen, etwa mit Blick auf die Literatur von Astrid Lindgren. „Das N-Wort an sich ist machtgeladen“, schreibt die Kommunikationswissenschaftlerin Natasha A. Kelly. „Dabei ist es egal, ob Schwarze Menschen anwesend sind oder nicht, die Sprachhandlung kann als rassistisch wahrgenommen werden.“
Seit den 1990er-Jahren veröffentlichen Sportmedien Beiträge über offenen Rassismus in den Stadien, über Bananen, Affenlaute, Schmähgesänge. In Artikeln und Dokus dominieren die Schilderungen von Betroffenen. Das ist wichtig, kann aber auch den Anschein erwecken, als hätten wir es mit einer losen Abfolge von Einzelfällen zu tun. „Wir dürfen nicht nur auf Skandale schauen“, sagt der Journalist Philipp Awounou, der unter anderem für Spiegel Online über US-Sport berichtet. „Wir sollten uns mehr mit den Strukturen befassen. Denn sie bilden das Fundament, auf dem sich der offene Rassismus später äußert.“
Mit diesen Strukturen musste sich Awounou früher befassen, als ihm lieb war. Er ist in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln. In praktischen Übungen und Prüfungen war er oft schneller und kraftvoller als seine Mitstudierenden. „Das habe ich auch nicht anders erwartet, dass Sie so schnell sind“, kommentierte einmal ein Dozent seine Leistungen und knüpfte damit offenbar eine Verbindung zum Vater Awounous, der aus dem westafrikanischen Land Benin stammt. „Ich habe das mit einem Lächeln genommen“, sagt Philipp Awounou. „Damals war ich nicht so weit, um mich mit dem Dozenten anzulegen. Eine solche Konfrontation ist immer auch ein Risiko und eine Anstrengung.“
Awounou hat drastischere Fälle von Rassismus erlebt. Doch in unserem Interview vermittelt er den Eindruck, dass er sich mit Schilderungen als Opfer zurückhalten möchte. Er hat sich als Journalist mit einer Themenvielfalt einen Namen gemacht, hat Artikel über die NBA und American Football geschrieben, aber auch eine Dokumentation über Bodybuilding gedreht. Er ist auch Experte für Rassismus im Sport. Nicht weil er selbst betroffen ist, sondern weil er sich mit Artikeln, Büchern und Studien auf dem Laufenden hält. Und weil er den Austausch mit Expertinnen und Experten sucht.
Als Reporter hat Philipp Awounou fast alle Stadien der Bundesliga kennengelernt. In mehr als 90 Prozent der Spiele, sagt er, sei er der einzige nicht-weiße Journalist in den Presseräumen gewesen: „Wir haben es im Sportjournalismus mit einer homogenen männlich-weißen Kultur zu tun, die womöglich noch einseitiger ist als in anderen journalistischen Genres. Diese Kultur begünstigt die Reproduktion von versteckten rassistischen Bildern.“
Eine Studie aus der Saison 2019/20 erhärtet diese Annahme. Forschende aus Dänemark und Großbritannien analysierten die TV-Kommentare bei 80 Spielen in England, Spanien, Italien und Frankreich. Einige Ergebnisse: Wenn Kommentator*innen über Intelligenz und Arbeitsmoral sprachen, richteten sich mehr als 60 Prozent ihres Lobes an „Spieler mit hellerer Hautfarbe“. Beim Thema Kraft war es dagegen 6,59-mal wahrscheinlicher, dass sie über einen „Spieler mit dunklerer Hautfarbe“ sprachen, beim Thema Schnelligkeit war es 3,38-mal wahrscheinlicher. Mit dieser Voreingenommenheit befördern die Kommentator*innen das Vorurteil, dass Schwarze Fußballer „von Natur aus sportlich oder mit gottgegebener Athletik ausgestattet“ seien, heißt es in der Studie. Und dass sie sich für Erfolg weniger anstrengen müssen.
Stereotype wie diese sind weniger offensichtlich als Affenlaute in der Kurve und lassen sich schwerer skandalisieren. Das gilt auch für andere Bereiche der Fußball-Öffentlichkeit: Vor der WM 2010 in Südafrika ließ ein Sportartikelhersteller in einem animierten Spot den kamerunischen Spieler Samuel Eto’o mit nacktem Oberkörper gegen einen Löwen kämpfen. Ein Beispiel von vielen für die entmenschlichende Darstellung Schwarzer Athlet*innen als tierähnliche Kämpfertypen. Bereits während der Kolonialzeit hatten Wissenschaftler für ihre „Rassenlehre“ Tiervergleiche gezogen, um eine Distanz zwischen weißen und Schwarzen Menschen zu schaffen.
Für die Aufklärung über strukturellen Rassismus im Fußball werden weitere Studien nötig sein, die sich mit Medien, Sponsoring und Merchandising befassen. Die britischen Wissenschaftler Paul Ian Campbell und Marcus Maloney haben sich beispielsweise mit der Videospielserie Fifa von Electronic Arts beschäftigt. Seit der ersten Auflage des Spiels 1993 können Nutzer*innen in die digitale Rolle ihrer Idole schlüpfen. Auf seiner Webseite wirbt der Entwickler EA mit „authentischeren Fußball-Animationen als je zuvor“. Programmierer*innen bemühen sich, das Aussehen und die Fähigkeiten von Kylian Mbappé, Lionel Messi oder Toni Kroos möglichst genau auf deren digitale Versionen zu übertragen.
Paul Campbell von der University of Leicester und Marcus Maloney von der Coventry University haben die Datenerfassung für das Spiel von 2020 analysiert. Jeder Fußballer wurde demnach in 29 Kompetenzbereichen benotet, zum Beispiel für Weitwürfe, Sprungkraft oder für Stärke. Diese Noten wurden zu einer Punktzahl addiert, von 1 bis 99. Campbell und Maloney schauten sich die 100 besten Spieler an. Es zeigte sich, dass Schwarze Spieler bei den „körperlichen Kompetenzen“ meist einen höheren Punkteschnitt erzielten als weiße Spieler. Das galt unter anderen für: Sprintgeschwindigkeit (79,15 zu 71,63 Punkte), Sprungkraft (78,19 zu 71,24) oder Aggressivität (74,04 zu 71,5).
Dagegen erzielten weiße Digitalspieler höhere Durchschnittswerte für technische und kognitive Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn es darum ging, „einen Ball zu kreuzen“ (72,29 zu 71,35 Punkte), Freistöße präzise auszuführen (67,98 zu 64,53) oder einen Pass präzise zu spielen (74,53 zu 71,04). „Unsere Ergebnisse zeigen subtile Wege, wie Stereotype verstärkt werden“, schreiben Paul Campbell und Marcus Maloney auf der Website „The Conversation“ über ihre Studie. „Es besteht die Gefahr, dass Kindern tatsächlich beigebracht wird, dass Schwarze und weiße Athleten bedeutungsvoll anders sind – durch den scheinbar unschuldigen und banalen Akt des Spielens.“
Ohne Anspruch auf Bürgerrechte
Für solche Ausprägungen des strukturellen Rassismus fehlen auch in der deutschen Gesellschaft die Sensibilität und das historische Wissen. Nur wenigen dürften bekannt sein, dass Schwarze Menschen seit mehr als 400 Jahren im deutschsprachigen Raum leben. So lehrte der ghanaische Philosoph Anton Wilhelm Amo im 18. Jahrhundert an den Universitäten in Halle, Wittenberg und Jena. Während des Kolonialismus an der Schwelle zum 20. Jahrhundert lebten mehrere hundert Afrikaner*innen aus den „Schutzgebieten“ im Deutschen Reich. In der Regel hatten sie keinen Anspruch auf volle Bürgerrechte. Sozialversicherung oder Arbeitslosengeld wurden ihnen verwehrt.
Das Dossier „Schwarz in Deutschland“, veröffentlicht von der Heinrich-Böll-Stiftung 2023, hebt die Forschung auf ein neues Niveau. In einem der Beiträge beschreibt die Historikerin Katharina Oguntoye frühere Lebensrealitäten: Schwarze Menschen wurden körperlich angegriffen, zur Sterilisation gedrängt, im Alltag schikaniert. In Hamburg veranstaltete der Tierhändler Carl Hagenbeck sogenannte „Völkerschauen“. Dort mussten außereuropäische Menschen aus fernen Regionen vor Publikum tanzen, brüllen, Keulen schwingen. Unter dem Titel „Kanaken der Südsee“ war dieser Menschenzoo auch auf dem Münchner Oktoberfest zu Gast.
Ein Teilnehmer, der zu den „Völkerschauen“ gedrängt wurde, war Willy Karembeu. Der Urgroßvater des französischen Fußball-Weltmeisters von 1998, Christian Karembeu, war 1931 unter falschen Vorwänden aus dem südpazifischen Neukaledonien nach Paris gelockt worden, zusammen mit Dutzenden Kindern, Frauen und Männern aus dem Volk der Kanak. Viele von ihnen wurden später in Hamburg als „Die letzten Kannibalen der Südsee“ vorgeführt.
Alles in allem wissen wir über den Alltag afrodeutscher Menschen bis Mitte des 20. Jahrhunderts wenig. Lange wurden Quellen über ihre Biografien nicht archiviert oder absichtlich zerstört. Welche Rolle spielte etwa der Fußball? Gründeten Schwarze Spieler eigene Teams? Hegten sie Sympathien für Traditionsklubs? Noch fehlt eine umfassende Forschung. Allerdings zeigen die wenigen Namen, die heute noch bekannt sind, dass wir in der Geschichte gute Argumente für den Antirassismus der Gegenwart finden können.
Zwangssterilisation, KZ und Todesmarsch
Ein Besuch in Nieder-Olm, einer Gemeinde mit 10.000 Einwohner*innen in der Nähe von Mainz. Im Alten Rathaus hat Stadtarchivarin Anuschka Weisener auf einem Tisch historische Fotos ausgebreitet. Auf einem Bild stehen sechs Jugendliche am Rand eines Schwimmbades und lächeln. Auf einem anderen blicken junge Fußballer zuversichtlich in die Kamera. Das erste Motiv stammt aus den frühen 1930er-Jahren, das zweite wohl aus den Fünfzigern. Auf beiden zu sehen: der Schwarze Fußballer, Trainer und Schwimmlehrer Heinz Kerz. „Es ist bemerkenswert, dass Heinz Kerz nach dem Krieg wieder nach Nieder-Olm zurückgekehrt ist“, sagt Weisener. „Obwohl man ihn vernichten wollte.“
Doch zum besseren Verständnis sollte man die Geschichte von Anfang an erzählen. Nach dem Ersten Weltkrieg besetzten die Siegermächte große Teile des Rheinlandes, unter ihnen waren französische Soldaten, die aus afrikanischen Kolonien stammten. Im Deutschen Reich empörten sich Politiker gegen diese „Schwarze Schmach“. Eine Satirezeitschrift zeigte einen Gorilla mit französischer Militärmütze, der eine weiße Frauenstatue trägt. In „Mein Kampf“ schrieb Hitler, dass die Stationierung Schwarzer Soldaten eine Strategie der „Juden“ sei, um durch die „zwangsläufig eintretende Bastardisierung die ihnen verhaßte weiße Rasse zu zerstören, von ihrer kulturellen und politischen Höhe zu stürzen und selber zu ihren Herren aufzusteigen“. Rassismus und Antisemitismus gingen einher.
Viele der mehr als 500 Kinder, die von französischen Soldaten und deutschen Frauen gezeugt wurden, erlebten früh Rassismus. Das dürfte auch Heinz Kerz, geboren 1920, so ergangen sein. Archivarin Anuschka Weisener möchte aber auch herausstellen, dass Kerz in Nieder-Olm gut integriert war. Im Fußball schoss er als Mittelstürmer viele Tore, Zuschauer bezeichneten ihn als „Schwarzen Bomber“. Mit Freundinnen und Freunden ging er häufig ins Schwimmbad.
Nach der Machtübernahme der Nazis wurde Heinz Kerz aus dem Fußballverein ausgeschlossen. 1937, im Alter von 17, wurde er in ein Krankenhaus nach Darmstadt gebracht und unter Zwang sterilisiert. Mehr als 400 Schwarze Menschen mussten nach einem „Führerbefehl“ diesen Eingriff über sich ergehen lassen. Später wurde Kerz ohne Anklage verhaftet und für zwei Jahre im KZ Dachau interniert. Er musste Zwangsarbeit leisten und wurde 1945 auf einen der „Todesmärsche“ geschickt. Kerz überlebte, doch rund 2000 Menschen afrikanischer Herkunft wurden in den Konzentrationslagern ermordet.
Nach dem Krieg baute sich Heinz Kerz in Nieder-Olm ein neues Leben auf, berichtet Anuschka Weisener: „Er schaute augenscheinlich ohne Groll auf diejenigen, die ihn einst erniedrigt und vertrieben haben.“ Kerz engagierte sich als Trainer im Fußballverein und brachte Kindern das Schwimmen bei. Er saß für die SPD im Gemeinderat und freute sich jedes Jahr auf den Karneval. In der Gemeinde tuschelte man über seine kinderlose Ehe, doch öffentlich wollte Kerz nicht über die Zwangssterilisation sprechen.
Weisener deutet auf ein weiteres Foto aus dem Jahr 1980. Darauf zu sehen: Heinz Kerz, inzwischen 60, wie er vom Bürgermeister in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet wurde. Seit der KZ-Haft hatte er unter Herzproblemen gelitten, doch auf dem Bild wirkte er zufrieden und präsentierte stolz seine Ehrenurkunde. Nur ein halbes Jahr später starb Heinz Kerz an einem Herzinfarkt.
Es mussten einige Jahrzehnte vergehen, bis sich die Nieder-Olmer wieder an ihren beliebten Fußballtrainer erinnerten. Eine große Sporthalle trägt inzwischen seinen Namen. Und immer mal wieder diskutieren Schüler*innen im Geschichtsunterricht über Heinz Kerz. Zum Holocaust-Gedenktag 2023 hielt Anuschka Weisener einen Vortrag über Kerz. Der Andrang war so groß, dass sie die Veranstaltung in den großen Ratssaal verlegen musste. Weisener ist selbst als Übungsleiterin im Sport tätig. Sie fände es toll, wenn noch mehr Vereine mit Empathie auf die Geschichte blicken würden.
Isolierte Vertragsarbeiter*innen in der DDR
Der deutsche Fußball hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten immerhin einen Wandel vollzogen. Fans, Vereinsarchivar*innen und Historiker*innen erforschten die Biografien von verfolgten jüdischen Spielern, Trainern und Funktionären. Münchner Ultras würdigten in Choreografien den einstigen Präsidenten des FC Bayern, Kurt Landauer. Der DFB widmete eine jährliche Auszeichnung dem Nationalspieler Julius Hirsch, der in Auschwitz ermordet wurde. Und der „Kicker“ erinnert inzwischen stolz an seinen einstigen Gründer Walther Bensemann. Es ließen sich Dutzende Beispiele nennen.
Nach Jahrzehnten der Verdrängung ist die Erinnerungskultur nun verankert. Fans besuchen Gedenkstätten, Jugendspieler nehmen an Workshops gegen Antisemitismus teil. Funktionäre wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund reisen nach Israel. Doch mit diesem vielschichtigen Geschichtsbewusstsein sollten wir uns nicht zufriedengeben. Es gibt nämlich noch mehr Schichten, die wir freilegen müssen. Die Geschichte des deutschen Fußballs ist auch eine Geschichte des Rassismus. Und über allem steht die Frage: Wer durfte mitspielen und wer musste draußen bleiben?
In der DDR herrschte schon in den frühen 1960er-Jahren ein Mangel an Rohstoffen, modernen Maschinen und vor allem: an Arbeitskräften. Mehr als drei Millionen Menschen waren in die Bundesrepublik geflohen oder übergesiedelt. Die DDR-Regierung wollte ihre Planwirtschaft am Laufen halten und warb Vertragsarbeiter*innen aus sozialistischen „Bruderstaaten“ an, unter anderem aus Polen, Ungarn, Mosambik, Vietnam, Angola und Kuba.
Die Folgen sind noch heute zu spüren, wie ein Besuch am Stadtrand von Leipzig zeigt. Für gewöhnlich trägt hier der SV Lokomotive Engelsdorf seine Heimspiele aus. Doch an diesem Sonntag findet ein anderes Ereignis statt: das Fußballturnier der vietnamesischen Vereine in Deutschland. Am Spielfeldrand ist eine Bühne aufgebaut, darüber baumeln die deutsche und die vietnamesische Flagge. Frauen in roten Kleidern, in der Landesfarbe Vietnams, posieren für Fotos. In langen Reihen stellen sich die zwölf Mannschaften auf. Sie sind unter anderem aus Berlin und Zwickau angereist, aus Chemnitz und Dresden, aus Halle und Weimar. Nur das Team aus Göttingen stammt nicht aus den ostdeutschen Bundesländern.
Vor dem Turnier in Leipzig wird die vietnamesische Hymne gespielt. Einer der Organisatoren, Hoang Van Thanh, wirkt gerührt. Er trägt ein weißes Hemd und ein blaues, festliches Sakko. Hoang Van Thanh kam 1988 in die DDR, als einer von 60.000 vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen. Er wurde für eine Metallfabrik im Leipziger Stadtteil Mockau eingeteilt. Integrations- oder Sprachkurse wurden ihm in der DDR nicht angeboten. „In unserer Heimat gab es nach dem Vietnam-Krieg große Herausforderungen“, sagt Hoang Van Thanh. „Wir wollten uns in der DDR eine neue Existenz aufbauen. Wir wollten von niemandem abhängig sein. Daher haben wir uns unauffällig verhalten. Die vietnamesische Gemeinschaft hat uns Kraft gegeben.“
Eines der Lieblingsthemen dieser Gemeinschaft war in der DDR: Fußball. Zwischen Ostsee und Erzgebirge formierten sich 16 Mannschaften vietnamesischer Vertragsarbeiter. Im Spielbetrieb der DDR waren sie nicht willkommen, deshalb organisierten sie eigene Turniere. Hoang Van Thanh, damals Anfang 20, kümmerte sich um Plätze, Reisebusse und Trikots. Die Vietnamesische Botschaft verbreitete die Informationen in ihren Rundschreiben. Hoang Van Thanh erinnert sich: „Unser Alltag war nicht leicht. Aber im Fußball konnten wir unsere Gemeinschaft leben. Beim Fußball fühlten wir uns sicher.“
Die marode DDR-Wirtschaft war in den 1980er-Jahren auf rund 90.000 Vertragsarbeiter*innen angewiesen. Die Arbeiter*innen, die oft für gesundheitsgefährdende Aufgaben eingeteilt wurden, mussten häufig ihre Pässe abgeben und Anteile ihres Lohnes an die heimischen Regierungen abführen. In der Regel wurden sie in engen Wohnheimen untergebracht, sagt der Historiker Patrice Poutrus, der sich seit langem mit dem Thema befasst: „Es wurde ihnen nur so viel Deutsch beigebracht, wie es nötig war. Es war auch nicht vorgesehen, dass es partnerschaftliche Beziehungen zu Deutschen gab.“ Im Extremfall wurden Vertragsarbeiterinnen zu Abtreibungen gedrängt. Und wenn sie sich weigerten, dann drohte man ihnen mit der Abschiebung.
In der DDR-Propaganda galt die Vertragsarbeit als solidarische Hilfe für die „Bruderstaaten“. Tatsächlich aber sollten Kontrollen in den Wohnheimen und die Staatssicherheit einen intensiven Kontakt zwischen Vertragsarbeiter*innen und DDR-Bürger*innen erschweren. Selbst Ehepaare hatten keinen Anspruch auf gemeinsame Zimmer. Da religiöse Praktiken in der sozialistischen DDR verpönt waren, zogen sich etwa Vietnames*innen für buddhistische Rituale ins Private zurück. Von rassistischen Angriffen, die vor allem Afrikaner*innen in Gaststätten oder Diskos erlebten, durfte in Medien keine Rede sein.
Auch im Fußball wurden Vertragsarbeiter*innen an den Rand gedrängt, schreibt die Migrationsexpertin Sylvia Gössel im Sammelband „Der Ball ist bunt“. Sie durften in der DDR keine eigenen Sportvereine gründen, aber theoretisch in bestehenden Mannschaften mitwirken. Von gut funktionierenden Beispielen ist heute aber kaum etwas bekannt. Die Forschung steht da erst am Anfang.
Nach dem Mauerfall verloren Zehntausende Vertragsarbeiter*innen ihre Anstellungen und Unterkünfte. Viele von ihnen gingen zurück in ihre Herkunftsländer. Die vietnamesische Regierung sträubte sich gegen die Rücknahme und hoffte weiter auf Geldüberweisungen aus Deutschland. 20.000 Menschen blieben nach dem Beitritt der DDR in der Bundesrepublik. Jahrelang standen sie unter dem Druck, ausgewiesen zu werden. Viele wurden Opfer von Rassismus. Ein Sinnbild dafür: 1992 die Angriffe in Rostock-Lichtenhagen.
Der langjährige Fußballer Hoang Van Thanh scheint in Leipzig nicht im Detail über die Neunzigerjahre sprechen zu wollen, über die „Baseballschläger-Jahre“. Stattdessen möchte er das Gespräch ins Positive wenden, vielleicht auch zum eigenen Schutz. Immer wieder erwähnt er Fleiß, Arbeitsmoral, Anpassungsfähigkeit. Hoang Van Thanh baute sich ein Textilunternehmen auf. Er entschuldigt sich dafür, dass sein Deutsch auch heute noch schlecht sei. Er hatte in den Neunzigern Sprachkurse in der Volkshochschule gebucht, für mehrere Tausend D-Mark. „Aber wir konnten nicht regelmäßig teilnehmen. Wir mussten arbeiten und wollten unser eigenes Geld verdienen. Niemand sollte denken, dass wir krumme Geschäfte machen oder dass man uns etwas schenkt.“ Hoang Van Thanh organisierte weiterhin Fußballwettbewerbe, allerdings nun mit weniger Mannschaften.
Beim bundesweiten Turnier 2023 in Leipzig will die vietnamesische Gemeinschaft die Fußballtradition weiter stärken. Am Rand auf einer Holzbank sitzt Bao Linh Huynh, Mitte 30, aufgewachsen in Dresden. Bao Linh Huynh engagiert sie sich für den Verein der Vietnamesen in Leipzig. Sie möchte, dass ihre Gemeinschaft, anders als früher, mehr an die Öffentlichkeit geht, mit Kulturveranstaltungen oder Fußballturnieren. Das würde dann auch nach innen wirken, sagt sie: „Im Fußball kann die zweite Generation zusammenkommen und sich mit der vietnamesischen Sprache auseinandersetzen. Diejenigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, können dann sehen, dass Vietnam mehr ist als ein Urlaubsort. Dass dort ihre Wurzeln liegen.“
Kraftraubende Karriere
Historische Perspektiven wie diese von nicht-weißen Menschen sind im Fußball noch selten. Im Leistungssport wurde die Geschichte von weißen Männern geschrieben. Lange hielt sich überdies die Wahrnehmung, dass Rassismus im Fußball mit rechten Hooligans in der Bundesrepublik Ende der 1980er-Jahre aufkam. Doch diese Gewissheit bröckelt. 2021 veröffentliche der Journalist Alexander Heflik eine Biografie über Erwin Kostedde. Der Sohn eines afroamerikanischen Soldaten spielte ab den späten 1960er-Jahren unter anderem für Standard Lüttich, Kickers Offenbach und Borussia Dortmund. 1974 und 1975 lief Kostedde dreimal für das deutsche Nationalteam auf – als erster Schwarzer überhaupt.