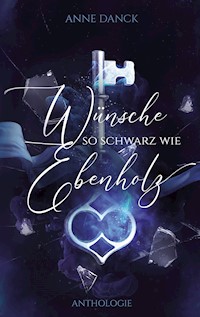Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ich würde mich nicht unterordnen, nur weil mir irgendjemand einen Ring auf den Finger schob! Er wollte meinen Gehorsam? Er würde ihn sich erkämpfen müssen.« Prinzessin Mirelle soll verheiratet werden - und das schnell, bevor sich ihr nacktes Bad im Fluss als Skandal herumspricht. Doch sie ist nicht bereit, sich dem Willen ihres Vaters zu fügen. Sie schlägt alle Freier in die Flucht mit der einzigen Waffe, die sie besitzt: gut gezieltem Spott. Nur nutzt es ihr nichts. Zur Strafe muss sie einen Bettler heiraten, der sie zu Demut erziehen soll. Kaum hat Mirelle den Ring am Finger, sinnt sie auf Rache an ihrem Vater - und an ihrem neuen Ehemann. Da kann er sie noch so faszinieren …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Spielmannsbraut
Anne Danck
Copyright © 2021 by
Lektorat: Stephan Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-579-3
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Triggerwarnung
Der Fluss
Der Rosengarten
Das Porträt
Der Plan
Die Freier
Der Landstreicher
Der Preis
Der Verkauf
Der Ring
Der Weg
Die Hütte
Der Spielmann
Das Brot
Die Weidenzweige
Das Kunstwerk
Der Lehrer
Die Spindel
Der Besuch
Die Früchte
Das Motiv
Die Wassernixen
Das Bad
Die Tonrose
Das Töpfern
Die Melodie
Die Fliesen
Der Maskenball
Die Konsequenz
Danksagung
Leseprobe
»Froschröschen« von Halo Summer
Drachenpost
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält Szenen, in denen Folgendes thematisiert oder dargestellt wird:
Mobbing, psychische Gewalt, Panikattacke, Unterdrückung von Frauen, erzwungene Ehe, körperliche Gewalt, (unbeabsichtigte) Selbstverletzung, Blut, Vergiftung, Erbrechen, (vorausgegangener) Verlust eines Angehörigen.
Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte entscheide selbst, ob du dieses Buch lesen möchtest oder dich durch diese Themen getriggert fühlen könntest.
Der Fluss
Ich saß auf der Uferkante und tauchte erst einen Fuß ins Wasser, dann den anderen, ließ die Beine in den Fluss baumeln. Kühl, verlockend kühl. Meine Füße schimmerten hell durch das klare Wasser; dort, wo sich die Oberfläche brach, glitzerte das Mondlicht. Mit einem Ruck drückte ich mich vom Ufer ab und sank nach unten, in die nasse Kühle.
Das Wasser umfing mich von allen Seiten, schlug über meinem Kopf zusammen. Wusch den Staub des Ritts und die Erinnerungen an zu viele stickige Kleiderschichten von meiner Haut. Löste die langen Haare von meinen Schultern und ließ sie mit der leichten Strömung spielen. Unter Wasser sah ich, wie die schrägen Strahlen des Mondlichts die Schwärze teilten und die Feenlichter ein Spiegelbild aus goldenen Perlen auf der Oberfläche hinterließen. Dann stieß ich mich unten am Boden ab und kehrte zur Luft zurück, holte Atem.
Die goldenen Lichter schwebten um mich herum in ihrem lautlosen Tanz. Sie hatten meine Zofe Henrietta und mich schon den ganzen Sommer begleitet, in jeder gestohlenen Nacht, die wir hier im Wasser verbrachten. Feenlichter. Man sagte, sie wären das sichtbar gewordene Lachen einer Fee und es zöge sie immer wieder zurück an die Orte, an denen sie entstanden waren. Selbst wenn es Feen in diesen Breitengraden schon seit über drei Generationen nicht mehr gab. So wie auch die Magie, die mit ihnen verschwunden war.
Mein Pferd schnaubte. Ich konnte es von hier aus nicht sehen, es befand sich die Böschung hinauf und versteckt zwischen den Zweigen. Aber es erinnerte mich daran, dass ich nicht unendlich Zeit hatte. Dass ich jeden Augenblick nutzen musste.
Ich sog die warme Sommerluft tief ein, dann tauchte ich erneut unter die Oberfläche. Mit weit ausgreifenden Bewegungen durchquerte ich die Kühle, ließ das Mondlicht über meinen Körper gleiten. Jeder einzelne Zug machte mich schwerelos, sorgenlos. Ich hatte Henrietta anflehen müssen, bis sie irgendwann lachend nachgab und es mir beibrachte: das Schwimmen. Wie man das Wasser kontrollierte, statt darin unterzugehen, wie es mein Vater oder meine Brüder tun würden.
Ich stieß wieder durch die Oberfläche, sprühte Tropfen nach allen Seiten. Es war ungewohnt, ohne Henrietta hier zu sein. Vermutlich war das die Zukunft, die mich erwartete. Wenn ich mit meiner Vermutung richtiglag und ihr Friedrich, der Zeremonienmeister, heute die Frage aller Fragen stellte, dann … dann wäre ich wieder allein. Keine heimlichen Leseabende mit gestohlenen Büchern, keine geheimen Ausflüge ins benachbarte Dorf. Niemand, der meine Sicht der Dinge teilte, der keine Marionette meines Vaters war. Vielleicht war der Moment, in dem sie ging, der Moment, in dem ich etwas ändern musste. Von der stillen Rebellion gegen ihn in den offenen Krieg übergehen oder …
Mein Pferd schnaubte erneut.
Ich drehte den Kopf, diesmal misstrauisch. War das eine Warnung? Hatte ich Besuch?
Schnell schätzte ich die Entfernung zum Ufer. Wenn derjenige sich schon in der Nähe meines Pferdes befand, war es nicht mehr weit bis hinab zum Fluss. Ich würde es nicht schaffen, rechtzeitig an Land zu kommen und mich anzukleiden. Trotzdem schwamm ich los. War das ein Knacken? War da wirklich jemand unterwegs? Verdammt. Verdammt! War es eine der Wachen? War sie mir gefolgt? Wenn der neue Stallknecht geredet hatte, dann …
Da. Eine Gestalt schälte sich aus den Bäumen, genau an der Stelle, an der ich mich vom Ufer in den Fluss hatte sinken lassen. Mond- und Feenlicht waren zusammen gerade hell genug, um mir zu zeigen, dass der hochgewachsene Mann ein weites, unförmiges Hemd trug. Ein Hemd, keine Uniform – keine Schlosswache, kein Handlanger meines Vaters.
Der Fremde wandte den Kopf und zeigte mir seinen dunklen, kurzen Zopf im Nacken. Er bückte sich, als würde er irgendetwas an der Uferböschung suchen.
Meine Kleider. »Finger weg!«, rief ich und hielt entschlossen auf das Flussufer zu.
Die Gestalt richtete sich wieder auf.
»Rühr sie nicht an! Glaub mir, du wirst es bitter bereuen, wenn du dich mit mir anlegst!«
Zwei Herzschläge lang beobachtete er schweigend, wie ich näher kam. Konnte er sehen, dass ich nichts trug, oder wurde es vom dunklen Wasser verborgen?
»Ach, tatsächlich?«, meinte er dann. »Du siehst mir nicht sonderlich gefährlich aus.«
»Hast du dir die Kleider nicht richtig angesehen, du Esel? Ich bin – die Zofe der Prinzessin! Weißt du, was mit Landstreichern wie dir geschieht, wenn sie ein Mitglied des Hofes auch nur einmal schief ansehen?«
»Welcher Prinzessin? Wir haben hier keine Prinzessin. Bist du aus Sahrmingen?«
»Wirklich hervorragend kombiniert.« Mich trennten nur noch wenige Züge vom Ufer. »Glaub mir, meine Herrin hat gute Verbindungen zu deinem König. Sie wird deine Bestrafung schon durchsetzen! Also mach dich gefälligst davon!«
»Was willst du denn tun? Das ganze Land nach Männern mit meiner Beschreibung absuchen, bis du den wiederfindest, der dir das Kleid gestohlen hat? Oder willst du mich gleich hier auf der Stelle überwältigen und eigenhändig zu deiner Prinzessin schleifen? Bitte sehr – komm aus dem Wasser, dann werden wir sehen, wer hier wen zu Boden ringt!«
Mit einer schnellen Handbewegung schickte ich ihm das kalte Flusswasser einmal quer über den Körper. Der Mann warf den Kopf in den Nacken und lachte. Lachte laut und herzlich unbeeindruckt, während ihm das Wasser vom Gesicht tropfte.
Ich war jetzt so nah, dass ich seine Schuhe erkennen konnte. Gute Schuhe. Beinahe zu gute Schuhe. Hatte er die etwa auch jemandem entwendet?
Doch bevor ich ihn danach fragen konnte, ging er in die Hocke, sodass sich sein Kopf nur noch einen Meter über meinem befand. »Entweder bist du ausgesprochen dumm oder an Dummheit grenzend mutig. Wie ist dein Name, Wassernixe?«
»Du jedenfalls bist ausgesprochen dreist und unhöflich! Wie ist denn bitte dein Name, Landstreicher?«
In dem fahlen Licht sahen sowohl Haare als auch Augen nachtschwarz aus. »Jannes.« Seine Mundwinkel, halb verborgen in den Ausläufern des akkurat gestutzten Barts, verzogen sich amüsiert. »Und du?«
Er lehnte sich vor und streckte die Hand in Richtung der tiefer gelegenen Flussoberfläche aus, um eine meiner langen, losen Haarsträhnen zu berühren, die um mich herum im Wasser trieben.
Sein Fehler. Ich machte kurzen Prozess mit ihm. Ehe er reagieren konnte, hatte ich ihn am Oberarm gepackt und in den Fluss gezogen. Sofort kletterte ich selbst aufs Ufer, griff mir meine Kleider und stolperte hinter die Sträucher. Hinter mir durchbrach sein Kopf prustend die Oberfläche.
Zum Abtrocknen blieb keine Zeit. Mit ungeschickten, hastigen Fingern zog ich mir das Unterkleid über den Kopf. Der Stoff klebte an meinem nassen Körper und sog sich schneller voll, als ich ihn hinunterziehen konnte. Es würde ein unangenehm klammer Ritt zurück werden.
»Hey!«
Ich warf einen Blick an den Zweigen vorbei zum Fluss. Der Fremde hatte Mühe, sich das Wasser aus dem Gesicht zu wischen. Aber er strampelte nicht um sein Leben, er konnte schwimmen.
»Du bist eine ziemlich freche kleine Nixe!«
»Eine echte Nixe hätte dich vollständig ertränkt«, informierte ich ihn. »Du solltest mir also dankbar sein.« Ich trat hinter den Büschen hervor, während ich mir die langen Haare nach vorn zog und sie hastig mit beiden Händen auswrang.
»War das Zufall? Oder wusstest du, dass ich dir die Gelegenheit dazu geben würde?«
Ich schenkte ihm ein Lächeln. »Woher hätte ich das denn wissen sollen?«
Er lachte ein weiteres Mal. Es war ein offenes, ausgelassenes Lachen, so wie ich es noch nie gehört hatte. Selbst das unerwartete Bad schien ihn nicht im Geringsten aus der Ruhe gebracht zu haben. Ganz im Gegenteil: Er schien es zu genießen.
»Willst du nicht wieder reinkommen? Ich wollte dich wirklich nicht verscheuchen.«
Ich band mir die Schnürung meines Überkleides zu. »Danke, der Fluss hat für mich jeden Reiz verloren.«
»Was … nur weil ich hier drin bin?«
»Ich bade lieber ungestört.«
Ich fand meine Schuhe zwischen Gras und Sumpf-Vergissmeinnicht und schlüpfte hinein. Als ich den Kopf hob, sah ich gerade noch, wie der Fremde sich mit einem kräftigen Schwimmzug zurück zum Ufer brachte. Er legte die Hände auf die Böschung, bereit, sich hinaufzuziehen. Seine Hemdsärmel klebten an seiner Haut und zeichneten die Konturen seiner Arme ab.
»Dann komme ich eben wieder heraus.«
»Warum so eilig? Das Wasser ist wirklich schön. Grüß die Wasserschlange von mir, wenn du ihr begegnest.« Ich warf ihm eine Kusshand zu. Dann raffte ich meine schweren, durchweichten Röcke und wandte mich ab, um mein Pferd aufzusuchen.
»Warte!« Hinter mir erklang ein lautes Platschen.
Ich hätte rennen sollen. Es wäre das Vernünftigste gewesen, damit ich zu meinem Pferd kam, bevor er es tat. Doch stattdessen drehte ich mich um.
Er stand aufrecht an der Uferkante. Die Nässe rann an ihm herab, ertränkte das Gras zu seinen Füßen in einer Pfütze. Wie schon an seinen Armen, so klebte seine Kleidung jetzt auch an seinem restlichen Körper wie eine zweite Haut.
»Wie kann ich dich wiedersehen?«
»Du wolltest mir die Kleider stehlen.«
»Du hast mich ins Wasser gezogen.« Er war größer als ich. Er hätte zu einer ernsthaften Bedrohung werden können, wenn er gewollt hätte. »Wie kann ich dich wiedersehen?«, wiederholte er jedoch nur.
»Gar nicht. Ich hätte gar nicht hier sein sollen.«
»Dann werde ich dich besuchen.«
»Ist das eine Drohung?«
»Ein Angebot, wenn du willst.« Das Wasser tropfte ihm noch immer aus Bart und Kleidung. Selbst sein Zopf hatte sich gelöst.
»In Ordnung«, hörte ich mich selbst sagen.
»Ausgezeichnete Wahl.« Ein unanständiges, unerschütterliches Grinsen. »Das Rosenschloss von Sahrmingen?«
»Komm zu den Ställen. Gib einem der Stallknechte Bescheid.«
»Einem der Stallknechte?«
»Eine Zofe hat einen Ruf zu verlieren.«
»Richtig.« Er lächelte. »Und ich frage dann nach …?«
»Henrietta.« Es war der sicherste Weg, um tatsächlich informiert zu werden. Ich deutete einen raschen Knicks an. »Ich muss los.« Die Nässe durchweichte zunehmend meine Kleidungsschichten, ich wollte nicht, dass er am Ende so viel von mir zu sehen bekam wie ich von ihm. Entschlossen wandte ich mich um, das Kleid noch immer zwischen den Fingern gerafft, und stieg den letzten Rest der Böschung hinauf.
»Bis bald«, erklang es leise hinter mir.
Der Rosengarten
Es war warm. Viel zu warm.
»Kronprinz Leonard von Garenien war hier«, teilte uns Tante Clementine mit, während ihr zart rosafarbener Fächer emsig arbeitete. »Er hat meine Züchtungen bewundert, vor allem meine neueste, die mit den gekräuselten Blütenblättern. Anscheinend möchte der Prinz seine eigene Zucht beginnen.«
Die Luft schien hier im Schatten unter dem Pavillon stillzustehen. Verborgen von den schweren Kleidungsschichten rann mir ein Schweißtropfen die Wirbelsäule hinunter. Ich wollte ihn aufhalten. Ich wollte das ganze verdammte Kleid ausziehen und den Wind an meine Haut lassen.
Stattdessen saß ich weiterhin aufrecht, das Kinn erhoben, fächelte mir Luft zu und wartete auf eine Gelegenheit, mich mit Henrietta in den Garten davonzustehlen. Dorthin, wo mich bunte Schmetterlinge lockten und uns niemand zuhören würde.
»Natürlich habe ich ihm zugesichert«, fuhr Tante Clementine mit gespitzten Lippen fort, »ihm mit Rat und Tat so gut zur Seite zu stehen, wie ich es vermag. Schließlich sind wir beinahe Nachbarn. Und was nützt es, wenn ich meine zahlreichen Erfahrungen nicht weitergebe?« Sie sah bedeutungsvoll in unsere kleine Runde, bestehend aus zwei meiner Brüder – der dritte, Thomas, schlenderte irgendwo durch den Garten –, vier Dienern, die mit Erfrischungen aufwarteten, sowie meiner Zofe und mir.
»Prinz Leonard ist ledig, wenn ich mich recht erinnere?«, erkundigte ich mich betont beiläufig.
»Ja, seine arme Frau verstarb vor nicht ganz drei Jahren.«
»Das erklärt einiges.« Vor allem, warum du ihm so bereitwillig hilfst.
Die Schwester meines Vaters warf mir einen scharfen Blick zu. »Möchtest du damit etwas andeuten, junge Dame?«
Ohne eine Miene zu verziehen, griff ich nach meinem Glas gekühlter Limonade. Es war in allen Ecken der Verbündeten Länder bekannt, wie verzweifelt Clementine nach einem neuen Gemahl suchte. Als wäre es eine gefährliche Krankheit, weiblich und unverheiratet zu sein. »Habt Ihr ihn schon gefragt, ob er Euch einen Tanz beim legendären Agarmundter Herbstball zusichert?«
»Ich bitte dich! Ich werde mich ihm doch nicht anbiedern wie eine … wie eine …«
»Sucht der König von Agarmundt nicht auch eine Frau? Vielleicht solltet Ihr ihn mal in Euren Rosengarten einladen, um … ihm Inspirationen für den nächsten Ball zu geben. Hattet Ihr Euch nicht darüber beklagt, das Thema Maskenball in diesem Jahr sei viel zu unoriginell? Bei den über zwanzig Jahren Erfahrung, die Ihr ihm voraushabt, gäbe es bestimmt noch ganz anderes, was er von Euch lernen könnte.«
»Mirelle!«, entfuhr es meiner Tante.
Sie mit ihrem perfekten Leben, das sie selbst nicht wertschätzen konnte. Sie konnte auf jeden Ball gehen, auf den sie wollte. Der einzige Ball, auf dem ich jemals gewesen war, hatte in einer abgelegenen Provinz stattgefunden und kaum zwanzig Teilnehmer umfasst. Doch sie, sie konnte überall hingehen. Sie hatte eine ganze Residenz zur eigenen Verfügung und wurde nur alle paar Wochen mal von meinem Vater besucht. Dafür hätte ich alles getan.
Ach, zum Henker mit dem Warten. Wenn ich hier noch einen Moment länger blieb, würden entweder Clementine oder ich in Rauch aufgehen. Ich erhob mich.
»Wohin willst du?«
»Eure Rosen bewundern?«, schlug ich vor.
»Bei der Sonne?«
Ich hielt meinen Sonnenschirm hoch. »Ich bin bestens ausgerüstet.«
Es gefiel ihr nicht. Dabei hatte dieser Drache bei meinem Bruder Thomas nicht einmal mit der Wimper gezuckt!
Ich knickste rasch und zog Henrietta mit mir mit.
»Mirelle von Sahrmingen!«, protestierte meine Tante, doch bei der Hitze fehlte es ihr zum Glück an Motivation, sich aufzuraffen, um mir zu folgen.
Im Vorbeigehen warf ich einen Blick hinüber zu meinem Vater und dessen Berater Ludwig, die in einem weiteren Pavillon über ausgebreiteten Landkarten die Köpfe zusammensteckten. Doch falls sie etwas von unserem Streit bemerkt hatten, dann zeigten sie es nicht. Kies knirschte unter meinen Füßen, während Henrietta und ich zwischen den säuberlich gestutzten Rosenhecken außer Hörweite schlenderten. Es roch ebenso sehr nach Blumen wie nach Staub, Hitze und Sommer. Schmetterlinge tanzten in der flirrenden Luft zwischen den üppigen Rosenknospen, Bienen summten beruhigend bei ihrer Arbeit. Eine dicke Hummel setzte sich auf eine kleine Blüte und brachte sie mit ihrem Gewicht zum Absinken.
Ich warf einen letzten Blick zurück. »Erzähl mir mehr über Friedrichs Familie«, bat ich dann. »Wie sind seine Eltern? Waren sie nett zu dir?« Ich kippte den albernen Schirm zur Seite und ließ meine Nase von den warmen, tastenden Strahlen kitzeln.
»Mirelle, dein Teint.« Ungeduldig schob Henrietta meinen butterblumengelben Schirm zurück über meinen Kopf. »Und es kommt gar nicht infrage, dass wir wieder zu meinem gestrigen Abend zurückkehren! Erst musst du mir noch mehr von deinem erzählen.«
Ich lachte. »Du hast dich verlobt, Henrietta! Wie könnte irgendetwas anderes jetzt spannender sein als das?«
»Hör auf damit.« Eine leichte Röte kroch in Henriettas Wangen, die nichts mit der Sommerhitze zu tun hatte.
»Warum sollte ich? Du willst doch auch drüber reden, gib es zu.«
»Ich glaube, es wäre wirklich ganz gesund, wenn ich zwischendurch mal über andere Dinge nachdenke. Mir dreht sich doch schon der Kopf!«
Mir wurde bei dem Gedanken an ihre Verlobung auch schwindelig, allerdings aus anderen Gründen. Immerhin bedeutete das, dass sie bald gehen würde. Ich wusste nicht, was ich ohne sie machen sollte.
»Von mir aus könntest du die ganze Zeit davon erzählen«, sagte ich ehrlich. »Es tut gut zu sehen, dass es auch anders geht als … in meiner Familie.«
»Du bist auch anders.«
»Nichts für ungut, Henrietta, aber nein. Ich bin da genau wie meine Familie.«
»Mir gegenüber nicht.«
»Und dreimal darfst du raten, an wem von uns das liegt.« Ich stieß ihr einen Ellenbogen in die Seite. »Hast du schon verdrängt, wie die ersten Wochen aussahen, als du vor drei Jahren meine Zofe wurdest? Da habe ich …«
»Oh, richtig!« Ihre Hand fuhr zu ihrem Mund und ihr entschlüpfte ein Lachen. »Du hast mir die unmöglichsten Aufgaben gestellt – sogar widersprüchliche! Und dann behauptet, ich wäre nur nicht in der Lage, mir die Aufträge richtig zu merken. Es kommt mir vor, als wäre das eine Ewigkeit her.«
»Sag ich doch: genau wie meine Familie.« Ich hatte sie nach allen Regeln der Kunst getestet. Wo ihre Grenzen lagen, ab wann sie zu meinem Vater laufen und sich beschweren würde. Jede einzelne Zofe vor ihr war durchgefallen. Henrietta nicht. Stattdessen hatte sie mit mir geredet, als ihr die Sache zu bunt geworden war. Sie war das Beste gewesen, was mir passieren konnte.
»Allerdings … lief es mit deinem Besucher gestern Abend doch auch ganz gut. Vielleicht habt ihr nicht zusammen gebadet, aber immerhin …«
Ich lachte. »Das war eine sehr ungeschickte Überleitung.«
»Und? Ich will wirklich mehr über ihn wissen.«
Wie ist dein Name, Wassernixe? Ungewollt sah ich ihn wieder vor mir, wie ihm die Haare an der Stirn klebten und das Wasser in die Augen lief.
Mit einem Blick über die Schulter prüfte ich noch einmal die Umgebung, doch wir waren allein. Und die üppigen Rosenbäume schirmten uns auch von der Sicht des Pavillons ab. »In Ordnung«, gab ich nach. »Was sind die brennenden Fragen?«
»Was konntest du von ihm erkennen?«, begann Henrietta. »Wie sah er aus? Könntest du erraten, was er von Beruf ist? Willst du ihn wiedersehen?« Sie stockte, sah mir ins Gesicht, prüfte das Lächeln darauf. »Meine Güte, du willst ihn wiedersehen!«
»Ich habe mich … eventuell … schon mit ihm verabredet?«
»Nein!«
Ich grinste. »Doch.«
Henrietta griff nach meiner Hand. »Jetzt musst du mir auf jeden Fall alles über ihn erzählen. Jedes Detail. Was muss man an sich haben, um eine harte Nuss wie dich schon beim ersten Treffen zu knacken?«
»Ich bin nicht geknackt. Nur … neugierig.«
»Da! Du hast ihn immer noch, diesen Gesichtsausdruck!«, behauptete Henrietta und wies mit dem Finger auf mich. Ich wischte ihn fort, konnte jedoch nicht aufhören zu grinsen. »Unsinn. Das ist nur –«
Im Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr und ich vergaß den Rest des Satzes. Dieser verdammte …!
Wütend fuhr ich herum, klappte den Schirm ein und sprintete los. Dann rannte auch er – doch selbst der verfluchte stickige Rock und die dünnen Pantoffeln hielten mich nicht auf. Ich holte ihn ein, bevor er die letzte Rosenreihe umrunden und zum Pavillon zurückkehren konnte. Ich hieb Thomas den Schirm flach gegen die Brust. Mit einem Keuchen entfuhr ihm die Luft und er hielt an. Es wäre befriedigender gewesen, ihn zum Stürzen zu bringen, hätte nur leider auch mehr Aufmerksamkeit auf uns gezogen.
Ich stellte mich ihm in den Weg. »Was hast du gehört?« Er musste etwas mitbekommen haben, sonst wäre er gar nicht erst gerannt.
Thomas rang noch immer schnaufend um Atem, schaffte es trotzdem bereits, mich anzulächeln. »Das wird dich ruinieren.«
Ich hätte nicht hier über die letzte Nacht sprechen dürfen. Auf keinen Fall. Wie hatte ich nur so leichtsinnig sein können?
Entweder bist du ausgesprochen dumm oder an Dummheit grenzend mutig.
Ich veränderte die Position des Schirmes so, dass ihm die Spitze nun wie ein Degen auf der Brust saß. Der Schweiß rann mir jetzt in Bächen den Rücken hinab. »Du wirst niemandem etwas davon erzählen!«
Sein Grinsen wurde breiter. »Dass du heimlich mit Männern badest?«
»Hast du vergessen, was mit Charle Timmons passiert ist?«
»Höre ich da etwa ein Quäntchen Besorgnis in deiner lieblichen Stimme, Schwesterherz? Was bekomme ich von dir, damit ich es nicht weitererzähle?«
Glaubte er ernsthaft, ich würde mit ihm verhandeln? Mit ihm? Obwohl ich selbst einen Trumpf auf der Hand hatte? »Wenn du auch nur eine Silbe zu irgendwem sagst, wird Vater erfahren, wohin dich deine Ausritte in Wirklichkeit führen!«
Er besaß die Dreistigkeit, sich daraufhin zu seiner vollen Größe aufzurichten – eine knappe Handbreit größer als ich. Die zwei Jahre, die er mir voraushatte, machten ihn allerdings nicht gerade klüger. »Er wird nichts dagegen haben.«
»Ach, tatsächlich? Warum hast du es ihm dann nicht schon erzählt? Du berichtest ihm doch sonst von allem, was so passiert.«
»Prahlerei ist geschmacklos.«
Ich verzog spöttisch den Mund. »Ich glaube eher, du weißt selbst ganz genau, wie wenig begeistert er sein wird, wenn er erfährt, dass du Vater wirst.«
»So leicht kriegst du mich nicht. Ich weiß, dass Louise nicht schwanger ist.«
»Oh, mein liebster Bruder, ich rede von Helene.«
Sein Lächeln flackerte … und verblasste dann. »Das erfindest du gerade!«
»Sag bloß, du hast ihr seitdem nicht einmal die Gelegenheit gegeben, mit dir darüber zu reden?«
»Das kann nicht sein! Das ist nicht möglich. Jemand anderes –«
»Was geht hier vor?«
Wir erstarrten beide. Tante Clementine stand so plötzlich neben uns, als wäre sie aus dem Boden gewachsen, einschließlich hellrosa Sonnenschirmchen. War sie auch durch den Garten spaziert? Hatte sie etwas mitbekommen?
Notgedrungen nahm ich den Sonnenschirm von Thomas’ Brust. Trotzdem starrte ich ihn warnend an. Du schweigst, befahl ich ihm lautlos.
»Ich glaube es einfach nicht. Da lässt man euch einen Moment lang aus den Augen und ihr vergesst all eure Manieren!«, schimpfte meine Tante. Sie wollte noch mehr sagen, doch was immer es war, sie schien nicht in der Lage, es auszusprechen. Sie kämpfte mit den Worten wie ein Huhn mit einem übergroßen Korn.
»Mirelle, du kommst auf der Stelle mit zurück unter den Pavillon«, rang sich Tante Clementine schließlich ab. »In gemäßigtem Schritt. Und mit Schirm! Meine Güte, anscheinend legst du es wirklich darauf an, wie eine Landpomeranze auszusehen. Ich kann die Sommersprossen förmlich sprießen hören!«
Ich warf Henrietta einen Blick über die Schulter zu, verdrehte die Augen, sodass nur sie es sehen konnte, und klappte den Schirm wieder auf.
Das Porträt
Ich sprang auf. »Endlich.«
»Beim Grab meiner Mutter! Nicht schon wieder!«, entfuhr es dem Maler.
Ich ignorierte ihn. »Was konntest du herausfinden?« Eilig lief ich Henrietta entgegen, die die Tür zuzog und sich dann schweigend zu mir umdrehte. Doch ihre Miene sagte mir bereits alles, was ich wissen musste. »Verdammt!«
»Es tut mir leid.« Henrietta klang ernsthaft bedrückt.
»Bitte, Prinzessin, bitte setzt Euch wieder!«
»Nicht mal einen Anhaltspunkt?«, hakte ich nach.
»Wie es scheint, ist das Porträt von Seiner Majestät höchstpersönlich angeordnet. Aber –«
»Prinzessin, ich habe wirklich nicht den ganzen Tag –«
»Würdet Ihr bitte wenigstens für einen Moment still sein!« Wütend fuhr ich zu dem hartnäckigen Schnurrbartträger herum. Der Pinsel, noch immer dick in Farbe getaucht, zitterte bedrohlich in seiner Hand. Ob vor unterdrückter Empörung oder Angst, vermochte ich nicht zu sagen.
Ich wandte mich wieder zu Henrietta um. »Was wolltest du sagen?«
Sie widmete mir einen ihrer vorwurfsvollen Blicke.
Ich seufzte und drehte mich erneut zum Maler – Antonio? Andiamo? – um, griff in die viel zu langen Stoffbahnen des Rockes und knickste. »Ich entschuldige mich für meine Ungeduld und meinen rauen Tonfall. Er war nicht wirklich gegen Euch gerichtet.« Ich wartete kurz, erhielt jedoch keine Reaktion, daher sah ich wieder Henrietta an.
Diese hatte immer noch die Augenbrauen erhoben, sprach dann jedoch trotzdem. »Es ist anscheinend bekannt, dass Seine Hoheit Euer Porträt angeordnet hat, aber niemand kennt den Grund dafür.«
»Oder alle behaupten nur, ihn nicht zu kennen.«
»Auch möglich.«
»Schön.« Ich zog mir den unnötig kunstvoll drapierten Seidenschal von den Schultern und drückte ihn Henrietta in die Hand. Die alberne Rose folgte. Nicht dass ich prinzipiell etwas gegen Rosen hatte, doch diese hier war dornenlos und das war einfach unsinnig. Als würde man einem Wolf die Zähne wegzüchten.
»Was habt Ihr vor?«, wollte Henrietta wissen. Solange wir unter Zeugen waren, hielt sie an der respektvollen Anrede fest.
»Ihn selbst fragen. Denkst du, ich werde hier weiter herumsitzen, ohne zu wissen, worauf das hinauslaufen soll?«
»Prinzessin!« Der angeblich so begabte Maler wagte einen erneuten Protest und warf sich mir halb in den Weg. »Ihr könnt nicht gehen! Die Farben – sie trocknen! Ich kann unmöglich –«
»Wisst Ihr denn, wozu das Gemälde dienen soll?«
»Ich bin der Künstler, meine Aufgabe ist –«
»Das ist wohl ein Nein.« Ich raffte mein Kleid zusammen – die Schleppe war eigentlich viel zu lang zum Gehen und nur zum Stillsitzen und Schönaussehen gedacht. »Dann hofft besser, dass ich den Grund herausfinde und er ein angemessener ist. Falls das hier wieder irgendeiner Intrige meines Vaters dient, werdet Ihr Euer Modell leider nicht zurückbekommen.«
Damit marschierte ich, so gut ich in diesem Kleid eben marschieren konnte, an Henrietta und Antjemo vorbei aus dem Saal. Ich kam nicht sonderlich weit. Nach nur einem Flur rutschte mir der Stoff aus den Fingern und ich kam ins Stolpern. Mühsam raffte ich die Röcke wieder zusammen und ging weiter. Dann die Treppe. Die einzelnen Stufen zu erklimmen, ohne dass ich mich im Saum verfing, war beinahe unmöglich. Himmel, wie ich mir manchmal wünschte, ich wäre ein Mann! Dann wäre das Gemälde von mir in einer prächtigen Uniform gemacht worden und nicht in so einem unpraktischen, zarten, berüschten … Ich fluchte ungehalten.
»Wenn Euer Vater das gehört hätte, würde er Euch enterben.«
Ludwig, Vaters Berater, kam die Treppe hinunter, das Kinn erhoben und die Brust geplustert. Gerade noch rechtzeitig unterdrückte ich einen weiteren Fluch.
»Dann berichtet ihm bitte davon. Ich würde mich freuen, wenn er das täte«, gab ich stattdessen zurück und kämpfte mit den nächsten Stufen.
»Diese Aussage beweist nur Eure Unwissenheit, sonst würdet Ihr Euch dergleichen nicht wünschen.«
»Oder wie wenig Ihr davon wisst, die Tochter einer königlichen Adelsfamilie zu sein.«
»Auch davon, Prinzessin, habt Ihr selbst noch keine Ahnung. Der entscheidende Teil kommt leider erst noch.« Mit wehendem weißem Haar lief er an mir vorbei die Treppe hinunter.
»Was bitte soll das denn heißen?«, rief ich ihm hinterher – aber er weigerte sich anscheinend, noch ein Wort mit mir zu wechseln. Selbstverliebter Kauz.
Ich überwand die letzten beiden Stufen und durchquerte dann den langen Gang, der zur Bibliothek führte, die zugleich Vaters Arbeitszimmer war. Die Handvoll Laufburschen und Wachen vor der Tür verrieten, dass mein Vater sich tatsächlich darin aufhielt. Doch bevor ich auch nur klopfen konnte, versperrten die Wachen mir den Zutritt. Sieh an, er kam wirklich auf immer neue Ideen, mich zu demütigen. Jetzt durfte ich nicht einmal ohne Erlaubnis mit ihm sprechen.
»Würdet Ihr so liebenswürdig sein und Euch erkundigen, ob mein ehrwürdiger Herr Vater, Seine Hoheit König Hagan, mich empfängt?«, säuselte ich und ließ meine Lider flattern.
Einer der Bediensteten schlüpfte lautlos durch die Flügeltür. Es verstrich eine ganze Weile – sicherlich in voller Absicht –, bevor er wieder erschien und durch ein Nicken zu den Wachen die Tür freigab. Fantastisch. Mit gerafften Röcken zog ich an den Wachen vorbei in die Schlacht.
»Was habt Ihr vor?«, forderte ich. Kurze Eröffnung, Angriff ohne Vorwarnung. »Warum ein Porträt?« Nach der neuen Eintrittsregelung fragte ich gar nicht erst, sonst hätte ich ihm nur gestanden, dass es mir etwas ausmachte.
Mein Vater saß an dem großen, ausladenden Tisch aus dunklem Walnussholz und hatte sich über Berge und Berge aus Papier gebeugt. Einige Bücher waren aufgeschlagen über die Tischplatte verteilt, der Rest blickte als stille Beobachter aus unzähligen, übermannshohen Regalen herab. Wenn ich hätte raten müssen, dann beschäftigte er sich vermutlich mit der Ahnenfolge und dem Erbanspruch der einzelnen Sahrminger Häuser. Meines Wissens nach gab es noch immer vier Teilgebiete, auf denen die Familie meiner Mutter saß und meinem Vater die Loyalität verweigerte. Ich war eben nicht die Einzige.
Mein Vater schob ein Dokument von rechts nach links und beugte sich vor, um unter düsteren Brauen die alten Grenzkarten zu mustern, als hätte er mich nicht gehört.
Ich hätte gern geschrien. Oder mit der Hand auf den Tisch geschlagen. Nur damit er zugeben musste, dass ich anwesend war. Dass ich eine Meinung hatte. Doch genau diese Art Reaktion war es, die er von mir sehen wollte. Damit er dann abfällig aufblicken und mir signalisieren konnte, dass diese Art von Verhalten genau der Grund wäre, warum er mich so behandelte.
Als Kind hatte ich immer wieder versucht, seine Anerkennung zu bekommen. Hatte mich mit Stöcken duelliert, wie meine Brüder es getan hatten, ihm Blumen geschenkt, wie er sie manchmal meiner Mutter überreicht hatte, oder ihm freche Antworten gegeben wie meine Mutter. Es war vollkommen gleichgültig, wofür ich mich entschied – er ignorierte mich und ging dann zu meiner Mutter, um mit ihr über mich Streit anzufangen. Als wäre ich keine eigenständige Person. Als wäre ich nur ein widerspenstiger Spielstein, der nicht tat, was man von ihm erwartete.
Ich schluckte meinen Frust hinunter und schlenderte näher zum Tisch. Mit ruhiger, fester Stimme setzte ich erneut an. »Wozu soll das Porträt –«
»Ich habe dich auch beim ersten Mal gehört. Nur ist leider nicht alles so dringend wie die Befriedigung deiner Neugierde.« Er hob nicht einmal den Kopf, um mich anzusehen.
Er hatte gewusst, dass ich kommen würde. Plötzlich war ich mir sicher, dass ich auch mit meinem Erscheinen hier nur seinem Plan folgte.
»Ich werde nicht weiter Modell sitzen, solange ich nicht weiß, wozu es dient«, sagte ich trotzdem. Probehalber.
Mein Vater lehnte sich lediglich zur Seite, um mit dem Finger eine Passage in einem der Bücher entlangzufahren. Dabei war er derjenige, der das Porträt in Auftrag gegeben hatte, ihm hätte auch etwas an seiner Vollendung liegen müssen. Vermutlich hatte er von Anfang an gewusst, dass ich diese Prozedur abbrechen würde. Vermutlich war Andramo eingeweiht gewesen – und seine wahre Begabung lag darin, alles Fehlende aus dem Gedächtnis ergänzen zu können.
Ich hätte mich hinsetzen und ihn belagern können. Allerdings war es unwahrscheinlich, dass seine Sturheit vor meiner wich. Stattdessen entschied ich mich dafür, einfach wieder zu gehen. Wenn er dieses Spielchen fortsetzen wollte, dann würde er als Nächstes eben zu mir kommen müssen.
Ich hatte die Hand schon nach der Klinke ausgestreckt, als er doch noch die Stimme hob.
»Du wirst heiraten.«
»Was?« Ich fuhr herum.
»Du hast mich schon verstanden.« Er machte sich eine Notiz, bevor er ein anderes Papier heranzog.
War das etwa Ludwigs Andeutung gewesen? Ich … Ich sollte heiraten?
»Das kann nicht Euer Ernst sein!« Mein Mund sprudelte Worte hervor, ohne dass ich ihm die Erlaubnis dazu gegeben hätte. »Ihr selbst sagt doch immer, ich würde der Familie nur Schande bereiten … und … und dass mit siebzehn zum Glück noch Zeit bliebe, bis man sich Gedanken um einen Ehemann machen müsste!«
»Nun, diese Zeit hast du selbst zum Ablaufen gebracht.«
»Ich?«
»Was dachtest du denn, was dabei herauskommen würde? Es ist der einzige verbliebene Weg aus dieser Katastrophe.«
»Katastrophe?«
Mit einem Knall, der mir schmerzhaft durch die Schläfen schnitt, schlug er das Buch zu und erhob sich. Unvermittelt war er größer als ich und starrte auf mich nieder – mit diesem finsteren, stechenden Blick, der allein für mich reserviert war. »Spar dir die geheuchelte Unschuld! Dieses Mal bist du zu weit gegangen.«
Etwas zog sich in meiner Kehle zusammen. »Was auch immer Thomas –«
»Das hat mit Thomas nichts zu tun. Clementine hat dich darüber prahlen gehört und Ludwig hat gesehen, wie du in der Nacht zuvor durch die Gänge gewandert bist. Sowohl Kleid als auch Haare waren tropfnass.«
Tante Clementine hatte es gehört? War sie womöglich doch sofort aufgestanden und uns gefolgt?
»Ich bin mir sicher, das ist ein Missverständnis, was auch immer Tante Clementine gehört haben will. Und warum sollte Ludwig sich nachts herumtreiben, um das zu beobachten? Er springt nur auf Clementines Unterstellung auf!«
»Die Waschfrauen haben bestätigt, dass dein Kleid nicht zum ersten Mal auffällig verdreckt war. Und die Stallknechte haben anscheinend regelmäßig weggesehen, wenn du dich nachts eingeschlichen und ein Pferd entwendet hast.«
Sie waren also alle unter Vater eingeknickt. Keiner hatte den Mund gehalten.
Immerhin schienen sie nichts über Henriettas Beteiligung an den Ausflügen davor verraten zu haben.
»Was also werft Ihr mir vor?« Ich zwang mich dazu, die Brauen zu heben, spielte meinen eigenen hämmernden Herzschlag herunter. »Dass ich mich gegen das fade, künstliche Leben hier zur Wehr setze? Dass ich zwischendurch einfach ausbrechen muss? Ja, ich bin regelmäßig zum Fluss geritten, um zu baden. Wenn Ihr das schon als Katastrophe betrachtet, weiß ich nicht –«
»Das Problem ist nicht das Baden, Prinzessin. Jedenfalls nicht das größte.« Die belehrende Stimme in meinem Rücken ließ mich zusammenzucken. Ludwig! Wie hatte er die Bibliothek betreten können, ohne dass er angekündigt worden war? Er hatte also nicht um Einlass betteln müssen wie ich.
»Das Problem ist«, fuhr Ludwig fort, »dass Ihr Euch nachts mit Männern trefft, um dann mit ihnen zu baden.«
Verdammt. Also hatte sie alles gehört.
»So etwas spricht sich nicht nur hier herum, vermutlich wird es bald das ganze Land wissen.« Ludwig trat um mich herum und strich sich dabei nachdrücklich die Hemdsärmel glatt.
»Dann sagt Clementine, sie soll schweigen anstatt –«
»Deine Tante ist in diesem Fall tatsächlich diejenige, die uns vor dem Schlimmsten bewahrt hat. Lediglich die von ihr zufällig mit angehörten Informationen machen es uns jetzt möglich, schnell genug zu handeln. Bevor alle Welt davon erfährt.«
»Ich habe doch überhaupt nichts getan!«
»Ihr habt gegen jeglichen gesellschaftlichen Anstand verstoßen und damit Eure Erziehung und Euer Haus befleckt, Prinzessin. Das habt Ihr getan.«
»Aber … es ist doch nichts passiert! Ich war nur baden, und wenn Ihr nicht –«
»Was an sich schon eine Ungeheuerlichkeit ist.«
»Wenn Ihr nicht den gesamten Hof darauf aufmerksam gemacht hättet, dann wüsste es überhaupt niemand!«
»Du hast dich also mit niemandem getroffen?«, hakte mein Vater nach.
»Nein!«
»Und es hat dich – abgesehen von den Stallburschen – sonst niemand gesehen?«
»Nein.«
»Was für ein Gespräch war es dann, das du mit deiner Zofe geführt hast?«
»Es ging nicht um mich. Es war lediglich eine Geschichte –«
»– über eine Person, der zufällig das Gleiche passiert ist und einen Mann zum Baden getroffen hat?«
Ach, verdammt. Ich hob das Kinn. »Er hat keine Ahnung, wer ich bin, er kann also gar nicht –«
Mit einem gedehnten Kopfschütteln wandte mir Vater den Rücken zu. Ich presste mir die Fingernägel in die Handballen, um ihn nicht laut anzufahren. Was bitte sollte dieses demonstrativ resignierte Bedauern? Warum konnte er mir nicht ins Gesicht sagen, was ihn störte? Warum konnte er nicht einfach mit mir reden?
»Ihr meint wohl«, schaltete sich Ludwig erneut ein, »Euer Zeuge weiß nichts über Euch … außer vielleicht, dass Ihr um die siebzehn Jahre alt seid, ein gepflegtes Äußeres habt, kostbare Kleider tragt, ein Pferd besitzt und … so langes blondes Haar habt, dass es der Prinzessin von Sahrmingen imponieren würde?«
»Mein Aussehen ist dem gemeinen Volk überhaupt nicht bekannt!«
»Ihr wärt überrascht, wie viel das gemeine Volk weiß.«
Es fühlte sich an, als würde mir jemand langsam, aber stetig den Boden unter den Füßen wegziehen. »Das sind lediglich Behauptungen! Ihr habt keinerlei Beweise dafür. Ich habe nicht –«
»Prinzessin, wir benötigen keinerlei Beweise. In dem Moment, in dem wir sie erhalten, wird es schon zu spät sein. Ihr müsst verheiratet sein, bevor der Skandal die höheren Gesellschaftsschichten erreicht und Zweifel an Eurer Reinheit aufkommen können.«
Klopf – klopf, klopf. Mein Herz schlug weiter. Immer weiter. Als würde sich die Welt nicht vor meinen Augen auf den Kopf stellen. Benommen sah ich zu meinem Vater hinüber – doch der saß schon wieder über seine Dokumente gebeugt und notierte Anmerkungen auf ein separates Blatt Papier. Für ihn war mein Schicksal längst besiegelt. Für ihn war ich vermutlich schon gar nicht mehr anwesend, sondern bereits verheiratet, verscherbelt an denjenigen, dem das Porträt am meisten imponiert hatte.
»Thomas hat die Tochter des Wachtmeisters geschwängert.«
Doch weder mein Vater noch dessen Berater zeigten sich interessiert.
»Er hat sie geschwängert. Ist das nicht …« Dann begriff ich. »Tante Clementine hat auch diesen Teil weitergegeben, nicht wahr?«
Keiner von ihnen sagte etwas. Und eigentlich war das Bestätigung genug.
»Wird er jetzt auch verheiratet?«
Ludwig lächelte verkniffen. »Dazu besteht kein Anlass.«
»Ach!«
»Der Fall ist ein ganz anderer.«
»Richtig! Ihm wurde nicht nur eine verwerfliche Geschichte angedichtet, sondern es gibt sogar handfeste Beweise dafür! Bei ihm war es kein Zufall, kein Versehen, sondern er hat sie gezielt aufgesucht! Es wird ihr Leben ruinieren, wenn er sie nicht heiratet.«
»Sehr genau: ihr Leben, nicht seines. Ebenso wie Ihr Eure Familie ruiniert hättet, wenn sich dieser Skandal herumsprechen würde. Abgesehen davon wird sich natürlich um die Familie gekümmert.«
»Thomas hat –«
»Eure Verpflichtungen, Prinzessin, lagen vor allem darin, Euren Ruf zu wahren, und das habt Ihr nicht getan!«
»Warum hätte ich denn auch?«, platzte es aus mir heraus und meine Stimme überschlug sich fast. »Ich bin dieser Familie nichts schuldig!«
Mein Vater sah kurz auf – sah jedoch nicht mich, sondern Ludwig an und gab ein kurzes Handzeichen. Ludwig nickte förmlich und ging zur Tür, um sie einen Spaltbreit zu öffnen und den Bediensteten davor Anweisungen zu geben. Er trat zurück und zwei der Wachmänner kamen herein, ihre Degen schlugen im Rhythmus ihrer Schritte gegen ihre Beine. Stumm positionierten sie sich rechts und links von mir.
So war das also.
»Angesichts Eurer jüngsten Eskapaden können wir es uns leider nicht erlauben, Euch länger unbewacht herumstreunen zu lassen«, erklärte Ludwig und hatte immerhin den Anstand, dabei ehrlich bedauernd zu klingen. »Ihr werdet bis auf Weiteres in Euren Gemächern verbleiben müssen.«
»Gerade Ihr, Vater, solltet es besser wissen«, spuckte ich aus, während mich die Wachen hinausdrängten. »Habt Ihr nichts von Mutter gelernt? Bei Ihr hat es Euch auch kein Glück gebracht, eine Frau zu bevormunden – und erst recht nicht, sie gegen ihren Willen in eine Ehe zu zwingen. Eher würde ich als Bettlerin auf der Straße leben, als zuzulassen, dass Ihr mich an einen Wildfremden verkauft!«
Er reagierte wieder nicht. Er stritt nicht einmal ab, dass er sie gezwungen hatte, so wie er es sonst immer tat.
Meine Mutter hatte es gekonnt. Meine Mutter hatte es geschafft, zu ihm durchzudringen. Sie hatte ihm diese Gleichgültigkeit vom Gesicht gerissen, hatte ihn in Rage getrieben, bis Porzellan mit einem hellen Klirren an der Wand zersplitterte.
Ich konnte das nicht. Hilflos musste ich mich von den Wachen fortbringen lassen, halb stolpernd über den Saum des viel zu langen Kleides, ohne dass mein Vater auch nur noch einmal aufsah.
Der Plan
Auf dem Gang vor meinen Gemächern ertönten Schritte und Stimmen. Degen klirrten. Dann schwangen die Türen auf und Henrietta eilte herein, über dem einen Arm ein übergroßes Nähkästchen, über dem anderen unsere begonnenen Stickereien.
Ich ließ mich vom Fensterbrett gleiten und landete lautlos auf dem Parkett. »Aus deinem verschmitzten Lächeln zu schließen, hast du sie tatsächlich bekommen.«
»In der Tat.« Zufrieden warf sie die Stickereien auf den kleinen Tisch, der vor dem Kamin stand. Dann stellte sie das Nähkästchen ab und klappte es auf. Zum Vorschein kamen mehrere dicke Bücher, eingeengt zwischen Scheren, Nadeln und Garn.
»Danke.« Vermutlich wäre ich ohne ihre Hilfe verrückt geworden.
»Habe ich es dir nicht gesagt? Er kann dich einsperren, wie er will, ich kriege dich schon unterhalten!« Als sie sich im Sessel niederließ, wallte ihr Kleid wie ein Ballon in alle Richtungen auf. »Na dann: Auf einen fröhlichen Lesenachmittag!«
Ich nahm mir eines der Bücher vom Stapel. Es waren allesamt nicht die Art von Büchern, die ich gewählt hätte. Mir waren Tatsachenberichte oder Biografien wie Durch die Wüste und Zurück wesentlich lieber. Andererseits blieben mir nicht mehr viele dieser Tage mit Henrietta, ihre Hochzeit mit Friedrich war schon auf nächsten Monat festgesetzt. Ich musste jede Zeit nutzen, die ich noch hatte, um Bücher zu lesen, die ich nur mit ihr lesen würde.
»Fred Semmelweiß?«, fragte ich. »Du bist mutig! Nachdem du letztes Mal kein Auge zutun konntest …«
»Gerade deswegen sind sie doch so gut!«
»Na, wenn du meinst …« Ich setzte mich auf den Sessel ihr gegenüber. Mit einem Klatschen landete eine der Stickarbeiten auf meinem Schoß. »Henrietta, ich will wirklich nicht –«
»Falls jemand reinkommen sollte.«
Ich verkniff mir den Hinweis, dass wir das unter den jetzigen Umständen – Wachen vor der Tür, verdammt noch mal! – vermutlich schon etliche Augenblicke vorher wissen würden, und schob den Stoff brav neben mir auf die Sessellehne.
Das Papier flüsterte wie ein geheimer Vertrauter, als ich das Buch aufschlug. Als würde es mir Versprechungen zuraunen, dass alles besser werden würde. Dass es dafür sorgen konnte, dass ich wenigstens für ein paar Stunden eine Ablenkung erfahren würde.
Ich räusperte mich. »Der Jäger im Schilf von Fred Semmelweiß. Erstes Kapitel.« Ich machte eine kurze Pause. »Der Regen lief schon seit Tagen über die Fenster der kleinen Hütte, und der Wind, der die Tropfen gegen die Scheibe trieb, wurde immer heftiger. Unsichtbare Finger rüttelten an den Fensterläden und die Stimmen einsamer Tiere jagten durch die Flure. Nachts konnte man kaum schlafen. Aber solange …« Ich hielt inne. Keines der Worte hatte eine Spur in meinem Kopf hinterlassen, sie hatten lediglich meinen Mund passiert. Mein Blick schnellte zum Anfang zurück, ich las die Sätze noch einmal. Dann klappte ich seufzend das Buch wieder zu.
»Es muss eine Lösung für das Problem geben«, behauptete ich. »Er kann mich doch nicht einfach verheiraten! Irgendwie muss ich es doch verhindern können.«
»Wenn es eine Lösung gibt, dann wird sie dir einfallen.« Henrietta hatte sich tief über das Nähkästchen gebeugt, um Nadel und Faden zu suchen. »Dir ist bisher immer etwas eingefallen. Erinnerst du dich an den Hoflehrer … Charle Timmons?«
»Natürlich«, murmelte ich. Das war vor ein paar Jahren gewesen, in einer der Phasen, in denen mein Vater mir erlaubt hatte, am Unterricht meiner Brüder teilzunehmen. Zufällig genau nachdem ein neuer Lehrer angestellt worden war. Timmons hatte mich angeblafft, wann auch immer ich den Mund geöffnet hatte. Weil Frauen in seinen Augen kein Recht zu sprechen hatten, wenn sie nicht von einem Mann dazu aufgefordert worden waren. Und natürlich hatte er mich nie aufgefordert. Nur meine Brüder.
»Auch ihn bist du irgendwann losgeworden«, erinnerte mich meine Freundin.
Ich hatte ihn wütend genug gemacht, dass er alle anderen hinausgeschickt hatte, um mir gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, ihn vor Zeugen bloßzustellen. Er hatte mir – wie er sagte – die Leviten lesen wollen. Ich war mir sicher, dass er vorgehabt hatte, mich zu schlagen. Nur war ich schneller gewesen, hatte ihm gezielt das Hemd zerknittert und das Toupet verrutscht. Natürlich erzählte er allen, ich wäre das gewesen – was ja auch gestimmt hatte –, doch weil er alle fortgeschickt hatte, gab es niemanden, der seine Version hätte bestätigen können. Stattdessen stand die Verdächtigung im Raum, dass er selbst mich belästigt haben könnte. Und er musste des guten Rufes wegen entlassen werden – aus demselben Grund, warum ich jetzt verheiratet werden sollte.
Mit der Anstellung des nächsten Lehrers hatte man mir dann wieder verboten, am Unterricht teilzunehmen. Weil mein Vater mir gegenüber ein Ungeheuer war. Weil er mir gern Privilegien gab, um sie mir wieder entziehen zu können.
Ein Ungeheuer, das sich irgendwie besiegen lassen musste. Nur wie? Wenn ich die Chance gehabt hätte, mit jedem Kandidaten unter vier Augen zu sprechen, dann wäre das etwas anderes gewesen. Aber nach allem, was ich wusste, würde es eine richtige Viehschau werden – alle Interessierten waren zu einem Abendessen eingeladen, ich durfte nur für kurze Zeit im Anschluss dazukommen. Damit sie einen besseren Eindruck von dem bekamen, was sie da ersteigerten. Ich würde keine Gelegenheit haben, mit ihnen zu reden, mein Vater würde die alleinige Aufmerksamkeit für sich beanspruchen. Mein Vater, der Verkäufer, nicht ich, die Ware.
Ich legte das Buch zur Seite und ging hinüber zum offenen Fenster, zum Sommer, der dort draußen nur eine Armlänge entfernt war und ohne mich verstrich. Das hier war bereits grausam. Dass mein Vater mir den Sommer stahl. Den endlos blauen Himmel über mir, die warmen Finger des Windes, das Surren der Bienen, den betörenden Duft der Baumblüten. Ich vermisste das alles so sehr, dass es körperlich wehtat. Hätte ich jetzt bloß noch die Gemächer zwei Stockwerke tiefer – oder mich damals nicht erwischen lassen –, dann hätte ich mich jetzt wenigstens nachts heimlich davonstehlen können. Für den vierten Stock war ich jedoch nicht gut genug im Fassadenklettern.
»Ich muss die Freier dazu bekommen, mir die Aufmerksamkeit zu schenken«, murmelte ich. Das Porträt würde dafür nicht reichen, dann würden sie mit einem Blick die Ähnlichkeit überprüfen und ich war wieder entlassen. »Sie müssen echtes Interesse an mir haben … fasziniert sein … oder ich muss sie von vornherein ganz abschrecken.«
»Was ist mit dem fahrenden Volk?«
Ich drehte mich zu Henrietta um. »Das fahrende Volk?« Wir hatten uns zusammen gelegentlich ins Dorf geschlichen, wenn es vorbeikam. Wenn ich schon sonst nicht ins Theater oder die Oper durfte, dann war das die naheliegendste und auf keinen Fall schlechteste Alternative. »Ist es hier?«
»Du hast nicht davon gehört?«
»Henrietta, ich sitze hier in einem Gefängnis!« Das Einzige, was ich außerhalb meiner Gemächer noch zu sehen bekam, war der Saal, in dem mein Vater meine Brüder jeden Abend zum gemeinsamen Essen zwang.
»Tut mir leid, das war taktlos von mir.«
Ich winkte ab. »Unwichtig. Meinst du … Meinst du, du könntest Kontakt zu ihnen aufnehmen?«
»Und was soll ich ihnen sagen? Sollen sie Lieder auf deine Schönheit singen?«
»Nein. Nein, effizienter ist es, wenn sie den Skandal verbreiten, den mein Vater so fürchtet. Wenn er sich tatsächlich vor der Freiervorstellung herumspricht, dann wird das Interesse radikal abnehmen, oder?«
Henrietta ließ ihre Nadel sinken. »Das kannst du nicht machen.«
»Warum nicht?«
»Weil …« Sie stockte, als hätte sie auf etwas Bitteres gebissen. »… deine Familie ebenfalls unter deinem geschädigten Ruf leiden wird«, schloss sie unsicher.
»Meine Familie ist diejenige, die mich loswerden will wie einen Sack fauliger Kartoffeln.«
»Es könnte doch jemand unter den Freiern sein, der dir gefällt«, versuchte sie es mit einer anderen Strategie. »Er würde dich nach dem Skandal niemals nehmen. Du würdest den bekommen, der übrig bleibt. Damit wärst du trotzdem verheiratet, aber wesentlich unglücklicher.«
»Ein einzelner Freier ist wesentlich leichter in die Flucht zu schlagen.«
»Nicht, wenn dein Vater sich mit ihm einig ist, weil er der einzige ist. Vielleicht bekommst du ihn gar nicht vorher zu Gesicht.«
»Wie wäre es dann mit einer Kombination beider Taktiken? Erst soll das fahrende Volk über meine Schönheit singen und später über den Skandal. Wenn sich dann der Skandal verbreitet, werden sich trotzdem noch genug Interessierte allein wegen der Legenden finden.« Ich ging hinüber zu meinem Ankleideschrank, durchsuchte die Schubladen nach meinem Schmuck, einer Bezahlung für die Schauspieler und Sänger.
»Das klingt riskant.«
»Besser, als mich selbst betrauern und nichts zu tun, ist es allemal.« Ich hielt Henrietta eine Schachtel mit Ohrringen hin. »Würdest du es dem fahrenden Volk für mich übermitteln?«
»Was ist, wenn dein Vater sie als Verleumder einsperren lässt?«
»Deswegen erzählen sie ja die Wahrheit und nicht irgendeine Geschichte. Eher wird er mich einsperren. Was er ja schon getan hat.«
»Ich kann das unmöglich gutheißen.«
»Aber du würdest es trotzdem tun?« Ich versuchte mich an einem liebreizenden Lächeln. »Für mich? Bitte?«
Henrietta zögerte, schwankte. Dann sanken ihre Schultern ein Stück zusammen. »Nein«, sagte sie leise. »Nur den einen Teil. Der andere geht nicht.«
Ich ließ mich wieder auf den Sessel ihr gegenüber fallen, die Finger fest um die kleine Schachtel gekrallt. Ich konnte sie verstehen, irgendwie. Die Enttäuschung fraß sich dennoch durch meinen Bauch. Ohne Henrietta würde ich auf andere Mittel und Wege zurückgreifen müssen, kompliziertere Wege. Es hieß, mehr Dienstboten bestechen, ein paar, um die Botschaft aus dem Haus und zum fahrenden Volk zu schleusen, und ein paar, um ebendiese zu überwachen und einzugreifen, falls sie mich verraten wollten. Wie in den Zeiten vor Henrietta. Wie in den Zeiten, die zurückkehren würden, wenn sie demnächst fort und verheiratet wäre.
»Gut«, beschloss ich, lehnte mich vor und schob ihr das Kästchen über den Tisch zu. »Dann eben nur den Teil, mit dem du einverstanden bist.«
»Wenn du meinst, dass es etwas nutzt …«
»Es ist besser als nichts.« Und den zweiten Teil würde ich anders organisieren müssen.
Henrietta nickte und ließ die Schachtel in ihrer Rocktasche verschwinden. »Ich werde sehen, dass ich noch heute Abend ins Dorf komme.«
»Danke. Du bist die Beste.« Ich schenkte ihr ein Lächeln, dann griff ich nach dem Buch, das ich vorhin aufgegeben hatte. »Also gut, Fred Semmelweiß. Zweiter Versuch.« Ich schlug den Buchdeckel auf, sammelte mich. »Erstes Kapitel.«
Ludwig musterte mich mit kritischem Blick, bevor er ins Zimmer stolzierte und den ihm folgenden Diener anwies, die Vase mit den Blumen auf den Tisch neben dem Fenster zu stellen. Ein Strauß voller üppiger blutroter Rosen. Kein sehr originelles Geschenk, wenn man bedachte, dass eine Rose das Wappen Sahrmingens war. Andererseits war das wenigstens ein Hauch Natur in diesem Raum.
»Dieser Brief war dabei.« Steif hielt er mir das zusammengefaltete Papier entgegen.
Das Siegel – ein Rabe und ein Schlüssel, vom Herzog von Marnette – war bereits gebrochen. Natürlich.
»Euer Vater lässt Euch Glückwünsche ausrichten, dass Euer Porträt so großen Anklang findet.«
Ich entfaltete den Brief und überflog ihn.
Selten etwas so Bezauberndes … selbst die Sterne … Mit dem bebenden Schlag meines Herzens versichere ich Euch …
Er klang genauso wie die drei Briefe zuvor, obwohl sie von vollkommen verschiedenen Absendern stammten. Da war der Landstreicher mit der Wassernixe schon kreativer gewesen.
»Des Weiteren wurde ein Schwarm weißer Turteltauben gebracht, von Fürst Dirque zu Nurbourg aus Linesse. Allerdings habe ich mir erlaubt, das Federvieh dort zu lassen, wo es hingehört, um Eure Gemächer nicht unnötig zu verdrecken.«