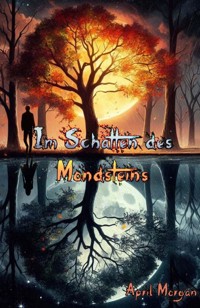Splitterkind
Zebrochene Seelen
April Morgan
Triggerwarnungen
Diese Geschichte enthält explizite Darstellungen zu folgenden Themen:
Drogenkonsum und Abhängigkeit
Körperliche und emotionale Gewalt
Sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt
Psychische Erkrankungen und Suizidgedanken
Gewalt gegen Kinder
Demütigung und Entführung
Selbstzerstörerisches Verhalten
Mord
Diese Inhalte sind sehr intensiv und emotional belastend. Sie dienen der realistischen Darstellung schwerer Lebensumstände und sollen keine Sensationslust fördern. Bei Betroffenheit oder einem negativen Eindruck wird empfohlen, die Lektüre abzubrechen und sich bei Bedarf Unterstützung durch vertraute Personen oder professionelle Hilfe zu holen.
Eine ausführlichere Auflistung und Erklärung der Inhalte findest du am Ende des Buches, da diese Hinweise Teile der Handlung spoilern können.
Vielen Dank, dass du dich getraut hast, mein Buch zu holen und einen Blick in die zerbrochenen Seelen dieser Figuren zu werfen.
Viel Spaß beim Lesen.
In Liebe
April
Vorwort
Splitterkind – zerbrochene Seelen erzählt keine einfache Geschichte. Die Seiten dieses Romans führen tief hinab in die Tiefen menschlicher Erfahrung, in eine Welt aus Schmerz, Verlorenheit und brüchiger Hoffnung. Die Themen sind schwer, düster und manchmal kaum zu ertragen, vielleicht gerade deshalb, weil sie oft unausgesprochen bleiben.
Dieses Buch enthält intensive Darstellungen von Drogenkonsum und Abhängigkeit, körperlicher und emotionaler Gewalt, sexuellen Übergriffen, psychischen Erkrankungen, Suizidgedanken, Gewalt gegen Kinder, Demütigung, Entführung, selbstzerstörerischem Verhalten und Mord. Wenn dich diese Themen belasten oder triggern, überlege bitte sorgfältig, ob du die Geschichte lesen möchtest. Unterstützung findest du bei Beratungsstellen oder im Gespräch mit vertrauten Menschen.
Splitterkind – zerbrochene Seelen ist eine Einladung, den Blick nicht abzuwenden. Es geht um den Versuch, Verständnis, Hoffnung und Mitgefühl selbst dort zu finden, wo alles verloren scheint.
Prolog
Der Trailerpark erstickt in einer Hitze, die wie fauliges Fleisch an den Wänden klebt. Der Gestank vergessener Leben liegt in der Luft, süßlich und scharf, als würde er die Haut von innen zerfressen. Tammy sitzt reglos da, ein zerbrochenes Fragment in einem Käfig aus Schweigen und Vergessen. Ihre Augen sind leer, doch in dieser Leere schreit eine Seele, zerschunden und wund, bis auf den letzten Rest Hoffnung ausgeblutet.
Bo ist da. Er ist immer da. Sein Griff ist unbarmherzig, seine Verachtung kalt wie rostige Nägel, die sich wie Dornen in die Haut bohren. Er lehnt im Türrahmen, eine Zigarette zwischen den Fingern, als gehöre ihm die Luft, die sie atmet. Seine Anwesenheit ist ein Schatten, der jedes Licht verschlingt, ein Gewicht auf der Brust, das jeden Atemzug bestraft, als wäre sie seiner nicht würdig. Und dort, inmitten der Schwärze, glühen eisblaue Augen. Kalt. Wachsam. Ein Blick, der sie durchschneidet, als würde er jeden Riss in ihr zählen. Nicht freundlich, nicht rettend, aber sie kann nicht wegsehen.
Ein Hauch von Zedernholz wirbelt durch die stickige Luft, Erinnerung oder Vorbote, süß und tödlich zugleich. Die Stille zieht sich zusammen wie eine Kette um ihren Hals und erstickt jede Hoffnung im Keim. Dies ist keine Geschichte von Rettung. Es ist der Anfang eines Überlebens, das mehr Schmerz als Leben kennt.
Kapitel 1
„Los, Süße, schwing deinen Arsch hierher!“, brüllt Bo lachend aus dem Nebenzimmer. Sein Lachen ist kein harmloses Kichern, sondern ein widerliches Grunzen, das an das röchelnde Geheul eines Schweins erinnert und mir eine Gänsehaut über den Körper jagt. Ich weiß genau, was er von mir will.
Er sitzt dort, zufrieden in seinem schmierigen Sessel, seinem Thron, umgeben von seinen ekelhaften Freunden, die nur darauf warten, dass ich ihnen das Bier bringe und zwar sofort. Jede Sekunde des Zögerns wäre in seinen Augen eine Beleidigung, eine Herausforderung, die er brutal bestrafen würde.
Mit zitternden Fingern öffne ich den Kühlschrank. Ein Schwall kalter, abgestandener Luft schlägt mir entgegen, als wolle er mich daran erinnern, wie wenig ich hier zähle. Die Dosen in meiner Hand sind schwer, das leise Aneinanderstoßen des Metalls hallt in meinen Ohren wie das Echo meiner eigenen Demütigung.
Ich zwinge mich zu einem falschen Lächeln, einer Maske, die weich und hilflos wirkt, obwohl mein Herz in viele kleine Stücke zerbricht. Genau das erwartet Bo von mir: ein freundliches Gesicht, immer verfügbar, immer bereit zu dienen, egal wie sehr jede Begegnung mich zerreißt.
Die Küche ist ein Drecksloch. Fettflecken kleben an den Oberflächen wie narbige Wunden, verkrustete Essensreste gammeln in den Ecken, und ein modriger Gestank wabert durch den Raum, frisst sich in jede Faser und lässt sich nicht mehr vertreiben. Der restliche Trailer ist nur ein Spiegel dieses Elends, nicht besser, eher schlimmer. Alles ein einziger Abgrund aus Verkommenheit und Verfall.
Dieses Leben verabscheue ich bis ins Mark, und doch klebt es an mir wie eine zweite Haut, die ich nicht abstreifen kann. Hier geboren, im Abschaum eines der vielen vergessenen Trailerparks, fühlt es sich an, als wäre mein Schicksal längst besiegelt, als hätte jemand mein Buch geschrieben, bevor ich meine Geschichte überhaupt kannte. Kein Happy End wartet hier auf jemanden. Wir alle sind vom System vergessen, ausgespuckt, verloren. Kein Ausweg, kein Lichtstrahl, nicht einmal ein flüchtiger Traum von einem anderen Leben, an den ich mich klammern könnte.
Manchmal stehe ich vor dem Spiegel, mit Bos entsicherter Waffe an der Schläfe, ein Lächeln im Gesicht, bereit, dem Elend ein Ende zu setzen. Doch der letzte Funke Mut, den Abzug wirklich durchzuziehen, fehlt mir. Also bleibe ich in diesem dunklen Kreis gefangen, der mich verschlingt.
Vielleicht sollte ich vor meinem Ende noch Bo und seine Freunde überraschen, nicht mit Bier, sondern mit einer geladenen Waffe in der Hand. Ich sehe mich, wie ich die Tür aufreiße, das falsche, glatte Grinsen im Gesicht, nur dass es diesmal echt sein wird, genährt von einem Entschluss, der nicht mehr wankt. Bereit, diesen Trailer und alle in ihm dem Erdboden gleichzumachen. Ein Schuss nach dem anderen, bis nur noch tödliche Stille bleibt. Es wäre kein Verlust für diese Welt, keinen Funken Trauer wert. Aber wer sollte auch schon um uns trauern?
Wir sind nichts weiter als Kakerlaken, Überlebenskünstler am Rand der Gesellschaft, unsichtbar und verachtet, die von einem Ort zum nächsten kriechen. Ungeziefer, das sich durch die Ritzen frisst und nimmt, was es kriegen kann, ohne Skrupel und ohne Aussicht auf Erlösung.
Keiner würde uns vermissen. Keine leisen Stimmen an unserem Grab, kein ehrendes Wort für das, was wir einmal hätten sein können, wir sind gefallene Seelen im Staub der Welt, längst verloren zwischen den Fugen eines Systems, das uns nie eine Chance gegeben hat.
Das Schwein brüllt jetzt noch lauter, seine Stimme schneidet gereizt und voller Ungeduld durch die Luft: „Was ist los, Schlampe? Soll ich’s dir abnehmen und das Bier selbst holen?“ Die Worte treffen mich wie eine Faust, reißen mir den Boden unter den Füßen weg. Ein Beben fährt durch meinen Körper, mein Herz stolpert gegen die Brust. Für einen kurzen Moment flackert der Gedanke auf, nach der Waffe zu greifen, aber wie so oft bleibt es nur ein Gedanke. Stattdessen klammere ich mich an die Dosen wie an den letzten dünnen Faden, der mich noch am Leben hält. Mit gesenktem Blick und eingezogenen Schultern gehe ich durch den Raum, äußerlich ergeben, während in mir ein Krieg tobt.
Bo starrt mich mit glasigen, vom Alkohol vernebelten Augen an. „Wird ja auch Zeit! Musstest du erst ’ne Tankstelle ausrauben, oder was hat so lange gedauert?“ Seine Worte tropfen vor Verachtung, wie Gift, das langsam in meine Haut sickert. Ich schlucke die Angst hinunter, die wie ein Stein in meiner Brust liegt. Ihn jetzt zu reizen, wäre ein Fehler, das weiß jeder Muskel, jede Narbe, jeder frische Bluterguss an meinem Körper.
„Tut mir leid, Bo, ich … ich …“ Mehr bringt mein zittriger Mund nicht hervor. Sein lautes, dreckiges Gackern spritzt Spucke durch den Raum, ein abscheuliches Sinnbild seiner Macht. Die anderen stimmen ein, johlend und feixend wie ein Rudel ausgehungerter Hunde.
„Dummes Weib! Schon zu blöd zum Reden?“ höhnt er. Meine Hände schlottern als ich die Bierdosen verteile. Jede Faser in mir schreit, sich zu verweigern, doch ich bewege mich wie ferngesteuert, erstarrt in der Rolle, die er mir aufgezwungen hat.
Ich versuche, mich wortlos zu verdrücken, so unsichtbar wie möglich zu werden, doch Bo packt mich mit brutaler Kraft am Arm und zerrt mich auf seinen Schoß. Sein beißender Schweißgeruch schlägt mir wie eine Welle entgegen, ein Gestank, der mir die Kehle zuschnürt; den Brechreiz kann ich gerade noch herunterwürgen.
Seine Hände sind grob, graben sich in meine Brust, als wollten sie Spuren hinterlassen, die nie wieder verblassen. Die Erniedrigung ist kalt kalkuliert, ein Schauspiel vor den gierigen Augen seiner Freunde, die lachen und spotten wie sein persönliches Hofgefolge, berauscht von seiner Herrschaft.
Ich spüre Jimmys Blick auf mir, gierig, feucht, sabbernd. „Bo, für’n Fuffi würd ich sie mir auch gern mal ausleihen, wenn du teilst“, krächzt er. Die Hände an meinem Körper werden fester, schmerzhafter, als wollten sie den letzten Rest Würde aus mir pressen. Ich will schreien, doch meine Stimme bleibt irgendwo tief in meiner Kehle stecken, erstickt von Angst und Verzweiflung.
Bo zuckt die Schultern und lacht, diesmal kalt und hohl. „Mal schauen. Wenn sie weiterhin so nutzlos ist, zieh ich das vielleicht wirklich in Betracht.“ Kein Scherz in seiner Stimme, keine Ironie, nur bitterer Ernst, ein makabrer Deal, über den ich keine Kontrolle habe. Tränen steigen mir in die Augen, die Gesichter verschwimmen zu einem einzigen Albtraum.
„Verpiss dich. Und komm mir heute nicht noch mal unter die Augen. Baller dir was hinter die Birne, wie du’s immer tust.“
Mehr brauche ich nicht zu hören. Ohne mich umzublicken, stolpere ich aus dem Raum, renne in das kleine Schlafzimmer und lasse die Tür ins Schloss fallen, verriegeln tue ich sie nicht. Wozu auch? Sie würde niemanden draußen halten. Sie ist nicht mehr wert als ein Stück Pappe.
Ich sinke schwer auf den abgewetzten Stuhl vor meinem alten Schminktisch. Im blassen Licht blickt mir eine Fremde entgegen, die traurige Hülle dessen, was aus mir geworden ist. Leblose, graue Augen, ein Gesicht, das mehr Jahre trägt, als es gelebt hat. Mein aschblondes Haar fällt strähnig über eingefallene Wangen; die Haut wirkt wie Pergament, durchzogen von bläulichen Adern und Narben, stumme Zeugen der Nächte, in denen jedes Geräusch eine potenzielle Gefahr war.
Überall zeichnen sich die knöchernen Konturen meines Körpers ab, als wolle mein Leib die letzten Reste von mir nach außen kehren. Ein Leben, gezeichnet von Drogen, Alkohol, Gewalt, und der Schuld, die in mir brennt wie ein unauslöschliches Brandmal.
Vielleicht verdiene ich diesen trostlosen Ort, all die Schmerzen und Verluste, die mich festhalten. Seit dem Tod meines Vaters trage ich die Schuld wie eine zweite Haut. Seit jenem Moment, als meine Mutter mit ihm in den Abgrund stürzte, und nie zurückkam.
Es ist nicht so, dass ich um meinen Vater trauere. Er war ein widerliches Arschloch, einer von denen, die Schmerz und Enttäuschung wie Souvenirs sammeln. Doch als er verschwand, wurde alles nur schlimmer. Das letzte Fitzelchen Fürsorge in meiner Mutter starb an diesem Tag, und ich war der Welt schutzlos ausgeliefert. Mit sechzehn jagte sie mich aus dem Haus, als wäre ich ein nutzloses Möbelstück.
Ich habe keinen Abschluss, keine Perspektive. Jeder schäbige Hilfsjob endete in Entlassung, als würde das Leben selbst mich abweisen. Als Bo mich aufnahm, war ich zu jung und zu naiv, um die Lügen hinter seinen vermeintlich schützenden Worten zu erkennen. Neun Jahre älter war er. Er versprach mir Rettung, ein Zuhause, das ich nie gehabt hatte. Für einen Moment fühlte ich mich bei ihm sicher, doch das war nur eine dünne Schicht Fassadenfarbe auf verrottetem Holz.
Bo ist nicht besser als die anderen. Ein Mistkerl, der mich ausnutzt und von seinen dunklen Geschäften abhängig macht. Er zwingt mich zu stehlen, zu erpressen, alles zu tun, was seinen kriminellen Machenschaften dient. Am Ende ist er nichts weiter als ein Verlierer, der Drogen verkauft und sich von einem zwielichtigen Deal zum nächsten hangelt.
Oft wünsche ich mir, er würde bei einem seiner „Deals“ endlich von der Polizei erwischt werden, oder besser noch, gleich erschossen. Doch was würde dann aus mir werden? Die Hoffnung auf ein besseres Leben ist längst verflogen. Es kommt kein weißer Ritter, der mich in den Sonnenuntergang entführt. Ich würde nur beim nächsten Bo oder Jimmy landen; neue Hände, neues Elend, andere Narben.
Vielleicht ist es besser, einfach hierzubleiben. Und sollte Bo wirklich beschließen, mich zu verkaufen, bleibt mir immer noch die Option, mit der Waffe alles zu beenden, ihn, Jimmy und mich selbst.
Eine einsame Träne bahnt sich ihren Weg über mein Gesicht, brennt heiß auf kalter Haut. Ich bin müde vom Warten auf Hoffnung, müde vom Kämpfen. Müde von diesem sinnlosen Leben. Vorsichtig greife ich nach der kleinen metallenen Schatulle, mein letzter Trost. Alles, was ich noch will, ist, nichts mehr zu fühlen und an nichts mehr zu denken. Mit geübten Griffen bereite ich meinen Schlupf ins Nirgendwo vor. Ich koche den kleinen braunen Klumpen mit etwas Flüssigkeit, in der Kuhle des alten Löffels auf, sehe zu, wie er sich in der Hitze löst und im matten Licht golden schimmert. Die Spritze saugt den Glanz auf – flüssiger Weg zur Erlösung. Gurt und Spritze nehme ich mit zum Bett, setze mich, schnüre mir die Adern ab. Die Haut in der Armbeuge ist vernarbt, genauso wie mein Inneres. Ich führe die Nadel unter das Schlachtfeld, ein kurzer, brennender Schmerz, ein Preis, den ich gerne zahle für das, was kommt. Beim Zurückziehen erscheint ein einzelner Tropfen Blut, das Zeichen, dass ich richtig getroffen habe. Ein tiefer Atemzug. Dann drücke ich den Inhalt in die Vene, alles auf einmal … Spüren … Verschwinden … Vergessen …
Das Werkzeug fällt klirrend zu Boden, der Gurt rutscht von meinem Arm. Gerade noch schaffe ich es, den alten, zerschlissenen Teddy an mich zu ziehen, meine letzte Heimat, die Restwärme einer Welt, die längst vergangen ist. Neben ihm treibe ich ab, sinke in die warme, betäubte Dunkelheit, eine Welt, in der alles in Ordnung ist. Keine Angst, keine Scham, kein Schmerz, nur Geborgenheit, die sich wie eine schützende Wolke um mich legt. Ich wünschte mir, ich müsste diesen Zustand nie wieder verlassen. Nie mehr aufwachen. Nie mehr kämpfen. Alles fühlt sich plötzlich so leicht an, wie ein sanfter Hauch, der mich umgibt. Mit einem leisen, zufriedenen Schnaufen ziehe ich meinen Teddy noch näher an mich und lasse mich in die Tiefe treiben, die sich anfühlt wie ein gestohlenes Stück vom Himmel, flüchtig, betrügerisch, aber im Moment alles, was ich noch habe.
Kapitel 2
Ein Mädchen steht im Wohnzimmer, doch alles ist anders als sonst. Sein Vater liegt in einer Pfütze aus Blut. Das dunkle Rot glänzt schmutzig im schwachen Licht, spiegelt jeden Strahl auf groteske Weise. Sein Kopf ist kaum noch als solcher erkennbar, überzogen von der klebrigen Flüssigkeit, die die Luft mit dem stechenden Geruch von Eisen füllt; die vertraute Form ist zu etwas Fremdem verzerrt.
Neben ihm kniet ihre Mutter auf dem früher beigen, nun blutgetränkten Teppich. Sie hält seine schlaffe Hand und schreit ihren Schmerz in den Raum. Als ihr Blick auf das Mädchen fällt, ist darin nichts Mütterliches mehr. In ihren Augen lodert nur noch kalter, gnadenloser Hass, wie ein eisiges Feuer. „Was hast du getan? Was hast du getan?“ Ihre Lippen zittern, das vom Weinen entzündete Gesicht ist übersät mit Tränen und Rotz.
Das Mädchen will zu ihr gehen, sie in die Arme schließen, sie trösten. Doch zwischen ihnen steht eine unsichtbare Mauer, so dicht, dass ein einziger Schritt zu viel, die Furie in der Mutter entfesseln würde. Vor ihren Augen entfaltet sich eine Szene, die eines Horrorfilms würdig ist, starr vor Schmerz, dunkel vor Verzweiflung.
Draußen zerreißen Sirenen die Stille. Das Mädchen hält den kleinen weißen Teddy fest umklammert, dessen schwarze Knopfaugen leer in diese zerbrochene Welt blicken. Er ist ihr einziger Schutz, ihr letzter Anker in einer Realität, die vor ihren Augen auseinanderfällt.
Kapitel 3
Als ich aufwache, liege ich nahezu noch genauso da wie gestern Abend, den Teddy fest an mich gedrückt, als könnte er mich vor dieser Welt beschützen. Erleichtert stelle ich fest, dass Bo nicht neben mir liegt. Entweder ist er noch mit den anderen unterwegs oder auf der Couch eingeschlafen, vielleicht in seinem eigenen Erbrochenen. Es ist mir egal, wo er ist, Hauptsache, nicht hier bei mir. Zu oft wache ich auf und merke, dass mein Slip heruntergerutscht ist, weil er sich in seinem Rausch an mir vergriffen hat.
Erschöpft und mit schmerzenden Muskeln richte ich mich auf. Ich wiederhole die Prozedur vom Abend, nur mit weniger Stoff, um nicht sofort wieder in den Dämmerschlaf zu kippen, nur genügend, um den aufkommenden Drang zu stillen. Ich bürste meine Haare und gehe, sobald meine Beine mich tragen, in die Küche, um Kaffee aufzusetzen.
Im Wohnzimmer kauert Bo im gleichen Sessel wie am Vorabend und schnarcht laut. Die anderen sind weg. Ich bewege mich wie auf Eierschalen, will ihn nicht wecken und hoffe auf ein paar Minuten Ruhe. Die herumliegenden Dosen sammle ich ein und werfe sie in den Müll, obwohl ich sie genauso gut liegenlassen könnte. Hier gleicht sowieso alles einer Müllhalde.
Die Küche ist alt, mit Eichenholz vertäfelt, doch ihre besten Jahre hat sie längst hinter sich, falls dieser Trailer überhaupt jemals bessere Tage gesehen hat. Ich nehme den Kaffee und gehe auf die Veranda, um die warmen Sonnenstrahlen des Frühlingmorgens zu genießen. Bald wird es wieder unerträglich heiß, und eine Klimaanlage haben wir nicht.
Rings um unseren Trailer stehen weitere, in denen Menschen leben wie wir, zerstört, zerrüttet, abgestumpft. Deshalb interessiert es hier niemanden, wenn Bo seinen Frust an mir auslässt. Die unausgesprochene Regel lautet: Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür; alle haben genügend Dreck und Ballast, um sich nicht auch noch in fremde Geschichten einzumischen.
Als ich vor acht Jahren hierherkam, kam mir das alles erschreckend normal vor, weil ich nichts anderes kannte. Heute kenne ich zwar immer noch nichts anderes, aber ich weiß, dass es nicht normal sein sollte.
Damals sah Bo noch gut aus, mit seinen wilden braunen Haaren und den dunklen, mandelförmigen Augen. Ich kannte ihn schon vorher, jeder kannte ihn, und die Mädels schwärmten für ihn. Mädels, keine Frauen, eine richtige Frau hätte sich mit so einem Typen nicht abgegeben. Wir saßen oft bei ihm, tranken Bier, rauchten Gras. Für uns war er der Inbegriff von Coolness, ein Hauch von Freiheit, eine Ausnahme unter den Erwachsenen, lockerer, lustiger, gefährlicher.
Als meine Mutter mich hinauswarf, wusste ich nicht, wohin. Also stand ich eines Tages vor seiner Tür. Seitdem bin ich geblieben.
Heute ist von dem rebellisch, schönen Jungen nichts mehr übrig. Bo ist ein widerlicher Typ mit Bierbauch und lichten Haaren. Schon damals hat er sich an Minderjährige rangemacht, ich war ein leichtes Opfer. Ich lief ihm in die Arme, und er formte mich zu seinem persönlichen Ding. Es blieb nicht beim Gras. Bald kamen härtere Drogen, dann Heroin und danach gab es kein Entkommen mehr.
Ich bin zerbrochen, in viele kleine Stücke zersplittert. Überall ziehen sich Risse durch mich. Wenn ich einen Ausweg wüsste, würde ich ihn gehen. Doch Menschen wie ich bekommen keine Chance.
Als Poltern von drinnen nach draußen dringt, fahre ich hoch und gehe hinein.
Bo steht schnaufend in der Küche. „Wir haben kein Bier mehr. Hol was.“ Keine Bitte, keine Frage, ein Befehl, wie alles, was von ihm kommt.
Ich nicke, gehe zur Keksdose und ziehe einen Schein heraus.
„Bring noch ’nen Whiskey mit“, krächzt er. Ich starre auf das Geld in meiner Hand. Es ist nicht genug.
„Ich glaube, das Geld reicht nicht.“
Patsch! Mein Kopf wird von der Wucht seines Schlages zur Seite geschleudert.„Du nutzloses Stück Scheiße! Wofür bist du eigentlich noch hier? Du kostest nur Geld und siehst aus wie eine Straßenhure. Du ekelst mich an! Komm mit der Flasche, ansonsten rufe ich heute noch Jimmy an, dann haben wir ausreichend Geld für Whiskey.“
Sein Gewaltausbruch sollte mich eigentlich schockieren, doch das tut er schon lange nicht mehr. Vielleicht hat er recht und ich bin genau das. Wenn ich mich ansehe, sehe ich auch nichts anderes. Nickend presse ich die Hand gegen die brennende Wange und zwinge mich, keine Träne zu zeigen, sie würden ihn nur noch aggressiver machen. Vorsichtig schlüpfe ich in eine dünne Jacke und verlasse den Trailer.
Der Weg ist nicht weit, vielleicht dreißig Minuten zu Fuß. Ich hoffe, er hat sich beruhigt, bis ich zurück bin, auch wenn das ohne Alkohol kaum vorstellbar ist. Wie gerne würde ich einfach in den nächsten Bus steigen und verschwinden. Aber mit dem wenigen Geld komme ich kaum aus der Stadt. Am Ende würde ich doch zurückkehren, mit leeren Händen, ohne Hoffnung. Und das, was dann auf mich wartet, wäre nur noch schlimmer.
Im Supermarkt schnappe ich mir ein paar Dosen Bier und stelle mich an die Kasse. Dort steht Earl.
„Hallo, Earl“, sage ich leise.
Er lächelt freundlich, ein älterer Mann, der mich immer respektvoll behandelt hat. Ich habe einmal für ihn gearbeitet; er war einer meiner besten Chefs. Doch Bo überredete mich, immer wieder etwas mitgehen zu lassen, bis ich schließlich entlassen wurde. Earl war nicht einmal wütend, als er es herausfand. Er hatte Mitleid. „Ich mache das ungern“, sagte er damals, „aber ich kann nicht dulden, dass meine Mitarbeiter mich bestehlen. Ich habe selbst Rechnungen zu bezahlen.“
Bis heute bekomme ich einen Kloß im Hals, wenn ich den Laden betrete und ihn sehe. Mir bleibt jedoch kaum eine Wahl, in den meisten anderen Supermärkten habe ich mittlerweile Hausverbot, und die übrigen sind zu weit weg.
„Hallo, Tammy. War’s das?“, fragt er in seinem gewohnt freundlichen Ton und reißt mich aus den Gedanken.
„Kann ich eine Flasche Whiskey anschreiben lassen?“, frage ich flehend. Ich will nicht mehr stehlen, nicht bei ihm, nicht hier.
Er atmet tief ein und schaut mich mit diesem vertrauten, mitleidigen Blick an.
„Tammy, ich kann nicht. Ihr schuldet mir noch etwas von letztem Monat. Ich kann euch nicht immer etwas anschreiben lassen.“
Ich schlucke schwer, will nichts erbetteln. Er war ohnehin immer zu nachsichtig mit uns. Also nicke ich nur, gebe ihm das restliche Geld und verstaue die Biere in einer Tüte. Earl legt mir noch einen Schokoriegel dazu.
„Kindchen, du bist viel zu dünn. Iss das“, sagt er ruhig, mit fürsorglicher Miene.„Zahl die offene Rechnung, und dann schauen wir weiter.“
Die Harmlosigkeit seiner Worte trifft mich trotzdem, diese Freundlichkeit wirkt wie ein Fremdkörper in meinem zerbrochenen Leben. „Danke“, flüstere ich, bevor ich den Supermarkt verlasse, ohne ihn noch einmal anzusehen.
Vor dem Laden setze ich mich auf eine alte Steinmauer. Ohne den Fusel kann ich nicht zurück nach Hause. Nicht weit von hier ist eine Tankstelle; vielleicht sollte ich einfach eine Flasche mitgehenlassen und hoffen, nicht erwischt zu werden. Oder ich rufe Jimmy direkt selbst an, um an Geld zu kommen. Die Gedanken drehen sich im Kreis. Alles fühlt sich wie ein weiterer Schritt in den Abgrund an.
Ich stehe auf, lasse die Tüte an der Mauer liegen und gehe zum Straßenrand. Ein viel zu schnell fahrender LKW rast auf mich zu. Nur ein Schritt, einmal nach vorn kippen, dann ist alles vorbei. Mein Herz rast, die Gedanken wirbeln. Ich schließe die Augen, atme tief ein und langsam aus. Das dumpfe Dröhnen des Motors wird lauter, die endgültige Entscheidung liegt in der Luft. Mein Bein hebt sich, ein letzter Schritt, die Befreiung zum Greifen nah.
Doch bevor ich meinen Entschluss in die Tat umsetzen kann, packt mich etwas. Zerrt mich zurück, reißt mich aus der Starre. Das aggressive Hupen des LKW zerreißt meine Trance, schleudert mich ins kalte Hier und Jetzt. In mir steigt ein Gefühl des Versagens auf, weil ich es wieder nicht geschafft habe. Adrenalin schießt durch meine Adern, wild und unkontrolliert. Mit geweiteten Augen drehe ich mich um, vor mir eine schwarze Wand, umgeben von einem Geruch nach Zedernholz. Helle, eisblaue Augen blicken ruhig durch dunkle Strähnen.
Mit der einen Hand hält er meinen Arm, in der anderen eine Tüte. Seine Lippen bewegen sich, doch seine Worte dringen kaum zu mir durch; das Rauschen des Blutes in meinen Ohren übertönt alles. Der Moment ist vorbei, übrig bleiben nur nackte Angst, ein Hauch von Wut auf den Fremden, der mich meiner Entscheidung beraubt hat, ein Nebel, der meine Sinne umhüllt.
„Hörst du mich? Du hast deine Tüte stehen lassen.“
Erst jetzt reiße ich mich aus der Hypnose, schüttle wie benommen den Kopf und nicke dann langsam. „Ja, ja, ähm …“, stottere ich.
„Deine Tüte stand noch da. Du hast sie beinahe vergessen. Gut, dass mir das aufgefallen ist, du hast wohl auch den LKW übersehen.“ Seine tiefe, melodische Stimme schneidet durch das Rauschen in meinem Kopf. Erneut nicke ich, als hätten mich alle Sinne verlassen.
„Ja, ähm … danke. Ich habe wohl einen Moment nicht aufgepasst.“
Er reicht mir die Tüte, sein Blick ist finster. „Scheint so“, kommt es schroff von ihm.
„Soll ich dich irgendwo hinbringen?“, fragt er, etwas weicher.
Ich schüttle hektisch den Kopf. Wenn mich jemand nach Hause bringt, bricht dort die Hölle los.„Nein, schon gut. Danke. Ich … ich muss jetzt gehen.“
Er lässt meinen Arm los, doch ich spüre seine Hand noch, als hätte sie sich in meine Haut eingebrannt. Unter dem Shirt zucken seine Muskeln, als er den Arm zurückzieht, fast, als täte er es widerwillig. Wahrscheinlich hat er Angst, ich würde vor das nächste Fahrzeug laufen. Ob er wirklich glaubt, dass ich nur aus Versehen auf die Straße geraten bin?
„Pass auf dich auf“, sagt er noch, bevor er sich umdreht und in seinen schwarzen Pick-up steigt.
Ich bin zu perplex, um zu reagieren. Beinahe wäre ich in einen LKW gelaufen, hätte mich hier vor Earls Supermarkt einfach umgebracht. Eine kleine Randnotiz in der morgigen Zeitung: „Drogenabhängige im Rausch vor LKW gelaufen.“ Und Bos Bier hätte daneben gestanden, einsam an der Mauer in der vergessenen Tüte gelehnt, eine kleine Genugtuung wäre es, dass er nicht genug Geld gehabt hätte, sich Neues zu kaufen.
Der Gedanke an den Beinahe-Aufprall lässt mich frösteln. Ich gehe direkt nach Hause. Erst unterwegs merke ich, dass ich die Flasche noch gar nicht besorgt habe, aber ich bin zu müde und leer, um noch einmal loszugehen. Soll Bo doch Jimmy anrufen. Mir ist alles egal, ich will nur noch ins Bett.
Drinnen angekommen, reißt er mir die Tüte aus der Hand. Ich setze gerade an, ihm zu sagen, dass ich seinem Wunsch nicht nachgekommen bin, als er eine Flasche Whiskey und mehrere Bierdosen herauszieht. Den Schokoriegel steckt er sich als Erstes in den Mund.
„Bist ja doch nicht ganz so nutzlos. Nun geh mir aus den Augen“, schmatzt er.
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen und verschwinde im Schlafzimmer. Wie ist die Flasche in die Tüte gekommen? Hat Earl mir doch noch eine hineingelegt? Es muss so sein, wie sonst hätte sie wie durch Zauberhand dort landen können? Ich bekomme das Rätsel nicht gelöst.
Stattdessen gehe ich zu meiner Metallschatulle und bereite alles vor, bereit für die nächste Flucht und das bisschen Ruhe, das ich habe, solange Bo an der Flasche hängt. Mit einer trügerischen Zufriedenheit, die durch meine Adern strömt, lege ich mich ins Bett, ziehe den Teddy fest an mich und drifte davon.
Kapitel 4
Meine Kopfhaut brennt wie Feuer, als er an meinen Haaren reißt und mich aus dem Bett zerrt. Bo flucht ununterbrochen, ist völlig außer Kontrolle. Er schleppt mich in die Küche und schleudert mich auf den dreckigen Boden. Ich rutsche rückwärts, bis mein Rücken gegen einen der Schränke stößt, während er wieder ins Schlafzimmer verschwindet.
Wenig später kommt er zurück, mit meinem Teddy in der Hand. Er wirft ihn ins Spülbecken. Es dauert einen Moment, bis mein Gehirn nachkommt, bis ich begreife, dass das kein Traum ist. Mein Herz rast, meine Atmung überschlägt sich, ich presse mich so dicht wie möglich an den Schrank.
Dann steht er wieder vor mir, mit einer Flasche Spiritus und einem Feuerzeug. Mit einem kalten, barbarisches Lächeln kippt er den Spiritus über den Teddy und zündet ihn an. Erst jetzt trifft mich die Erkenntnis: Er wird ihn verbrennen.
Wild kreischend springe ich auf, will nach vorn stürzen, um das Letzte zu retten, was mir geblieben ist. Doch er reißt mich zurück. Mein verzweifeltes Schlagen und Treten prallt an ihm ab. Er ist geübt, ein Kämpfer, der genau weiß, wie er dominieren muss und beweist es mir, als er auf mich einprügelt wie auf einen abgenutzten Boxsack.
Ein Schrei zerreißt mir die Kehle. Der beißende Geruch von verbranntem Plastik hängt in der Luft. Mein Teddy, das zerfetzte Ohr, die geflickten Nähte, die Knopfaugen, verglimmt langsam zu nichts. Er tötet den letzten Teil von mir, der noch ich selbst war.
„Wo hast du sie hingetan?“, brüllt er über meine Schreie hinweg. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Ein Tritt trifft mich, presst mir die Luft aus der Lunge, schickt eine Welle brennenden Schmerzes durch meinen Körper, als würde heißes Öl in mir explodieren. Beim nächsten Schlag spucke ich Galle; sie brennt mir die Speiseröhre hinauf und klatscht auf den Boden.
Mit letzter Kraft versuche ich zu kriechen, doch er packt mein Bein, zerrt mich zurück und schlägt mir mit der Faust ins Gesicht. Sofort schießt Blut aus meiner Nase, vermischt sich mit den Tränen auf meinen Wangen.
„Ich sollte dich auf der Stelle totprügeln!“, brüllt er. „Du bist so nutzlos. Ich hätte damals einfach die Tür zuschlagen sollen, als du da standest.“ In seiner Stimme liegt purer Hass.
Beschwichtigend hebe ich die Hände, entschuldige mich immer wieder, ohne zu wissen, wofür. Wahrscheinlich hat er im Suff wieder etwas verlegt und ist überzeugt, ich hätte es versteckt oder weggenommen. Immer das gleiche Spiel, immer der gleiche Ablauf.
Er schnappt sich eine Kaffeetasse und schleudert sie in meine Richtung. Hinter mir zerschellt sie an der Schranktür, ein Schauer aus Splittern regnet zu Boden. Die Tasse bricht in tausend Teile, so wie ich längst in tausend Teile zerbrochen bin. Wie etwas, das man nicht repariert, nur noch wegwirft.
Vielleicht wäre es das Beste, wenn er weitermacht, bis alles vorbei ist. Vielleicht sollte ich ihn provozieren, einmal für mich einstehen, aber ich tue es nicht. Der Feigling wie immer. Ich sitze in den Scherben, in den Scherben meines Lebens, weine wie ein Kind und entschuldige mich immer und immer wieder. Tief in mir hoffe ich nur, dass er endlich aufhört.
Nachdem er noch eine Weile Beleidigungen auf mich niederprasseln lässt, verlässt er den Raum und lässt mich zurück, ausgebrannt, geschunden. Trotz der scharfen Splitter lasse ich mich ganz auf den Boden sinken, ignoriere die Schnitte, die sie in meine Haut reißen. Was machen ein paar neue Narben schon aus? Nur weitere Risse in einer ohnehin zerbrochenen Hülle.
Kapitel 5
Es ist mitten in der Nacht, als ich zitternd und schweißgebadet auf dem kalten Küchenboden aufwache. Das laute Schnarchen aus dem Nebenzimmer schenkt mir für einen Moment vermeintliche Sicherheit. Vorsichtig, um keine neuen Schnitte zu riskieren, drücke ich mich an der Kante des alten Küchenschranks hoch.
Obwohl ich nichts lieber täte, als wieder wegzudämmern, greife ich nach Kehrblech und Besen und fege die Scherben der zerbrochenen Tasse zusammen. Mein Blick fällt ins Spülbecken, und sofort schießen mir Tränen in die Augen: Das einst geliebte Stofftier ist nur noch ein verkohlter Klumpen. Ich sammle die traurigen Reste ein und trage sie mit schweren Schritten zur Mülltonne hinter dem Trailer.
Anschließend stelle ich mich unter die Dusche und lasse das rostig riechende Wasser über mich laufen, in der Hoffnung auf ein bisschen Wärme und Reinigung, wissend, dass beides hier nicht für mich gedacht ist. Danach gehe ich in mein Zimmer, werfe mir noch ein paar Schlafpillen ein und flüchte mich erneut in den trügerischen Schlaf.
Kapitel 6
Als ich aufwache, ist es beinahe Mittag. Ich fahre hoch, doch mein Körper rebelliert sofort, Kreislauf und Glieder sind schlaff und widerspenstig. Ich lausche ins Haus. Stille. Vielleicht schläft er noch. Mit Mühe rapple ich mich hoch, der Kopf noch komplett in einen dichten Nebel eingehüllt.
In der Küche liegt ein zerknüllter Zettel auf dem Tisch. Bo ist unterwegs, kommt erst in ein paar Tagen zurück. Ich soll Geld oder „irgendetwas“ besorgen, wenn ich weiter hier wohnen will. Ich zerreiße den Zettel, als könnte ich damit seine Stimme aus meinem Kopf reißen, ziehe mir Bademantel und Latschen an. Mein ganzer Körper zittert, die Nacht und der beginnende Entzug fordern ihren Tribut.