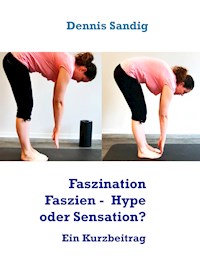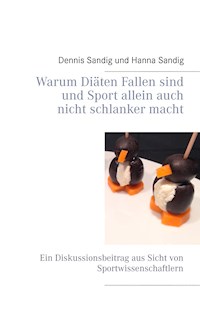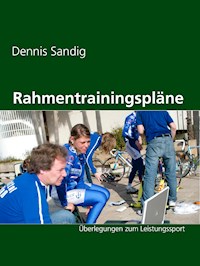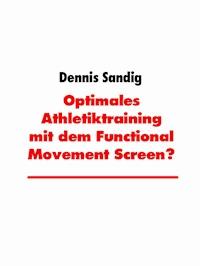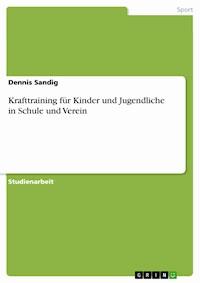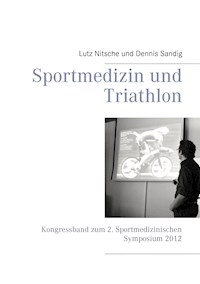
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 2012 trafen sich Experten aus Sportmedizin und Triathlon, um gemeinsam über neue Studien und Entwicklungen zu diskutieren. In diesem Kongressband werden die Studien und Diskussionsbeiträge einem breiten Publikum vorgestellt. Die Themen reichen dabei von sportpraktischen Fragestellungen bis hin zu sportmedizinischen und orthopädischen Beiträgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
Orthopädische Belastung und Beanspruchung im Radsport
Fallbeispiel
Literatur
Krafttrainingseffekte nach regenerativer Kaltwasserimmersion
Einleitung
Ermüdung und Regeneration im Trainingsprozess
Kaltwasserimmersion als regenerative Maßnahme im Sport
Methode
Ergebnisse
Diskussion
Schlussfolgerung
Literatur
Zu Entwicklungen leistungsbestimmender Funktionssysteme in der Leistungsdiagnostik von Triathleten im Mehrjahresverlauf
Trainingsqualität und -quantität als erfolgsdifferenzierende Merkmale im Triathlonnachwuchsbereich
Einleitung
Forschungslage im Triathlon
Methode
Ergebnisse
Diskussion und Schlussfolgerung
Literatur
Das Rad neu erfunden? Entwicklungen beim Krafttraining im Triathlon!
Einleitung
Die Teildisziplinen des Triathlons
Kraft und Kraftausdauer?
Langhanteltraining als zentrales Krafttrainingselement
Krafttraining als Präventionsfaktor!
Praktische Relevanz und Fazit
Literatur
Spannungsfeld „Immunsystem und Sport“
Aufgabenspektrum des Immunsystems
Problem der modernen immunologischen Forschung
Sport und Immunsystem - „die Dosis macht das Gift“
Take-home-Message
Talentsichtung im Triathlon – Ergebnisse einer sportartspezifischen Testbatterie
Einleitung und Hintergrund
Methoden und Tests
Ergebnisse
Diskussion und Ausblick
Literatur
Die Bedeutung der Kontaktzeiten im Ausdauersport
Triathlon über die Olympische Distanz mit einer Endzeit von 2.25 Stunden
AKS – die großen 3 des Ausdauersports:
Praxisbeispiele / Übungen
Übungen zum Laufen
Übungen zum Schwimmen
Übungen zum Radfahren
Muskelabbau als Folge gesteigerter Trainingsumfänge im Ausdauersport
Literatur
Vorwort der Herausgeber
Aus dem Wunsch Fragestellungen rund um den Ausdauersport mit Trainern, Physiotherapeuten und Medizinern diskutieren zu können entwickelte sich die Idee ein interdisziplinäres Forum zu etablieren, bei dem eine Plattform entsteht, bei der Referenten aus Wissenschaft und Praxis verschiedene Aspekte des Ausdauersports diskutierten. Recht schnell entstand die Idee dafür zu sorgen Praxis und Wissenschaft an einem Ort zu versammeln, um die verschiedenen Entwicklungsansätze innerhalb des Ausdauersports gemeinsam zu erörtern. Im Jahr 2011 fiel der Startschuss für das 1. Sportmedizinische Symposium, bei dem das Thema „Radsport“ die gemeinsame Überschrift für interessante Diskussionen lieferte. Die Fortsetzung 2012 erforderte ein neues Thema, aus dem Reigen der vielen spannenden Ausdauersportarten. Was lag näher als eine Sportart zu wählen, die verschiedene Facetten des Sport Treibens vereint. Triathlon erfreut sich großer Beliebtheit und bietet neben den bekannten Langstreckenrennen rund um Ironman und Challenge Serien auch viele kurze Rennen und Wettkampfstrecken. Sport- und Bewegung rücken auf der anderen Seite in den Fokus präventivmedizinischer Fragestellungen. In der Vorbereitung auf die Veranstaltung lagen einige Hindernisse auf unserem Weg, die wir glücklicherweise umschiffen konnten wie die drohende Insolvenz des Veranstaltungsortes – letztendlich gelang es jedoch eine harmonische Veranstaltung mit außerordentlichen Referaten und fruchtbaren Diskussionen. Schon jetzt freuen wir uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2013!
Lutz Nitsche und Dennis Sandig
Lutz Nitsche
Orthopädische Belastung und Beanspruchung im Radsport
Die Belastungen des Bewegungsapparates im Radsport sind äußerst vielfältig. Während die zyklische Ausdauersportart Radfahren im Triathlon eine, vor allem für den Oberkörper, eher statische Belastung ist, ist der Straßenradsports deutlich differenzierter zu betrachten. Tempo- und Sitzpositionswechsel sind wesentlich häufiger im Straßenradsport. Beim Triathlon, insbesondere auf der Langdistanz, wird meist über die gesamte Renndauer eine möglichst aerodynamische Position auf dem Aerolenker eingenommen. Im Mountainbike, v.a. im Downhill, sind die Belastungen noch einmal anders. Es kommt vor allem auf Gleichgewicht und Koordination und weniger auf die Langzeitausdauerleistungsfähigkeit an. Anders als im Triathlon und Straßenradsport ist der Mountainbike Downhill weniger eine zyklische Sportart. Die statische und koordinative Komponente überwiegt bei weitem.
Abhängig vom Streckenprofil werden im Profiradsport mittlere Wattleistungen von 220-300 Watt erreicht. Beim Zielsprint werden kurzfristig deutlich höhere Werte erzielt. Für die letzten 3 Minuten einer Etappe werden Leistungswerte im Mittel von 500-600 W beschrieben. In den letzten 5-8 Sekunden einer Straßenradsportetappe können Leistungen von 1500-1700 W von Sprintern der Weltklasse erzielt werden. Bei Bahnsprintern sind bis zu 2375 Watt beschrieben. Daten von Profisportlern beim Ironman Hawaii weisen mittlere Leistungswerte von 320 W über die 180 km auf, bei einer Fahrzeit von 4 Stunden 25.
Diese Werte aus dem Profiradsport der unterschiedlichen Disziplinen unterscheiden sich deutlich von denen der alltäglichen Rennsportpraxis im Amateur- und Nachwuchsbereich. Hierbei sind vor allem Kriterien in 90 bis zu 90 % der Rennveranstaltungen üblich. Ein Kriterium sind meist 50-70 Runden (Amateure C-Klasse) auf einem meist innerstädtischen Rundkurs mit 2-4 Kurven und einer Kurslänge von ca. 1 km. Dies bedeutet 200-250 Antritte. Diese Antritte werden mit Leistungen von 500-800 W über 3-5 Sekunden gefahren. Das im Profisport weit verbreitete Format des Straßenrennens mit Kilometerumfängen von 100-250 km, und einer deutlich geringeren Variation der Leistung, ist im Amateurbereich eine Seltenheit. Weiterhin bestehen deutliche Unterschiede darin, ob am Anfang oder am Ende eines Feld gefahren wird. Es entsteht der so genannte „Ziehharmonikaeffekt“ am Ende des Feldes. Dies bedeutet ein vermehrtes Anbremsen vor den Kurven und ein ausgeprägteres Beschleunigen nach der Kurve. An der Spitze des Feldes ist ein geringes Anbremsen und Beschleunigen im Kurvenbereich zu vermerken. Beim Anbremsen vor Kurven ist für einige Sekunden keinerlei Leistung auf dem Powermeter zu verzeichnen, während die Daten der Herzfrequenz nahezu unvermindert hoch bleiben. Diese deutlichen Unterschiede lassen sich nicht mit den Verlaufskurven der Geschwindigkeit oder der Herzfrequenz darstellen. Hierzu ist ein Leistungsmesser (Wattmesssystem) notwendig.
In der Literatur werden deutliche Unterschiede im muskulären Aktivierungsmuster von Radprofis, Triathleten und Anfängern beschrieben (4). Triathleten weisen eine deutlich größere Variation des EMG-Musters der Muskulatur der unteren Extremität auf. Unter anderen ist eine deutlich ausgeprägtere und variablere Aktivierung der Arbeitsmuskulatur zu beobachten. Dies kann als Anpassungserscheinung auf ein Training der triathletischen Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen gedeutet werden.
Radsport ist eine sehr gelenkfreundliche Sportart. Untersuchung zur Inzidenz und dem relativen Risiko einer Coxarthrose ergeben Werte von einem relativen Risiko von 0,4 im Vergleich zum Referenzkollektiv (2). Leider wurden in dieser Untersuchungen in die Kategorie Radfahren auch die Sportarten Schwimmen und Golfspielen eingeschlossen. Somit lassen sich keine differenzierten Aussagen über das alleinige Ausüben des Radsports bezüglich des Risikos Coxarthrose treffen.
Betrachtet man die Belastungen für den Bewegungsapparat so lassen sich mittels inverse Dynamik die Gelenkmomente für das Sprung-, Knie- und das Hüftgelenk ermitteln. Hierbei ist bei steigender Belastungen (75%, 90%, 100% der maximalen Leistung im Stufentest) vor allem ein steigendes Gelenkmoment für das Kniegelenk zu beobachten (2). Während Anfänger vor allem über die Muskulatur der Hüfte ihrer Leistung erbringen, sind routinierte Radsportler vor allem in der Lage die Leistung über das Kniegelenk zu absolvieren (2).
Untersuchungen von BRADBURY konnten zeigen dass allein die Sportart Radfahren nach einer endoprothetischen Versorgung des Kniegelenks verstärkt betrieben wird. Die anderen Sportarten wie zum Beispiel Golf und Tennis werden, im Vergleich zum Aktivitätsniveau vor der Operation, reduziert ausgeführt (3).
Biomechanische Modellversuche (in vitro) zeigen deutlich erhöhte Beanspruchungen für Knieprothesen beim Joggen im Vergleich zum Powerwalking und Joggen. Für das Fahrradfahren werden die niedrigsten Werte bei verscheiden Belastungen und Prothesen-/Inlayversionen ermittelt. Die Belastung lag beim Fahrradfahren unterhalb der Überbeanspruchungsgrenze der Knieprothese (3).
Mit der Methode der inversen Dynamik lassen sich Rückschlüsse auf Gelenkmomente ziehen. Hierbei werden Werte von externen Kraftsensoren (Bodendruckplatten, Pedalkraftmeßsysteme) mit den Videodaten von Hochgeschwindigkeitskameras gekoppelt. Anhand von Körpersegmentmodellen lassen sich Gelenkmomente und Winkelgeschwindigkeiten des jeweils betroffenen Gelenkes bestimmen.
Wichtig bei der Interpretation der erhobenen Werte ist jedoch dass dieses Verfahren keine Messung der Gelenkmomente, sondern eine Modelrechnung ist. Anhand von extern erhobenen Daten der distalen Gelenke (Fuß- bzw. Handgelenke) werden Rückschlüsse auf weiter proximal gelegenen Gelenke (Knie- und Hüftgelenke) gezogen. Dies ist somit keine Messung der Gelenkmomente, sondern eine rechnerische Bestimmung anhand von Modellierungen. Dem Modell liegen generalisierte Aussagen von Körpersegmentmassen zu Grunde. Besonders dicke oder dünne, bzw. kleine oder große Menschen werden evtl. nur unzureichend von diesen Modellen erfasst. Weiterhin kann der Faktor der Kokontraktion der Agonisten und Antagonisten nicht quantifiziert werden.
Betrachtet man die Tangentialkraft während das Trittzyklus so ist vor allem ein Maximum bei 90° zu verzeichnen. Für die Gelenkmomente vom Sprung-, Hüft- und Kniegelenk sind jedoch andere Muster zu beobachten. Diese variieren von Gelenk zu Gelenk stark und sind an unterschiedlichen Stellen des Trittzyklus zu verzeichnen (6)
Fallbeispiel
Ein 71 jähriger Patient stellt sich mit einer seit rund 30 Jahren bestehenden Bewegungseinschränkung des linken Kniegelenkes und progredienten Schmerzen vor. Die Vorgeschichte besteht aus einer Multiligamentverletzung des linken Kniegelenk vor 30 Jahren. Initial erfolgte eine Ruhigstellung mittels Gips. Hierbei kam es zu einer Peroneusläsion mit seitdem bestehender Fußheberschwäche von 2/5 (Kraftgrad nach Janda). Nach Abschwellen erfolgte ein Versuch der komplexen Banrekonstruktion des linken Kniegelenks. Die Beweglichkeit des Kniegelenk betrug zum Zeitpunkt der Konsultation ROM Extension/Flexion 0/10/45°. Trotz dieser massiven Bewegungseinschränkung im Sinne eines kombinierten Beuge- und Streckdefizites war es dem Patienten möglich 2500 km pro Jahr auf dem Rad zu absolvieren. Darüber hinaus konnte die Teilnahme an 4 RTF`s/Jahr verzeichnet werden. Möglich war dies nur mit einer speziellen Kurbelkonstruktion mit Doppelgelenk (Kurbelarmverkürzer der Firma Hase).