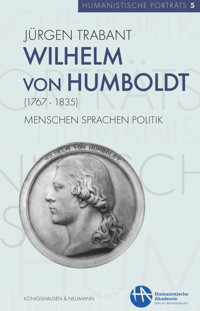22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Sprache ist die menschliche Weise, sich die Welt denkend zu erschließen. Diese Einsicht wird jedoch in der europäischen Sprachkultur oft missachtet oder gar bekämpft. Deswegen ist die Sprache heute von vielen Seiten bedroht: durch die Übertreibung ihrer bloß kommunikativen Funktion, durch die Vernachlässigung der alten Kultursprachen, durch einen falschen Purismus und durch die Abkehr von der Mehrsprachigkeit. Das neue Buch des Sprachwissenschaftlers Jürgen Trabant ist eine leidenschaftliche Verteidigung der welterhellenden Kraft der Sprache und ihrer inneren wie äußeren Vielfalt.
Die vielen Sprachen Europas und der ganzen Welt sind – das wusste schon Wilhelm von Humboldt – ebenso vielfältige Weisen, die Welt zu erfassen. Will man also die kognitive Funktion der Sprache verteidigen, muss man auch den Reichtum der vielen Sprachen erhalten. Wenn das Deutsche heute gegenüber dem globalen Englisch zunehmend in Not gerät, gilt das genauso für all die anderen europäischen Sprachen, die auf dem Rückzug sind, weil nur die globale Sprache Macht verspricht. Jürgen Trabant zeichnet höchst aufschlussreich die historischen und sprachgeschichtlichen Entwicklungen nach, die zu unserer heutigen Situation geführt haben. Sein Buch ist ein Lob der Sprache, ohne die der Mensch nicht zudenken ist, und eine Warnung vor der heranrückenden Sprachdämmerung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
JÜRGEN TRABANT
Sprachdämmerung
Eine Verteidigung
C.H.BECK
Zum Buch
Sprache ist die menschliche Weise, sich die Welt denkend zu erschließen. Diese Einsicht wird jedoch in der europäischen Sprachkultur oft missachtet oder gar bekämpft. Deswegen ist die Sprache heute von vielen Seiten bedroht: durch die Übertreibung ihrer bloß kommunikativen Funktion, durch die Vernachlässigung der alten Kultursprachen, durch einen falschen Purismus und durch die Abkehr von der Mehrsprachigkeit. Das neue Buch des Sprachwissenschaftlers Jürgen Trabant ist eine leidenschaftliche Verteidigung der welterhellenden Kraft der Sprache und ihrer inneren wie äußeren Vielfalt.
Die mannigfaltigen Sprachen Europas und der ganzen Welt sind – das wusste schon Wilhelm von Humboldt – ebenso vielfältige Weisen, die Welt zu erfassen. Will man also die kognitive Funktion der Sprache verteidigen, muss man auch den Reichtum der vielen Sprachen erhalten. Wenn das Deutsche heute gegenüber dem globalen Englisch zunehmend in Not gerät, gilt das genauso für all die anderen europäischen Sprachen, die auf dem Rückzug sind, weil nur die globale Sprache Macht verspricht. Jürgen Trabant zeichnet höchst aufschlussreich die historischen und sprachgeschichtlichen Entwicklungen nach, die zu unserer heutigen Situation geführt haben. Sein Buch ist ein Lob der Sprache, ohne die der Mensch nicht zu denken ist, und eine Warnung vor der heranrückenden Sprachdämmerung.
Über den Autor
Jürgen Trabant ist emeritierter Professor für Sprachwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Er hatte zahlreiche Gastprofessuren im In- und Ausland inne und lehrte als Professor für «European Plurilingualism» an der Jacobs University Bremen. Bei C.H.Beck sind von ihm u.a. erschienen: «Europäisches Sprachdenken. Von Platon bis Wittgenstein» (2006), «Die Sprache» (C.H.Beck Wissen, 2009) und «Weltansichten. Wilhelm von Humboldts Sprachprojekt» (2012).
Inhalt
Vorwort
Sprache: Licht der Menschen
1: Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache
2: Artikulation oder: Über das Mundwerk
3: Ursprung und Evolution der Sprache
4: Zeichen – Wort – Bild
5: Weltansichten oder: Die Farbe des Denkens
Muttersprache: Das Deutsche
6: In die Rappuse gegangen
7: Über deutsche Sprache und über den Fug und Unfug, welchen sie sich jetzt muss gefallen lassen
8: Gegen die Sorge: Die Coolen
9: Über das Deutsche in den Wissenschaften
10: Purismus 1: Gegen fremde Wörter
11: Purismus 2: Gegen schmutzige Wörter
12: Purismus 3: Gegen den Akzent
13: Rückkehr des Dialekts?
14: Kiezdeutsch
Die neue Vatersprache: Das Globalesische
15: Die Stimme Amerikas: Szenen einer akroamatischen Verführung
16: On my globalization
17: Lantsch
Brudersprache: Das Französische
18: La langue fraternelle
19: La France c’est une langue
20: Le génie/Jenni de la langue française
21: Madeleine? – Madeleine.
Geschwister: Die Sprachen Europas
22: Der Kirchenpelz im Museum
23: Glossodiversität
24: Europäische Glossodiversität – europäische Mehrsprachigkeit
25: Glossodiversität als Chance: Emmanuel Macron über die Sprachen Europas
26: Die Philosophie und das Unübersetzbare
27: Europäische sophistication
28: Übersetzung als Sprache Europas
Sprachdämmerung
29: Das Ende – von Anfang an
30: Tränen des Abschieds
Anhang
Anmerkungen
Sprache: Licht der Menschen
Muttersprache: Das Deutsche
Die neue Vatersprache: Das Globalesische
Brudersprache: Das Französische
Geschwister: Die Sprachen Europas
Literaturverzeichnis
Nachweise
Personenregister
Für C.,seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander
Vorwort
«Am Anfang war das Wort.»
Also ist das Wort das Licht der Menschen, sagte er. Und so richtig gibt es die Dinge erst, wenn sie in Worte gefasst worden sind.
(Pascal Mercier)
Das vorliegende Buch möchte das «Licht der Menschen» hüten. Es feiert sein Leuchten, seine welterhellende Funktion, seine Farben – und sein Tönen. Sprache ist ein tönendes Licht, das sich über die Welt ergießt, eine Kostbarkeit, die uns anvertraut ist und für die wir Sorge tragen müssen – als souci de nous-mêmes, als Sorge um uns selbst. Daher geht das Buch auch einigen Gefährdungen nach, denen Sprache heute ausgesetzt ist.
Am meisten sorgen sich viele Menschen um die eigene Sprache. Die Sorge um die Sprache in diesem Buch ist aber gar nicht zuvörderst auf die deutsche Sprache gerichtet. Die Sorge um das Deutsche ist vielmehr nur eine Form der Sorge um die Sprache überhaupt. «Sprache überhaupt» kommt zwar nirgendwo in der Realität vor, sie manifestiert sich immer in Form bestimmter Sprachen. Aber alle diese Sprachen gehören eben doch zu einem Typus menschlicher Aktivität, der vielleicht noch mehr in Gefahr ist als irgendwelche besonderen Sprachen. Menschliche Sprache wird nämlich von zwei Seiten aus bedrängt, von unten und von oben. «Von unten» wird sie zunehmend ersetzt durch vorsprachliche kommunikative Formen: In der U-Bahn spricht man nicht mehr miteinander, man verdrängt den anderen einfach sprachlos von der Tür. Junge Männer – und alte wie der amerikanische Präsident – bellen einander an und machen eine aggressive Schnute, um den anderen einzuschüchtern. Das Zeigen von Tätowierungen und Peircings kommuniziert Stammeszugehörigkeiten und sexuelle Präferenzen, aber es spricht nicht. Und auch «von oben» ist Sprache – vielleicht noch massiver – bedroht, und zwar von etwas, das als Sprache daherkommt, in Wirklichkeit aber etwas anderes ist, nämlich Zeichen. Die technisch-wissenschaftliche Welt, in der wir leben, verlangt eine Verwendung der Sprache als Zeichen. Das heißt, die Gegenstände der Welt und die Begriffe müssen von unseren Wörtern präzise bezeichnet werden. Die Wörter, die wir dabei verwenden, sind völlig arbiträr, es ist vollkommen gleichgültig, welcher Sprache sie zugehören. Sie sind, wie Europa es seit Jahrtausenden wünscht und denkt, eindeutige Mittel zur Kommunikation von Sachen und Begriffen, die jenseits der Sprache durch technisches Hantieren und wissenschaftliche Abstraktion gewonnen worden sind. Während die vorsprachlichen Handlungen, «unten», eher icons sind, Bilder der mitgeteilten Gefühle (Objektives wird nicht dargestellt), sind die nachsprachlichen Handlungen, «oben», nicht-ikonische, arbiträre Repräsentationen des Objektiven, Zeichen. Der Zweck beider Handlungen ist Kommunikation.
Sprache ist aber etwas anderes: Sie ist das «bildende Organ des Gedanken» (Wilhelm von Humboldt), also wesentlich Kognition, genauer: gemeinsames Denken, «Mit-Denken» (ebenfalls ein schönes Wort von Humboldt). Das Wort ist kein Bild und kein Zeichen, sondern steht zwischen beiden, als «Licht der Menschen», das im dichterischen Sprechen am schönsten leuchtet. Es gilt, an diese für den Menschen konstitutive Weise des In-der-Welt-Seins zu erinnern, denn der Mensch ist nur Mensch durch Sprache. Weil jenes Sprach-Denken notwendigerweise in ganz verschiedenen Sprachen gebildet wird, generiert es oft die Liebe zu einer bestimmten Sprache, aber gleichzeitig auch – durch die «Lust an Sprache als Sprache» (Humboldt) – Liebe zu den vielen Sprachen des Menschen.
Meine Sorge um die deutsche Sprache werde ich hier zunächst mit der berühmtesten Schrift zur Verteidigung und Illustration des Deutschen beleuchten, mit Leibniz’ «Unvorgreiflichen Gedanken» von 1697. Leibniz’ Vorbild war Joachim Du Bellays «Défense et illustration de la langue française» von 1549. Beide Schriften evoziere ich, weil mir die Zeit für eine Verteidigung gekommen zu sein scheint: Das Deutsche ist wie im 17. Jahrhundert «in die Rappuse», in Not und Zerstörung, geraten. Deswegen kann es gar nicht genügend Verteidigungen und «Illustrationen» geben. Die Berichte der deutschen Akademien (2013 und 2017) zur Lage der deutschen Sprache illustrieren diese, die schönen Bücher von Kaehlbrandt (2016) und Steinfeld (2010) illustrieren und verteidigen sie. Ich setze die Illustration voraus, verteidige sie nur und suche nach Auswegen aus der Rappuse.
Denn als verlockende Alternative zur Muttersprache steht eine Vatersprache bereit. Es ist klar: Die Deutschen sehnen sich nach einer solchen Vatersprache, die sie im amerikanischen Englischen finden, dem von mir so genannten «Globalesischen». Dieses ist deswegen so attraktiv, weil es nicht wie die Muttersprache ständig an die Schuld gemahnt. Der starke Vater sagt, wo’s lang geht: Our Master’s Voice. Doch eine Alternative zur väterlichen Überwältigung könnte die freundliche Hinwendung zur Brudersprache sein, zur langue fraternelle. Sie drängt sich nicht vor, sie dominiert nicht, sie eröffnet einfach den Raum einer unschuldigen alternativen Sprachlichkeit. Insofern ist sie eigentlich attraktiver als die verführerische Vatersprache. Aber sie verspricht natürlich keine Macht, und sie wird gerade ihrerseits vom starken Vater eingeholt, wie all die anderen Brüder und Schwestern in Europa. Vielleicht kann sie uns aber dennoch helfen, zusammen mit den anderen Sprachgeschwistern die Mutter Sprache zu bewahren. Wie Brünnhilde die Walküren, so bitten wir die schwesterlichen Sprachen gleichsam, uns – und die Mutter – gegen Wotan zu schützen. Den Walküren gelingt das bekanntlich nicht, weil sie sich einschüchtern lassen. Tapfere Mehrsprachigkeit aber könnte uns und die europäische «Glossodiversität», die Vielfalt der Sprachen, retten. Der junge französische Präsident ermuntert uns dazu. Falls dies aber nicht gelingt, erfüllt sich Europas Schicksal als jenes Ende der Sprache, das Europa in seiner Philosophie und seiner Religion von Anfang an denkt – und ersehnt. Das Licht der Menschen verlöscht dann in einer wenig gloriosen Sprachdämmerung
Sprache: Licht der Menschen
1
Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache
«Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache», sagt Wilhelm von Humboldt in seiner ersten Rede vor der Berliner Akademie, am 29. Juni 1820 (GS IV: 15).[1] Ein starker Spruch, gleichsam eine evolutionär-anthropologische Version des ersten Satzes des Johannes-Evangeliums: «Am Anfang war das Wort» – am Anfang des Menschen nämlich. Indem Humboldt die alte aristotelische Bestimmung des Menschen als zoon logon echon, als «Sprache habendes Wesen», vor allem mit dem «nur» erheblich pointiert, gewinnt sein einfacher Spruch ein gewisses Irritationspotential. Er macht offensichtlich das Menschsein exklusiv vom Besitz der Sprache abhängig. Das empört bestimmte Menschenfreunde und reizt entschiedene Bilderfreunde.
Die Ersteren fragen: Schließt Humboldt damit nicht Menschen aus der Menschheit aus, die mehr oder minder große Defizite bei der Sprache haben? Nimmt er nicht kleine Kinder, «Wolfskinder», Gehörlose, Anderssprachige, Schlechtsprechende, Aphasiker, Demente und aus anderen Gründen Sprachlose vom Menschsein aus?[2] Doch Humboldt sagt nicht, dass der Mensch schon von Geburt an eine voll ausgearbeitete Sprache haben muss, dass seine Sprache eine Lautsprache sein muss, dass er eine bestimmte Sprache zu sprechen hat, diese Sprache auch noch richtig und schön sprechen sollte und dass er zu jedem Moment seines Lebens fähig sein muss, sie zu sprechen, um Mensch zu sein. Er sagt bloß: «Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache.»
Wir müssen also fragen, was mit der «Sprache» gemeint ist, durch die der Mensch Mensch sein soll. Es ist nicht eine bestimmte Sprache oder die voll entfaltete Sprachlichkeit, sondern, wie Humboldt sich ausdrückt, ihr «Typus». Und dieser ist die «Verstandeshandlung, welche zum Begreifen eines einzigen Wortes erfordert wird», nämlich die Verbindung der Reflexion mit der Artikulation: «Der Mensch besitzt die Kraft, diese Gebiete [das Denkbare und das Lautliche] zu theilen, geistig durch Reflexion, körperlich durch Articulation, und ihre Theile wieder zu verbinden, geistig durch die Synthesis des Verstandes, körperlich durch den Accent, welcher die Silben zum Wort, und die Worte zur Rede vereint» (GS IV: 4). Mit anderen Worten gesagt ist der «Typus» Sprache die synthetische Verbindung von «Bedeutung» mit artikulierten Lauten, mit welcher der Mensch sein Denken produziert. Er ist, in einer weiteren berühmten Wendung Humboldts, «die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den articulirten Laut zum Ausdruck des Gedanken fähig zu machen» (GS VII: 46). Hinzukommt, dass jene Kraft «dieselbe Durchdringung im Hörenden bewirkt» (GS IV: 4), so dass die Arbeit des Geistes sich in der Gemeinsamkeit von Ich und Du vollendet.
Man braucht dieser Beschreibung des «Typus» der Sprache nicht zuzustimmen und kann etwas anderes als Typus annehmen, zum Beispiel, wie der einflussreiche amerikanische Linguist Noam Chomsky, eine Universalgrammatik. Ich folge hier allerdings Humboldt: Sprache ist demnach «das bildende Organ des Gedanken» (GS VII: 53). Humboldt beschreibt die Keimzelle universeller Sprachproduktion, und diese tragen alle Menschen als angeborene Disposition in sich, sie muss «als unmittelbar in den Menschen gelegt angesehen werden». In der Druckfassung seines Vortrags hat Humboldt die Worte «von Gott» gestrichen, die im Manuskript vor «unmittelbar» standen. Das erlaubt es uns, modern umzuformulieren: «Sprache» bezeichnet eine genetisch gegebene Fähigkeit zur Produktion des Denkens, über die nur der Mensch verfügt und durch die er daher Mensch ist.
Humboldts Satz steht in einer Passage, in der es um den Ursprung der Sprache geht. Humboldt lehnt hier eine allmähliche – er verwendet das aparte Wort «umzechige» – Evolution der Sprache ab, wie sie die meisten Sprachursprungstheorien des 18. Jahrhunderts angenommen haben: «Es hilft nicht, zu ihrer [der Sprache] Erfindung Jahrtausende und abermals Jahrtausende einzuräumen» (GS IV: 14). Stattdessen nimmt Humboldt gleichsam einen qualitativen Sprung an. Es gibt für ihn kein Mehr oder Weniger an Sprache – entweder man hat den «Typus» der Sprache oder nicht: «Die Sprache ließe sich nicht erfinden, wenn nicht ihr Typus schon in dem menschlichen Verstande vorhanden wäre» (GS IV: 15). In dieser Hinsicht sind sich Chomsky und Humboldt im Übrigen völlig einig. Und der Mensch ist auch für Chomsky nur Mensch durch Sprache.
Gerade durch die Annahme eines angeborenen «Typus» sind aber auch die genannten scheinbar sprachdefizitären Menschen natürlich Menschen: Säuglinge sind ja nur auf den ersten Blick infantes, «Nicht-Sprechende», wie der lateinische Ausdruck zu verstehen gibt. In Wirklichkeit ist in sie wie in jedes menschliche Wesen genetisch die Fähigkeit zur Sprache gelegt, die sich nach einem gegebenen Bioprogramm im sozialen Verkehr mit anderen Menschen entwickelt und zu voller Sprachlichkeit entfaltet, in Tausenden verschiedenen Sprachen, die den ganzen Reichtum jener «Arbeit des Geistes» ausmachen. Der Ausdruck infantes ist auch insofern unzutreffend, als schon das neugeborene – ja selbst das ungeborene – Menschenwesen Sprache in einem weiteren Sinn des Wortes hat: Es kommuniziert von Anfang an mit allem, was es umgibt. Das meinte Herder mit dem berühmten ersten Satz seiner «Abhandlung über den Ursprung der Sprache»: «Schon als Thier hat der Mensch Sprache» (Herder 1772: 9). Allerdings ist diese «Tiersprache» nach Herder noch nicht jene Sprache, die den Menschen zum Menschen macht. Auch Humboldt meint nicht Kommunikation, wenn er «Sprache» sagt, sondern das skizzierte kognitive Verfahren, die Gliederung des Denkbaren in «Portionen des Denkens» und des Lauts in unterscheidbare Segmente. Jedoch geht es hier um ein Denken, das sich in der Dimension des anderen erzeugt: ein «Mit-Denken», wie der junge Humboldt es einmal mit einem genialen Ausdruck nannte (GS VII: 583).
Nicht nur Kleinkinder, auch «Wolfskinder» haben wie alle Menschen die genetische Ausrüstung zur Sprache. Aber sie haben das Zeitfenster verpasst, das ihnen die volle Entfaltung dieser genetischen Ausstattung ermöglicht hätte, unwiederbringlich. Menschen, die Sprache haben, sind sie trotzdem. Den Gehörlosen spricht Humboldt ausdrücklich Sprache zu (eine damals überhaupt noch nicht allgemein akzeptierte Auffassung), auch wenn deren Zeichen anders sind als diejenigen der lautsprachlichen Mehrheit; geistig und körperlich gegliedert ist sie aber durchaus.
Es ist eine Gemeinheit vieler Völker, nicht nur Kinder «Nicht-Sprechende» zu nennen, sondern auch anderen Völkern, die sie nicht verstehen, die Sprache überhaupt abzusprechen. Die Griechen nannten die anderen Völker barbaroi – das sind diejenigen, die brbr machen, also tierische Laute ausstoßen. Die Slawen nennen die Deutschen «die Stummen», also solche, die nicht sprechen. Bezeichnungen dieser Art negieren tatsächlich das Menschsein von Anderssprachigen. Aber nach Humboldt gibt es natürlich keine brbr-Sager und keine «Stummen», denn die Sprache ist ja «unmittelbar in den Menschen gelegt». Auch die Schlechtsprechenden, die wir oft aus unseren Gemeinschaften ausschließen (durch schlechte Zeugnisse, Lächerlich-Machen, Verweigerung von Arbeitsplätzen etc.), sind deswegen selbstverständlich keine Un-Menschen. Schließlich: Aphasiker, Demente und Überwältigte hören nicht auf, Menschen zu sein, nur weil sie nicht mehr sprechen können. Die Sprache ist nach wie vor «in sie gelegt», selbst wenn sie sie nicht mehr hervorbringen können. Es ist wie mit dem aufrechten Gang, der ja ebenfalls ein ziemlich exklusives menschliches Merkmal (und eine der vielfältigen Vorbedingungen für Sprache) ist: Es ist in den Menschen gelegt, dass er aufrecht geht, er richtet sich nach einem biologischen Wachstumsprogramm auf und ist dann dieses aufrechte Wesen. Wenn aber ein Mensch durch Krankheit oder Alter nicht mehr laufen kann, hört er nicht auf, ein Mensch zu sein, ebenso wie er zu Beginn des Lebens, als er noch nicht laufen konnte, schon ein Mensch war.
Humboldts Spruch irritiert des weiteren durch seinen ausdrücklichen, scheinbar skandalösen Glottozentrismus: «Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache.» Ist es wirklich allein die Sprache, die den Menschen zum Menschen macht? Sind nicht Artefakte, Zeichen, Symbole, Bilder und andere semiotische Gebilde das, was die Menschlichkeit begründet? Hat der Mensch nicht eher eine – wie Saussure (1916) annahm – facultas signatrix, eine Zeichenfähigkeit, die viel weiter ist als die Fähigkeit zur Lautsprache, welche ihrerseits nur ein Spezialfall von «Zeichen» wäre? Ist er nicht viel eher ein animal symbolicum, wie Cassirer sagt, als ein zoon logon echon? Vieles spricht dafür, dass der Mensch Artefakte herstellte, dass er – vor allem visuelle und gestuelle – Symbole und Zeichen bildete, bevor seine Lautsprache die Form erhalten hat, die Humboldt als für den Menschen konstitutiv erachtet. Sicher ist der Mensch also ein animal symbolicum, und das Ensemble seiner Symbole macht seine Menschenwelt aus. Insofern ist er auch Mensch durch seine Symbole. Aber niemals hätte er die Symbole – also seine gesamte Kultur – auf die historisch gegebene Weise entfalten können, wenn in ihrem Zentrum nicht die Sprache stünde, jenes «bildende Organ des Gedanken».
Besonders lebhaft wird Humboldt von einer pansymbolisch inspirierten Bildwissenschaft widersprochen. Sie sieht in seinem Satz einen sprachlichen Imperialismus, der die Bilder und Artefakte nicht hinreichend würdigt.[3] Entsprechend setzt sie das Menschsein entwicklungsgeschichtlich früher an: eben bei den Bildern, das heißt bei den ersten Einritzungen des Menschen in die Welt, und bei den ersten Artefakten. Und sie betrachtet die Sprache als eine spätere Technik, die dann sozusagen zum Menschsein noch hinzukommt und dieses vollendet.
Humboldts Spruch steht einer solchen Auffassung des Menschen überhaupt nicht entgegen. Gewiss kann die Beziehung von Bild und Sprache evolutionär so beschrieben werden, dass die Sprache eine weitere Entwicklung gerade dieser Welt-Bearbeitungen ist (Humboldt interessiert allerdings ein solches modernes evolutionäres Szenario nicht). Es ist in der Tat davon auszugehen, dass schon die Herstellung von Artefakten auf Fähigkeiten und Gehirnaktivitäten, zum Beispiel die «Lateralisierung», verweist, die dann später zur Sprache führten. Dabei handelt es sich auch zweifellos um geistige Artikulationen der Welt.[4] Nur, wenn diese artikulatorischen Tätigkeiten nicht zur Sprache geführt hätten, dann wären die artikulierenden Wesen keine modernen Menschen geworden, sondern eine andere Art von symbolisierenden Primaten, die die Welt vielleicht mit allerlei Bildern und Faustkeilen gefüllt, aber vermutlich keine Autos gebaut oder komplexe Gesellschaften gebildet hätten. Natürlich wäre die «Ilias» ebensowenig gedichtet worden wie der «Faust» oder «Don Giovanni» oder die Bibel. Auch die Bilder der Sixtinischen Kapelle wären dann wohl nicht gemalt worden.
Wir müssen also davon ausgehen, dass die artikulatorischen Bearbeitungen der Welt durch Hand und Auge irgendwann einmal vom Stimme-Ohr-System übernommen wurden bzw. besser noch: gleichzeitig auch von vokal-auditiven Bewegungen ausgeführt wurden, die dann aber einen entscheidenden Schritt weitergingen. Das vokal-auditive System hat nämlich – und das ist das Entscheidende – nicht nur kognitive «Portionen» der Welt unterschieden, sondern vor allem die geniale Technik der lautlichen Artikulation entwickelt, also der Produktion einer begrenzten Anzahl von Lautbewegungen, die zu quasi unendlicher Kombination fähig sind. Diese Technik ist nicht nur eine irgendwie graduelle Fortführung der visuell-haptischen Artikulationsfähigkeit, sondern ein qualitativer Sprung in etwas wirklich Neues. Erst mit dieser Technik entfaltet der menschliche Primat Sprache, die ihn zur unendlichen Produktion von Äußerungen und Texten befähigt, mit denen er die Welt denkt und die Beziehungen mit anderen in höchster Komplexität organisiert. Dieser Primat ist der homo sapiens, das zoon logon echon, das, wie Aristoteles und Tomasello sagen, zunächst ein zoon politikon ist. Das nächste Kapitel wird diesem artikulierenden Wesen gewidmet sein.
Was die besondere Kostbarkeit der Sprache noch erhöht, wird merkwürdigerweise gemeinhin als einer ihrer größten Mängel betrachtet und verursacht seit Jahrtausenden ein großes Klagegeschrei: Die Sprache, durch die der Mensch Mensch ist, kommt auf der Welt konkret nicht als «Sprache überhaupt» vor. Von weitem sieht es zwar so aus, weil alle Menschen sprechen. Ein Marsmensch, das schreibt Chomsky an mehreren Stellen, der von außen kommend die Menschen auf dem ganzen Globus beobachtete, würde zunächst denken, dass die Menschen alle dasselbe tun: sich mittels Lauten, die mit den Mundwerkzeugen produziert werden, gegenseitig beeinflussen. In der Tat tun sie das auch, und insofern ist das Tun dasselbe, die Sprache ist ja universell «in den Menschen gelegt». Aber diese Anlage realisieren sie nicht überall auf dieselbe Art und Weise, sondern tatsächlich jeder einzelne Mensch auf seine eigene. Nun ist es allerdings auch nicht so, als habe jeder individuelle Mensch eine völlig individuelle Sprache. Zwar kommt Sprache nur als individuelle Tätigkeit vor, aber diese Tätigkeit wird eben doch nach dem Modell der Tätigkeit einer Gruppe von Menschen ausgeführt. Zwischen das Individuum und die Menschheit schieben sich die besonderen Arten und Weisen, die angeborene Fähigkeit des Sprechens zu realisieren, die jeweils einer ganzen Gruppe gemeinsam sind.
Wer jemals eine fremde Sprache gelernt hat, weiß, wie verschieden Sprachen sein können. Alle ihre strukturellen Eigenschaften sind jeweils anders: die Laute, die Kombination der Laute, die Wörter, deren Bedeutungen, die grammatischen Einheiten, die Syntax, die Phrasen. Die Art, wie der Mensch sich die Welt aneignet, folgt der Vorgabe einer Sprachgemeinschaft. Jedes menschliche Wesen wird mit der Sprache in eine Gemeinschaft eingebunden und in die Art und Weise, wie diese sich die Welt erschließt. Dies erzeugt zumeist eine tiefe geistige Prägung und eine Bindung an die Gruppe, die spricht wie ich. Zwar ist, wie Humboldt an einer Stelle gesagt hat, diese Sprache dem Ich auch zutiefst fremd, sofern es sie von anderen und aus der Tiefe der Vergangenheit empfängt. Aber sie ist ihm eben auch unendlich nah, weil sie es schon vor der Geburt in einem intra-uterinären Rhythmus gewiegt hat, weil es in ihr die geliebten anderen und in diesem Klang und dieser Liebe die Welt kennengelernt hat, in ihr also denkt und lebt.
Nicht nur weil an der Sprache unser Menschsein hängt, ist sie also kostbar, sondern auch weil mit jeder Sprache eine ganz besondere Art, in der Welt zu sein, gegeben ist. Weil alle Menschen ihr durch die Sprache gegebenes Menschsein in ihren vielen Sprachen erschaffen, weil alle Sprachen kostbare Geschöpfe des menschlichen Geistes sind und die merveilleuse variété des opérations de notre esprit, die «wunderbare Vielfalt der Operationen unseres Geistes» (Leibniz), darstellen, sorge ich mich um die Sprachen, um meine Sprache und die Sprachen der anderen.
2
Artikulation oder: Über das Mundwerk
Nichts konstituiert den Menschen also so sehr wie das, was aus seinem Munde tönt, die Sprache, sein Mundwerk. «Das, was in der Stimme ist», ta en te phone, nennt Aristoteles die materiellen Sprachzeichen. Und phonai bzw. voces, «Stimmen«, heißen bei den Griechen und Römern die Wörter. Wörter sind etwas dem Mund Entströmendes. Was umgekehrt durch den Mund in den Menschen hineingeht, ist ebenfalls einigermaßen menschlich, aber es definiert nicht das Menschsein. So war die Zubereitung von Fleisch durch Feuer sicher eine fundamentale menschliche Erfindung (andere Primaten tun das nicht) und eine wichtige Bedingung für die kulturelle Evolution (nicht von ungefähr raubt Prometheus den Göttern das Feuer, es ist die Voraussetzung aller Kultur). Die dadurch mögliche Einnahme gebratenen Fleisches über den Mund war auch ein wichtiger Schritt in der Menschwerdung des Menschen. Dennoch wird dieser von Aristoteles zu Recht nicht als «gebratenes Fleisch essendes Tier», sondern als «Sprache habendes Tier» definiert.
Das Vokale, die sprachliche Lautproduktion, ist notwendig begleitet vom Hören. Die Stimme braucht das Ohr, das Phonetische bildet eine Einheit mit dem Akroamatischen (von griech. akroates, «der Hörer»), und zwar in dreifacher Hinsicht: Erstens hört sich der vokale Sprache erzeugende Mensch selbst, er muss sich selbst hören; wenn er es nicht kann, misslingt die Lautproduktion. Das vokal Produzierte ist zweitens essentiell an einen anderen gerichtet, der es hören (und verstehen) soll. Und drittens erheischt das Tönende und Gehörte eine vokale Produktion des anderen und damit ein Hören des Sprechenden auf den anderen: Wort und Ant-Wort. Das Phonetische und das Akroamatische konstituieren das Ich und das Du. Im weiteren Sinne konstituiert die vokale Lautproduktion, die das eigene Hören impliziert, auf das Hören des anderen gerichtet ist und sich in meinem Hören auf den anderen vollendet, menschliche Gemeinschaft, polis, sie ist das Medium des Politischen. Die Sprachlichkeit des Menschen als zoon logon echon ist damit aufs engste mit der anderen Definition des Menschen durch Aristoteles verbunden: als zoon politikon.
Natürlich können auch Menschen, die das Vokale nicht hören und daher auch nichts Vokales produzieren, eine der vokalen Sprache äquivalente Sprache ausbilden. Als Menschen haben sie die angeborene Fähigkeit, Wörter und Sätze zu bilden, auch wenn diese nicht über das phonetisch-auditive System realisiert werden können. Die Gebärdensprachen der Gehörlosen, Systeme, die in visueller Modalität ablaufen, sind funktionsfähige Sprachsysteme. Dennoch ist die Gebärdensprache ein den angeborenen Fähigkeiten des Menschen nicht ganz entsprechender Umweg. Denn die angeborenen Fähigkeiten zielen auf das Vokale als den «eigentlichen» Ort der artikulierten Sprache. Diese Bemerkung sagt nichts Negatives über die Sprache der Gehörlosen, sondern drückt im Gegenteil Bewunderung für die fundamentale Artikulationsfähigkeit des Menschen aus, der auch in einem anderen Medium Sprache bilden kann, und für die Leistung der Menschen, die jene Sprache sprechen.
Die vokale sprachliche Lautproduktion wird, so merkwürdig das vielleicht klingen mag, in vielen Diskursen zur Sprache zu wenig beachtet. Man gibt sich oft mit einem generischen Hinweis auf die Vokalität der Sprache zufrieden, ohne die einzigartige Struktur der Lautsprache und deren doppelte Eigenschaft von hoher Komplexität der Bewegungsabläufe und genialer Einfachheit zu würdigen. Dabei ist die menschliche Lautsprache ein wirkliches Wunder, dessen Struktur und Funktionieren wir einigermaßen gut beschreiben können, dessen Genese aber immer noch weitgehend ungeklärt ist.
Über die Gründe, aus denen die Vokalität der Sprache oft wenig berücksichtigt wird, kann ich nur Vermutungen anstellen. Mein Hauptverdacht ist, dass die vokale Sprache zu körperlich ist. Sie wird ja von Organen produziert, die zunächst gar nicht für die «höhere» Funktion der Symbolisierung bestimmt sind: Sie sitzt gleichsam parasitär auf «niedrigen» primären Funktionen auf. Diese primären Funktionen der Organe, die die Sprache erzeugen, sind die Nahrungsaufnahme und die Atmung. Dabei ist der Mund nicht sehr vornehm, er ist sogar extrem körperlich. Weil aber das Symbolische, das die Ess- und Atmungsorgane erzeugen, etwas Besonderes ist, erhöht man es zum «Geist» und schämt sich seiner niedrigen körperlichen Basis.
In diesem Sinne ist es bezeichnend, dass eine mächtige Glaubensrichtung der modernen Linguistik die – wenn auch biologisch gefasste – Sprachfähigkeit ins rein Geistige erhöht und als das eigentlich Definierende der Sprache eine Eigenschaft betrachtet, die sie «Rekursivität» nennt.[5] Gemeint ist damit eine bestimmte Art der Kombination sprachlicher Einheiten, eine rein formale Eigenschaft, die mit Oralität, also mit irgendwelchen Ess- oder Atmungsorganen, aber auch gar nichts zu tun hat. «Rekursivität» ist eine angeborene, hoch geistige Eigenschaft, die natürlich extrem vornehm ist. Die Geringschätzung des Körperlichen, die einer solchen Auffassung zugrunde liegt, erkennt man auch an der Terminologie: Worüber ich hier spreche, die orale Sprache, heißt in dieser Sprachwissenschaft «äußere Sprache», external language oder e-language, wobei das «Äußere» wie bei allen Geistesfreunden das Niedrigere ist. Die eigentliche Sprache ist dann die internal language, i-language, eben das, was im mind ist – in einer körperlosen Instanz, die im Gehirn lokalisiert ist und dort mehr oder weniger wie ein Computer funktioniert. Mit dieser hohen geistigen Sprache ist das Vokale nur kontingent, als Äußeres, verbunden.
Ich lenke hier aber den Blick auf das von Atem- und Essorganen produzierte orale Geschehen, weil ich gerade in diesem das Wesen der Sprache vermute. Die Stimme ist ein von den Atmungsorganen erzeugter, nach außen gerichteter Luftstrom, der durch ein Zusammenspiel bestimmter Teile des Mund- und Rachenraums jene Bewegungen produziert, die wir «Sprachlaute» (Phone, Phoneme) nennen. Der aus der Lunge hervorgedrängte Luftstrom muss den Kehlkopf passieren, wo er die Stimmlippen in Schwingung versetzt (oder auch nicht). Er kann entweder frei dem Mund entströmen, oder er wird durch einen Verschluss oder eine Verengung des Mundraums behindert. Gibt es kein Hindernis für den Luftstrom, produzieren wir Vokale. Diese werden durch weitere Bewegungen der Zunge, der Lippen oder des Zäpfchens «gefärbt». Öffne ich zum Beispiel den Mund weit bei flacher Zunge, ergibt sich ein [a]. Runde ich meine Lippen, dann produziere ich ein [o]. Senke ich dabei das Zäpfchen, so dass die Luft auch durch den Nasenraum strömen kann, ergibt sich ein nasales [õ]. Wenn ich unter Beibehaltung der Lippenrundung die Zunge etwas weiter hinten gegen den Gaumen wölbe, habe ich ein [ö], ohne Lippenrundung ein [e]. Konsonanten hingegen entstehen, wenn der Luftstrom im Mundraum durch ein Hindernis aufgehalten wird. Ich kann dabei entweder einen kompletten Verschluss des Mundraums bewirken, zum Beispiel indem ich die Zunge an die Alveolen hinter den Zähnen presse [t], oder der Luftstrom kann eine Friktion erzeugen, etwa wenn die Zunge etwas Luft durchlässt [s]. Solche Verschlüsse oder Friktionen finden an verschiedenen Stellen statt, zum Beispiel durch die Annäherung der Lippen aneinander [p] oder des Zungenrückens an den harten Gaumen [k]. Während bei den Vokalen die Stimmbänder immer beteiligt sind, kann ich diese bei konsonantischen Lauten beteiligen oder nicht; das unterscheidet stimmhafte von stimmlosen Konsonanten: etwa [z] (das stimmhafte s) von [s] (dem stimmlosen s).
Diese Bemerkungen über die Produktion von Sprachlauten sind natürlich keine professionelle und systematische Einführung in die Phonetik, aber sie machen vielleicht doch einigermaßen klar, was geschieht, wenn wir sprechen: Mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision führen wir höchst komplexe Bewegungen im Mundraum (und den benachbarten Nasen- und Rachenräumen) aus, um verschiedene Laute zu erzeugen. Diese Bewegungen werden von den Menschen im Laufe ihrer sprachlichen Sozialisation als ganz bestimmte wiederholbare Bewegungen, als Bewegungstypen oder Bewegungsschemata, gelernt. Die Sprecher versuchen dabei, die von ihnen in der Rede der anderen als Lauttypen (Phoneme) erkannten Bewegungen selbst zu realisieren. So bemüht sich etwa ein Deutsch-Sprecher, durch die Berührung der Alveolen mit der Zungenspitze bei gleichzeitiger Vibration der Stimmbänder ein Exemplar des Lauttyps /d/ zu erzeugen. Der Ort der Begegnung zwischen den unteren und den oberen Teilen des Mundes gibt den entsprechenden Lauten ihren phonetischen Namen: Das /d/ zum Beispiel ist ein Dental, ein «Zahn-Laut».
Die Lauttypen sind von Sprache zu Sprache verschieden, auch wenn einige von ihnen sich in sehr vielen Sprachen finden, wie das /t/ im Deutschen, Französischen, Italienischen, Japanischen usw. Dennoch unterscheiden sich ein deutsches und ein französisches /t/ auf so charakteristische Weise, dass man am «deutsch» ausgesprochenen /t/ den Deutschen erkennt, selbst wenn er Französisch spricht. Denn dieses Charakteristische bleibt oft als «Akzent» erhalten.[6] Die Zahl der Phoneme differiert von Sprache zu Sprache, es ist aber immer eine relativ begrenzte Zahl: Menschliche Sprachen haben zwischen zehn und achtzig Phonemen. Das meinte ich, als ich sagte, die vokale sprachliche Lautproduktion sei einfach und komplex zugleich: Die Bewegungen zur Erzeugung der Sprachlaute sind zwar hochkomplexe Vorgänge (was hier nur angedeutet wurde), gleichzeitig handelt es sich aber um eine überschaubare Zahl solcher phonetischen Handlungsschemata, also um eine numerisch einfache Technik.
Das zweite Wunder dieser Lautproduktion ist nun, dass die wenigen, aber komplexen Bewegungen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu «Wörtern», also Lautsequenzen kombiniert werden (die dann Bedeutung haben, das ist der Zweck der Kombination). Diese Kombinationen unterliegen bestimmten, von Sprache zu Sprache verschiedenen Regeln: Nicht alle Kombinationen sind möglich, und nicht alle möglichen Kombinationen werden realisiert. Möglich ist im Deutschen zum Beispiel Folgendes: Ich schließe den Luftstrom mit meiner Zunge an den Alveolen (ohne Beteiligung der Stimmbänder), öffne meinen Mund weit mit flacher Zunge und verschließe den Luftstrom erneut durch die Annäherung meiner Zunge an den harten Gaumen. Die so entstandene Sequenz ist [tak] (Tag). Ich kann die drei Lautbewegungen aber auch anders kombinieren, zum Beispiel zu [akt]. Prinzipiell könnte ich auch die Sequenzen [kta], [tka], [atk] oder [kat] erzeugen. Nur wären die ersten drei Kombinationen keine im Deutschen möglichen Wörter (kein deutsches Wort beginnt mit kt- oder tk- oder endet mit -tk). [kat] dagegen wäre eine im Deutschen mögliche Lautkombination, sie ist aber nicht realisiert, also mit Bedeutung «gefüllt» – es gibt kein solches Wort im Deutschen.
Was ich soeben skizziert habe, nennt man gemeinhin «Artikulation». Das Prinzip der Artikulation oder – mit dem deutschen Ausdruck – «Gliederung» ist aber ein über die lautliche Artikulation hinausgehendes strukturelles Grundprinzip der Sprache. Es liegt nicht nur der Produktion der Laute zugrunde, sondern auch der Produktion der Bedeutungen. Articulus ist das Gelenk, das verschiedene Glieder miteinander verbindet. Traditionell wurden die Konsonanten als die «Gelenke» angesehen, die den – vokalischen – Lautstrom zerteilen und verbinden. Die ausströmende Atemluft durch eine Gliederung in unterscheidbare Bewegungen zum Aufbau bedeutungstragender Lautsequenzen zu nutzen ist die geniale «Erfindung» der menschlichen Primaten. Durch die minimalen Handlungsschemata der Phoneme können höherrangige Handlungsschemata aufgebaut und mit Bedeutung verbunden werden: Wörter und Morpheme. Die semantische «Aufladung» der Lautkombinationen ist der Zweck dieser komplexen Teilhandlungen, in ihr realisiert sich die Gliederung des Denkbaren (der Welt) in geistige, konzeptuelle, inhaltliche Einheiten. Diese lautlich-konzeptuellen Größen können nun ihrerseits zu noch größeren Einheiten – Äußerungen – verbunden werden, wobei diese Kombinationen, jedenfalls bis zur Satzebene, ebenfalls regelhaft festgelegt sind. Allerdings sind diese Regeln so, dass sie einen unendlichen Raum freier Gestaltung eröffnen: Die Kombinationen können sich nämlich jeder Situation frei anpassen und damit auch frei neue Gedanken schaffen.
So sind, um diese Dialektik von Regelhaftigkeit und Freiheit anzudeuten, die Wörter und Morpheme über, all, -en, Gipfel, -n, ist, Ruhe in der deutschen Sprache als Handlungsschemata mit bestimmten Bedeutungen festgelegt. Ebenso ist im Deutschen festgelegt, dass die Präposition über den Dativ regiert (wenn es nicht um eine Bewegung geht) und dass das Verb an der zweiten Stelle im Satz steht. Sehr vieles in der Verbindung morphematischer sprachlicher Einheiten ist also schon regelhaft vorgegeben. Dennoch war die Sequenz «Über allen Gipfeln ist Ruh» eine bis zum Zeitpunkt ihrer Formulierung durch Goethe inexistente und damals völlig neue Kombination von Lauten, Wörtern, Morphemen, Bedeutungen. Die sprachliche Gliederung ermöglicht also gerade die Produktion von Neuem und Unerhörtem, nicht nur die «Aufführung» oder Realisierung eines vorgängigen Handlungstyps. Natürlich werden hier zum Beispiel die Schemata über oder Ruh auch «aufgeführt», also konkret in der Rede realisiert, aber die Kombination solcher Schemata ermöglicht eben gleichzeitig den Aufbau von etwas ganz Neuem: dem Goetheschen Vers. Die ungeheure Produktivität des menschlichen Geistes entfaltet sich durch die lautlich gegliederte Struktur der Sprache.
Wilhelm von Humboldt schreibt in seiner großen Rede über die Buchstabenschrift von 1824, einer Rede über die Artikulation und das artikulatorische Wesen oder Sprache: