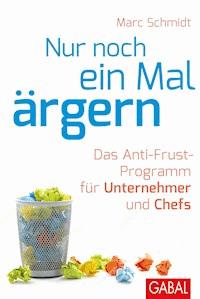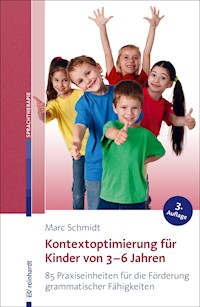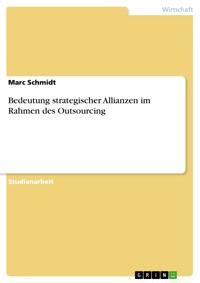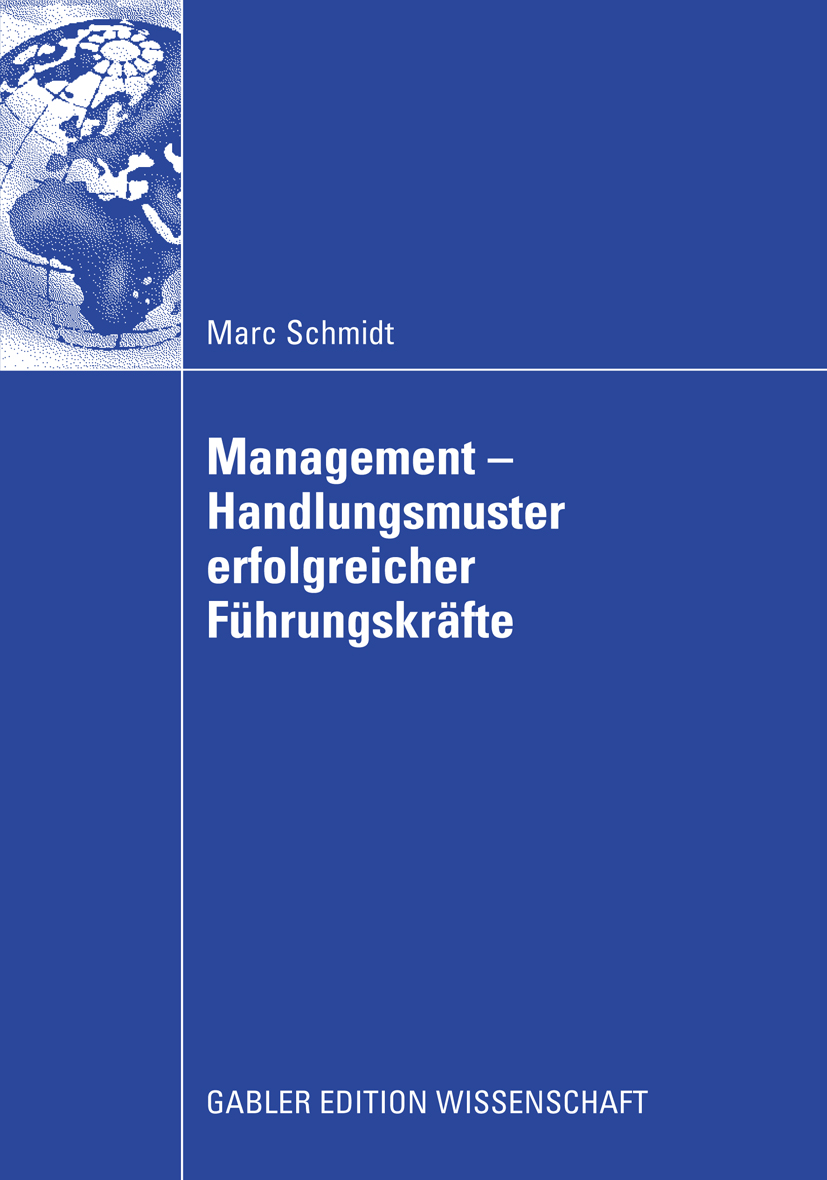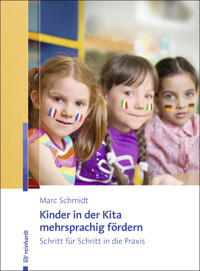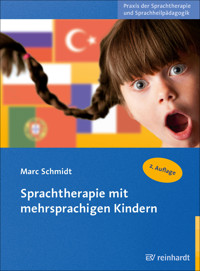
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik
- Sprache: Deutsch
Mehrsprachige Kinder mit Spracherwerbsstörungen benötigen eine spezielle Therapie und Förderung. Ausgangspunkt der vom Autor vorgestellten und erprobten "kontrastoptimierten Therapie", die auf den Prinzipien der Kontextoptimierung (H.-J. Motsch) beruht, ist die Zweitsprache Deutsch. Wie Therapeuten auch ohne besondere Vorkenntnisse die Erstsprache konsequent miteinbeziehen können, zeigt Marc Schmidt u. a. anhand von 45 konkret umsetzbaren Therapieeinheiten. Die Besonderheiten der Erstsprachen Türkisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch und Französisch werden dem Deutschen gegenüber gestellt und erklärt. Auch zur allgemeinen Förderung des bilingualen Spracherwerbs bietet das Buch Grundlagen und praktische Anregungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dr. Marc Schmidt ist Direktor des Centre de Logopédie in Luxemburg. Er hat im Bereich Sprachtherapie sprachentwicklungsgestörter Kinder promoviert und hat über 20 Jahre im Vorschulbereich mit Kindern gearbeitet, die eine spezifische Sprachentwicklungsstörung aufzeigten.
Ebenfalls von Marc Schmidt im Ernst Reinhardt Verlag erschienen:
Kontextoptimierung für Kinder von 3–6 Jahren. 85 Praxiseinheiten für die Förderung grammatischer Fähigkeiten – ISBN: 978-3-497-02472-8
Kinder in der Kita mehrsprachig fördern. Schritt für Schritt in die Praxis – ISBN: 978-3-497-02754-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03068-2 (Print)
ISBN 978-3-497-61500-1 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61535-3 (EPUB)
2. Auflage
© 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Coverbild unter Verwendung eines Fotos von ©iStock.com/ideabug
Satz: Katharina Ehle, Leipzig
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Inhalte des Onlinematerials
Vorwort
Abkürzungen
1Grundlagen
1.1Sprachen Europas
1.2Begriffsbestimmung
1.3Mehrsprachigkeit und SSES
1.4Bedeutung der Erstsprache
1.5Interlanguageeffekte
2Spracherwerb
2.1Sprachtypologie
2.2Erwerb der deutschen Sprache
2.3Erwerb romanischer Sprachen am Beispiel des Französischen und Portugiesischen
2.4Erwerb slawischer Sprachen am Beispiel des Russischen und Polnischen
2.5Erwerb der türkischen Sprache
3Diagnostik
3.1Ziel der Sprachdiagnostik
3.2Überprüfung der Erstsprache
3.3Überprüfung der Zweitsprache
3.4Überprüfung nonverbaler Faktoren
4Therapiebasis: Gezielte Förderung des bilingualen Spracherwerbs
4.1Komplementäre Förderung im Elternhaus
4.2Komplementäre Förderung in der Schule
4.3Sprachliche Ziele
4.4Wesentliche sprachübergreifende Prinzipien
4.5Strukturorientierte Förderung
4.6Sprachliche Aktivitäten
4.7Förderung der phonologischen Fähigkeiten
4.8Förderung der semantischen Fähigkeiten
4.9Förderung der grammatischen Fähigkeiten
5Sprachtherapie
5.1Phonologische Therapie
5.2Semantische Therapie
5.3Grammatische Therapie
5.4Therapieeinheiten
Literatur
Sachregister
„Spiele, Bilderbuchtipps u. v. a. m. finden Sie auf der Homepage des Ernst Reinhardt Verlages: www.reinhardt-verlag.de Das Passwort befindet sich auf S. 181.“
Hinweise zur Verwendung der Icons
Informationsquellen print und online
Praxis- oder Arbeitsmaterial
Fallbeispiel/Beispiel
Tipp
Verweis zu Zusatzmaterialien im Onlinematerial
Inhalte des Onlinematerials
13 Spielformate in 85 Fotos anschaulich dargestellt:
1 Memory gegen den „bösen“ Drachen
2 Fliegenklatschenspiel
3 Bingo
4 Matrix-Bingo
5 Plüschtier-Memory
6 Montagsmaler
7 Parallelanordnung
8 Bilder sammeln
9 Bilder verschenken
10 Wettrennen
11 Würfelspiel
12 Drachenspiel
13 Mau-Mau
Tabellen aus Kapitel 5
Abbildungen aus Kapitel 5.3
Geschichte: Das schüchterne „Du“ (Kick-off zur Subjekt-Verb-Kongruenz)
Bilderbücher zum Grammatikerwerb
Anmerkung: Die Tabellen in Kapitel 5, die für den Einbezug der Erstsprachen der Kinder benötigt werden, befinden sich zusätzlich im Onlinematerial. So können sie vom Therapeuten ausgedruckt werden und es besteht die Möglichkeit, einzelne Zielstrukturen ausgedruckt oder elektronisch für die Vorbereitung oder Durchführung der Therapieeinheit zu nutzen. Entsprechende Hinweise zur Nutzung befinden sich in der Publikation.
Bitte beachten Sie, dass die Tabellen im Buch sich in ihrer Farbigkeit von denen im Onlinematerial unterscheiden: Was im Buch schwarz/unterstrichen ist, ist in der jeweiligen Tabelle im Onlinematerial grün. Schwarz/kursiv gehaltene Abschnitte im Buch sind in den Tabellen im Onlinematerial rot. Die im Buch in blau gehaltenen Abschnitte sind auch im Onlinematerial blau.
Zur Bedeutung der unterschiedlichen Farben in den Tabellen:
■schwarz/unterstrichen bzw. grün:
1Die Beispiele sind auf grammatischer Ebene in der jeweiligen Sprache regelkonform. Die Regeln sind zudem mit den entsprechenden Regeln der deutschen Sprache vergleichbar.
■blau:
1Die Beispiele sind auf grammatischer Ebene in der jeweiligen Sprache regelkonform. Die Regeln sind anders als die entsprechenden Regeln in der deutschen Sprache und für kontrastive Vergleiche besonders gut geeignet.
2Lautlich vergleichbare Verbmarkierungen
3„Semantische Freunde“; optimale Strukturen für kontrastive Vergleiche
■schwarz/kursiv bzw. rot:
1Die Beispiele sind auf grammatischer Ebene in der jeweiligen Sprache nicht regelkonform und sind demnach für Kontrastierungen ungeeignet.
2Semantische „Feinde“
Vorwort
„Kontextoptimierung“ ist ein mittlerweile weitverbreitetes Konzept, welches von Prof. Motsch (2017) entwickelt wurde. Mit großer Überzeugung habe ich über 15 Jahre nach den Prinzipien der Kontextoptimierung gearbeitet. Meine Überzeugung war v. a. auf die Lernfortschritte der Kinder zurückzuführen, ob in der Einzel-, Gruppen- oder Klassentherapie – Lernfortschritte, die zudem in mehreren randomisierten Interventionsstudien wissenschaftlich belegt wurden (Berg 2007; Riehemann 2008; Schmidt 2010).
„Kontrastoptimierung“ ist ein von mir entwickeltes Konzept, welches auf den Prinzipien der Kontextoptimierung basiert und sich speziell an Therapeuten mehrsprachiger Kinder richtet. Die Therapie mehrsprachiger Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen gehört nämlich für Sprachtherapeuten, Logopäden und Förderschullehrer zum Alltag und stellt zudem eine besondere Herausforderung dar (Berg 2014). Die Erstsprachen der Kinder werden konsequent in die Therapie einbezogen. Auch wenn der Therapeut keine oder nur wenige erstsprachliche Kompetenzen besitzt, kann er in kurzen, reflexiven Phasen oder in sogenannten zwischengelagerten Sequenzen die Erstsprache kontrastiv zur deutschen Sprache einbringen. Dies erhöht nach meinen Erfahrungen und ersten Untersuchungen (Da Cruz 2020) nicht nur zusätzlich die Fortschritte in der Zweitsprache Deutsch, sondern wirkt sich zudem positiv auf die Erstsprachen der Kinder aus.
Die nötigen Informationen (bspw. linguistischer Natur), Übersetzungen und phonetischen Transkriptionen der wesentlichen Zielstrukturen, bezogen auf 45 sprachtherapeutische Sequenzen, sind Bestandteil der vorliegenden Publikation.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt.
Ein herzlicher Dank gebührt Frau Oksana Pakhomova (russische Sprache), Frau Malgorzata Jankowska (polnische Sprache), Frau Anuschka Ocakdan Sledsens (türkische Sprache) und Frau Idalina Soares (portugiesische Sprache), die mir bei der Übersetzung behilflich waren und meine zahlreichen Fragen beantworteten. Das gleiche trifft auf meine Frau, Michèle Lorang, zu, die sich intensiv mit der portugiesischen Sprache auseinandergesetzt hat und viele Anregungen geben konnte.
Danken möchte ich aber v. a. Prof. Motsch, auch weil er mich dazu angeregt hat, eine Publikation im Bereich Mehrsprachigkeit zu verfassen. Last, but not least gebührt mein Dank selbstverständlich Prof. Grohnfeldt, der mir wertvolle Ratschläge vermitteln konnte.
Rollingen/Mersch, Januar 2021
Marc Schmidt
Abkürzungen
I
erwachsener Interaktionspartner
Int.Pro.
Interrogativpronomina
K
Kind
L1
Erstsprache
L2
Zweitsprache
m
männlich
P. E.
Person Einzahl
s
sächlich
SES
Sprachentwicklungsstörung
SLI
Specific Language Impairment
SOV
Subjekt-Objekt-Verb
SSES
spezifische Sprachentwicklungsstörung
SVK
Subjekt-Verb-Kongruenz
SVK-Regel
Subjekt-Verb-Kongruenz-Regel
SVO
Subjekt-Verb-Objekt
SVX
Subjekt-Verb-Ergänzung
V2
Verbzweitstellung
V2-Regel
Verbzweitstellungsregel
w
weiblich
1Grundlagen
Viele Kinder werden bereits kurz nach der Geburt von ihren Eltern in Kindertagesstätten angemeldet, die Mehrsprachigkeit fördern und in denen zwei Sprachen gleichzeitig gelernt werden. Die Eltern wollen sicher gehen, dass ihr Kind den Kitaplatz zum gewünschten Zeitpunkt definitiv erhält (Fürstenau/Gomolla 2011).
Die Vorteile der mehrsprachigen Erziehung wurden in den letzten Jahren aufgrund einer Vielzahl an wissenschaftlichen Studien deutlich. So wurde festgestellt, dass kleine Kinder sehr wohl in der Lage sind, unter günstigen Bedingungen zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen und beide Sprachen früh zu trennen. Es ist den Kindern möglich, in beiden Sprachen bei ausgeglichener Mehrsprachigkeit monolinguale Kompetenzen zu erwerben – Kompetenzen, die in beiden Sprachen mit einsprachig aufwachsenden Kindern vergleichbar sind. Auch konnte Bialystok (2010) bereits 2001 in unterschiedlichen kognitiven Tests feststellen, dass viele bilinguale Kinder im Vergleich zu monolingual aufwachsenden geistig flexibler und leistungsfähiger in ihrer Wahrnehmung sind. Dadurch können sie bspw. leichter grammatische Regeln erfassen und verfügen über ein ausgeprägtes metasprachliches Bewusstsein. Diese positiven Befunde werden durch neueste Ergebnisse aus der Hirnforschung untermauert, die auf eine kompaktere Repräsentation der Sprachen im Sprachareal von Früh-Mehrsprachigen im Vergleich zu Spät-Mehrsprachigen hinweisen. Auch weitere Sprachen werden von ersteren leichter gelernt, diese werden an die ersten beiden Sprachen direkt „angedockt“ (Riehl 2013).
Vorteile der mehrsprachigen Erziehung
Man muss sich aber – trotz großem Enthusiasmus, der zunehmend bei Eltern oder in politischen Ansprachen zu vernehmen ist – weiterhin bewusst sein, dass Mehrsprachigkeit in Verbindung mit erschwerenden Faktoren zu eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen führen kann. Als solche Faktoren gelten ungünstige soziale Bedingungen, v. a. niedriger Sozialstatus (Statistisches Bundesamt 2007), ein wenig sprachförderliches Umfeld (z. B. durch einen qualitativ und quantitativ unangemessenen Sprachinput in beiden Sprachen) und/oder zu früher Abbruch der Förderung des Erstspracherwerbs (v. a. bei Kindern mit Migrationshintergrund). Seit einigen Jahren wird auf geringere Bildungserfolge und eine gefährdete Integration in die Gesellschaft von Kindern mit Migrationshintergrund hingewiesen (Triarchi-Hermann 2005; Tracy 2008). Auf immerhin 15% bis 25% der mehrsprachigen Kinder (Paul 2000; Motsch 2011) scheint dies zuzutreffen. Diese Kinder profitieren nicht von den Vorteilen einer mehrsprachigen Erziehung. Im Gegenteil: Sie sind aus den oben erwähnten Gründen bereits in einem frühen Alter auf eine systematische und intensive Förderung bzw. auf therapeutische Hilfen angewiesen. Besonders trifft dies auf die 6% bis 8% an Kinder zu (Grimm 2000), die sowieso aufgrund einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung eine intensive Therapie brauchen.
erschwerende Faktoren
Therapiekonzept
In der vorliegenden Publikation steht die Therapie mehrsprachiger Kinder im Mittelpunkt (Kap. 5). Wichtige Erkenntnisse im Bereich der allgemeinen Förderung mehrsprachiger Kinder, die zugleich die Basis des therapeutischen Vorgehens darstellen, werden im 4. Kapitel erläutert. Die eigentliche Therapie sollte – wenn nur irgendwie möglich – auf die eine oder andere Art und Weise beide Sprachen einbeziehen und durch eine parallele Förderung zu Hause und/oder in der Schule zusätzlich unterstützt werden. Heute weiß man, welchen Stellenwert die Erstsprache für die gesamtsprachliche Entwicklung hat und wie wichtig der Einbezug beider Sprachen in Förderung und Therapie mit dem Ziel einer erhöhten Therapieeffizienz ist (Kap. 4) (Wagner 2018a; 2018b; Groba 2018). Mit der Kontrastoptimierung (in Anspielung an die Kontextoptimierung,Motsch 2017) wird ein solches Konzept präsentiert:
Deutsch im Vordergrund
■In den therapeutischen Einheiten (ob in der Einzel- oder Gruppentherapie) steht die Zweitsprache Deutsch im Vordergrund. Die Therapie basiert auf den „Essentials“ der Kontextoptimierung, die nicht nur im mono-, sondern v. a. auch im bilingualen Kontext zu höchst signifikanten Fortschritten innerhalb von überschaubaren Zeitfenstern in der Zweitsprache geführt hat (Berg 2007; Motsch/Riehemann 2008; Schmidt 2010). Kontrastoptimierung versucht, die bewährten Prinzipien der Kontextoptimierung auf der Basis von kontrastiven Analysen erst- und zweitsprachlicher Zielstrukturen in den Mittelpunkt zu stellen. Das jeweilige Therapieziel wird in der Zweitsprache Deutsch festgelegt und mit den entsprechenden Strukturen in der Erstsprache der Kinder verglichen (Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden bestimmt). Auf diese Weise kann die Therapie in der Zweitsprache optimiert und, wenn möglich, eine parallele Therapie in beiden Sprachen ermöglicht werden. Der simultane Gebrauch beider Sprachen „begünstigt die zeitnahe Generalisierung von Informationen und Regelableitungen in beide Sprachen“ (Scharff 2013, 173).
Erstsprache einbeziehen
■Innerhalb der konkreten Therapieeinheiten, die im 5. Kapitel chronologisch vom Erwerb erster sprachlicher Fähigkeiten bis hin zum Erwerb komplexer Strukturen präsentiert werden, werden unterschiedliche Erstsprachen einbezogen: Französisch und Portugiesisch, stellvertretend für die romanischen Sprachen, Russisch und Polnisch, stellvertretend für die slawischen Sprachen, und Türkisch als meistgesprochene Sprache innerhalb der Familie der Turksprachen (gehört zur altaischen Sprachgruppe). Zusätzlich wird in einem kurzen Exkurs auf die Besonderheiten des Italienischen, als weitere romanische Sprache, hingewiesen.
1Der Sprachtherapeut hat die Möglichkeit, innerhalb der Therapieeinheit punktuell auf die Erstsprache (L1) zurückzugreifen, v. a. mit dem Ziel, beide Sprachen in sogenannten reflexiven (metasprachlichen) Phasen gegenüberzustellen. Die Kontrastierung grundlegender Sprachstrukturen, den sogenannten Meilen- bzw. Stolpersteinen des Spracherwerbs, führt zum schnelleren (bewussten) Erfassen grammatischer Regeln. Durch das Arbeiten innerhalb desselben semantischen Feldes in beiden Sprachen können sprachübergreifende Kontraste und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden.
punktuelle, reflexive Phasen
2Der Therapeut hat auch die Möglichkeit, die Erstsprache innerhalb von „zwischengelagerten“ Therapiesequenzen in den Vordergrund zu stellen, indem er bspw. ein Buch sprachlich prägnant (Hervorhebung wichtiger Strukturen, der sogenannten Trigger) in der Erstsprache erzählt und als Rollenspiel umsetzt, oder indem er mit dem Kind ein Sprachspiel in dessen Erstsprache durchführt. Innerhalb verschiedener Rahmenthemen werden die wichtigen Zielstrukturen in den oben erwähnten Erstsprachen dargestellt (Kap. 5), sodass der Therapeut praktisch über keine Vorkenntnisse in der jeweiligen Erstsprache verfügen muss. Die eigene Erfahrung zeigt, dass die Kinder stolz sind, wenn sie in ihrer Muttersprache die „Fachleute“ sind und bspw. dem Therapeuten bei der Aussprache helfen. Dieser kann dies gezielt ausnutzen, indem er durch die nicht-zielsprachliche Aussprache die Aufmerksamkeit auf bestimmte Endungen fokussiert.
zwischengelagerte Sequenzen in L1
■Im 4. Kapitel steht, wie bereits erwähnt, die Sprachförderung im Vordergrund, zu Hause oder in der Kindertagesstätte oder im Kindergarten. Diese schließt – genau wie die Sprachtherapie – kompetente Sprachvorbilder und ausreichende Gelegenheiten, sich selbst zu äußern, sprachlich aktiv zu werden, mit ein (ob in der Erst- oder Zweitsprache). Die Prinzipien einer effektiven mehrsprachigen Förderung, die im 4. Kapitel erarbeitet werden, bilden gleichzeitig die Grundlage der im 5. Kapitel ausführlich dargestellten Therapie. Weil Sprachförderung und –therapie besonders effektiv sind, wenn sie gemeinsame sprachliche Ziele verfolgen, erhöht der regelmäßige Austausch zwischen Eltern, Lehrer und Sonderschullehrer oder Sprachtherapeuten den Therapieerfolg.
Förderung als Grundlage der Therapie
fehlende Therapiekonzepte
„Es liegen bisher keine spezifischen Therapiekonzepte für die sprachtherapeutische Intervention mit mehrsprachigen Kindern diverser Sprachenkombinationen vor“ (Scharff 2013, 175).
Im Bereich Therapie bei Mehrsprachigkeit gibt es tatsächlich sehr wenige Veröffentlichungen (Wagner 2018b). Erstaunlich, wenn man sich die oben erwähnten Prozentwerte von Kindern, die sprachliche Schwierigkeiten aufweisen, in Erinnerung ruft.
Kontrastoptimierung: erste Charakteristika
Die Effektivität der Therapie mehrsprachiger Kinder soll anhand der Kontrastoptimierung dadurch erhöht werden, dass
■die Therapie der deutschen Sprache als Therapie einer Zweitsprache verstanden wird.
■die Erstsprachen der Kinder einbezogen werden: Dies geschieht v. a. punktuell in reflexiven Phasen in der Therapie, im Unterricht und in der Therapie, aber auch zusätzlich in parallelen, „zwischengelagerten“ Sequenzen, sowie zu Hause anhand abgesprochener Zielstrukturen.
■Erst- und Zweitsprache konsequent kontrastiert werden: Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden bewusst wahrgenommen.
■die Kontrastierung auf den zentralen Regeln, die zumeist durch eine erhöhte Komplexität gekennzeichnet sind, beruht. Diese stellen besondere Stolpersteine im Zweitspracherwerb dar und führen häufig zu langwierigen Stagnationen im Spracherwerb. Ausgangspunkt sind die Regeln der Zweitsprache Deutsch, die den vergleichbaren Regeln der Erstsprache gegenübergestellt werden.
Inhalt der Publikation
Im 1. Kapitel werden in kurzer Form wichtige Grundlagen der mehrsprachigen Erziehung erläutert, im 2. Kapitel die oben erwähnten Erstsprachen v. a. auf phonologischer und grammatischer Ebene analysiert und mit dem Deutschen kontrastiert (als wichtige Basis von Diagnostik, Förderung und Therapie) und im 3. Kapitel einige zusätzliche Überlegungen zur Diagnostik im mehrsprachigen Bereich vorgenommen. Abschließend werden Sprachförderung und -therapie (4. und 5. Kapitel), wie oben erwähnt, ausführlich dargestellt.
1.1Sprachen Europas
Weltweit existieren etwa 5.000 bis 7.500 Sprachen – je nachdem, ob bestimmte Varietäten als eigenständige Sprachen angesehen werden –, die sich nach sprachstrukturellen Aspekten zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Historisch gesehen gehören viele europäische Sprachen der indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachfamilie an, der mit über drei Milliarden Sprechern größten Sprachfamilie:
■die westgermanischen (u. a. Englisch, Deutsch und Niederländisch) und nordgermanischen Sprachen (u. a. Dänisch, Schwedisch und Norwegisch)
indoeuropäische Sprachfamilie
■die romanischen Sprachen (u. a. Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch)
■die südslawischen (u. a. Bulgarisch, Serbokroatisch, Bosnisch, Slowenisch und Mazedonisch), westslawischen (u. a. Polnisch, Slowakisch und Tschechisch) und ostslawischen Sprachen (u. a. Russisch, Belorussisch und Ukrainisch)
Finnisch, Ungarisch, Estnisch und Lappisch gehören (als „Sprachinseln“ innerhalb Europas) nicht zur indogermanischen Sprachfamilie, sondern zu den finnougrischen Sprachen. Türkisch ist die meistgesprochene Sprache innerhalb der altaischen Sprachen, gefolgt von Aserbaidschanisch und Usbekisch. Beide Gruppen, die finnougrische und die altaische, gehören zur ural-altaischen Sprachfamilie.
ural-altaische Sprachfamilie
Die Sprachen innerhalb einer Sprachfamilie sind in der Regel demselben Sprachtypus zuzuordnen – unterschieden wird v. a. in flektierende, agglutinierende und isolierende Sprachen (Kap. 2) – und weisen dadurch vielfältige sprachstrukturelle Gemeinsamkeiten auf. Türkisch, als agglutinierende Sprache, und Deutsch, als flektierende Sprache, unterscheiden sich in vielen Bereichen grundlegender als Englisch und Deutsch, beide westgermanische Sprachen (obschon Englisch als schwach flektierende Sprache gilt).
Sprachtypus
Sprachstrukturelle Gemeinsamkeiten auf phonologischer, semantischer oder grammatischer Ebene führen in der Regel zu schnellen Lernfortschritten im Erwerb einer Zweitsprache. Sprachstrukturelle Differenzen stellen eine große Herausforderung dar und stehen in der Sprachförderung und -therapie besonders im Fokus.
Viele Länder Westeuropas sind durch eine multikulturelle und vielsprachige Schülerschaft geprägt, u. a. durch die Öffnung des Arbeitsmarktes (Vertrag von Rom 1957), Krieg, Vertreibung, Furcht vor Verfolgung oder materiellen Notstand. In Deutschland ist der prozentuale Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung in den letzten Jahren stetig gestiegen, bis auf heutzutage etwa jeden vierten Einwohner und sogar auf über 35 % unter den Kindern. Staatsangehörige aus der Türkei bilden die weitaus größte ausländische Personengruppe (13,4 %), gefolgt von polnischen (7,8 %) und syrischen (6,9 %) Staatsangehörigen (BAMF 2019). In Österreich lebten 2020 etwa 2,07 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (23,7 % der Gesamtbevölkerung). Die meisten Ausländer stammen aus Deutschland, Rumänien, Serbien und der Türkei (Statistik Austria 2020). In der Schweiz liegt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund bei knapp 37,5 % (Bundesamt für Statistik 2020), der größte Anteil stammt aus Italien, Deutschland, Portugal und Frankreich.
multikulturelle Gesellschaft
Inwieweit Kinder mit Migrationshintergrund auch tatsächlich mehrsprachig aufwachsen und wie hoch die Zahl der Kinder ist, die auch ohne Migrationshintergrund zu Hause mehrere Sprachen sprechen, ist nur schwer einschätzbar. Man kann davon ausgehen, dass etwa ein Drittel der Schülerschaft in Deutschland zwei- oder mehrsprachig aufwächst (Bredthauer 2020).
1.2Begriffsbestimmung
Definition
Als mehrsprachig wird eine Person bezeichnet, die ohne größere Schwierigkeiten in mindestens zwei Sprachen mündlich und schriftlich kommunizieren kann (Triarchi-Herrman 2005; Tracy 2008).
simultane und sequenzielle Zweisprachigkeit
Die Erstsprache (L1) eines Kindes (die Sprache, die das Kind von Geburt an hört) ist normalerweise auch dessen Muttersprache. Bei simultaner Zweisprachigkeit hat das Kind in der Regel eine „Muttersprache“ und eine „Vatersprache“, es hat also zwei Erstsprachen. Die Unterscheidung zwischen simultaner und sequenzieller Zweisprachigkeit basiert auf dem Zeitpunkt, an dem das Kind mit der Zweitsprache (L2) in Kontakt kommt. In etwa bis zum 3. Lebensjahr, wobei dieses Alter in der Literatur unterschiedlich weit gedehnt wird, wird von simultaner Zweisprachigkeit gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Grundlagen der Erstsprache in wesentlichen Zügen erworben, wohl wissend, dass große interindividuelle Unterschiede im Erwerbsprozess bestehen.
Erwerbsverlauf der simultanen Zweisprachigkeit
Die simultane Zweisprachigkeit „ist in den letzten dreißig Jahren international in vielen Studien erforscht worden“ (Tracy 2008, 106). Der Erwerbsverlauf ähnelt in beiden Sprachen dem monolingualen Erwerbsverlauf (Erwerbsverlauf bei einsprachiger Erziehung, daher auch die Bezeichnung „doppelter Erstspracherwerb“), zumindest hinsichtlich des Erwerbs früher grammatischer Fähigkeiten. Ein doppelter Erstspracherwerb kann den Erwerb von monolingualen grammatischen Kompetenzen in beiden Sprachen ermöglichen, sofern das Kind in beiden Sprachen einen vergleichbaren Input und ähnliche Gelegenheiten zum Sprachgebrauch erhält (Siebert-Ott 2001; Reich/Roth 2002; Paradis et al. 2003; Müller 2005; Rothweiler 2006; Haberzettl 2015).
Der Spracherwerb mit dem Ziel der Mehrsprachigkeit sollte schon im Vorschulalter, am besten bereits vor Beginn des 3. Lebensjahres, gefördert werden, damit alle Kinder mit guten sprachlichen Voraussetzungen in das Bildungssystem eintreten können (Schulz 2011).
Bis etwa zum 6. Lebensjahr (die Angaben in der Literatur sind nicht immer einheitlich, zudem ist dieser Zeitpunkt auch als interindividuell variabel zu verstehen) wird vom frühkindlichen Zweitspracherwerb gesprochen.
frühkindlicher L2-Erwerb
Nach Meisel (2008) belegt die Forschung eindeutig, dass nicht nur bei doppelter Erstsprachigkeit, sondern auch beim frühkindlichen Zweitspracherwerb in jeder Sprache eine Kompetenz erworben werden kann, die der von Monolingualen qualitativ völlig entspricht. Der sukzessive Erwerb einer zweiten Sprache dauert im Vergleich zum monolingualen Erwerb normalerweise jedoch etwas länger (De Jong et al. 2008; Prévost 2009).
Tracy (2008, 158) geht sogar davon aus, dass sich „sprachliche Kompetenzen beim frühen Zweitspracherwerb geradezu erstaunlich schnell entwickeln, wenn die Erwerbsbedingungen stimmen, und in mancher Hinsicht noch den L1-Erwerb in den Schatten stellen.“
Erkenntnisse aus der Hirnforschung bestätigen dies. Kinder, die in ganz jungem Alter zwei Sprachen erwerben, bilden nur ein einziges neuronales Netz aus, morpho-syntaktisches Wissen wird in den gleichen zerebralen Strukturen verarbeitet. „Untersuchungen in der Computertomographie (CT) zeigen, dass bei der Nutzung beider Sprachen die gleichen Areale angezeigt werden“ (Hoppenstedt/Apeltauer 2010, 18), während bei spät erworbener Zweitsprache benachbarte Areale aktiv sind (Meisel 2008; De Simoni 2011).
neurologische Erkenntnisse
Es scheint demnach so zu sein, dass bestimmte Zeitfenster für den Erwerb einer Zweitsprache besonders günstig sind. Je später das Kind mit einer Zweitsprache in Kontakt kommt, desto mehr verschiebt sich der Zweitspracherwerb von einem schnellen, ungesteuerten, natürlichen Erwerb hin zu einem mühsamen und langwierigen Fremdsprachenlernen; das Zeitfenster des „mühelosen bilingualen Erwerbs“ schließt sich fortschreitend (Dalgalian 2000; Chilla et al. 2010). In der Regel kommt es zu dem, was man in der Forschung als „Fossilierung“ bezeichnet: „Grammatische Phänomene erreichen ein Plateau, von dem man sich nur sehr schwer wegbewegen kann“ (Tracy 2008, 128). Gemeint sind hier also Stagnationen in den zentralen Bereichen des Grammatikerwerbs, die den weiteren Spracherwerb erschweren. Es wird angenommen, dass Sprachen nicht mehr nach denselben Prinzipien wie beim Erstspracherwerb erworben werden. Nach dem 6. bis 7. Lebensjahr wird nicht mehr vom frühen, sondern vom späten Zweitspracherwerb gesprochen. Aus denselben Gründen ist eine frühe Intervention im Falle von Spracherwerbsschwierigkeiten sinnvoll.
später L2-Erwerb