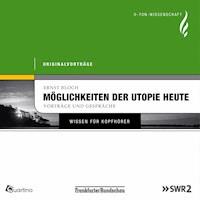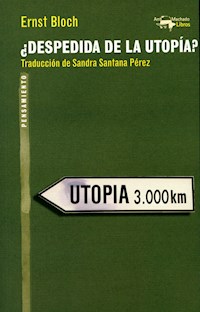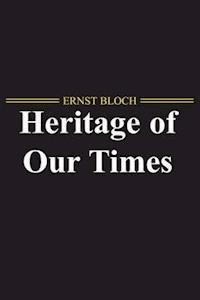15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für den in der Gesamtausgabe erschienenen Band »Spuren« hatte Ernst Bloch 21 Texte neu geschrieben. Diese erweiterte Ausgabe erscheint jetzt in der Bibliothek Suhrkamp. »Wie nun? Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.« Dieser Text aus den »Spuren« steht als Motto über Blochs Gesamtwerk, er ist auch das Thema der »Spuren«. Es sind »Spuren«, die hinführen zu Sinn und Deutung des Daseins, »im Erzählen merkend, im Merken das Erzählte meinend«. Es sind Spuren, die auch von der Geschichte der eigenen Jugend Blochs berichten. Diese Parabeln, die zu den Glücksfällen deutschen Denkens und deutscher Prosa gehören, sind heute so fabelhaft und wahr wie vor siebzig Jahren, als sie gesammelt, gedacht und geschrieben wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ernst Bloch
Spuren
Suhrkamp Verlag
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der Bibliothek Suhrkamp 54.
© 1969, Suhrkamp Verlag AG, Berlin
Erste Ausgabe: Berlin 1930 Paul Cassirer
Zweite Ausgabe: Frankfurt 1959 Bibliothek Suhrkamp
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag: Willy Fleckhaus
eISBN 978-3-518-75267-8
www.suhrkamp.de
FÜR SIEGFRIED UNSELD
INHALT
Zu wenig*
Schlafen
Lang gezogen
Immer darin
Sich mischen
Singsang
Kleiner Wechsel
Lampe und Schrank
Gut gewöhnen
Das Merke
LAGE
Die Arme
Der Schmutz
Das Geschenk
Verschiedenes Bedürfen*
Spielformen, leider
Das nützliche Mitglied
Schüttler für Erdbeeren*
Brot und Spiele
Kleinkarierte Mitstreiter*
Störende Grille
GESCHICK
Weiter geben
Der Schwarze
Die Wasserscheide
Kein Gesicht
Graf Mirabeau
Armer und reicher Teufel
Das Kätzchen als David*
Triumphe der Verkanntheit
Schreiber auf die Mairie*
Der edle Schein
Rokoko des Geschicks
Geist, der sich erst bildet
Der Busch
Das rote Fenster
Der Lebensgott
Motiv des Scheidens
Spuk, dumm und aufgebessert*
Fremdes Zuhause, urvertraute Fremde*
Pippa geht vorüber
Der lange Blick
Wiedersehen ohne Anschluß
Die gutmachende Muse
Rafael ohne Hände
DASEIN
Eben jetzt
Dunkel an uns
Fall ins Jetzt
Stachel der Arbeit
Nur durch Fleiß, sonst gar nichts, kommt Wohlstand*
Zehn Jahre Zuchthaus, sieben Meter Courschleppe*
Schweigen und Spiegel
Mittel, nicht gesehen zu werden
Die unmittelbare Langeweile
Augenblick und Bild
Potemkins Unterschrift
Ein Inkognito vor sich selber*
Motive der Verborgenheit
Nur klopfen
Der Bettzipfel
Kleine Ausfahrt
Grauen und glückliche Ahnung
Exkurs: Mensch und Wachsfigur
Daneben: Wirtshaus der Irren
Tableau mit Bogen*
Einige Schemen linker Hand
Der zweimal verschwindende Rahmen
Das Tor-Motiv
DINGE
Halb gut
Der nächste Baum
Blume und Anti-Blume*
Die Leidner Flasche
Die erste Lokomotive
Der städtische Bauer
Das Haus des Tags
Montagen eines Februarabends*
Ein verquerender Flaneur*
Das genaue Olivenessen*
Einen Punkt machen*
Der Rücken der Dinge
Gruß und Schein
Motive der Lockung
Anhang: Das Niemandsland
Ein russisches Märchen?*
Der witzige Ausweg
Enttäuschung mit Heiterkeit*
Die glückliche Hand
Motive des weißen Zaubers
Das Staunen
Der Berg
Tot und brauchbar*
Die Perle*
Texte mit* sind unveröffentlicht und erscheinen hier also zum ersten Mal. Sie gehören in den Entstehungszeitraum der »Spuren« (1910-1929), zu einem kleineren Teil sind sie für diese Ausgabe geschrieben worden.
ZU WENIG
Man ist mit sich allein. Mit den anderen zusammen sind es die meisten auch ohne sich. Aus beidem muß man heraus.
SCHLAFEN
An uns selbst sind wir noch leer. So schlafen wir leicht ein, wenn die äußeren Reize fehlen. Weiche Kissen, Dunkel, Stille lassen uns einschlafen, der Leib verdunkelt sich. Liegt man nachts wach, so ist das gar kein Wachsein, sondern zähes, verzehrendes Schleichen an Ort und Stelle. Man merkt dann, wie ungemütliches mit nichts als mit sich selber ist.
LANG GEZOGEN
Warten macht gleichfalls öde. Aber es macht auch trunken. Wer lange auf die Tür starrt, durch die er eine, einen erwartet, kann berauscht werden. Wie von eintönigem Singen, das zieht und zieht. Dunkel, wohin es zieht; wahrscheinlich in nichts Gutes. Kommt der Mann, die Frau nicht, die man erwartete, so hebt die klare Enttäuschung den Rausch nicht etwa auf. Sie mischt sich nur mit seiner Folge, einem Kater eigner Art, den es auch hier gibt. Gegen das Warten hilft das Hoffen, an dem man nicht nur zu trinken, sondern auch etwas zu kochen hat.
IMMER DARIN
Wir können nicht lange allein sein. Man langt damit nicht aus, in der allzu eignen Bude ist es nicht geheuer. Trotzdem nimt man sie überall mit, besonders wenn man jung ist. Viele werden dann sonderbar in sich zurückgeholt, sie machen sich stumm. Das rasselt wie mit Ketten hinunter und gräbt die ein, die nur in sich sind. Grade weil sie nicht aus sich herausgehen können, ängstigen sie sich, nämlich in der Enge, wo sie sind. In die sie getrieben werden, auch ohne daß sie etwas andres dahin brächte. Es gibt auch sonst nur vor dem Angst, was man nicht sieht. Was uns sichtbar bedrängt, vor dem gibt es Fürchten, sofern man schwächer ist, oder man tritt an. Aber gegen die Angst, weil sie aus uns allein kommt, wenn wir allein sind, hilft nur, sich zu lieben oder sich zu vergessen. Wer das nicht zulänglich kann, langweilt sich. Wer es kann, nimmt entweder sich wichtig oder das, was er außerhalb seiner tut, gleich wie es ist. Beides ist nicht so weit voneinander weg, wechselt auch bei den meisten ab. Läßt sie morgens aufstehen, auch wenn sie nicht müßten, und tagsüber löst sich beides erst halb.
SICH MISCHEN
Ists gut? fragte ich. Dem Kind schmeckt es bei andern am besten. Sie merken nur bald, was dort auch nicht recht ist. Und wäre es zuhause so schön, dann gingen sie nicht so gern weg. Sie spüren oft früh, hier wie dort könnte viel anders sein.
SINGSANG
Merkwürdig, wie das manche halten, sieht sie niemand. Die einen schneiden morgens Gesichter, noch andre tanzen sich eins, die meisten summen sinnlos vor sich hin. Auch in Pausen, beim Zahlen etwa, summen manche etwas, das man nicht versteht, das sie selber nicht hören, in dem aber viel darin sein mag. Da fallen Masken ab oder ziehen neue auf, je nachdem, närrisch genug ist die Sache. Allein sind viele etwas irr, sie singen ein Stück von dem, was früher mit ihnen los war und nicht fest geworden ist. Sie sind schief und geträumte Puppen, weil man sie gezwungen hat, noch schiefer und öder erwachsen zu werden.
KLEINER WECHSEL
Ich kannte einen, der machte nicht viel von sich her. Zwar als Kind, sagte er, sei er recht stolz gewesen, beim Spiel mußte er der erste sein. Wer nicht parierte, wurde gehauen und meistens blieb der zarte Herr oben, schon weil der andre nicht recht zuschlug.
Aber danach war das freilich weg, mit einem Schlag, wie verschluckt. Wir aus seinen unteren Klassen erinnerten uns noch: er war damals ein recht jämmerlicher Junge gewesen. Die Flegeljahre der andern tobten sich an dem neuen Feigling aus, tauchten ihn ins Bad, banden auf dem Spielplatz einen Strick an sein Bein, und er mußte hüpfen. Einem Jungen, der ihm am wenigsten getan hatte, nahm er das Heft weg, wonach der andre bestraft wurde; kurz, es war ein armseliger Bursche geworden, schlecht und haltlos. Aber nun geschah etwas Merkwürdiges: mit vierzehn Jahren oder etwas später, so im ersten Schuß der Pubertät, kam eben das stolze Kind wieder, der erbärmliche Junge fiel ab, seine Art schlug zum zweiten Mal um, er wuchs kräftig und wurde bald der Führer in der gleichen Klasse. Er hatte Sprüche am Leib, mit ziemlich echtem Kraftgefühl, frecher Überzeugung und wenig Pose; in Wirtschaften ging er mit dem Ruf: Hut ab, Fritz Klein kommt; die Bürger saßen sowieso ohne Hut. Ein andrer, auch etwas späterer Spruch war: wer mich ablehnt, ist gerichtet; doch so dummes Zeug hätte er gar nicht zu sagen brauchen, es war jetzt um den Jungen ohnehin etwas, was ganz merkwürdig und eigentlich schwer erklärlich ist und was er mit manchen teilt, denen ich später begegnet bin und die, übrigens, nicht immer die Besten waren: er strahlte Macht aus, man konnte sich ihr kaum entziehen.
Doch der gleiche Mann erzählte nun weiter: als er sich, natürlich lange Jahre später, er saß in guter Assiette und war in Amt und Würde, ein Haus einrichtete, hatten die Handwerker plötzlich ein Gefühl, vielmehr einen alten, längst vergessenen Spaß an ihm, den er gar nicht näher beschreiben könne, aber die eine Seite von früher war wieder da, wenigstens verhielten sich die Kerle danach und grinsten. Also etwas in ihm, meinte er, mußte nicht gestimmt haben, mindestens aus der schlechten Zeit weich geblieben sein. Wenn Hunde das Geschlecht von Menschen riechen, so hatten die Handwerker in der kleinen Stadt (und was für welche) eine andre Witterung, die doch ebenso genau war. Eine ferne Erinnerung wurde ihm selber frisch, und er wollte an ihr gelernt haben, daß über innere Untaten kein Gras wächst, ja daß man immer wieder ein Feiges, das man war, sein, und ein Schlechtes, das man getan hat, tun kann, wenn es die nachgeborenen Brüder der alten Zeit so deutlichmerken.
Einer unter uns, der überhaupt nicht an das eine Ich glaubte, suchte hier freundlicher zu deuten. Aber es kommt freilich auf die Lage an, in der der Mensch ist; je nachdem werden die kümmerlichen oder die wohlwollenden Airs, die schwachen oder starken Handlungen Luft bekommen. Hätte der ehrliche Mann für das neue oder vielmehr Kinder-Ich, das da mit vierzehn Jahren wieder anrollte, kein Geleise gehabt, so hätte er das lehrreiche Zeug gar nicht erzählen können. Sondern die Handwerker hätten ihn im Leibblatt gefunden, dort, wo die kleinen Schufte unter die Räder kommen oder gehängt werden, besonders die haltlosen und rückfälligen.
LAMPE UND SCHRANK
Einer meinte, das Einzige, was heute noch lebt, hat man nur zu zweit, höchstens zu dritt. Er dachte an Liebe, Freundschaft, Gespräch; es war ein gütiger, verzweifelter Mann, der im Betrieb fror und nicht sah, was da allgemein herauskommen könnte. Er machte sich, bei alldem, gar nichts aus individuellen oder großkopfigen Menschen, sondern war ganz auf Seiten der Masse, freilich einer rechten, lebendigen, jetzt nicht seienden. So zog er sich, so unbürgerlich wie möglich, auf die kleine bürgerliche Seite zurück, nicht ins Haus, aber dorthin, wo noch eine Lampe auf dem Tisch stand.
Doch ein andrer erzählte: als ich mir ein Zimmer einrichtete und es recht gesellig meinte, ist etwas Sonderbares geschehen.Alte Möbel hatte ich eingekauft, doch wie ich fertig war, merkte ich, vielmehr Frauen und Freunde merkten, daß sozusagen alle Stühle fehlten. An den Wänden standen Truhen, Kredenzen, mittlere Schränke und vor allem große, in der Mitte lag ein Teppich, der den Raum füllte; doch freilich: die Gelegenheit zum Sitzen, zum Gespräch, das ich zu lieben glaubte, hatte ich vergessen. Selbst die Lampen, die freilich nicht vergessenen, standen weniger gesprächsbereit, lesegerecht als bestrahlend und auswendig; wie herabgestiegene Wandarme. Was der Mann ist, sagte eine kluge Frau, sieht er vor sich ziehen; doch so sehr Mann, meinte der Erzähler, sollte man auch nicht sein oder so sehr einer, der alles bloß an der objektiven Wand ziehen und stehen hat. Der in diesem Fall auch so wenig objektiv war, möglicherweise, daß sein Zimmer doch nur schöne, schwere, stolze Schaudinge trug, fast wie eine Frau. Es war mir eine Lehre, schloß der erstaunte Einridtter, und er besuchte seinen Freund, eben den, von dem oben erzählt wurde, und der so menschlidt war, daß er selbst noch die dicken Krawatten haßte.
GUT GEWÖHNEN
Denen es bloß etwas schlecht geht, die spüren das ziemlich genau. Wenigstens in ihrem Gefühl; in ihrem Wissen sieht es trüber aus, da lassen sie sich leimt ablenken. Aber wie ihr Leib macht ihr Gefühl das Stampfen und Schaukeln des Wagens genau mit, der sie morgens in die Fabrik oder die Schreibstuben fährt. Höchstens die Gewöhnung hilft da etwas, als ein sehr leichtes Rauschmittel, das man kaum als solches erkennt. Denn das ganze bürgerliche Leben ist davon durchsetzt und erträgt sich nur daraus. Wird dagegen die Lage ganz verzweifelt, nicht nur eintönig, sondern vernichtend schlecht, so bildet sich ein viel stärkeres Gegengift, eines aus uns selbst. Schon Knaben haben einen sonderbaren Rausch wenn die Noten immer schledtter werden und das Unglück wirklich im Flug ist. Erwachsene spüren das anders, aber verwandt: hat einer auf die letzte Karte gesetzt und alles verloren, so kommt zuweilen ein ganz täuschendes Glück, so am Ende zu sein. Ein weiches Glück, das die Schläge auffängt, so daß sie eine Zeitlang wenigstens vorbei oder daneben gehen. Kräfte kommen keine daraus, aber während uns die Gewöhnung absetzt und betäubt, ist der kleine, funkelnde Rausch im Unglück der Genuß eines Trotzes, sogar eines, der es scheinbar nicht einmal mehr nötig hat zu trotzen, der sonderbar frei macht, wenn auch nur kurz. Da ist ein Stück Ungekommenes verborgen, teils als Notpfennig, teils als Lampe, und nicht nur als innerliche.
DAS MERKE
Immer mehr kommt unter uns daneben auf. Man achte grade auf kleine Dinge, gehe ihnen nach.
Was leicht und seltsam ist, führt oft am weitesten. Man hört etwa eine Geschichte, wie die vom Soldaten, der zu spät zum Appell kam. Er stellt sich nicht in Reih und Glied, sondern neben den Offizier, der »dadurch« nichts merkt. Außer dem Vergnügen, das diese Geschichte vermittelt, schafft hier doch noch ein Eindruck: was war hier, da ging doch etwas, ja, ging auf seine Weise um. Ein Eindruck, der über das Gehörte nicht zur Ruhe kommen läßt. Ein Eindruck in der Oberfläche des Lebens, so daß diese reißt, möglicherweise.
Kurz, es ist gut, auch fabelnd zu denken. Denn so vieles eben wird nicht mit sich fertig, wenn es vorfällt, auch wo es schön berichtet wird. Sondern ganz seltsam geht mehr darin um, der Fall hat es in sich, dieses zeigt oder schlägt er an. Geschichten dieser Art werden nicht nur erzählt, sondern man zählt auch, was es darin geschlagen hat oder horcht auf: was ging da. Aus Begebenheiten kommt da ein Merke, das sonst nicht so wäre; oder ein Merke, das schon ist, nimmt kleine Vorfälle als Spuren und Beispiele. Sie deuten auf ein Weniger oder Mehr, das erzählend zu bedenken, denkend wieder zu erzählen wäre; das in den Geschichten nicht stimmt, weil es mit uns und allem nicht stimmt. Manches läßt sich nur in solchen Geschichten fassen, nicht im breiteren, höheren Stil, oder dann nicht so. Wie einige dieser Dinge auffielen, wird hier nun weiter zu erzählen und zu merken versucht; liebhaberhaft, im Erzählen merkend, im Merken das Erzählte meinend. Es sind kleine Züge und andre aus dem Leben, die man nicht vergessen hat; am Abfall ist heute viel. Aber auch der ältere Trieb war da, Geschichten zu hören, gute und geringe, Geschichten in verschiedenem Ton, aus verschiedenen Jahren, merkwürdige, die, wenn sie zu Ende gehen, erst einmal im Anrühren zu Ende gehen. Es ist ein Spurenlesen kreuz und quer, in Abschnitten, die nur den Rahmen aufteilen. Denn schließlich ist alles, was einem begegnet und auffällt, dasselbe.
LAGE
DIE ARME
Was tun Sie? fragte ich. Ich spare Licht, sagte die arme Frau. Sie saß in der dunklen Küche, schon lange. Das war immerhin leichter als Essen zu sparen. Da es nicht für alle reicht, springen die Armen ein. Sie sind für die Herren tätig, auch wenn sie ruhen und verlassen sind.
DER SCHMUTZ
Wie man doch sinken kann. Das hörte ich gestern, mit allem, was dazu gehört.
In der rue Blondel lag ein betrunkenes Weib, der Schutzmann packt an. Je suis pauvre, sagt das Weib. Deshalb brauchst du doch nicht die Straße zu verkotzen, brüllt der Schutzmann. Que voulez vous, monsieur, la pauvreté, c’est déjà á moitié la saleté, sagt das Weib und säuft. So hat sie sich beschrieben, erklärt und aufgehoben, im selben Zug. Wen oder was sollte der Schutzmann noch verhaften.
DAS GESCHENK
Alles kann man für Geld haben, sagt man. Nur das Glück nicht; aber konträr: grade dieses, Kinder fangen früh damit an. Ein achtjähriges Mädchen hatte vor kurzem einen Jungen vorm Ertrinken gerettet. Vielmehr solange geschrieen, als es den blauen Burschen sah, bis Leute kamen und ihn herauszogen. Für sein Schreien bekam das Kind vom Nikolaus zwanzig Mark, viel Geld, nicht zuviel, wie man hören wird. Denn als das Mädchen wieder einmal zum Fenster hinaussieht, etwas Längliches treibt auf dem Wasser, so stürzt es vors Haus: »Herr, da schwimmen wieder zwanzig Mark!« (Es war aber nur ein Baumstamm.) Bedenkt man die Folgen, die sonst mit dergleichen verbunden sein können (dem Anblick von Wasserleichen und so fort), so wurde hier das Trauma doch merkwürdig durch Geld gelöst, ja verhindert. Doppelt Böses hob sich auf, der Mädchenengel kam zur Ruhe. Es ist das unterste Unglück: arm zu sein. Sankt Nikolaus, der selten kommt, hebt es nicht auf, aber stellt es wenigstens richtig hin.
VERSCHIEDENES BEDÜRFEN
Man erzählt, ein Hund und ein Pferd waren befreundet. Der Hund sparte dem Pferd die besten Knochen auf, und das Pferd legte dem Hund die duftigsten Heubündel vor, und so wollte jeder dem anderen das Liebste tun, und so wurde keiner von beiden satt. Das gibt genau ein Elend noch zwischen sich nächsten Menschen wieder, vorab verschiedenen Geschlechts, wenn sie nicht aus ihrem eigenen Haus können, aber auch zwischen loser vertrauten. Bescheidener Anspruch an das gar allgemein, üblicherweise zum Guten Gereichte hilft freilich viel. Denn sieht man die Heubündel, den Abend, den Sonntag der meisten Menschen, so begreift man nicht, wie sie am Leben bleiben können.
SPIELFORMEN, LEIDER
1.
Nach viel sah der Tag heute nicht aus.
Kein Geld, auch Paris wird dann kleiner. Ging in die alte Arbeiterkneipe, es gibt schlechtere, die nicht billiger sind.
Da sah ich aber einen, der ging auf. So richtig, so schuldlos genießend, wie es sich gehört. Der Mann mir gegenüber hatte Hummer in den verschafften Fäusten, biß und spuckte rote Schale, daß der Boden spritzte. Doch dem zarten Wesen darin sprach er fröhlich zu, als er es einmal hatte, still und verständig. Endlich war hier ein Gut nicht mehr durch genießende Bürger geschändet; der Schweiß der Entbehrenden, die Schande der Kapitalrente schmeckte diesem da nicht mit. Seltsam genug in Paris, wo sich noch kein Bürger geniert, einer zu sein, sich nicht nur bequem, sondern auch stolz einen Rentier nennt. Am Arbeiter mit dem Hummer blieb noch andres erinnert, vom großen Einbruch damals, lange her. Erst recht schimmerte ein gewisses Später auf, wo das Geld nicht mehr um die Güter bellt oder in ihnen wedelt. Wo die überaus törichte Wahl zwischen reiner Gesinnung und reinem Bissen erspart bleibt.
2.
Man ging an diesem Abend durchaus nicht wie sonst. Rettete sich nicht vor der Straße, ihrer Mitte, auf der die Wagen sausten, links herauf, rechts herab, scharf und gegen uns.
Sondern endlich lebte diese Mitte, ja, es wuchs etwas auf ihr. Die Artillerie des besitzenden Verkehrs war gelegt, zog sich in die Ferne oder außen herum, der herrliche Asphalt wurde bewohnt. Farbige Papierlampen quer darüber machten niederen Raum, darin wurde getanzt. Häuser waren nun seine Wände, die erleuchteten Fenster ringsum glänzten als neue Lampen, wie selbstleuchtende Spiegel, nochmals mit Menschen darin. Und am schönsten war, daß sich der Tanzraum nur an den Seiten schloß, aber sonst die lange Straße für sich hatte, ihre Querstraßen dazu. An der nächsten Ecke spielte schon wieder Musik, und die Paare wanderten durch das leuchtende Quartier.
Das ist Pariser Straße am 14. Juli, dem großen Tag. Auch als die Bastille erstürmt wurde, hat das Volk getanzt, auf dem Boden, dem die Festung gleichgemacht worden war. Er vertrat die Wiese der Seligen, und das ist geblieben; freilich tanzte man damals anders nach der Natur. Aber haben sich die Revolutionäre auch beruhigt, längst Hörner und Flügel abgestoßen, so schießt doch durchs »Nationalfest« zuweilen noch ferne Erinnerung. Gar nicht in Bausch und Bogen der Nation zugehörig, sondern ohne Frieden mit dem gekommenen bourgeois gentil’homme. Denn als am 14. Juli 1928 ein Auto durch eine dieser Tanzstraßen vorstoßen wollte, von einem Herrn mit Strohhut gesteuert, machte das Volk nicht Platz, obwohl man gar nicht tanzte in diesem Augenblick und bloße Taxi schon in Menge durchgekommen waren. Wohl der Strohhut reizte auf, sonst ja nichts Besonderes, hier aber merkwürdigerweise ein Symbol der Herrenklasse, vielleicht wegen seiner Helle und weil sonst Maschinen nicht mit Strohhüten bedient zu werden pflegen. Der aufreizende Strohhut wich nicht, sondern gab Vollgas, durch die Menge hindurch. Doch zwanzig Fäuste hatten schon den Wagen von hinten gepackt, zogen ihn trotz des wütenden Auspuffs die Straße wieder herunter, hin und her, in schweigsamem Takt auf der freiwilligen Stechbahn; selbst der Propritétaire schaffte ruhig, mit einer gewissen finsteren Sportlust von Reaktion. Einmal nur wäre ihm der Durchstoß fast gelungen, da kam die zweite Herzensfreude: ein junges Mädchen sprang plötzlich vor den Wagen, tanzte lächelnd und furchtlos, eine Blume in der Hand, später im Mund, diktierte dem stoppenden Herrn die Bewegung, und als der Wagen stillhielt, verneigte sie sich mit großem, mit anmutigem Spott. Hier hätte sich nun der Fahrer wirklich zurückziehen lassen sollen, aber die herrschenden Klassen kapitulieren auch noch schief, abstrakt und undialektisch; kurz, statt die Lage zu fassen und sich in ihr aufzuheben, verwandelte der Provokateur die Kraft seines Vorstoßes in eine nicht minder anmaßende des Rückzugs, drehte um, fuhr bei dem schweren und falschen Manöver nun wirklich in die Masse hinein. Einige Frauen wurden an die Mauer gedrückt, die Männer hatten keinen Anlauf mehr hinter der kehrenden Maschine, so kräuselte sich die Luft sehr rasch, Schimpfworte fielen, das Auto wurde höchst putschistisch von der Seite gepackt und es wäre umgestürzt, hätte nicht der Propriétaire das Vordersteuer in die rechte Lage gebracht, und der Wagen schoß fliehend davon. Doch der Strohhut erfuhr wenigstens, was der weißen Lilie in jeglicher Gestalt zukommt. Ein junger Bursche hatte ihn dem Bürger vom Kopf geschlagen, warf ihn in die Höhe, andere fingen ihn auf, schon spielte die Musik wieder und die Paare tanzten, aber nicht nur mit Füßen und Leib, sondern die Hände hatten zu tun. Hatten den Strohhut zu suchen, wie er von einem Paar zum andern durch die Luft gestoßen ward, bis er endlich auf dem Boden lag, nivelliert und zertreten, ein sehr geringer, sehr allegorisch zerstampfter Stellvertreter der Bastille. Brave Taxifahrer, die jetzt daherkamen und den nahen Boulevard gewinnen wollten, machten sogleich kehrt; die Wirtschaftspartei beteiligt sich nicht am Bürgerkrieg. Und auch die Rebellenstraße hatte bald wieder vergessen, daß sie als einzige in Paris ein wenig 14. Juli getanzt hatte. So kam der Strohhut nicht einmal in einen Polizeibericht, geschweige denn in die Geschichte, sondern nur in diese kleine, wartende Erzählung.
3.
Ebenfalls in Paris hat ein ruhiger Mensch, zwei Jahre vorher, folgendes in Gang gebracht.
Der saß vor einem grünen Schnaps, bisweilen las er. Das Café war um diese Stunde sehr besetzt, die Gespräche lebhaft, politische Unruhe lag in der Luft. Der Gast hatte ein Buch bei sich, das ihn weit von Brotteuerung und Frankensturz führte oder auch gar nicht weit, nur waren schon dreißig Jahre seitdem vorüber. Seit dem fin du siede, wie man damals sagte, und die geputzten Menschen schienen es vergessen zu haben, trotz der Truppen, in den Kasernen »konsigniert«. »Doch ältere Leser«, so stand in dem Buch, »ältere Leser gedenken vielleicht noch der Zeit und der großen Aufregung, die durch die Welt ging, wenn die Zeitungen immer wieder, in ganz kurzen Abständen, von anarchistischen Bombenattentaten in Paris zu berichten wußten, die offenbar von einer weitverzeigten Bande ausgingen, deren die Polizei nur teilweise habhaft werden konnte. Scheinbar wahllos flogen die Bomben in Wohnhäuser wie in ein elegantes Café am Bahnhof St. Lazare, in die Deputiertenkammer und ein kleines Restaurant, selbst in die menschenleere Madeleinekirche. Eine Kaserne ging in die Luft, der serbische Gesandte wurde auf der Straße angeschossen, Sadi Carnot, der Präsident der Republik, auf der Fahrt zum Theater erdolcht. Es war die Zeit der Revachol, Vaillant, Henry, Caserio und andrer gefährlicher Propagandisten der Tat, die Zeit des Dynamits und der Verstecktesten Bedrohung bürgerlicher Gesellschaft und Gesittung.« Mitten in Gerüchte, ja in den nächtlichen Schrecken der Kinderzeit führte so das Buch: selbst die anarchistischen Bünde, die man ausgehoben hatte, trugen furchterregende Namen, wie aus Kolportage, die keinen Spaß kennt. Da waren »Die haarigen Burschen von Billancourt«, »Die Panther von Batignolles«, »Die Eichenherzen von Cettes«, »Die Kinder der Natur«, »Die Zuchthäusler von Lilie«, »Der Pranger von Sedan«, »Der Yatagan von Terre Noire«. Die Verschwörerblätter selbst führten am Ende, mitten unter harmlosen Anzeigen, eine ständige Rubrik mit der Überschrift: »Anweisung zur Herstellung nichtbürgerlicher Produkte«.
Hier mußte der Gast unterbrechen, denn ein junges Paar hatte an seinem Tisch Platz genommen und sprach. So elegant waren die beiden, wie die »Dame«, wie der »Herr« sich denkt, daß sie im Paradies angezogen seien. Jetzt erhob sich der ruhige Leser, ganz ahnungslos, er wollte sich nur Zigaretten holen, dachte gar nicht mehr an die Panther von Batignolles, sondern Nana lag ihm näher: – da geschah, kaum einen Schritt von dem Tisch entfernt, eine so entsetzliche Explosion, daß sie das Paar hochhob vor Schreck, Tische umfielen, die Passage Stillstand. Dem Leser selbst zitterten die Knie, doch im Ganzen war er unverletzt wie das Paar übrigens auch, was immerhin ein Zufall war; denn wie leicht hätten die Splitter der Syphonflasche verwunden können, die der Gast heruntergestoßen hatte, als er sich Zigaretten holen wollte. Der Direktor kam und verlangte Ersatz, der Leser zahlte ihn und freute sich fast schamhaft, so harmlos davongekommen zu sein. Auch im übrigen Café legte sich die leidenschaftliche Landschaft, das vornehme Paar bestellte einen frischen Aperitif, aus tiefem Instinkt mit der bloßen Geldbuße des Manns nicht ganz zufrieden. Dieser verließ auch bald den Schauplatz, das sehr historische Dynamitbuch unterm Arm, holte sich endlich die Zigaretten am Schanktisch, wie Friedenspfeifen, fuhr in sein gewohntes Restaurant. Dort erzählte er die heroische Geschichte, worin aus Pech ein Attentäter, aus einer Syphonflasche Weltgericht erschienen war. Rasch hatte sich der Geist wieder in die Flasche zurückgezogen; doch die dunkle Scham des Manns, der Ärger des Paars an seiner Strafe standen noch fühlbar in der Luft. Betroffenheit des Literaten, Erberinnerung der Bourgeoisie: beides spielte über dem unfähigen Ereignis. Spielte eine Vergangenheit nach, die nicht verging, eine Zukunft vor, von der sich selbst der Pariser Bürger nicht losgesprochen fühlt. Was ein Fest wurde wie der 14. Juli, ist gewesen; aber die Furcht, die einmal darin war, ist noch frisch. Speisten alle Arbeiter Hummer, so ritzten die Splitter der Syphonflasche keine Gefühle.
DAS NÜTZLICHE MITGLIED
Als Bernhard und Simon wieder einmal ihr Kaffeehaus betraten, Schach zu spielen, waren alle Bretter besetzt. Sie gingen daher zu zwei bewährten Spielern hin. Plötzlich rief Bernhard, der sich langweilte: »Ich wette fünf Mark, daß Westfal gewinnt!« Simon wettete auf Herrn Dyssel dasselbe. Zuerst merkten die beiden vorzüglichen Spieler gar nichts von der Wette, höchstens die Zustimmungen waren lauter und die Tadel schärfer. Doch bald wurden die Männer Rennpferde, auf die gesetzt war, und sie wurden es nicht nur, sondern fühlten sich auch selber als solche. Schließlich, Strich um Strich von der edlen Interesselosigkeit des Spiels abgetrieben, sahen sie sich als Lohnarbeiter, die für fremde Unternehmer, eingespannt in kapitalistischen Betrieb, Mühe der Arbeit und Verstand vergossen. Der Zorn des Siegers war völlig klar, als ihm Simon von der gewonnenen Wette, mit einem Bruchteil, den Kaffee bezahlen wollte; seine Arbeitskraft war im Leben schon genug ausgebeutet. Das Geschäft erlaubt manchen Spaß, aber der Spaß konnte erst recht wieder zum Geschäft werden. So genau unterliegt noch das Spiel den Formen, in denen der Ernst des Lebens abläuft; man kann daraus nicht fliehen, nicht einmal in der Flucht. Auch die Widerwilligsten nimmt das Kapital auf seine Flügel; einigen scheint dies in der Tat eine Erhebung.
SCHÜTTLER FÜR ERDBEEREN
Was reich ist, dem muß alles zum Besten dienen. Am Rand einer feinen Pariser Straße stand, wenig hergehörig, ein armer Teufel von Invalide. Ihm zitterten beide Hände, die Arme schlugen hin und her, das hatte er im Krieg davongetragen, ein sogenannter Schüttler. Brillat-Savarin kam vorbei, sah zu, gab keine milde Gabe wie sonst, aber beim Weggehen seine Adresse. Der Schüttler möge sich dort beim Koch melden, »pour sucrer les fraises«. Besser das freilich, als auf der ungemütlichen Straße zu stehen. Und Brillat-Savarin war immerhin ein erfindungsreicher Feinschmecker, seinesgleichen Freude bereitend. Aber der immerhin leckere Mann hatte mit dem nichts als reichen ersichtlich gemeinsam, daß er aus dem Elend noch besonderen Nutzen zog, ja es sich dankbar machen konnte. Statt von den vielen Armen gesprengt zu werden, schütteln diese ihm nur seine Erdbeeren, bedienen ebenso mechanisch höhere Maschinen. Ja, wächst beschäftigungslos oder vom dauernden Schüttelfrost ihrer Lage angeödet die Unzufriedenheit, so kann neuerdings selbst diese gebraucht werden, ablenkend, auf die Opfer ihresgleichen dressiert, doppelt betrogen, faschistisch. Das ist neu, bislang hatten die besseren Herren nur Lumpenproleten oder immerhin Landsknechte für sich. Keine Erbitterung, gar Revolte konnte von daher nach links gefährlich werden statt nach rechts. So wird Schmalhans ein besonders guter Küchenmeister derer, die ihn zu Schmalhans und weit Ärgerem gemacht haben. Nicht nur die Faust im Sack kommt dann auf keine schlechten Gedanken.
BROT UND SPIELE
Ich kenne einen, der plötzlich verarmte und sich gezwungen sah, in eine üble Kammer zu ziehen. Am andern Tag, als er nach einer durchbissenen Nacht auf die Straße kam, erstaunte er, wie völlig nichts er vor sich selbst geworden war. Wie wichtig ihm die kleinen gewohnten Dinge fehlten: Farbe der Wand, das wohlige Viereck des Schreibtischs, der runde Schein der Lampe, die er alle vordem mit sich ins Freie genommen hatte. Nur der Tabakrauch bildete noch einen Pufferstaat zwischen ihm und der kahlen Welt, trug ihn, umwölkte, pythisierte in etwas sein Ich. Widerlich fühlte sich der Mann durch den Gruß eines Hotelportiers geehrt, war geneigt, die kleine Macht nicht nur zuerst, sondern tief zu grüßen. So rasch sinken also Menschen zusammen, verlieren ihren Pol, wenn man ihnen die äußere Fixierung entzieht. (Selbst die Entsagenden, wo Armut ein großer Glanz von innen sein soll, haben sich immerhin, vor dem Auszug aus dem äußeren Haus, ein inneres gebaut, in dem Möbel, sogar Teppiche und Herrensessel durchaus nicht fehlen.) Das beste Schlafmittel ist der Schlaf und das beste Mittel, Sklaven in ihrem Stand zu halten, arm, »aber« ehrlich, scheint ebenso die völlige Armut selber. Denn wie das Grundgefühl des Portiergrüßers zeigte, ist Armut an sich noch keineswegs rebellisch. Im Gegenteil: wie sie selbst nichts haben, woran sie sich greifen können, so strömt die volle Verachtung der Oberschicht in die nichts als Armen herein und hält sie bei der Stange. Sonst wäre rätselhaft, daß es nicht mehr »Verbrecher« gibt, die sich in Kürze holen, was nur die reiche Geburt oder der gerissene Betrug in Ehren gibt. Sonst wäre noch merkwürdiger, daß die paar Reimen die Macht halten können und die Arbeiter das va banque der Barrikade nicht auf jeden Fall ihrem Hundeleben vorziehen. Reißt nicht Hunger empor, der an sich freilich nur plündern läßt und so rasch beruhigt wie er satt wird, sprechen nicht vor allem Führer aus einer »andren Schicht« zu den Stummen herab, wie der Kapitän durchs Melderohr in den Heizraum eines Schiffs: so gehört jedenfalls ein ziemlich geheimnisvoller Antrieb dazu, revolutionär zu sein. Er stammt nie aus der Armut allein, die ihn oft verdeckt, sondern aus einem Gefühl unbesessenen »Besitzes«, der einem zukommt, aus einem verkleideten Glanz, der im Stand der proles explosiv wird. Der Ruf nach panis in Ehren, er hat viel Meuterei gebracht und setzt die ersten, nächsten, sachlichsten Wege; aber ohne den Ruf nach circenseshielte er nicht lange an und wäre überhaupt nichts, als revolutionär. Daß Aufruhr, bei so alter Sklavenzüchtung und Gewöhnung an sie, überhaupt möglich ist, das ist so ungewöhnlich, daß man, auf seine Weise, daran fromm werden kann.
KLEINKARIERTE MITSTREITER
Als es mir unpassend schien, noch länger an einer politischen Zeitschrift mitzuarbeiten, die sehr subalterne Beiträge hatte, antwortete mir ein davon unberührter Freund: »Wenn hundert Katzen vor dem Berliner Schloß stehen und miauen, so achte ich nicht darauf, daß es Katzen sind, sondern daß sie protestieren, stelle mich neben sie und miaue mit.« Das war zweifellos gut gegeben, das verwendete Bild stimmte. Nur: es gibt besonders heutzutage eine Unmenge Leute, die kein Recht darauf haben, recht zu haben. Die den kalten, gar vorher den heißen Krieg mitmachten und nun sozusagen dasselbe sagen wie rote Getreue, die mit viel gar uneins sind, was aus herrschenden Genossen geworden ist. Nur diese Art Unzufriedene, als eine bewährte, zum Unterschied von den bloßen Katzen des kalten Kriegs, kann heute ihren Mann stehen, buchstäblich ihren Mann mit Rat und Tat, nicht ihren opportunistischen Tagdieb.
STÖRENDE GRILLE
Die meisten werden dunkel gehalten und sich sehen sie kaum. Der Mann am fließenden Band, der acht Stunden am Tag dieselbe Bewegung machen muß, ist genau so verschollen wie der Bergarbeiter. Keiner liebt den fünften Stand um der schönen Augenwillen, die er schon hat.
Da bemerkte aber einer, der viel für die proles übrig und manches mit ihr getan hatte, also keine böswillige, gar feindliche, sondern mehr eine trauernde Figur, zu einem Kommunisten: »lm citoyen steckte der bourgeois; gnade uns Gott, was im Genossen steckt«. Er fügte hinzu: Deshalb seid ihr auch so vorsichtig und wollt nie sagen, wie es im neuen Leben aussieht. Sonst seid ihr preußisch präzis, lauter Gebot der Stunde, aber will man wissen, welche Gesellschaft da zum Durchbruch will, so werdet ihr österreichisch, verschiebt alles aufs morgen, gar übermorgen. Um 1789, als der dritte Stand revolutionär war, mußte man nicht so formal, auch kein so vorsichtiger Träumer sein. Damals waren immerhin mehr Inhalte da, der Kalif Storch von damals brauchte keine Katze im Sack zu kaufen und nur zu glauben, es sei eine verwunschene Prinzessin. Denn so vorsichtig ihr aufs Kommende seht, so träumt ihr doch dauernd ein Wunderbares, das in der Arbeiterklasse sei, hier seid ihr durchaus Gläubige. Hier betreibt ihr nicht nur die nüchterne Aufhebung von Not und Ausbeutung, sondern malt den ganzen Menschen, den neuen Menschen in die unentschiedene Gegend. Dabei ist der jetzige Prolet doch meist nur ein mißglückter Kleinbürger, läuft zu den Völkischen oder zu den Budikern ab, die auf dem roten Kanapee sitzen. Aus seinem Klassenbewußtsein hört ihr, obwohl ihr dicht darin zu sein glaubt, eine Weise heraus, die, bei uns wenigstens, nur sehr undeutlich oder gar nicht gespielt wird. Da fährt nur bare Unzufriedenheit und ein sehr verständlicher, sehr heutiger Lebenswille; sprengende Melodie ist so viel und so wenig darin, wie beim Wagengeräusch, auf das man sich auch allerhand singen kann, Sogar Genaueres.
So sprach der grillenhafte Mann und war heimatlos, trank nur manchmal aus der Subjekt- oder Freundschaftsflasche, wo ihm noch etwas Leben war. Er vergaß nur mit dem, was er dem Andren so zu schaffen machte, daß ihn der Genosse gar nicht enttäuschen kann. Denn er spiegelt doch grade nichts vor, zum Unterschied vom ehemaligen Bürger, der dann so enttäuscht hat. Am Sieg der bürgerlichen Klasse hat man, was große Worte, selbst menschliche Inhalte bedeuten, wenn der Grund nicht in Ordnung ist. Die proles ist doch grade die einzige Klasse, die keine sein will; sie behauptet nicht und kann allerdings nicht behaupten, daß sie als solche besonders großartig wäre, jeder Proletkult ist falsch und bürgerlich angesteckt. Sie behauptet nur, daß sie den Schlüssel zum menschlichen Speiseschrank hergibt, wenn man sie aufhebt, nicht aber, daß sie den Schrank mit sich führe oder gar, daß sie dieser sei. Sie lehrt grade radikal in ihrer völligen Entmenschung, daß es bisher noch kein menschliches Leben gegeben hat, sondern immer nur ein wirtschaftliches, das die Menschen umtrieb und falsch machte, zu Sklaven, aber auch zu Ausbeutern. Was dann käme? – wenigstens springt kein Ausbeuter heraus, ja sollte selbst noch etwas Schlimmeres geschehen, so ist doch reiner Tisch und man hat bar, was mit den freien Menschen los ist oder noch nicht an ihnen los ist. Auch ohne Armut wird man sich noch genug unähnlich oder falsch bedingt sein, es gibt noch Zufall, Sorgen, Geschick genug und kein Kraut gegen den Tod. Aber was im Genossen steckt, das steckt dann wirklich in ihm und nicht in Verhältnissen, die die Menschen noch schiefer machen als sie sind. Sprach der Kommunist, beunruhigte selber den Andern, war also gar nicht so gläubig; denn der Mensch ist etwas, was erst noch gefunden werden muß. Sowohl indem man den Sack von der Katze wegläßt, als auch indem man die mögliche Prinzessin erst besprechenmuß, bis sie es wird.
GESCHICK
WEITERGEBEN
Als der und jener scheint zwar jeder schon da. Aber keiner ist, was er meint, erst recht nicht, was er darstellt. Und zwar sind alle nicht zu wenig, sondern zuviel von Haus aus für das, was sie wurden. Später gewöhnen sie sich an die Haut, in der sie nicht nur stecken, sondern in die man sie auch noch gesteckt hat, beruflich oder wie sonst. Aber da fand einmal ein Bursche, weit von hier, einen Spiegel, kannte so etwas noch gar nicht. Er hob das Glas auf, sah es an und gab es seinem Freund: »ich wußte nicht, daß das dir gehört.« Dem andern gehörte das Gesicht auch nicht, obwohl es ganz hübsch war.
DER SCHWARZE
Einer blickte sich schon mehr an, grade indem er irrte. Spät abends kam ein Herr ins Hotel, mit Freunden, alle Betten waren besetzt. Außer einem, doch im Zimmer schlief bereits ein Neger, wir sind in Amerika. Der Herr nahm das Zimmer trotzdem, es war nur für eine Nacht, in aller Frühe mußte er auf den Zug. Schärfte daher dem Hausknecht ein, sowohl an der Tür zu wecken als am Bett, und zwar am richtigen, nicht an dem des Schwarzen. Auf die Nacht nahm man allerhand Scharfes, mit so viel Erfolg, daß die Freunde den Gentleman, bevor sie ihn ins Negerzimmer schafften, mit Ruß anstrichen und er es nicht einmal merkte. Wie nun der Hausknecht den Fremden geweckt hatte, er rast an den Bahnhof, in den Zug, in die Kabine, sich zu waschen: so sieht er sich im Spiegel und brüllt: »Jetzt hat der Dummkopf doch den Nigger geweckt.« – Die Geschichte wird auch noch anders erzählt, läuft aber immer aufs Gleiche hinaus. War der Mann nicht verschlafen? gewiß, und er war zugleich nie wacher als in diesem Augenblick. So unbestimmt nah an sich selbst und die gewohnte Weiße fiel vom Leib wie ein Kleid, in das man ihn sonst, wenn auch ganz angenehm, gesteckt hatte. Auch die Weißen sehen meist nur dem Zerrbild von sich ähnlich; da sitzt nichts, das Leben ist ein schlechter Schneider. Dem Neger freilich fiele sein Kleid noch mehr herunter, blinzelte er einmal scharf hin.
DIE WASSERSCHEIDE
Einer sagte, auf dich und mich kam es überhaupt nicht an. Wenigstens zuerst nicht, ich war kaum dabei, als ich gezeugt wurde. Es ging vermutlich recht zufällig her bei Vater und Mutter. Dann freilich ist man da, rollt aus sich selbst ab, sofern man etwas taugt.
Ist da, aus der Gnade seiner selbst? unterbrach sich der Mann. Nein, auch hier ist zu viel Zufall, und er beleidigt uns. Mindestens unsere Begegnungen sind ungefragt, unser Beginn mit Menschen und das Schicksal daraus (das es ja ohne diesen Beginn nicht gäbe) hängt von den zufälligsten Anlässen ab. Es kann die läppigste Quelle sein und oft erstaunlicherweise nur eine, immer dieselbe; die andern Anlässe fließen dann nicht oder wenigstens nicht weit. Was mich zum Beispiel betrifft, sagte der Mann, so fand ich, nach genügender Prüfung, in einer respektlosen Stunde, daß mein eigentliches Leben, sozusagen meine zweite Geburt oder die Erwachsenentaufe, mit der Entlassung eines bayrischen Offiziers zusammenhängt, dessen Namen ich nicht einmal weiß.
Ich lebte als junger Mensch sehr zurückgezogen, suchte und fand niemand. In meinem ersten Münchner Semester wohnte ich bei einer Frau, die ich für eine Witwe hielt, manchmal prahlte sie mit besseren Tagen. Seit kurzem war ein alter Mann als Mieter zugekommen, offenbar krank, der sich vornehm ächzend zuweilen auf dem Flur sehen ließ. Einmal kam ich spät nachts nach Hause, an dem Schlafzimmer der Witwe vorbei, das sonderbarerweise offen stand: da lag der alte Mann schön aufgebahrt in ihrem Bett, ein Nachtlicht brannte noch und rechts und links zwei hohe Kerzen; die Wohnung leer, die