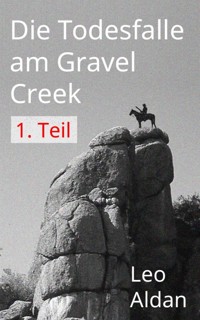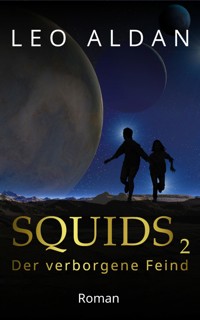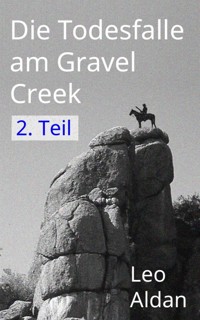7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Squids
- Sprache: Deutsch
Ein ungewöhnlicher Roman, nicht nur für SciFi-Fans
Der Astrophysiker Jake stürzt bei einer Grönland-Expedition am Petermann-Gletscher ins Meer. Er erwacht in völliger Dunkelheit ... Er weiß nicht, wo er ist ... Er kann nicht entkommen ... Eine merkwürdige Krankenschwester gibt ihm Befehle. Niemand beantwortet seine Fragen, bis die schöne Myriam auftaucht. Ist auch sie eine Gefangene? Oder ein Köder?
Jake wird in eine exotische Welt gestoßen, ein trügerisches Paradies voll fremder Rituale und Kasten. Je mehr Antworten er findet, desto mehr Fragen stellen sich. Als er in die Enge getrieben wird, taucht Myriam wie aus dem Nichts auf und rettet ihn, was ihrer Familie gar nicht passt. Dann stößt Jake auf die schockierende Wahrheit. Er gerät in höchste Gefahr und muss sich schier unlösbaren Problemen stellen, deren Ausmaß er nicht einmal ahnen kann.
Jake rennt gegen Wände, bis er seine Vorurteile sprengt. Nur widerwillig wächst er in seine Heldenrolle. Er trifft auf Aliens, die Squids, die ganz anders sind, als alles, was bis jetzt das SciFi bevölkert.
Die wissenschaftliche Grundlage bildet die Fitzgerald-Lorentz-Interpretation des Michelson-Morley-Experiments. Wie sähe die Struktur des Kosmos aus, wenn es ein Lichtmedium gäbe? Und welche vernichtenden Kräfte könnten darin stecken?
SQUIDS: abenteuerlich, spannend, phantastisch, romantisch, vielschichtig und immer wieder ein bisschen schräg.
* Dieser Roman ist eine überarbeitete Version von „SQUIDS – Die phantastische Reise des Jake Forrester“
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Leserstimmen:
"Die Philosophen unter uns lesen in dem Buch dabei eine starke Gesellschaftskritik heraus (…) Nicht nur SciFi-Fans sollten SQUIDS lesen, sondern alle, die etwas Spannung (oder viel Spannung) gern haben." Sofia (Meine kleine Bücherwelt)
"Es ist ein sehr ungewöhnliches Buch und einfach erfrischend anders." Kata (BuchKata-b-log)
"Wer bisher Probleme mit dem Genre SciFi hatte, sollte es mit diesem Buch versuchen." Andrea (Andreas Bücher)
"Ich will hier nicht zu viel verraten, aber die andere Lebensform (…) ist doch sehr ungewöhnlich. Dadurch wirkt die Handlung teilweise sogar etwas schräg, was mir sehr gut gefallen hat." Astrid (Letannas Bücherblog)
"Die Idee mit den SQUIDS hat mich überrascht, aber ich finde diese Wesen total super." Annika (Annikas Bücherwelt)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SQUIDS
Aus der Tiefe des Alls
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenKapitel 1
Jake Forrester erwachte in völliger Dunkelheit. Der Hauch eines scharfen Geruchs lag in der Luft. Und Summen. Fernes Summen. Auch schien der Boden zu vibrieren. Wie auf einem Schiff. Nur höher, schriller.
Verwirrt richtete er sich im Bett auf.
Die Stimme des Expeditionsführers kam ihm wieder ins Gedächtnis. ›Geh nicht so weit an die Kante! Da geht es mindestens eine halbe Meile runter.‹ Dann hatte es einen Knall gegeben und das Eis brach. Rutschen, Panik, verzweifeltes Klammern, blutige Finger, Fallen … Die unzähligen Eisbrocken um ihn herum schienen zu schweben, während die schäumende Meeresoberfläche rasend schnell näher kam. Der Schmerz splitternder Knochen. Dann war es dunkel geworden. Dunkel und still.
Ein Wunder, dass er noch lebte. Vorsichtig rollte er die Schultern und bewegte die Finger. Kein Problem, auch keine Schmerzen. Sein ganzer Körper fühlte sich unversehrt an. Die Ärzte in diesem Krankenhaus hatten ihn offensichtlich sehr gut zusammengeflickt.
Jake ließ sich erleichtert in die Kissen sinken. Der Bezug fühlte sich merkwürdig an … wie menschliche Haut. Jake fuhr hoch und betastete misstrauisch den Stoff. Der war warm und weich, wie der Bauch einer Frau. Verwirrt strich er darüber – nur ein Kissen. Eine neue Microfaser. Beruhigt legte er sich wieder hin und starrte in die Finsternis.
›Du bist der verrückteste Vogel, der mir je begegnet ist!‹ Jake hatte nicht auf Paul gehört, hatte sich gegen den eisigen Wind gestemmt. Der ambitionierte wissenschaftliche Mitarbeiter war nur neidisch. Schon als Kind hatte Jake ein Gefühl dafür gehabt, was richtig war. Auch wenn sie ihn verlachten, er hatte den siebten Sinn. Und da vorne war etwas … es rief ihn förmlich. Jake konnte es spüren, fast hören. Das musste es sein, der Beweis, auf den er sein ganzes Streben gerichtet hatte, das seine Karriere, sein Leben verändern würde. Diesmal würden sie ihm glauben müssen, ihm, dem verspotteten Utopisten. Er griff den Karabinerhaken, klinkte sich aus der Seilschaft aus und lief auf den Gletscherrand zu.
Jake stöhnte und wälzte sich auf die andere Seite des Betts. Noch nie zuvor hatte ihn seine Intuition im Stich gelassen. Und nun das.
Die Dunkelheit umschloss ihn wie ein Sarg. Plötzlich schoss Hitze durch seinen Körper. War er durch den Sturz erblindet? Er atmete stoßartig ein und betastete seine Augen. Sie fühlten sich unverletzt an. Aber vielleicht war der Sehnerv geschädigt – oder das Gehirn? Schweiß trat aus allen Poren. Und warum vibrierte dieses Krankenhaus?
Irgendwo fiel eine metallene Tür ins Schloss. Jake horchte auf. Und dann ertönten Schritte. Harte Sohlen auf Stahl. Sie kamen näher. Das wird die Nachtschwester sein. Jakes Linke krallte sich am Bettrahmen fest.
Die Schrittgeräusche endeten ganz in der Nähe, gleichzeitig begann gedämpftes Licht aus der Decke zu leuchten, lilafarben und milchig. Jake zwinkerte mehrmals, aber der Eindruck blieb. Er nahm einen tiefen Atemzug. Zumindest konnte er sehen.
Über seinem Bett bemerkte er einen metallischen Schirm, der einer Operationslampe ähnelte. Langsam richtete er sich auf. Dabei rutschte ihm die Decke auf den Schenkel. Er war nackt. Jake erschrak. Sollte er jetzt operiert werden? Hatte die Narkose nicht gewirkt? Entsetzt starrte er auf die fugenlose, silbrigschimmernde Wand vor ihm.
Ein leises Zischen wie von einer Bustür ließ ihn zusammenzucken. Ein Teil der Wand glitt zur Seite. In der Öffnung erschien eine rundliche Frau. Mittleres Alter. Ihr weiter, violetter Kittel und die helle Haube, die ihr Haar vollständig bedeckte, gaben ihr das Aussehen einer OP-Schwester. Aber dann doch wieder nicht. Irgendetwas war anders. »Wo bin ich?«
Die Frau lächelte, dabei schienen ihre Augen irgendwie leer zu sein, abwesend. Sie schritt auf Jake zu. Ihre Bewegungen wirkten mechanisch. Jake beobachtete sie. Sie kam herbei und hielt ihm einen Kittel entgegen. Jake streckte die Hand aus. Er erstarrte, denn im Türrahmen erschienen zwei Roboter. Sie schwebten.
Jake vergaß alles um sich herum. Verwundert betrachtete er die Maschinen – technische Wunderwerke, wie er sie noch nie gesehen hatte! Verspiegelte Halbkugeln saßen auf silberglänzenden, elliptischen Körpern, die rundum mit Armen bestückt waren. Im Gegensatz zu den Marsrobotern, für die er im Rahmen eines Forschungsprojektes Algorithmen zur Erzeugung künstlicher Intelligenz entwickelt hatte, wirkten diese hier utopisch und – bedrohlich.
Jakes Nackenmuskeln spannten sich. In was für ein merkwürdiges Krankenhaus war er gebracht worden?
Er versuchte, sich zu beruhigen, aber beim Anblick der blitzenden Werkzeuge am Ende der mechanischen Arme zog es seine Eingeweide mit eisiger Kälte zusammen. Das waren doch nicht etwa Operationsroboter?
Entsetzt starrte er die Maschinen an. Die Krankenschwester hielt ihm immer noch wortlos den Kittel entgegen. Die Geste war eindeutig. Er sollte sich anziehen. Erleichtert griff er nach dem Kleidungsstück, doch da schwebten die Roboter heran. Jake blickte von einem zum anderen.
Die Maschinen bauten sich in Augenhöhe vor seinem Bett auf und begannen, abwechselnd sirrende Töne auszusenden. Jake schien es, als glotzten sie ihn an und unterhielten sich dabei. Er schüttelte unwillkürlich den Kopf. Seine Fantasie ging mit ihm durch.
»Die Adjutoren beurteilen Sie als genesen, Herr Doktor Jake Dexter Forrester«, sagte die Krankenschwester mit mildem Lächeln und monotoner Stimme.
Jake runzelte die Stirn. »Reden Sie von den Dingern?«
»Würden Sie das bitte anziehen.«
»Gerne. Könnten Sie mir bitte sagen, wo wir sind?«
»Wenn Sie mir in Ihr Quartier folgen wollen.«
»Ma’am, würden Sie bitte meine Fragen beantworten?«
Wortlos wendete sich die Frau ab und verschwand durch die Tür. Jake starrte ihr hinterher. Auf Höflichkeit schien hier kein Wert gelegt zu werden. Aus dem Augenwinkel sah er einen Roboterarm zucken. Er fuhr herum. Lichtchen blitzten auf der Oberfläche der Maschine. Jakes Haut kribbelte, als ob er in ein Feld von Starkstrom geraten sei. Die Roboter steuerten langsam auf ihn zu. Jake spürte Panik in sich aufsteigen. Hastig streifte er den Kittel über und lief über den kalten, glatten Boden der Schwester hinterher.
Der schmale Gang, der sich hinter der Tür auftat, erinnerte Jake an ein U-Boot. Metallisch glänzende Rohre und rotschimmernde Leitungen zogen sich an den Wänden entlang. Ventile, Lampen und hydraulische Geräte spickten die Decke. Er war also auf einem Schiff! Mit den Robotern an Bord konnte er von keinem gewöhnlichen Kahn aufgefischt worden sein. Vielleicht ein Forschungsschiff? Welchem Staat gehörte es? Die Schwester sprach mit Akzent, aber das musste nichts heißen.
Das Zischen kam unerwartet. Nervös schaute er sich um. Die beiden Roboter folgten ihm auf dem Fuß und versperrten den engen Korridor. Jake beschleunigte seinen Schritt. Hinter einer Sicherheitsschleuse wartete die Krankenschwester an einer geöffneten Tür. »Hier hinein, bitte.« Ihr abwesendes Lächeln befremdete Jake und das feine Sirren der Roboter schien durch den Hinterkopf direkt in seinen Schädel zu dringen. Er warf einen flüchtigen Blick in die silbergraue Kabine jenseits der Tür, die ihm wie eine Rattenfalle vorkam. »Wenn es möglich ist, würde ich gerne zuerst mit dem Arzt sprechen.«
Als Antwort traf ihn ein Stoß wie aus einer gigantischen Pressluftpistole und katapultierte ihn vorwärts. Jake stolperte in die Kabine. Empört rappelte er sich auf, doch bevor er die Tür erreichte, fiel sie ins Schloss. Er drückte dagegen, er schob. Das Ding war wie zugeschweißt! Jake tastete den Türrahmen und die glatte Wand nach einem Öffnungsmechanismus ab. Nichts. Seine Hände begannen zu zittern. Ihm wurde heiß und ein Druck baute sich in seinem Inneren auf. »Machen Sie auf!«, schrie er und schlug mit der flachen Hand gegen die Tür. »Warum sperren Sie mich ein?«
»Du sollst dich entspannen!«, ertönte eine sanfte Stimme hinter ihm. Er fuhr herum. Auf dem einzigen Bett lag eine brünette Frau mit mädchenhaftem Gesicht.
Jake starrte sie an. Sie war mit einem dünnen Laken spärlich bedeckt und ließ ihre blauen Augen interessiert über seinen Körper wandern.
»Wer sind Sie?«
Sie richtete sich ein wenig auf, wobei die langen Haare ihre nackten Schultern freigaben.
»Ich werde dir die Reise so angenehm wie möglich machen.« Ihre Stimme war melodisch und sie sah ihn unter langen, dunklen Wimpern einladend an.
Jake zog die Brauen hoch. Das war absurd! Sein Blick glitt, wie von einer magischen Kraft gelenkt, über ihre schlanken Formen, die sich reliefhaft unter der dünnen Decke hervorhoben. Wohlgeformte Brüste und spitze Brustwarzen zeichneten sich deutlich ab. Sie mochte etwas jünger als er sein. Und sie war schön. Sein Interesse regte sich, doch kochte gleichzeitig sein Ärger hoch. »Warum werde ich eingesperrt?«
Ihre Augen leuchteten. »Weil du noch wild bist.«
Jake starrte sie entgeistert an. Was sie sagte, ergab keinen Sinn. Er straffte die Schultern. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich hier herausließen! Ich möchte den Kapitän sprechen«, sagte er mit fester Stimme.
Die Frau wich zurück. Für einen Moment schien sie ratlos. Nervös wanderte ihr Blick über Jakes Gesicht, versuchte darin zu lesen.
Jake stemmte die Hände in die Hüften. »Rufen Sie bitte nach der Schwester!«
»Das kann ich nicht. Das steht mir nicht zu.« Die junge Frau fasste sich wieder und versuchte ein kleines Lächeln. »Warum entspannst du dich nicht? Es ist doch alles in Ordnung.«
Jake musterte sie. Er sah ein, dass es keinen Sinn hatte zu argumentieren. Frustriert ließ er die Schultern hängen. Das war verrückt! Eingesperrt! Mit einer Frau, die wohl so etwas wie ein Lockmittel sein sollte. Er wandte sich ab und hämmerte wieder auf die Tür ein. »Lasst mich raus!«
Niemand kam. Keine Schritte im Gang. Nur das ferne Ächzen der Schiffshülle und das Stampfen von Kolben waren zu hören, überlagert vom hohen Sirren irgendwelcher Maschinen.
Jake ließ die Arme sinken. Die Wände der Kabine schienen näher zu rücken. Er konnte sich nicht vorstellen, was die Leute von ihm wollten. Er besaß doch nichts, was so einen Aufwand wert wäre. Oder waren sie scharf auf sein Wissen? Jake stieg das Blut in den Kopf. Er hatte Gerüchte gehört: Menschen verschwanden und tauchten nie wieder auf, oder sie hatten unerklärliche Unfälle.
Jake ging auf und ab. Nein. Das Militär war es nicht, sonst würde die Schwester eine Uniform tragen. Es musste jemand anderes dahinterstecken. Jake wandte sich ruckartig zu der Frau um. Sie hatte die Decke bis unters Kinn gezogen. Ihr Atem ging schnell und flach und sie taxierte ihn, als ob sie ihre Fluchtmöglichkeiten ausloten wollte. Jetzt sah sie gar nicht mehr wie eine berechnende Verführerin aus. Jake sah sie betroffen an. Sie schien Angst zu haben. Angst vor ihm. Ihm kam der Verdacht, dass sie ihre Show nicht aus freien Stücken abzog, vielleicht wurde sie gezwungen.
Beschwichtigend hob er die Hände.
Ihre Augen folgten jeder Bewegung.
Er senkte die Stimme und wechselte zu einem vertraulichen Ton. »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich werde dir nichts tun.«
Sie zog die Decke noch etwas höher. »So einen wilden Mann wie dich habe ich noch nie gesehen.«
Jake betrachtete ihr seidiges, volles Haar, das in goldbraunen Wellen über ihre Schultern fiel. Eine leidvolle Erinnerung stieg in ihm auf und er musste einen Moment wegsehen, um die aufkeimende Trauer zu unterdrücken.
Er nahm einen tiefen Atemzug. »Ich wollte dich nicht ängstigen. Wie heißt du?«
Die junge Frau warf ihm wieder einen forschenden Blick zu. »Myriam«, sagte sie dann leise.
»Das ist ein schöner Name. Ich bin Jake.«
Mit behutsamen Bewegungen nahm er auf einer metallisch wirkenden Sitzbank an der rechten Wand Platz. Statt stählerner Kälte erwartete ihn angenehm warmes, überraschend nachgiebiges Material. Er nahm einen tiefen Atemzug und lehnte sich zurück. »Kannst du mir sagen, wohin sie mich bringen?«
»Beruhige dich doch erst einmal«, sagte sie, ohne ihre defensive Haltung aufzugeben.
Jake schüttelte den Kopf. Statt gerettet zu werden, war er entführt worden. Sie brachten ihm irgendwohin, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nicht in die Vereinigten Staaten. Sie schien nicht zu verstehen, was das für ihn bedeutete, schien sich keine Gedanken darüber zu machen. Aber das Ziel der Reise musste sie doch kennen. Er dämpfte seine Stimme. »Ich bin doch schon wieder ganz ruhig. Weißt du, wohin wir fahren?«
»Nach Njamingloh.«
Jake legte die Stirn in Falten. Davon hatte er noch nie etwas gehört. Dem Klang nach konnte es eine Ortschaft in Afrika sein. Oder vielleicht in China. Allerdings sah Myriam europäisch aus. Und sie sprach seine Sprache, mit einem leichten, fremdländischen Akzent zwar, aber fließend. Genau wie die Krankenschwester. »Wo liegt das?«, fragte er.
Ihr Blick schweifte in die Ferne. »Es ist ein reiches Land, wo es allen gut geht. Es wird dir gefallen.«
Das klang auswendig gelernt. Und sie beantwortete seine Frage nicht. Warum wich sie ihm aus? Jakes Kiefermuskeln spannten sich. Vielleicht machte sie das hier nicht freiwillig, vielleicht hatten die Entführer sie indoktriniert – oder unter Drogen gesetzt. Angst und Ärger kämpften in seinem Inneren, doch ihre ebenmäßigen Gesichtszüge nahmen ihn gefangen, besänftigten seine Gefühle. Wie bezaubernd sie aussah, mit den feinen Linien ihrer Nase und dem verträumten Blick. Und wie reizend der blaue Stein in ihrem silbernen Ohrring ihre Augen betonte.
»Ist es schön in Namiklo?«, fragte er.
»Njamingloh«, verbesserte sie. »Meine Eltern wohnen dort. Und meine Geschwister.« Ihre Züge entspannten sich und ihre Augen bekamen wieder diesen fernen Blick. »Da ist der endlose Strand, wo Kinder spielen und die langen Blätter der Bäume in der warmen Seebrise wiegen.«
»Du hast eine sehr poetische Art, dich auszudrücken. Es muss wunderschön in deiner Heimat sein.«
Sie sah ihn an. Ein schiefes Lächeln spielte über ihr Gesicht. »Das schon, aber ich empfand das Leben als eintönig und wollte etwas erleben.« Ihr Blick entfernte sich wieder. »Vielleicht bin ich wirklich ein zu wildes Kind.«
Die Idylle in Jakes Kopf zerbarst in tausend Splitter. »Was willst du damit sagen? Haben sie dich deshalb auf diesem Schiff eingesperrt?«
Myriam sah ihn erstaunt an. »Niemand wird eingesperrt. Und es ist doch schön hier. Magst du mich denn nicht?«
Jake blieb der Mund offen stehen. So eine Antwort hatte er nicht erwartet. Sie steckte doch mit drin. Er setzte sich kerzengerade auf und sah ihr direkt in die Augen. »Was willst du von mir?«
Myriam richtete sich auf und schmunzelte. »Jake, ich möchte, dass Du dich wohlfühlst. Dass du dich entspannst. Es ist meine Aufgabe, dir dabei zu helfen.« Und mit einem kecken Zwinkern fügte sie hinzu: »Du gefällst mir sehr. Auch wenn du etwas zu wild bist.« Mit diesen Worten ließ sie ihre Decke heruntergleiten. Sie war nackt. Und wunderschön. Ihre weichen Rundungen ließen sein Verlangen steigen. Verdammt! Er riss sich zusammen. Sie war der Köder in irgendeiner Falle. »Zieh das wieder hoch«, erwiderte er.
Verblüfft sah sie ihn an. »Bin ich nicht hübsch genug?«
Das klang so unschuldig. Jake wurde aus ihr nicht schlau.
Myriam senkte die Augen. »Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut.«
Jake schoss von seinem Sitz hoch. »Was?«
Sie hob den Kopf und sah ihn mit leuchtenden Augen an. »Sie haben gesagt, ich bekomme einen Mann. Einen ganz Besonderen. Einen Wilden eben. Nicht solche, wie bei uns.«
Jake verstand überhaupt nichts mehr. Wilde Männer, zahme Männer. Seine Phantasie ließ Bilder von grell bemalten, muskelbepackten Eingeborenen entstehen, denen gefügige, hühnerbrüstige Weichlinge gegenüberstanden. Er musste lachen, als er sich Myriam vorstellte, die hüftschwingend zwischen diesen Kerlen hin- und herspazierte. Sie schaute ihn fragend an und Jake fühlte sich plötzlich sehr beschämt. Diese junge Frau, wer auch immer sie war und was auch immer ihr Job in dieser Kabine sein sollte – sie sah nicht nur blendend aus, sie war auch von entwaffnender Natürlichkeit und Offenheit und sicher weder dumm noch naiv. Ein einfaches Landmädchen, das man mit dem Versprechen auf einen Ehemann aus ihrem Dorf gelockt hatte, wäre anders aufgetreten.
»Es tut mir leid«, sagt Jake.
»Was tut dir leid?«, fragte sie zurück.
»Dass ich nicht so bin, wie sie es dir versprochen haben.« Jake stand auf und begann wieder, in der Kabine auf- und abzugehen. Was hatten sie mit ihm vor? Er war Astrophysiker, Forscher. Die unglaublichen Ergebnisse seiner letzten wissenschaftlichen Experimente kamen ihm in den Sinn.
Spionage!
Sein Blick schweifte auf der Suche nach versteckten Mikrophonen und Mikrokameras über Decke und Wände. Irgendjemand hatte Wind von seiner Forschung bekommen und nahm sie ernster als sein Chef. Na klar! Ein Element ohne Masse, das er in einer Meteoritenprobe am Massachusetts Institute of Technology entdeckt hatte, würde die gesamte Wissenschaft revolutionieren – und die Rüstungsindustrie. Jakes Magen zog sich zusammen. Er blieb stehen. Ja, das musste es sein! Die Expedition zum jüngsten Meteoriteneinschlagsort hatte ihm zum Petermann-Gletscher nach Grönland geführt. Dort war bestimmt schon jemand vor ihnen gewesen und hatte das Gleiche gesucht. Nun wollten sie ihn mundtot machen oder sein Wissen nutzen. Oder beides.
Ein leises Zischen an der Tür schreckte Jake auf. Zwei Roboter schauten durch eine Luke herein. Als ob sie in einen Karnickelstall glotzten! Jake hielt nach der Schwester Ausschau. Sie war nirgends zu sehen. Die Bewegung eines der mechanischen Arme ließ Jake zusammenzucken, aber es schwebte nur ein mit Schalen und Gläsern beladenes Tablett herein. Wie von selbst löste sich eine tischgroße Platte aus einer Wandnische.
Jake sprang zur Seite. Ein Tisch ohne Beine!
Das Servierbrett senkte sich langsam darauf. Jake beobachtete jede Bewegung. Er war beeindruckt und seine Neugier biss sich an dem Schwebeeffekt fest, wollte wissen, wie er funktionierte. Elektromagnetische Felder? Jake registrierte, dass er sich schon wieder mit den Fingern durchs Haar fuhr. Vielleicht sollte er sich wirklich erstmal entspannen. Jedenfalls verfügten die Entführer über eine erstaunliche Technologie. Das setzte Macht und Intelligenz voraus. Und mit intelligenten Leuten könnte er verhandeln.
»Essen!«, rief Myriam freudig, sprang aus dem Bett und zog den Tisch zu sich, sodass er zwischen Sitzbank und Bett schwebte. Dabei fiel ihr die Decke herunter, die sie achtlos liegen ließ. Jakes Blicke wurden unwiderstehlich von ihren straffen Brüsten angezogen. Ihm wurde heiß. Wenn Myriam ständig nackt herumlief, würde er der Versuchung nicht lange widerstehen können. »Hast du nichts anzuziehen?« Der innere Kampf zwischen Wollen und Nichtwollen ließ seinen Ton unwillkürlich schroff ausfallen.
Für einen Moment schaute ihn Myriam verdutzt an, aber dann stahl sich ein befriedigtes Lächeln über ihr Gesicht. Jake ärgerte sich darüber. So einfach würde er sich nicht manipulieren lassen! Sie schien seinen Groll zu spüren. Mit hängenden Schultern wandte sie sich einer Wandöffnung neben dem Bett zu und zog daraus ein Tuch hervor. Das schlang sie wie einen Sari um ihren Körper.
Jake setzte sich. Er ließ den Rücken gegen die Wand sinken. Was passierte mit ihm? Er war Wissenschaftler, ein rationaler Mensch. Doch hier fühlte er sich von seinen Instinkten getrieben. Er musste seinen Verstand bewahren, sonst gewannen die Entführer.
Der Duft von Gebratenem und exotischen Früchten zog ihm in die Nase. Sein Magen knurrte wie ein Kettenhund. Soweit er sich erinnern konnte, hatte er das letzte Mal im Camp auf dem Gletscher gegessen. Das war eine Ewigkeit her. Oder erst gestern? Jake schüttelte kaum merklich den Kopf und fasste die Mahlzeit ins Auge.
Auf dem Tablett lagen die verschiedensten Häppchen auf muschelförmigen Schälchen. Fleisch, Fisch, Gemüse, garniert mit Salatblättern, Kräutern und bunten Blüten. Der Geruch von Curry und Thymian stieg ihm in die Nase, darunter andere Gewürze, die er nicht benennen konnte. Eine Anzahl diverser Getränke komplettierte das Angebot. Neben einem Weinkelch stand ein Glas, gefüllt mit einer lilafarbenen Flüssigkeit. Jake beäugte das Arrangement misstrauisch. Drogen?
Myriam griff bedenkenlos zu und begann genüsslich zu kauen. Vielleicht war sie resistent? Jake angelte sich ein Schälchen mit Rindfleisch im Bratensaft und hielt es unter seine Nase. Es roch warm und würzig. Unverdächtig genug. Langsam und bedächtig zerkaute er das zarte Fleisch … Rosmarin, Salz, Pfeffer … er war kein Gourmet mit feiner Zunge. Sie konnten alles Mögliche beimischen, ohne dass er es bemerken würde. Er nahm einen tiefen Atemzug. Was nützte die Vorsicht? Ohne Essen würde er nicht lange durchhalten. Und wenn sie ihn umbringen wollten, hätten sie es schon früher tun können. Also bediente er sich.
Bei der Wahl des Getränks machte er sich keine großen Gedanken. Er tat es Myriam gleich und trank diesen lilafarbenen Saft. Der schmeckte süß wie die Sünde und wirkte belebend. Mit einem befriedigten Seufzer lehnte er sich zurück.
Myriam, die ihn während des Essens beobachtet hatte, machte ein zufriedenes Gesicht.
Jake musterte sie argwöhnisch. »Bin ich euch in die Falle getappt?«
Abrupt stand sie auf. »Du stellst seltsame Fragen. Ich verstehe dich einfach nicht.« Sie schob den Tisch zurück in die Nische. Das Tablett ließ sie in einer Öffnung darüber verschwinden. »Zeit zum Schlafen«, verkündete sie und wickelte sich mit verschmitztem Lächeln aus ihrem Gewand.
Jake konnte seine Blicke nicht von ihr reißen. Sein Körper war bereit und seine Sinne wollten nur eins. Aber genau das ärgerte ihn. Er war doch nicht völlig seinen Trieben ausgeliefert. Selbst wenn sie ihm ein Aphrodisiakum in sein Getränk gemischt haben sollten, wollte er die Kontrolle durch seinen Verstand nicht verlieren! So schnell sollten die ihn nicht bekommen! Und wenn er eigens auf der Sitzbank schlafen musste! Er ließ sich von Myriam eine zweite Decke geben.
Kaum hatte er sich auf dem unbequemen Möbel ausgestreckt, ging das Licht aus. Nur ein fahles Orientierungslämpchen wies den Weg zum Sanitärraum. Es war lange still in der dunklen Zelle. Doch bevor Jake einschlief, hörte er Myriam leise in ihr Kissen schluchzen. Sie tat ihm leid, und er schalt sich selbst einen unfreundlichen, groben Klotz. Aber Small Talk hatte er noch nie beherrscht und bei aller Faszination – er wollte kein Risiko eingehen. Je nachhaltiger er sich von ihr fernhielt, desto besser.
Die Zwei an den Beobachtungsmonitoren entspannten sich.
»Der Fang …« Der Eine warf dem Anderen einen nachdenklichen Blick zu. »Hat es schon eine Registriernummer?«
»5830254M«
»Es verhält sich nicht normal. Soweit ich mich entsinne, lösen Weibchen triebhaftes Paarungsverhalten aus und danach beruhigen sich die Männchen ganz schnell. Aber bei dem scheint es nicht zu funktionieren. Was sagen Sie als Spezialist dazu?«
»Ich finde es höchst interessant. Mich dünkt, es verfügt über eine höhere Intelligenz, als die bisher eingefangenen Exemplare.«
»Das ist nicht gut, mein Bester. Es könnte gefährlich werden. Sollen wir es lieber einschläfern?«
»Davon rate ich vorerst ab. Was kann es hier denn anstellen? Wir sollten es erst einmal mit einem anderen Weibchen probieren. Manche dieser Böcke zeigen eine erstaunliche Selektivität. Er wird sich schon noch beruhigen.«
Kapitel 2
Mitten in der Nacht erwachte Jake schweißgebadet aus unruhigem Schlaf. Sein Rücken schmerzte, der linke Arm war taub und der rechte Oberschenkel verkrampft. Eine Folterbank konnte nicht schlimmer sein. Jake setzte sich und streckte sein Kreuz. Unter höllischem Kribbeln kam das Blut in den Arm zurück. Jake schlenkerte ihn, bis sich auch das Gefühl wieder einstellte. Auf die Bank wollte er sich nicht mehr legen. Resigniert ließ er sich auf den harten Boden nieder.
Doch auch dort fand er keinen Schlaf. Die Gedanken überschlugen sich. Rastlos wälzte er sich hin und her. Er musste mit seinen Entführern sprechen, musste herausbekommen, welche Bedingungen sie für seine Freilassung stellten. Immerhin hatten sie ihn bisher nicht misshandelt. Ganz im Gegenteil. Sie lockten ihn, schienen an seiner Kooperation interessiert. Die Frau im Bett war Beweis genug. Sie brauchten ihn also. Und das war seine Lebensgarantie. Hoffentlich konnte er einen Vorteil daraus ziehen. Er grübelte, bis ihn endlich der Schlaf übermannte.
Licht weckte ihn. Eine Bewegung zog seine Aufmerksamkeit an. Dunkle Mandelaugen lugten über die Bettkante zu ihm hinab. Schwarze, glatte Haare fielen um ein rundes Gesicht. Jake wischte sich über die verschlafenen Augen. »Wer bist du? Wo ist Myriam?«
Ohne zu antworten, glitt die Frau herunter zu ihm und schlüpfte pudelnackt unter seine Decke. Empört hielt er sie zurück. »Was soll das?«
»Ich bin besser als Myriam!«, schnaufte sie und stürzte sich auf ihn. Jakes Blut geriet in Wallung. »Halt!«, rief er aufgebracht, »Ich will das nicht!«
»Aber ich habe doch noch gar nicht richtig angefangen«, stieß sie unbeirrt hervor.
Hitze schoss ihm in die Adern. Was fiel diesen verdammten Kerlen ein, diese Frauen in seine Kabine zu schicken? Er sprang auf. »Hör auf damit!«
»Ich bin besser! Ich werde der Meduse zeigen, dass ich die Beste bin.« Sie packte ihn mit beiden Händen. Jake fühlte sich zwischen Lust und Zorn hin- und hergerissen. Der Zorn gewann und pulsierte wie Feuer durch seinen Körper. Mit Mühe riss er sich zusammen. »Holt diese Wahnsinnige hier raus!«, rief er zur Tür hin. Augenblicklich öffnete sie sich. Die Krankenschwester und ihre beiden Roboter standen im Gang, als ob sie darauf gewartet hätten. Verblüfft sprang Jake zurück.
»Es wäre mir lieber, ihr sagtet, was ihr von mir wollt, anstatt mir diese Frauen auf den Hals zu hetzen.« Die Schwester schaute ihn gar nicht an, sondern blickte mit ausdruckslosem Gesicht an ihm vorbei auf die Frau.
»Komm mit!«, befahl sie und schnipste mit dem Finger. Wie ein geprügelter Hund kroch die Schwarzhaarige zu ihr.
»Lasst mich hier raus!«, forderte Jake und sprang zur Tür. Doch bevor er sie erreichte, schlug ihm etwas Unsichtbares an den Kopf, dass er rücklings in die Zelle fiel. Benommen blickte er auf, nur um zu sehen, wie sich das Frühstückstablett auf den Tisch senkte und die Tür zischend zuglitt.
Erschöpft setzte er sich auf die Pritsche. Was, zum Teufel, passierte hier mit ihm? Er atmete schwer. Die wollten ihn mürbemachen! Wenigstens war er jetzt allein. Er musste einen Weg zur Flucht finden. Dazu brauchte er einen klaren Kopf. Und seine körperliche Kraft. Er musste essen, auch wenn sein Magen rebellierte. Zum Frühstück hatten sie ihm fladenähnliches Brot und Obst gebracht. Es waren auch einige sonderbare Früchte in dem Sortiment. Die rührte er nicht an.
Nach dem Essen untersuchte Jake noch einmal den Eingang. Das Material fühlte sich ungewohnt an, glatt und warm. Wenn es auch auf den ersten Blick so aussah, Metall war es nicht. Auch saß die Tür so eng im Rahmen, dass der Spalt kaum zu sehen war. Saubere Maßarbeit. Nicht einmal die Klinge des Früchtemessers konnte er dazwischen schieben. Es hätte auch nicht viel genutzt, denn es war aus Kunststoff. Er legte es auf den Tisch und suchte sein Quartier nach einem Gegenstand ab, den er als Werkzeug gebrauchen könnte. Alles war fest angebracht. Nahtlos verschweißt. Kein einziger Schraubenkopf, als wäre der ganze Raum aus einem Stück gegossen. Die Chancen aus eigener Kraft daraus zu entfliehen, waren gleich null.
Jake ließ sich auf die Sitzbank fallen. Er überlegte, ob er die Krankenschwester überwältigen konnte. Mit seiner langjährigen Taekwondo-Erfahrung sollte sie kein großes Problem sein. Sie nicht, aber die Roboter.
Er brauchte eine Waffe. Noch einmal sah er sich gründlich um. Der einzige Gegenstand, den er dazu benutzen konnte, war der Tisch. Besser als nichts. Jake wollte ihn anheben, aber er schaffte es nicht. Als ob das Ding tausend Kilo wog. Das war sonderbar, denn schieben ließ er sich mit einem Finger in jede beliebige Richtung. Jake fuhr sich durchs Haar. Wie sie das machten, konnte er sich nicht erklären, jedenfalls war auch der Tisch als Waffe unbrauchbar. Aber vielleicht könnte er ihn gegen die Schwester kicken. Das schien im Moment der einzig durchführbare Plan zu sein. Also hieß es warten und harmlos tun. Jake nahm auf der Bank Platz und verschränkte die Arme hinter seinem Nacken. Die Füße legte er auf den Tisch und schloss die Augen.
Endlich hörte er Schritte. Er blinzelte unter den Lidern hervor zur Tür. Seine Muskeln spannten sich. Als sich die Tür öffnete, gab Jake dem Tisch einen gewaltigen Tritt und sprang mit einem tigerhaften Satz hinterher. Augenblicklich prallte er an ein unsichtbares Hindernis, flexibel wie eine Gummimatte. Dann schob ihn etwas unaufhaltsam bis in die Mitte der Kabine zurück. Während er sich dagegenstemmte, fiel sein Blick auf die Krankenschwester im Gang. Sie führte eine Frau an der Hand. Jake verließ die Kraft. Er ahnte, was nun kommen würde. Die Neue betrat seine Zelle. Die unsichtbare Wand verschwand, als sich die Tür wieder schloss.
Jake blieb stehen, wo er war und musterte die Frau. Sie erschien älter als die beiden vorigen. Blonde, kurze Locken rahmten ihr volles, gutmütiges Gesicht. Ihre Hautfarbe wirkte dunkler – sonnengebräunt, hätte er unter normalen Lichtverhältnissen vermutet. Ein beigefarbenes Wickelgewand bedeckte ihre üppigen Formen. Sie sah nicht unbedingt wie eine Kurtisane aus, eher so, wie er sich seine Tante vorgestellte, hätte er eine gehabt. Eine neue Taktik der Kidnapper?
Die Frau sah Jake einen Moment lang abwägend an, dann setzte sie ein mütterliches Lächeln auf und ließ sich auf der Sitzbank nieder. »Ich bin Manulana. Setz dich doch.«
Das war zumindest eine zivilisierte Anrede. Auch machte sie keine Anstalten, Jake sofort an die Wäsche zu gehen. Ohne sie aus den Augen zu lassen, setze er sich ihr gegenüber auf das Bett. »Jake Forrester. Was möchten Sie von mir?«
»Ich soll dir Gesellschaft leisten.« Sie blieb ruhig sitzen und sah ihn aus schokoladenbraunen Augen offen an.
»Das ist sehr nett von Ihnen«, antwortete er höflich und fragte sich, was sie wirklich wollte. »Warum hält man mich gefangen?«
Sie lächelte. »Weil du dich noch nicht eingewöhnt hast.«
Jake zog die Stirn kraus. »Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Können Sie dem Kapitän ausrichten, dass ich ihn gerne sprechen möchte?«
Sie machte ein besorgtes Gesicht. »Es soll dir doch gut gehen, bis wir zuhause sind.«
Jake deutete auf die verschlossene Tür. »Eingesperrt in diese enge Zelle?«
Sie hob beruhigend die Hände. »Du musst doch nicht die ganze Reise hier verbringen. Später darfst du in die Messe.«
Jake warf ihr einen ungläubigen Blick zu. »Sie lassen mich frei? Was ist der Zielhafen?«
»Nelantis.« Manulana machte sich auf der Sitzbank breit und lächelte Jake an. »Aber bis wir ankommen, dauert es noch eine Weile und ich werde dir helfen, die Zeit zu vertreiben. Weißt du, meine Großtante war auch einmal Eskorbine auf einem Schiff. Als sie noch jung war. Sie erzählt immer noch davon. Ununterbrochen, wenn man es genau nimmt. Eigentlich will keiner mehr zuhören. Aber mich haben ihre Erzählungen fasziniert. Es klang so aufregend, auf Reisen zu gehen. Ihren Erstgeborenen, den Anselm, hat sie nach seinem Vater benannt, der war nämlich ein Wildfang. Ich habe ihn nicht mehr kennengelernt. Da war er schon verschollen. Er hat in den Minen …«
»Wo, bitte, ist Nelantis?«, unterbrach Jake ihren Monolog.
»In Njamingloh. Das habe ich als Kind in der Schule gelernt. Ich war Klassenbeste. Nur in Hydrotechnologie hat Rinsana mich übertrumpft. Das hat mich gewurmt, obwohl sie meine beste Freundin war. Jetzt ist sie Mutter und muss sich um ihre Kinder kümmern. Sie hat eine Menge Arbeit mit ihnen. Gerade der Kleinste. Aber vielleicht hat sie schon wieder eins …«
Ihr Geschwätz begann Jake auf die Nerven zu gehen, auch wenn er es nur noch als Hintergrundgeräusch wahrnahm.
»… auf der Werft verunglückt. Wir haben schon gedacht, es ist aus mit ihm, aber sie nahmen ihn mit …«
Jake begann sich zu wundern, ob sie jemals den Mund hielt.
»… noch nicht einmal eine Narbe hat man sehen können …«
Jakes Gedankenstrom schien sich zu verlangsamen und sein Körper wurde schwer. Das Gerede zog ihn unaufhaltsam in ein schwarzes Loch. Tiefer und tiefer.
Mit Mühe fokussierte er seine Gedanken. »Halt!«, rief er.
Manulana schwieg betroffen und sah ihn an.
»Wenn es möglich wäre, hätte ich gerne für einen Moment meine Ruhe.«
Sie atmete hörbar aus. »Aber das ist doch kein Problem, Jake. Ich kannte mal einen – Korleinz. Ja. Korleinz war sein Name. Mit blauen Augen und kantigem Schädel. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Er war etwas behäbig und anfangs habe ich gedacht, er sei stumm …«
Jake nahm einen tiefen Atemzug. »Ich möchte Sie nicht beleidigen, aber mir wäre es lieber, Sie würden gehen!«
Sie sah Jake erschrocken an. »Aber du kannst doch nicht allein bleiben! Wer für sich bleibt, wird verrückt.«
»Ich werde verrückt, wenn Sie hierbleiben! Bitte gehen Sie.«
Jake deutete zur Tür. Die öffnete sich, als sei sie durch seine Geste aktiviert worden. Wieder stand die Krankenschwester, flankiert von den zwei Robotern, wartend im Gang. Manulana erhob sich langsam von der Sitzbank und schlich nach draußen.
Jake wusste nun, dass er beobachtet wurde, sonst wären die Bewacher nicht so schnell zur Stelle gewesen. Er spürte ihre Augen förmlich im Nacken. Die Mikrophone und Kameras zu finden, war aussichtslos. Es gab inzwischen so kleine, dass man sie unter einem Fingernagel verstecken konnte. Auch kam ihm die Andeutung, ihn freizulassen, wie eine wohlplatzierte Finte vor. Sie wollten ihn in Sicherheit wiegen.
Jake warf sich frustriert aufs Bett und versuchte sich zu entspannen, da spürte er etwas Hartes im Rücken. Zwischen den Laken fand er einen silbernen Ohrring. Sein Herz klopfte. Der gehörte Myriam. Er nahm das Schmuckstück in die Hand. Kleine, goldfarbene Einsprengsel in dem tiefblauen Stein ließen ein Bild in ihm aufsteigen. Der Lapislazuli, der in der Antike die Wände der Königspaläste geziert hatte. Unwillkürlich musste er lächeln. Myriam, dieses zarte, kleine Wesen, hatte wirklich etwas von einer Prinzessin. Jake atmete tief. Sinnlose Gefühlsduselei! Er schaute sich nach einem Platz um, wo er den Ohrring aufbewahren konnte. Schließlich steckte er ihn in die Tasche seines Kittels.
An den Überwachungsmonitoren herrschte gespannte Stimmung. »Wenn er seinen Widerstand nicht aufgibt, wird er unbrauchbar sein. Sie wissen, was das bedeutet?«
Der Andere schaltete sein Gerät auf eine stärkere Vergrößerung. »Nun gedulden Sie sich doch, mein Verehrtester. Ich habe noch ein paar probate Tricks auf Lager!«
Kapitel 3
Sie kamen nur noch, um Essen zu bringen – Roboter. Die Schwester ließ sich nicht mehr sehen, auch keine Frauen. Jake war allein. Wie von selbst tastete seine Hand nach dem Ohrring in seiner Tasche, und wie jedes Mal, wenn er das Schmuckstück berührte, erschien Myriams liebreizendes Gesicht vor seinem inneren Auge. Wo war sie geblieben? Er ertappte sich dabei, dass er sich Sorgen um sie machte. Er verdrängte die Vision. Sie konnte letztlich nur ein Mädchen sein, das man angewiesen hatte, ihn zu verführen. Jake zog die Hand aus der Tasche. Er musste hier raus, bevor er wahnsinnig wurde! Er sprang auf und zum hundertsten Mal tastete er die Wände ab – nach Ritzen, lockeren Paneelen, spröden Stellen im Material, Leitungen … irgendetwas!
Nichts. Es gab noch nicht einmal Steckdosen, um einen Kurzschluss zu verursachen. Die Verschalungen der Lampen ließen sich nicht abnehmen. Nichts, aber auch gar nichts konnte er abmontieren oder als Waffe benutzen.
Frustriert warf er sich auf das Bett in seiner Zelle und starrte die kahle Decke an. Kein Ausweg. Noch nie hatte er sich so hilflos gefühlt.
Erinnerungen stiegen in ihm auf. ›Na, jetzt wirf schon!‹ Jakes Sandkastenfreund Joey von nebenan war kaum größer als der Baseballschläger, den er schlagbereit mit beiden Händen umklammerte und dabei Jake auffordernd ansah. Sie hatten sich heimlich Dads Sachen geliehen. Seines Vaters Kappe hing Jake über die Ohren bis in den Nacken. Er presste seine Hand um den harten Ball, holte aus und warf mit aller Kraft. Joey schwang den Schläger in weitem Bogen und traf den Ball mit einem satten Plopp. Mit offenem Mund folgte Jake der Flugbahn, bis der Ball jenseits der Thujahecke verschwand. Das Klirren einer Scheibe im Nachbarhaus ließ ihn erstarren.
Mom sperrte Jake in seinem Zimmer ein. ›Warte, bis Dad kommt!‹ Jake hatte auf seinem Bett gelegen, unerträgliche Angst schnürte seine Eingeweide zusammen … und die Ungewissheit, was kommen mochte. Bei seinem Vater wusste er nie. ›Bitte, lieber Gott, lass Dad nicht betrunken sein.‹
Jake zwang sich zur Ruhe und versuchte seine Gedanken wieder in die Gegenwart zu bringen. Mit Gewalt konnte er aus seiner Zelle nicht entkommen. Er könnte es höchstens mit List probieren. Aber dazu müsste er seine Kidnapper zum Verhandeln bewegen.
Entschlossen stand er auf. Wahrscheinlich gab es mehrere Kameras, die ihn permanent beobachteten. Er wandte sich zur Tür, so hatte er wenigstens das Gefühl, nicht völlig ins Leere hinein zu sprechen. Er atmete noch einmal tief durch: »Ich möchte mich hiermit an meine Entführer wenden. Ich bin bereit zu verhandeln und wünsche mit Ihnen in Kontakt zu treten, sodass wir diese Situation so schnell wie möglich zum beiderseitigen Vorteil beenden können.«
Dann setzte er sich erwartungsvoll auf die Bank. Wenn sie ihn gehört hatten, sollten sie bald reagieren. Sein Magen flatterte.
Er lauschte angespannt in die Tiefe des Schiffs, doch nur ein fernes Knacken drang an sein Ohr.
Jakes Magen knotete sich mit jeder Minute weiter zusammen. Er konnte nicht mehr still sitzen, stand auf und lief in der Zelle auf und ab. Keine Reaktion. Das hatte Methode. Fünf Schritte vor, Wenden, fünf Schritte zurück, Wenden. Wie schon zuvor wurde er einfach ignoriert. Er kam sich vor wie ein Stück Vieh!
Jake beschleunigte seinen Gang.
Endlich vernahm er Schritte. Er blieb stehen und legte lauschend den Kopf schräg. Richtig. Jemand näherte sich. In seinem Magen begannen tausend Ameisen zu krabbeln. Er holte tief Luft und stellte sich erwartungsvoll an die Tür.
Wenig später öffnete sie sich und gab den Blick auf die Krankenschwester frei. Ohne ein Wort bedeutete sie Jake, ihr zu folgen.
Jake gab sich einen Ruck und trat in den Gang. Rechts blockierten zwei Roboter den Weg. Die Schwester wendete sich nach links, führte ihn durch zwei Schleusen und bog in einen Seitengang. Er versuchte sich vorzustellen, wer seine Entführer waren. Jakes Hände wurden feucht. Vielleicht schlitzäugige Gesichter mit streng geschnittenen Uniformen oder ein hartgesichtiger Kerl im schwarzen Rollkragenpullover? Alternativ entstand vor seinem inneren Auge das Bild eines aalglatten Businesstyps im Designeranzug und im Hintergrund Bodyguards mit anschlagbereiten Maschinenpistolen.
Jake atmete schwer. Er hatte das Gefühl, auf einen Abgrund zuzulaufen, ja, dahin getrieben zu werden. Er spürte die Roboter hinter sich und zog den Kopf zwischen die Schultern.
Vor einem offenen Schott blieb die Schwester stehen und forderte Jake mit einer Handbewegung auf, hindurchzugehen.
Jake holte noch einmal tief Luft und trat steifbeinig hindurch. »Such dir eine aus«, rief sie ihm nach. Zischend schloss sich der Ausgang hinter ihm.
Vor ihm lag eine Halle, dessen linke Hälfte an die Turnhalle seiner Schule erinnerte. Bunte Linien und Markierungen verzierten den Boden. Klettergerüste überzogen die Wand und eine Nische beherbergte Sportgeräte. Der andere Teil sah aus wie das extravagant angelegte Tropenhaus in einem botanischen Garten, oder wie ein exklusives Erlebnisbad mit Schwimmteich, exotischen Pflanzen und Strandbar. Verwirrt blieb er stehen und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. Jake glaubte, nicht richtig zu sehen: Um die Tische an der Bar schnatterte eine Horde – Frauen! Gute zwei Dutzend. Alle waren in Wickelgewänder gehüllt, in leuchtenden Farben, dünn wie ein Lufthauch. Gelegentlich nippten sie an langstieligen Gläsern, deren Inhalt ebenso bunt war wie ihre Garderobe.
Zu seinem Erstaunen wirkte die Atmosphäre völlig entspannt. Der schwere Duft von Parfüm in der Luft ließ ihn zu nur einem Schluss kommen: schon wieder Amüsierdamen!
Die Mädchen wurden plötzlich still und richteten ihre Blicke taxierend auf Jake.
Er gab sich einen Ruck und ging weiter. Keine Frau glich der anderen. Er musste lachen, als er an den Spruch seiner Mutter dachte: Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Eine lange, vollbusige Blondine lehnte lässig an der Bar und verfolgte ihn mit ihren hellblauen Augen. Daneben erkannte er Manulana, die eher skeptisch dreinsah, wogegen die Wilde mit dem runden Gesicht bereit schien, sich wieder auf ihn zu stürzen.
Jake konnte nirgendwo Männer entdecken. Es war, als konzentrierten sich alle Frauen nur auf ihn. Aber keine machte Anstalten, auf ihn zuzugehen. Dennoch konnte Jake ihren stummen Lockruf spüren: Komm zu mir! Eine Stimme in seinem Inneren flüsterte, sich einfach gehen zu lassen, die Sorgen abzuwerfen und zu genießen. Es wäre hilfreicher, die Frauen auszufragen, hielt eine andere dagegen. Jake schlenderte auf sie zu. Die Blonde bewegte sich als Erste. »Darf ich dir einen Drink servieren?« Sie blickte Jake in die Augen und senkte langsam ihre Lider.
Sie wirkte … professionell. Jake räusperte sich und schaute sich nach den anderen Mädchen um. Er entdeckte ein schwarzes Augenpaar in einem dunklen Gesicht. Diese Frau schien ihn weniger einladend anzusehen. Er war nicht ihr Typ und sie war nicht versiert genug, es zu verbergen. Aus ihr konnte er vielleicht etwas herausbekommen. Kurz entschlossen ging er auf sie zu. »Hallo.«
Sie warf ihm einen Blick zu, der Bände sprach. »Möchtest du etwas trinken?«, fragte sie zögernd.
»Wenn Ihr Bier hättet?«
»Gerne«, sagte sie mechanisch. »Ich hole es dir. Wo möchtest du dich hinsetzen?«
Jake sah sich nach einem Platz um, wo sie ungestört wären. »Vielleicht dort am Teich?«
Sie senkte den Kopf in Andeutung eines Nickens. »Ich werde gleich zu dir kommen.«
Jake ließ sich auf einem geflochtenen Sessel unter einer Palme nieder. Kurze Zeit später brachte sie zwei Gläser und stellte sie auf den Beistelltisch.
Jake lächelte sie freundlich an. »Nimm doch Platz. Wie heißt du?«
Sie schlug ein Bein über und schob den Saum ihres leuchtend gelben Gewands über ihr Knie. »Ungasili.«
»Weißt du, wo wir hinfahren?«
Sie zuckte die Achseln. »Zurück nach Nelantis.«
Jake ließ den Blick durch den Saal schweifen. »Ich frage mich, wer der Chef von dem ganzen ist?«
Sie legte den Kopf schief und sah ihn befremdet an.
Was ging in ihr vor? Hatte er zu offensiv gefragt? Er nahm sein Glas. »Trink doch erst mal.«
Mit angewidertem Blick nahm sie einen Schluck.
Jake stutzte. »Du magst kein Bier?«
Sie zuckte leicht zusammen.
»Warum hast du dir nicht etwas anderes mitgebracht?«
Sie senkte den Blick. »Es ist höflich, zu trinken, was der Mann wählt.«
Er runzelte die Stirn. »Auch wenn es dir nicht schmeckt?«
Sie presste die Lippen zusammen. »Es ist der Wille der Meduse.«
Jake horchte auf. »Ist das euer Leiter?«
Sie hob das Kinn. »Es ist die Göttin.«
Jake blickte sie verdutzt an.
Sie spielte nervös mit ihren Fingern. »Willst du mich nun mitnehmen?«
Jake schaute auf. »Wohin? Ich kann hier nicht weg.«
»Zu dir«, sagte sie mit hölzernem Gesichtsausdruck.
Jake schüttelte den Kopf.
Ungasili schien verwirrt. »Warum hast du mich dann gewählt?«
»Ich wollte mit dir reden«, antwortete er wahrheitsgemäß.
Sie schaute ihn verständnislos an. Aber auch erleichtert.
Anscheinend waren die Frauen an der Bar dem Verlauf der Unterhaltung gefolgt, denn nun schoben sie sich heran.
»Du solltest eine von uns wählen«, sagte eine grazile Rothaarige, die sich geschickt vor die anderen schlängelte und ihn aufreizend von oben bis unten musterte.
Jake schüttelte ungläubig den Kopf. Wer wählte hier eigentlich wen? Unter den Frauen schien es eine Art Wettbewerb zu geben. Nicht sie standen, wie es die Schwester noch angedeutet hatte, zur Wahl – es sah ganz so aus, als ob er für die meisten von ihnen die Trophäe war. Sein Blick sprang von einer Frau zur anderen, bis er plötzlich an einem vertrauten Gesicht hängen blieb. Myriam saß verloren an einem Tisch in der hintersten Ecke. Ein Gefühl der Wärme breitete sich in ihm aus.
Sie schaute nicht herüber, betrachtete nur still ihre Hände. Sie wirkte traurig. Unwillkürlich glitt seine Hand in die Tasche seines Kittels, suchte nach dem zierlichen Ohrring. Dann stutzte er. Warum hatte sie sich isoliert? Mochte sie ihn etwa nicht? Vor ein paar Tagen hatte er in der Kabine einen völlig anderen Eindruck gewonnen. Und er hatte sich von ihr, ganz im Gegensatz zu den übrigen Frauen, respektiert gefühlt. Ob er sie verprellt hatte? Dabei war er sich auf einmal sicher, dass er sich mit ihr arrangieren konnte. Überrascht stellte er fest, dass ihn der Gedanke sogar erfreute.
Jake ging langsam zu Myriam hinüber und setzte sich ihr gegenüber. Sie blickte auf. Ein kleines Lächeln erhellte ihr Gesicht, ihre zierlichen Augenbrauen zogen sich fragend ein wenig nach oben, aber sie schwieg. Jake sah sie lange an. Dann zog er den Ohrring hervor und legte ihn auf den Tisch.
Sie begann zu strahlen. »Da ist er ja! Oh, ich hab schon alles wie verrückt nach ihm abgesucht. Paps hat ihn mir geschenkt.«
Sie legte ihre Hand auf seine und Jake spürte eine ebenso tiefe wie ungewohnte Vertrautheit. Myriam war tatsächlich der einzige Mensch auf diesem verdammten Schiff, der Herzenswärme ausstrahlte. Ihre Nähe fühlte sich so gut an. Er konnte den Blick nicht von ihr wenden.
»Danke, danke, danke!«, flüsterte sie. Ihre Augen leuchteten und Jake wäre in diesem Moment am liebsten darin versunken.
»Ich hab ihn in der Kabine gefunden«, sagte er und es irritierte ihn, dass seine Stimme heiser klang.
Myriam beugte sich über den Tisch und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Ich bin so froh, Jake. Dieser Ohrring ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich hätte ihn nie ersetzen können.«
Jake räusperte sich. »Ich war nicht sehr nett zu dir, Myriam, es tut mir leid. Mir ging es nicht besonders gut.«
»Das habe ich mir schon gedacht«, antwortete sie. »Es macht nichts.«
Jake nahm ihre Hand. »Ehrlich gesagt, es wäre schön, wenn du mir Gesellschaft leisten würdest. Magst du mit mir kommen?«
Jake hätte schwören können, einen Anflug von Erleichterung in ihrem Gesicht zu sehen, als sie lächelte und nickte.
In der Kabine schickte sich Myriam an, ihre Kleider fallen zu lassen. Jake nahm sie bei den Händen. »Ich möchte, dass wir eine Vereinbarung treffen. Wir wollen Freunde sein, mehr nicht. Zumindest jetzt nicht. Ist das in Ordnung für dich?«
Myriam schaute ihm in die Augen, als hätte sie ein rätselhaftes Buch vor sich. Dann lief ein leises Lächeln über ihr Gesicht. »Ich glaube, ich verstehe.«
»Gut«, Jake machte es sich für die Nacht auf der Sitzbank bequem. Während er in den Schlaf sackte, spürte er ihren Blick, der ihn wie eine zärtliche Hand berührte.
Aber seine Träume waren bewegt: Um ihn herum erhoben sich schneebedeckte Gipfel. Die Gondel steckte fest und schaukelte im Wind. Dann stürzte sie. Jemand schrie. Schweißnass wachte er auf – aber das Gefühl des Fallens endete nicht. Ein Schwindelgefühl überkam ihn und die Pritsche schien sich unter ihm wegzudrehen. Dann presste es seinen Körper in die Polster. Erschrocken öffnete er die Augen. Die Zelle schien zu steigen, verharrte und kippte seitlich weg, sein Magen kribbelte. Dann wurde sein Körper schwer und es ging in einem Höllentempo nach oben. Irgendwo krachte es metallisch. Das Schiff stöhnte. Unregelmäßiges Sirren drang an sein Ohr, unterbrochen von statischem Rauschen.
Sturm.
Das musste ein mächtiger Orkan sein, dass er ein großes Schiff dermaßen beutelte. Jake krallte sich an der Pritsche fest und warf einen besorgten Blick auf das Bett neben ihm: Es war immer noch Myriam, die darin lag. Keine andere. Er atmete auf. Aber sie sah hundeelend aus. Sie hatte die Augen angstvoll aufgerissen und zitterte am ganzen Körper. Sie erinnerte ihn an ein Kaninchen, das der Fuchs in die Enge getrieben hatte.
Kurz entschlossen wartete Jake auf den nächsten Wellenberg. In dem kurzen Augenblick des Schwebens sprang er zu ihr und nahm sie in die Arme. »Es ist nur ein Sturm«, flüsterte er ihr beruhigend ins Ohr, so nah, dass seine Lippen die filigrane Silberfassung ihres Ohrrings berührten. »Er wird vergehen.«
So lagen sie, bis der Sturm abflaute, und sich ihr Zittern verlor.
»Solche Angst hatte ich noch nie«, gestand Myriam. Sie war blass und wirkte fahrig. »Bisher war die Fahrt so ruhig gewesen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht mitgekommen.«
Jake spürte die Wärme ihres Körpers. Sie erregte ihn. Doch so weit wollte er es nicht kommen lasen. Er setzte sich im Bett auf. »Ist das deine erste Reise?«, fragte er sanft.
Sie nickte und sah so aus, als ob es auch ihre Letzte sein würde. Jake strich ihr tröstend übers Haar. Er sog ihren süßen Duft ein und plötzlich spürte er ihre zarten Hände auf seiner Haut. Pass auf, was du tust, warnte eine Stimme in ihm, doch er wollte nicht hinhören.
Das Zischen der Tür ließ ihn zusammenzucken. Erschrocken schaute er auf und erblickte die Krankenschwester mit ihren Robotern. »Alles in Ordnung?«
Die Ernüchterung traf Jake wie eine kalte Dusche. Er sprang aus dem Bett und lief auf die Schwester zu. »Ich möchte …« Das neuerliche Zischen der Tür, die sich direkt vor seiner Nase schloss, ließ ihn verstummen.
Er schlug frustriert gegen die Wand.
»Die Dienerinnen kümmern sich immer um uns«, sagte Myriam beschwichtigend. »Damit wir wissen, dass uns die Meduse nicht verlassen hat. Sie beschützt ihre Kinder.«
Schon wieder diese Meduse. Jake drehte sich herum. »Eure Göttin?«
Sie nickte.
Eine Ordensschwester also. Das erklärte wohl auch das kleine Abzeichen an der Schulter ihres Kittels, das ihn an die Silhouette eines Tintenfischs erinnerte. Sein Verdacht verdichtete sich. Hinter seiner Entführung steckte eine Sekte, die ihre Anhänger psychisch versklavte. Er schaute Myriam an. »Wie bist du nur auf dieses Schiff geraten?«
Sie lächelte. »Zu Hause war es mir langweilig geworden. Ich wollte etwas erleben. Anfangs versuchte mein Vater mich davon abzuhalten, aber schließlich hat er nachgegeben.«
Jake ging zu ihr und schlüpfte wieder unter die Decke. »Willst du mir nicht ein bisschen mehr über deinen Vater erzählen?«
Sie legte den Kopf schief und kicherte. »Weißt du, dass du meinem Paps ähnlich bist, Jake? Er ist anders, als die anderen Männer. Er kann im Handumdrehen zornig werden und wie der Donner grollen, aber bald verziehen sich die Wolken und die Sonne strahlt wieder aus seinen hellblauen Augen.«
»Er ist wohl sehr nett, dein Vater.«
»Oh ja! Und er erzählt immer seltsame Geschichten, die sich anhören, als kämen sie aus einer anderen Welt. Sie ließen mir schon als Kind keine Ruhe. ›Das wird noch einmal schlimm enden mit dir‹, hat mir meine Mutter prophezeit.«
Jake richtete sich auf dem Ellenbogen auf und sah ihr in die Augen. »So weit lag sie wohl nicht daneben.«
Myriam schmiegte sich an. »Ach was! Was soll ich mit den langweiligen Kerlen, die sie mir schickten? Kinder gebären? Ich hatte das Gefühl, etwas zu verpassen, ich wollte raus. Also meldete ich mich bei den Schiffen. Zuerst musste ich zur Ausbildung zu den Kleristen. Die waren sehr streng und vieles verwirrte mich, aber ich lernte fleißig und machte alle Tests. Schließlich bestand ich als Jüngste auch die Prüfungen.«
Jake spitzte die Ohren. Er fragte sich, was diese Kleristen ihr beigebracht hatten und was das für Tests waren. »Mussten die anderen Frauen auch eine Ausbildung machen?«
Sie nickte.
Ihre Erzählung warf eine Reihe Fragen auf. Jake fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Aber gleichgültig, ob er es nun mit einer Sekte oder Menschenhändlern zu tun hatte, er war sich sicher, dass Myriam nichts von deren miesen Geschäften wusste. Vielmehr musste er befürchten, dass die Entführer Myriam etwas antun würden, wenn sie sich zu unbedachten Antworten verleiten ließ. Er atmete schwer und beschloss, sie nicht weiter auszufragen.
»Das hast du großartig gemacht! Sicher sind deine Eltern sehr stolz auf dich.«
Myriams Augen begannen zu strahlen. »Ja, ich glaube schon.«
Auf den Überwachungsmonitoren war kaum eine Bewegung zu sehen. Die beiden Beobachter streckten sich auf ihren Sitzen. »Es scheint so, als hätte es sich hinreichend beruhigt«, stellte der eine fest.
»Ich traue ihm nicht. Wenn Sie mich fragen, verstellt es sich, um uns aus der Reserve zu locken.«
»Genau das finde ich ja so spannend, mein Bester. Dieses Männchen ist sehr intelligent. Es fasziniert mich, ihm zuzuschauen. Lassen Sie uns sehen, wie er auf den zweiten Teil des Programms reagiert.«
Kapitel 4
Mittags öffnete sich unerwartet die Zellentür. Myriam fuhr freudig auf: »Wir haben Ausgang.«
Jake hob ungläubig den Blick. Der Gang blieb leer. Vermutlich hatte sich seine gute Führung schon bezahlt gemacht. Neugierig stand er auf und schaute in den Korridor. Es war niemand zu sehen. Jakes Herz pochte. Während Myriam den Weg nach links einschlug, wandte er sich in die andere Richtung.
»Hier geht es entlang«, rief sie.
»Gleich«, antwortete er und lief weiter.
Er kam nicht weit. Die nächste Schleuse war verschlossen. Sackgasse. Ende. Jake unterdrückte einen Fluch. Die Entführer ließen nur einen Weg offen und der endete in der bekannten Halle. Zelle mit Freilauf.
Neben der Strandbar war diesmal ein Buffet aufgebaut. Die Frauen drehten sich um und musterten Jake. Instinktiv nahm er Myriams Hand. Der Effekt verblüffte ihn: Die Mädchen wendeten sich augenblicklich den Speisen zu und schenkten ihm keine weitere Beachtung.
Am Buffet fand er zu seiner Überraschung unter all den fremdartigen Nahrungsmitteln Ribeye-Steak, gekochte Maiskolben und gebackene Kartoffeln mit Sour Cream. Es weckte Bilder aus seiner Jugendzeit: Zum vierten Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, war seine Familie immer zu Onkel Will nach Minnesota gefahren. Jake konnte ihn noch vor sich sehen, wie er die mächtigen Fleischstücke auf dem Grill wendete und heißes Fett in der glühenden Holzkohle zischend verdampfte.
Hitze stieg in Jake hoch. Sein Lieblingsessen hier zu finden, konnte kein Zufall sein. Man hatte ihn wohl vorher schon ausspioniert. Jake stellte seinen Teller ab. Sogleich hielt ihm Myriam eine Frucht hin, die wie eine warzige Melone aussah. Das Fruchtfleisch glich einem blauen Schwamm.
»Wamlomar«, erläuterte sie.
Das Ding sah aus wie die Kreuzung aus einem überdimensionalen Pockenvirus und einem Psychopharmakon. Jake schüttelte den Kopf.
»Etwas Süßeres gibt es in ganz Njamingloh nicht«, lockte sie.
Er sah sie zärtlich an. »Doch, dich.«
Myriam lachte und ehe er sich versah, schob sie ihm ein Stück zwischen die Zähne, dabei sah sie ihn mit kindlicher Erwartung an.
Jake seufzte und begann zu kauen. Das Fruchtfleisch prickelte auf der Zunge wie Brausepulver und schmeckte nach Marzipan.
In der Nacht hielt er es dann kaum noch aus. Mit aller Macht drängte es ihn, zu Myriam unter die Decke zu schlüpfen. Doch ein Gedanke törnte ihn ab, wie eine kalte Dusche: Wie viele Männer würden an den Monitoren der Überwachungskameras sitzen und zusehen?
Ein Roboter brachte Frühstück. Es schien Jake, als musterte er ihn einen Augenblick, bevor sich die Tür wieder schloss. Myriam erzählte von zuhause. Über Kinder, endlose Strände, Berge und die Stadt. Es schien keine Gewalt zu geben und die Göttin strahlte über einer friedlichen Kolonie. Er aber fragte sich, was wirklich in diesem Njamingloh los war. Gehirnwäsche? Massenmanipulation? Jake bekam feuchte Hände. Er würde es bald herausfinden.
Am Mittag, als er von der Halle zurückkam, die von Myriam die Messe genannt wurde, stand in seiner Zelle ein zweites Bett. Jake starrte darauf, als sei es eine Fata Morgana. Dann schlug er sich vor Freude auf die Schenkel: Das war ein Triumph über seine Entführer! Sie hatten eingesehen, dass sie ihn durch ihre Masche nicht kleinkriegen konnten! Er war standhaft geblieben! Im Überschwang riss er die überraschte Myriam in die Arme und wirbelte sie einmal fröhlich im Kreis herum.
In der Beobachtungskanzel wurden die Geräte auf Nachtlichtverstärkung gestellt. »Das hat ja hervorragend geklappt! Es hat den Köder geschluckt.«
»Exzellent! Dann können wir Phase drei einleiten.«
Der Andere wirkte alarmiert. »So früh? Sie wissen, dass das seine Gefahren birgt?«
»Ich denke, ich werde es riskieren.«
Kapitel 5
Die Zellentür öffnete sich früher als sonst. Jake suchte den Auslauf. In der Messe war das Buffet noch nicht aufgebaut, einige der Frauen schwammen nackt im Teich. Doch das war es nicht, was Jakes Aufmerksamkeit anzog: An einer Drückbank in der Mitte der Halle schwitzte ein muskelbepackter Südländer unter mächtigen Hanteln.
Jake blieb wie angewurzelt stehen. Er war also nicht der einzige Gefangene.
Mit klirrendem Scheppern ließ der Mann die Gewichte in die Halterung fallen. Ohne aufzusehen, rief er mit schwerem südamerikanischen Akzent: »Kannst du mir noch zwei Kilo auflegen?«
Jake sah sich um und wunderte sich, mit wem der Fremde redete.
Der hob den Kopf und entdeckte Jake. »Oh, ein Mann.« Grinsend setzte er sich auf. »Pedro. Pedro Gonzales.«
Jake runzelte die Stirn. »Angenehm. Jake Forrester.« Er schüttelte flüchtig die dargebotene, riesige Hand. »Gehören Sie hier dazu?«
Behände sprang Pedro auf. Er reichte Jake bis zum Kinn, war aber doppelt so breit wie er. »Das ist aber schön, Jake. Lass uns einen trinken.« Auf dem Weg zur Bar kam er am Teich vorbei, wo er geschwind sein Gewand abstreifte und zu den Frauen ins Wasser sprang.
Verwundert sah Jake ihm nach, wie er eine Bahn schwamm, dabei eine Frau am Kinn kraulte und eine andere neckisch am Haar zupfte. War er vielleicht ihr Bewacher? Mit seiner unbefangenen Art und seinem herzlichen Lachen passte er allerdings nicht zu dem Bild, das Jake von Mädchenhändlern hatte.
Pedro stieg wieder aus dem Becken und sogleich kam eine Frau und reichte ihm ganz selbstverständlich einen Kittel. Er warf ihn über, packte Jake am Arm und schob ihn zur Bar. »Trinkst du Tequila?« Ohne eine Antwort abzuwarten, schnipste Pedro mit dem Finger. Eine der Frauen beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen. Der Mann war jedenfalls der Macker hier.
Jake ließ sich auf einem Barhocker nieder und fixierte Pedro. Der kämmte sich sein nasses schwarzes Haar mit den Fingern zurück, wandte ihm sein rundes Gesicht zu und lächelte gutmütig. »Wie kommst du hier her, Jake? Americano?«
Die Frage warf Jake aus dem Konzept. Ein Entführer würde so etwas nicht fragen. »Ja, ich bin Amerikaner«, sagte er verhalten.
»Ah, bueno.« Pedro grinste und griff in eine Schale, die neben ihm auf dem Tresen stand, ließ etwas Salz daraus auf seinen Handrücken rieseln und leckte mit spitzer Zunge daran. Jake erinnerte sich an das Trinkritual, das seine Kommilitonen auf dem College gepflegt hatten. Und auch an die fette Mottenlarve, die, als Qualitätsbeweis für den Inhalt, in der Tequilaflasche schwamm. Ihm wurde flau im Magen. Pedro leerte sein Glas in einem Zug und biss genussvoll in einen Zitronenschnitz. Jake zog es die Schleimhäute zusammen. »Ich glaube, ich hätte besser einen Manhattan bestellen sollen.«
»Ja, mein Freund, sag’s der Kleinen!« Pedro nickte zu einer Frau hinüber, die sich hinter der Theke unübersehbar langweilte. »Die sorgt dafür, dass dein Heimweh weggeht.« Seine Pranke landete auf Jakes Schulter. »Und das hast du nötig, du siehst traurig aus.«
Jake schaute ihm forschend in die Augen. »Um deine Frage zu beantworten – wie ich hierher gekommen bin, weiß ich nicht. Ich bin von einem Gletscher abgestürzt, ansonsten habe ich keine Erinnerung.«
Pedro pfiff durch die Zähne: »Ja, die Gletscher sind gefährlich! Bei uns holen sie manchmal auch Eis aus den Anden herunter. Einige überleben das nicht.«
»Ich hole kein Eis«, grinste Jake. »Ich bin Astrophysiker und suche auf den Gletschern nach Meteoritenspuren.«
Pedro nickte und ließ den Blick langsam an ihm auf- und abgleiten. »Un cientifico. Dachte mir schon, dass du lieber mit dem Kopf arbeitest.«
Jake verspürte ein leises Ziehen im Magen, schluckte aber seinen aufkommenden Zorn hinunter. Er wusste, dass er in diesem Punkt etwas empfindlich war. Und Pedro schien eher zu der groben Sorte zu gehören, die es aber im Grunde gut meinte.
Er nippte an seinem Cocktail. »Wissen Sie, wo wir sind?«
Pedro winkte nach der Frau für einen zweiten Drink.
»Auf einem Schiff, denke ich. Erst hab ich gedacht, ich bin tot. Und dann kamen die Frauen. Madre Mia! Dann hab ich gedacht, ich muss versehentlich bei den Moslems im Himmel gelandet sein. Doch jetzt glaube ich, dass es nach Amerika geht. Ja, Jake, du bist sicher bald wieder zuhause.«
»Kommt es Ihnen denn hier nicht komisch vor?«, hakte Jake nach.
»Komisch? Nein! Kolumbien ist komisch. Kein Geld. Keine Arbeit. Ich bin Fischer. ›Jetzt reicht’s‹, hab ich mir gesagt und bin abgehauen mit Wasser und Proviant. Dann kam der Sturm. Boot futsch, ich untergegangen. Ende. Bin dann hier wieder aufgewacht.«
Ein einfacher Mensch. Das Ganze wurde noch rätselhafter. Jake hatte bisher angenommen, wegen seiner besonderen Kenntnisse entführt worden zu sein. Und jetzt sah es so aus, als ob man auch einen schlichten Fischer eingefangen hatte – einen, der sicherlich über kein Geheimwissen verfügte. »Warum glauben Sie, dass es nach Amerika geht?«
»Ah. Roboter und schöne Señoritas!« Er zwinkerte.
Das war also das Image Amerikas im Ausland. Fortschrittliche Technologie und heiße Girls. »Wenn das Schiff nun nach China oder sonst wohin fährt?«
»Egal, alles besser als Kolumbien!« Grinsend klopfte Pedro Jake auf die Schulter. »Sie können von mir aus zum Mars fahren. Solange ich genug zu essen und Señoritas habe, ist es mir gleich.«
Brot und Spiele. Jake schüttelte den Kopf. Pedro hatten sie schon in der Hand.
»He, Americano. Warum lachst du eigentlich nie? Gefällt es dir hier nicht?«
Was sollte Jake ihm sagen? Der Mann würde es doch nicht verstehen. »Ich habe Angst, dass ich nicht mehr nachhause komme.«
Aus mitfühlenden Bernhardineraugen sah Pedro ihn an. »Hast du Familia?«
Jake starrte ins Leere. Zwei Jahre war es her. Cape Cod. Die Sonne brannte vom Nachmittagshimmel auf das windschiefe Strandvolleyballnetz. Liljas glänzendes, goldbraunes Haar flatterte wie ein Banner, als sie nach dem Ball hechtete, traf und sich abrollte. Trockener Sand heftete sich an ihre schwitzende Haut, dass sie wie ein paniertes Hühnchen aussah. Lachend sprang Jake auf sie zu, versuchte sie zu greifen. Sie warf ihm Sand entgegen und stellte ihm ein Bein. Kichernd rangen sie wie kleine Kinder. Sie waren erst wenige Wochen verheiratet.
Jake ließ den Atem gehen und schüttelte langsam den Kopf. »Nein, ich habe keine Familie. Aber ich habe ein ungutes Gefühl.«
Schon lachte Pedro wieder. »Du bist Americano und hast Geld. Genieße die Reise, egal wohin sie führt. Dann kaufst du dir eine Rückfahrkarte.«
Jake fand seine Zellentür unverriegelt. Er schien jetzt Freigänger zu sein, und als hätte dieses winzige Stückchen Freiheit ein Tor aufgestoßen, fluteten Erinnerungen von Zuhause sein Bewusstsein. Der Nachbarsjunge Ron tauchte vor seinem inneren Auge auf. Jake spürte einen Stich im Herzen. Wer würde ihm nun die Matheaufgaben nachsehen? Jake schüttelte den Kopf. Ronny käme allein zurecht, aber es wurde Jake schlagartig klar, dass er die unendlich vielen Fragen des Jungen vermisste. Er seufzte wehmütig und seine Gedanken schweiften zu der pummeligen Sekretärin Sherry, der Mutter des Forschungsinstituts. Sie machte sich sicher große Sorgen. Rivale Paul hingegen würde dem Institutsleiter Prof. Charles E. Ditherberry, III. in den Ohren liegen, um die Finger an Jakes Projekt zu bekommen. Jake knirschte mit den Zähnen. Dabei war er so kurz vor dem Durchbruch zu revolutionären Erkenntnissen gewesen! Die durften nicht in die falschen Hände geraten. Jake warf einen Blick auf die unversperrte Zellentür. Sie kam ihm wie eine Einladung vor, eine Chance zur Flucht.
Noch in derselben Nacht stand er leise auf und zog sich im Dunklen an. In den Gängen warf die dämmrige Nachtbeleuchtung lange Schatten. Jake tastete sich vorwärts, die Sinne angespannt. Nur der Weg zur Messe stand offen.
Im milchigen Licht der Funzeln wirkte der Raum nebelig, die Konturen der Einrichtungen verschwommen. In den ersten unverschlossenen Gang schlich er hinein. Er war noch nicht weit gekommen, da ließ ihn ein jähes Knacken zusammenfahren. Begleitet von leisem Zischen schob sich eine Kabinentür auf. Jake drückte sich an die kalte Wand. Gegen das blendende Licht zeichnete sich eine vollbusige Figur mit Wespentaille ab. Die Blonde aus der Messe.
Jake atmete auf.
Sie lehnte sich an den Rahmen und brachte ihr Profil zur Geltung. »Hast du endlich genug von der Kleinen?«, hauchte sie. »Komm rein.«
Dazu war er nicht gekommen. Aber Erklärungen wollte er auch nicht abgeben. »Ich suche Ungasili«, log er.
»Zu ihr kannst du nachher noch gehen. Die Nacht ist lang.«
»Du willst doch nicht, dass ich sie enttäusche? Sag mir lieber, welches ihre Kabine ist.«
»Ich zeige es dir«, sagte sie und ließ ihr Gewand heruntergleiten. »Danach.«
Jake musste an Myriam denken und wandte den Blick ab. »Ich werde es selber finden. Pass du lieber auf, dass du dich nicht erkältest.«
Sie schnurrte wie eine Katze. »Etwas Wärme könnte mir jetzt guttun.«
»Dann mach die Tür zu. Du stehst im Zug.«
Die Haare flogen, als sie ihren Kopf herumwarf und in der Kabine verschwand.
Jake wartete noch einen Moment, dann schlich er weiter, fand aber die Schleusen verschlossen. Auch hier gab es keinen Weg nach draußen.
Enttäuscht ging er zurück zur Messe und ließ sich in einen Sessel fallen. Da kam ihm eine Idee.
Am Morgen wandte er sich an Myriam. »Glaubst du, sie haben etwas dagegen, wenn ich in der Messe schlafe?«
Sie verzog das Gesicht. »Soll ich in meine eigene Kabine zurückgehen?«
Jake wollte Myriam nicht kränken. Aber er konnte ihr seinen Plan nicht unterbreiten, ohne dass es abgehört wurde. Er entschied sich für eine Notlüge. »Ich schlafe so gerne am Wasser.«
Ein freudiges Lächeln flog über Myriams Gesicht. »Ich auch! Oh, das ist schön! Da komme ich mit.«
Jake nahm sie in die Arme. Wie gut sie sich anfühlte. Mit ihr zusammen würde es mehr Spaß machen, gewisse Gewohnheiten auszuspionieren. Obendrein verschleierte ihre Gesellschaft seine Absicht.
Die Übernachtungen am Pool sprachen sich schnell herum. Andere Frauen gesellten sich zu ihnen. Myriam war begeistert und organisierte regelmäßige Beach-Partys. Die Frauen kicherten und giggelten die halbe Nacht, bis es Jake auf die Nerven ging. Was er wissen wollte, hatte er nach wenigen Tagen herausbekommen. Nun fehlte ihm nur noch eine günstige Gelegenheit.
Er wartete.
Die Tage wurden zur Woche. Die Schwester arrangierte Ballspiele und Sportwettkämpfe. Abends führten die Frauen Tanz- und Theaterstücke auf. Die waren meist erotischer Natur und nagten schmerzlich an Jakes Widerstand. Pedro hatte keine Probleme. Jeden Abend kam eine andere Frau zu ihm. Das schien niemanden zu stören. Ganz im Gegenteil. Neue Frauen kamen in die Messe, dafür vermisste Jake andere.
»Warum kommen sie nicht mehr?«, fragte er Myriam eines Abends.
»Sie sind mit Kind«, antwortete sie und lächelte.
»Nehmen sie denn keine Verhütungsmittel?«
Myriam runzelte die Stirn. »Was ist denn das?«
»Na, damit eine Frau nicht schwanger wird.«
Myriam sah ihn verständnislos an. »Wozu soll das gut sein?«
Es verschlug Jake die Sprache. Das war absurd. Zugegebenermaßen konnte es ja auch bei Amüsierdamen immer mal einen ›Unfall‹ geben. Aber es fehlte mindestens ein halbes Dutzend der Frauen. »Nimmst du auch nichts, um eine Schwangerschaft zu verhindern?«
»Warum?«
»Na, ich dachte, du willst, dass ich …«
Sie lächelte.
»Und wenn du dann ein Kind von mir bekommst?«