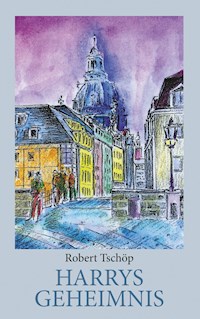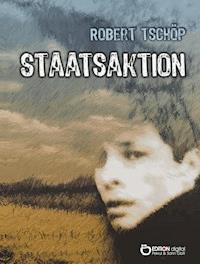
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Robert Tschöp ist es gelungen, in 15 Skizzen Wesentliches zu seinem Werdegang literarisch zu gestalten. Episoden einer Nachkriegskindheit, Studentenulk mit lächerlich-bedrohlichem Nachspiel, erschütternde wie anrührende Schicksale und Porträts - all das rundet sich zu einem eindrucksvollen Bild ostdeutscher Befindlichkeit zwischen Mauerbau und Wendezeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Robert Tschöp
Staatsaktion
Ein Werdegang in Episoden
ISBN 978-3-86394-752-1 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Sabine Beck
Illustrationen: Robert Tschöp
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Für Annerose, Claudia, Lotte und Bertram
DIE ZUCKERTÜTE
Heute, nach mehr als fünfzig Jahren, genügt noch immer ein winziger Anstoß, und ich habe Klänge von herrlicher Reinheit, eine fröhliche Melodie im Ohr - den Gruß eines Türglöckchens aus Messing, das willkommen heißt oder verabschiedet - je nachdem, ob man den Raum dahinter, einen Laden, betritt oder verlässt. -
Wegen ein paar Kleinigkeiten, die sie unbedingt benötigte, hatte Mutter uns an jenem späten Nachmittag in den Dorfkonsum geschickt. Gewöhnlich maulte ich, wenn ich dorthin mitmusste; denn im Konsum hatte ich, anders als bei Fleischer Lohse, weder ein Scheibchen Blutwurst zu erwarten, noch konnte ich darauf spekulieren, den Laden, an einem süßen Keks knabbernd, zu verlassen. An jenem Tag aber packte ich zu Mutters Erstaunen rasch die Hand meines großen, fünf Jahre älteren Bruders und zerrte ihn auf die Straße hinaus.
Hell tönte das Ladenglöckchen beim Öffnen der Tür und beim Schließen hinter uns. Kaum war sie zu, ließ ich die Hand meines Bruders los und steuerte schnurstracks die linke Ladenseite an, ohne die bauchigen, mit bunten Bonbons gefüllten Gläser auf dem Ladentisch neben der Kasse auch nur eines Blickes zu würdigen, gab es doch an dem bewussten Tag, dem vor meiner Schuleinführung, nur eine einzige Sache, die wichtig war: die Zuckertüte.
Wahrhaftig, da hing sie, baumelte dutzendfach - und noch immer an weißen Schnüren - an der Decke wie an einem riesigen Baum. Und morgen war Schuleinführung, der erste Schultag; morgen würde ich endlich, endlich meine Zuckertüte bekommen!
Aber wieso, fragte ich mich, plötzlich beunruhigt, wieso hingen hier noch so viele Zuckertüten herum?
Hatten meine Eltern etwa vergessen, eine für mich zu kaufen?
Ein schrecklicher Gedanke schoss mir durch den Kopf, eine furchtbare Vorstellung: Wenn nun ich morgen dastehen würde, ich vor allen anderen Kindern - ohne Zuckertüte vom Zuckertütenbaum? Vielleicht, weil meine Eltern sich nicht hatten entscheiden können, welche sie nehmen sollten. Vielleicht auch, weil sie gedacht hatten: Er ist noch zu klein, unser Junge, er kann eine Zuckertüte noch gar nicht halten; bestimmt fällt er um damit und tut sich weh. Wir werden ihm später eine kaufen - nächstes Jahr, wenn er größer ist.
Ich schloss die Augen, wischte mir Schweiß von der Stirn.
Dachte: Nein, so dumm, so gemein sind meine Eltern bestimmt nicht.
Stand dann, auf den Zehenspitzen gereckt, am Ladentisch und überlegte, was so eine bunte Zuckertüte kosten mochte. Sicher viel, bestimmt ungeheuerlich viel Geld. Hoffentlich - ach, hoffentlich hatten meine Eltern diesmal, nur dies eine Mal genügend Geld gehabt!
Dabei - so sagte ich mir - möchte ich ja gar nicht die größte Zuckertüte. Schließlich gibt's auch kleine, die mir gefallen. Zum Beispiel wäre ich schon zufrieden mit ... mit - ja, mit der dort. Ist die nicht wunderschön?
Verzückt starrte ich sie an. Bis mir auffiel, dass sie - leider - die Größte am Zuckertütenbaum hier unter der Ladendecke war. Dabei hatte man ihr - auch das noch! - mein Lieblingsmärchen auf den runden, bunten Bauch gemalt: Rotkäppchen im Wald, am Arm das Körbchen mit Wein und Kuchen, und daneben der graue Wolf, der gar nicht böse aussah, eher wie Karo, der Schäferhund unseres Nachbarn ...
Ich blinzelte. - Ja, Karo war ein lieber Wolf, und diese
Zuckertüte würde ich schon tragen können. Fest würde ich sie an mich pressen und sie ohne abzusetzen bis nach Hause schleppen, ohne Hilfe, ganz allein. Es sei denn, Mutti würde bitten, sie auch mal tragen zu dürfen.
Wieder und abermals besah ich mir die Pracht unter der Ladendecke. Da stolperte mein Blick unvermittelt über eine merkwürdige, eine ganz besondere - ja, eine völlig unmögliche Zuckertüte: Inmitten der schönen, runden, bauchigen hing tatsächlich eine kantige, hässlich eckige?
Die musste ich meinem Bruder zeigen, sofort!
Der aber winkte mir, in der Hand den Einkauf, ihm zu folgen, und auf dem Heimweg schwieg er, schwieg beharrlich, als ich, aufgebracht und höhnisch, ihm erklärte, wie blöd ich eckige Zuckertüten fände.
Tags darauf bekam ich - eine eckige Zuckertüte. Die Enttäuschung war - trotz des ansehnlichen Inhalts - gewaltig, und sie wurde noch größer durch eine Besonderheit, ein exotisches Extrageschenk. Außer Bonbons, Schokolade und Keksen und außer einem Paar langer brauner Wollstrümpfe hatten meine Eltern drei rotwangige, mit Härchen bewachsene Früchte ergattert. Früchte, die sie - stolz und geheimnisvoll - "Pfirsiche" nannten.
Liebe, arme Eltern! Mir die Schuleinführung, meinen ersten Ehrentag, derart und vollends zu verderben! Gewiss, selbst neun Jahre nach dem Krieg war es für "Flüchtlinge", für aus dem Sudetenland Vertriebene noch eine Meisterleistung, so was aufzutreiben, und bestimmt habt ihr euch Groschen und Pfennige abgespart, um mir, dem schmächtigen Kerlchen, eine außergewöhnliche Freude zu machen, und - nun ja, außergewöhnlich war ja auch, was mir mit euerm Extrageschenk widerfuhr.
Ums so zu sagen: Ich kannte jene Früchte nicht, hatte vorher nicht mal ihren Namen gehört, tat so, als freue ich mich, und rieb sie, weil sie so rotbäckig und seidenhaarig waren, heimlich und neugierig an meinen eher blassen Schulanfängerwangen ...
Das Entsetzen zu aller Enttäuschung: Minuten später prickelten mir die Wangen, kribbelte es im Gesicht wie nach einer Brennnesselwäsche.
Das Brennen ging zwar bald weg, aber die Pfirsiche, diese Dinger - auch noch essen ...?
Was ich dann doch tat - brav, wie ich war, zudem erschöpft vom Gutzureden, vom Enttäuscht-, ja Entrüstetsein meiner lieben, hartnäckigen Eltern.
Volle zwei Pfirsiche würgte ich unter Tränen hinunter, und in der Nacht danach erbrach ich derart heftig, dass ich den folgenden Tag, den ersten richtigen Schultag, daheim und größtenteils im Bett verbringen musste.
FÄLSCHUNG
Während der Grundschulzeit war ich meist der Klassenbeste. Nicht, dass ich schlauer, intelligenter als meine Klassenkameraden gewesen wäre. Mein Vater hatte "Schuld" an meiner Spitzenstellung.
Mein Vater war Lehrer.
Nur wer einen Lehrer zum Vater hat, zudem einen Lehrer-Vater, von dem er selber unterrichtet wird, nur der kann nachvollziehen, unter welchem Dauerstress ich stand. Es war ein Druck, der mich von einem Angstzustand in den nächsten trieb, mich zu absurden Vorstellungen, ja zu lächerlichen Handlungen drängte. Was sonst wohl hätte mich dazu bewogen, vor der Wohnungstür stehen zu bleiben, bangevoll ein Kreuz zu schlagen und - obwohl mir keinerlei Schuld bewusst - zu Gott zu beten, ja nichts Schlechtes getan zu haben?
Wenn dennoch in meiner Furcht-Liebe zu den Eltern die Liebe überwog, so verdanke ich dies der damals vielleicht noch im Unterbewusstsein verborgenen Einsicht, dass hinter der unbestechlichen Strenge meiner Eltern zwei Beweggründe standen: die unbestreitbar gute Absicht und die - ich muss es heute zugestehn - Notwendigkeit, konsequent zu sein.
An meinem Vater liebte ich den Vater, und auf den Lehrer in ihm war ich stolz. Nie habe ich einen besseren Lehrer als ihn kennengelernt. Unvergesslich für mich, welche Ruhe in der Klasse von ihm ausging. Unglaublich seine Ausdauer, wenn jemand einmal etwas partout nicht in den Kopf zu bekommen schien. Dann redete er gut zu, machte Mut, fing, wenn es sein musste, zum -zigsten Mal von vorne an.
Geriet er dennoch in Rage, was selten genug vorkam, dann freilich Gnade dem, auf den sich sein Donnerwetter entlud. Die glatten schwarzen Haare bebten auf dem ruckenden, zuckenden Kopf und das Brüllen aus der Tiefe seines mächtigen Leibes schien kein Ende nehmen zu wollen.
Alle Unbeteiligten glitten schnellstens, so tief sie nur konnten, in die Bänke und hüteten sich tunlichst, sich durch einen Mucks als nächstes Ziel zu präsentieren. Für Gesprächsstoff in den Pausen danach war gesorgt - und der angebrüllte Schüler geraume Weile ein Held.
Ging es allerdings um mich, vermochte ich irgendeine Frage nicht auf Anhieb zu beantworten, dann schien mein Vater seine pädagogischen Fähigkeiten allesamt in einen Panzerschrank weggeschlossen zu haben.
Vom ersten Schultag an - eigentlich schon Monate vorher - bekam ich seinen seltsamen Ehrgeiz zu spüren:
Immer hatte ich als sein Sohn, als Lehrersohn, den Mitschülern ein Stück voraus zu sein. Lernten wir in der ersten Klasse einen neuen Buchstaben schreiben, hatte Vater ihn schon -zigmal mit mir geübt. Waren wir in der Schule noch bei den Druckbuchstaben, dressierte er mich zu Hause bereits mit Schreibschrift.
Meine Zensuren "stimmten" zwar, waren wie erwartet, mit den Jahren aber wuchs dennoch meine Angst vor schlechten Noten. Zudem nahm die Zahl der Zensuren mit der Zahl der Unterrichtsfächer zu, und bald hatten die Erwartungen meines Vaters die Grenzen der Vernunft meilenweit überschritten: Eine Eins ohne volle Punktzahl gab Anlass zu Kritik; eine Zwei dokumentierte bereits offenkundiges Versagen; eine Zweiminus hatte es schlicht nicht zu geben.
Wollte ich trotz meiner ständigen Angst, die im Laufe der Zeit weder meinen Mitschülern noch den Lehrern entgangen war, weiter auf den Beinen bleiben, gesund und aktiv, dann - so weiß ich heute - musste etwas geschehen, sich etwas ereignen, musste irgendwer oder irgendwas mir Hilfe zuteilwerden lassen.
In der vierten Klasse geschah es dann, traf's mich.
Die Aufgaben, die uns von Mathelehrer Thomas gestellt worden waren, hatte ich rasch gelöst. Nur Achim war wieder einmal als Erster fertig gewesen - Achim, der Junge aus meinem Haus, den ich beneidete, weil er es nicht nötig hatte, daheim stundenlang zu üben, der statt dessen Rad fuhr oder im Wald herumstrolchte - Achim, der keinen Vater hatte, nur eine Mutter, bei der er ungemein viel Freizeit genoss.
Die anderen rechneten noch, grübelten, kauten an ihren Füllfederhaltern.
Wie mein Vater mir eingetrichtert hatte, überprüfte ich
meine Rechenergebnisse, und da passierte es: Genau zwischen zwei Zahlenkolonnen tropfte es einen Klecks aus meinem Füller.
Erschrocken sah ich nach vorn. - Die Formzensur, die Note für das Äußere, auf das mein Vater so viel Wert legte, war in Gefahr.
Lehrer Thomas schaute gelangweilt von seinem Stuhl aus durchs Fenster, wohl hinüber zu seinem Garten.
Wie viel Zeit blieb mir noch?
Beiläufig: Das Tragen einer Uhr war uns - weshalb auch immer - strengstens verboten.
Ich machte mich klein, duckte mich, so gut es ging, hinter Rosi, einer - wie wir es nannten - "mageren Gans", riss vorsichtig und leise, beinah geräuschlos die bekleckste Seite aus dem Heft und begann zu schreiben.
Allmählich wurde es lebhaft ringsum. Einer nach dem anderen legte seinen Füller in die Aussparung auf der dunkelbraunen Holzbank und schloss sein Heft. Ich aber schrieb wie ein Besessener, heiß der Kopf, schrieb mit schweißfeuchten, zitternden Händen.
Anderthalb Aufgaben fehlten mir noch, als die Hefte eingesammelt wurden.
Die Drei unter meiner Arbeit ließ mich nicht einmal weinen. Zu tief saß der Schock, zu ungeheuerlich war die Angst.
Die erste Drei in meinem Leben ...
Nicht die Schläge fürchtete ich, die es zweifelsohne diesmal geben würde, nicht die Hiebe, wohl aber die Worte meines Vaters. Die würden mehr wehtun, tausendmal mehr.
Nach dieser Mathearbeit - das war mir klar - musste ich unwiderruflich als Jauchefahrer enden. Das hatte Vater schon des Öfteren prophezeit, bei weitaus geringeren Anlässen, und das hörte ich ihn jetzt wieder und wieder äußern, bis - wie früher manchmal - Mutter nach mir griff, mich packte, mir den Hosenboden versohlte und mich dann bekümmert in mein Zimmer schickte.
Seltsam im Rückblick: Ich kann mich nicht erinnern, dass Vater mich je geschlagen hätte. Mutter hingegen war flink mit der Hand; aber richtige Prügel habe ich auch von ihr nie bekommen.