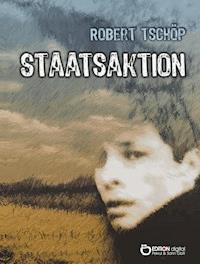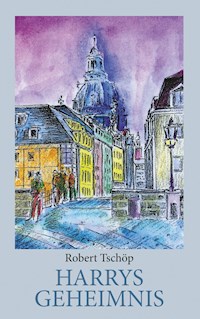Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In 22 chronologisch gereihten Episoden beschreibt der Autor Robert Tschöp seinen Werdegang in mal humorvollen, mal tragischen Erinnerungen an die nicht immer leichte Kindheit, an die ihn prägenden Erlebnisse während der beschwerlichen Abiturzeit, über die befreienden Jahre als Student in Erfurt bis hin zu den vielschichtigen Ereignissen in seiner vierzigjährigen Lehrertätigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Eine leise Geschichte
Die Lederhose
Kilometersteine
Anna S.
Der Hund
Sekundenentscheidung
M.
Mathe-Abitur
Glaubenssache
Fan und Vernunft
Die Versuchung
Über Mut
Politunterricht
Glückssache
Lektionen
Seelenfraß
Späte Genugtuung
Prager Botschaft
Es reicht!
Doppel- Referat
Ende gut. Alles gut?
Fazit
Eine leise Geschichte
Wir, meine Eltern, mein Bruder Wolfgang und ich, wohnten in Kurort Gohrisch, einem Dorf mit etwa tausend Einwohnern in der Sächsischen Schweiz. Meine Eltern waren 1946 Vertriebene aus dem Sudetenland. Nach relativ kurzer Zeit hatten sie die Integration einigermaßen geschafft. Einigermaßen deshalb, weil ich aus den Berichten meiner Mutter weiß, dass sie, als der Hunger damals über alle Maßen groß war und sie und andere in der Nacht auf das abgeerntete Kornfeld des Dorfes gingen, um nach ein paar übrig gebliebenen Ähren zu suchen, vom Bauern des Feldes mit der Peitsche vertrieben wurden.
In diese Zeit war ich hineingerutscht. Heißt: Statt eines geplanten Sudetendeutschen war also mit mir ein Sachse geboren. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, als solcher stets bestens gefühlt. Selbst der Dialekt, der Nichtsachsen eher zum Verachten als zum Schmunzeln bringt, wurde mir angeboren, und ich beherrsche ihn bis heute prächtig. Schließlich wuchs ich hier auf. Mit sieben kam ich in die Schule.
Neun Jahre mag ich gerade gewesen sein. Mein Vater lag seit Wochen schon wegen seiner Lungen-Tbc in einer Heilanstalt. Mutter, mein fünf Jahre älterer Bruder und ich waren an einem Wintersonntag auf dem Heimweg von der fünf Kilometer entfernten, im Bielatal liegenden katholischen Marienkirche des Städtchens Königstein.
Über Nacht hatte es viel Neuschnee gegeben, und es war bitterkalt. Unbarmherzig zwackte eisiger Wind durch die mäßig warme Kleidung. Mit Gedanken an die bald warme Stube daheim, versuchten wir mit flotten Schritten dem Frost ein wenig zu entkommen.
Wir hatten Königstein bereits verlassen und befanden uns in halber Höhe der steilen Straße durch den Wald. Da vernahmen wir leises, ganz leises jämmerliches Piepsen. Wir blieben stehen, hoben die Köpfe, lauschten und gingen auf das Jammern zu. In einer Schneewehe am Straßenrand hockte ein Sperling, der offenbar zu entkräftet zum Fliegen war.
Tatsächlich gelang es uns, den halb erfrorenen Sperling lebendig nach Hause zu bringen.
Entgegen dem sonstigen sonntäglichen Rhythmus fielen die Küchenarbeiten für das Mittagessen aus. Stattdessen hockten wir drei wie gebannt um den mit glänzenden Messingstäben gefertigten Vogelkäfig, den mein Bruder eilig auf dem Dachboden aufgestöbert hatte. Wie ein kleiner orientalischer Palast ist er mir in Erinnerung, mit seinen quadratischen Glasplatten an zwei Seiten, in die feine Blumenornamente ziseliert waren.
Mit halb geschlossenen Augen hockte unser Sperling da. Unbeweglich. So, wie mein Bruder ihn behutsam hineingesetzt hatte.
Unser eindringliches Zureden, unser leises Flehen, er möge etwas von dem hingestreuten Vogelfutter aufpicken, blieb ohne jeden Erfolg. Er fraß nicht. Er trank nicht.
Mittlerweile knieten wir um den Tisch, spürten nicht die Unebenheiten der Holzdielen, die durch den dünnen, grünen Linoleumbelag in unsere Knie drückten.
Schon die geringste Bewegung des armen Geschöpfs ließ uns noch mehr erstarren und uns flüstern: Jetzt!
Endlich, nach über einer Stunde, öffnete unser Sperling seine Augen, sah er uns groß an – und war tot.
Reglos, wie erstarrt, verharrten wir noch eine Weile.
Dann erhob sich Mutter und machte sich am Küchenherd zu schaffen.
Ungläubig starrte ich auf das braungraue Gefieder unseres kleinen Freundes.
Derweil war mein Bruder verschwunden und kam bald darauf mit einer leeren Zigarrenkiste und etwas Heu wieder. Er nahm das Heu und bettete es in die Kiste, legte den toten Sperling behutsam in seinen kleinen Sarg und bedeckte ihn mit dem restlichen Heu. Um ihm ein würdevolles Begräbnis zu geben, nagelte ich den Deckel mit vier kleinen Nägeln und dicken Tränen zu.
In einer Ecke im Garten unter einem Apfelbaum scharrten wir den Schnee beiseite und erzwangen im hart gefrorenen Erdreich ein Loch. Da hinein senkten wir den Sperlingssarg, bedeckten ihn mit Erde und Schnee, und wir waren fest überzeugt, dass seine kleine Vogelseele auch dank unseres kurzen Gebets schnurstracks dem Vogelhimmel zuflattern würde.
Die Lederhose
Mit zehn Jahren war ich aus meiner kurzen Lederhose endgültig herausgewachsen. Nichts wurde von uns Dorfjungen vom Frühjahr bis Herbst lieber getragen als diese Hose. Eine geniale Erfindung! Mit breiten Hosenträgern am Körper gehalten, kam uns dieses Kleidungsstück auf unseren Streifzügen und Kraxeleien im Elbsandsteingebirge ideal entgegen. So auch beim Durchzwängen des Geästs beim Pilzesuchen, beim Hinhocken am Gesträuch während des Heidelbeersammelns oder einfach nur beim Stromern und Spielen im angrenzenden Wald in meterhohem Farn, beim Besteigen von Bäumen und beim Hausen in Höhlen. Wie oft wären wir doch beim Tragen einer dünnen Stoffhose – Jeans gab es damals noch keine – mit einem Riss oder Loch darin nach Hause gekommen. Von Kratzern und Schürfwunden abgesehen. Nichts dergleichen ließ die Lederhose zu. Und noch eine vollkommen andere nicht zu unterschätzende Hilfe hielt sie parat: Ihr circa fünf Zentimeter breiter Umschlag am Oberschenkel bot die einzigartige Möglichkeit, ihn als Versteck für einen Spickzettel zu nutzen, darauf vielleicht Namen oder Jahreszahlen zu schreiben. Natürlich wussten die Lehrer von dieser Art Mogelei. Deshalb hieß es größte Vorsicht walten zu lassen, wenn man den Hosenumschlag zu gegebener Zeit möglichst unauffällig herunterklappte.
Nun also wurde zu meinem zehnten Geburtstag mein sehnlichster Wunsch erfüllt, und ich konnte nicht schnell genug in die neue Hose steigen. Voll Stolz präsentierte ich meinen Eltern dieses hellgraue Meisterstück aus Wildleder. Überglück
lich drehte ich mich hin und her, klopfte mit beiden Händen entzückt auf meinen Hintern. Wirklich, prachtvoll saß sie und passte, wie eine Lederhose eben passen musste. Die alte, zu kleine, dunkel glänzende hob meine Mutter vom Fußboden auf und brachte sie fort.
Ach, hätte ich mich einige Tage später bloß nicht an den einmal von Mutter mehr unbedacht geäußerten Satz erinnert: Eine richtige Lederhose muss dunkel und speckig sein! Dieser Satz gab mir zu denken, denn meine war noch immer hell und sauber.
Was tun? Um meiner Mutter eine Freude zu bereiten, marschierte ich geradewegs Richtung Wald, wo es einen hübschen Abhang zwischen hohen Kieferbäumen gab. Dort setzte ich mich hin und rutschte die gut zehn Meter hinab. Wieder und wieder. Um mein Resultat zu begutachten, zog ich die Hose aus, begutachtete das tiefschwarze Hinterteil und war äußerst zufrieden. Dunkel war sie nun. Der Glanz würde im Laufe der Zeit dazukommen.
Voll Freude rannte ich nachhause und traf Mutter im Garten am Schuppen an. Freudestrahlend kam ich ihr entgegen und drehte mich stolz in Erwartung ihres Lobes um. Noch ehe ich mich versah, hatte sie mich mit einem lauten Aufschrei gepackt, mich übers Knie gelegt und mir laut schimpfend mit der Hand den Hintern versohlt. Zutiefst erschrocken ließ ich mir die Schläge gefallen. Aber ich verstand Mutter nicht und überlegte. Offenbar hatte ich etwas sehr Schlimmes getan, denn noch nie hatte ich sie so wütend erlebt.
Allein, dank des Leders hatte ich die Schläge kaum gespürt und hatte größte Mühe, nicht lachen zu müssen. Als Mutter von mir abließ und davonging, tat sie mir fast ein wenig leid, denn ich sah, wie sie sich intensiv die Hände rieb, weil ihr diese wohl arg zu brennen schienen.
Kilometersteine
Nahten die Sommerferien, war ich glücklich. Durfte ich doch diese seit Jahren bei meinen Großeltern, den Eltern meines Vaters, verbringen. In Cammin. Einem mecklenburgischen Dorf, wie man es sich nur als Klischee vorzustellen vermag. Rund dreißig Kilometer südlich von Rostock gelegen. Vorwiegend reetgedeckte gelbe und rote Backsteinhäuser. Landwirtschaft ringsum, weite, leicht hügelige Wiesen und Felder, zwischen Graskoppeln kleinere und größere Seen, Moore in den angrenzenden Wäldern. Die Straße mit ihren rot, blau und grau gepflasterten Granitsteinen, deren Oberfläche durch die eisern beschlagenen Räder unzähliger Fuhrwerke in mehreren Jahrhunderten glatt gefahren war, endete hier in Cammin.
Zum vom Forstbetrieb gepachteten Haus meiner Großeltern gehörten ein Stallteil, eine eigene eiserne Wasserpumpe mit gebogenem Schwengel, ein Holzschuppen, sowie ein Gemüsegarten mit Bohnen-, Tomaten- und Gurkenanbau für den Eigenbedarf. Selbst eine Fläche für Kartoffeln besaßen meine Großeltern nebst einem kleinen Obstgarten mit Kirsch- und Apfelbäumen, mit Johannisbeer- und Stachelbeersträuchern. Vor dem Haus beherrschte ein mächtiger Pflaumenbaum den Eingangsbereich. Um ihn herum hatte Großmutter Blumen für jede Jahreszeit angepflanzt. Großvater war als Waldarbeiter angestellt, Großmutter bewerkstelligte den Haushalt, machte die Gartenarbeit und kümmerte sich um das Vieh: Um die Kuh Janka, das Schwein Vaclav, um Ziegenbock Richard, um die Hühner und um die Katze Schnurri. Letztere versorgte natürlich ich während meiner Besuchszeit. Aber das ist eine andere Geschichte...
Der Spruch meines Vaters: Wenn die Welt untergeht und du in Mecklenburg wohnst, lebst du noch einhundert Jahre. Auf Cammin bezogen, schien dies wohl zu stimmen.
Um die zwölf oder dreizehn mag ich gewesen sein, als wir uns wieder von meinem Heimatdorf Kurort Gohrisch auf die Fahrt in diese Idylle machten. Mein Vater und ich.
Nach einer knappen Stunde waren wir, vom Königsteiner Bahnhof kommend, in Dresden angekommen. Um die Zeit bis zum Einlaufen des D-Zuges nach Rostock zu überbrücken, bummelten wir durch den beeindruckend großen Hauptbahnhof.
An einem Zeitungsstand kaufte mir Vater zu meiner großen Freude die neueste Ausgabe der Kinderzeitschrift „Fröhlich sein und singen“.
Als sich der Zug in Bewegung setzte, blickte ich aus dem Fenster, sah die Häuser und Gärten vorbei fliegen, und die Erinnerung an meine am Königsteiner Bahnhof zurückgebliebene, weinende Mutter wurde allmählich blasser und blasser. Ich sah zurück und sah nach vorn. In Cammin würde ich meine beiden Freundinnen Margit, ein Jahr älter als ich und Margrit, ein Jahr jünger als ich, wieder treffen. Meine beiden Spielkameradinnen. Seit Jahren kannten wir uns schon…
Faszinierend verfolgte ich beim Schauen aus dem Zugfenster die Leitungen der dünnen, dunklen Telefonkabel, die von Mast zu Mast auseinander zu driften schienen, um sich zum nächsten Mast hin zu vereinen, als wollten sie sich nach einem kurzen Kuss wieder vereinen, um sich dann erneut zu trennen und um dann wieder Anlauf zu nehmen. Ein scheinbar schier endloses Liebesspiel.
Nach einer Weile ließ ich mich in meinen Sitz zurückfallen und widmete mich meiner Kinderzeitschrift.
Knapp eine halbe Stunde später griff mein Vater nach meinem Arm und deutete aus dem Fenster auf die vorbeihuschenden weißen Steine mit den schwarzen Zahlen: 22,4 dann 22,6 , dann 22,8, 30,0… Das sind Kilometersteine, erklärte er mir und fuhr fort: Wenn man die Zeit zwischen den Steinen von einem Kilometer bis zum nächsten stoppt, kann man ausrechnen, wie schnell der Zug fährt, also die Stundenkilometer errechnen.
Ich nickte ihn verständnisvoll an und wollte mich weiter dem interessanten Artikel über den Bau der ägyptischen Pyramiden zuwenden. Da fasste mich mein Vater erneut am Arm.
Ich wusste, dass Vater mich nach seinem hochverehrten Herrn Mathematikprofessor Robert Hanke von der Handelsschule in Trautenau benannt hatte. Leider musste ich ihn diesbezüglich schwer enttäuscht haben. Nein, ich war und wurde zeitlebens nie ein Freund der Mathematik.
Gewiss, ich war kein schlechter Schüler. Die Noten auf dem Zeugnis waren stets gut bis sehr gut, und das Lernen an sich fiel mir nicht schwer. Allein der Leistungsdruck, den mein Vater auf mich ausübte, der zudem an meiner Dorfschule unterrichtete, ließ mich nicht wirklich wissen, was ich tatsächlich ohne Druck, ohne seine Erwartungshaltung zu leisten vermochte. Er war eben ein Lehrer, der Privates und Berufliches nicht voneinander zu trennen vermochte. Gegenüber anderen, fremden Schülern war er so hilfsbereit, so sensibel, wie es wohl kaum einen zweiten gab. Einem Mädchen aus dem Kinderheim beispielsweise, das niemanden als Verwandte hatte, schenkte er zu Weihnachten ein Handtuch. Das einzige Geschenk, das dieses Mädchen erhielt, über das es sich freuen konnte.
Lächelnd entnahm mir Vater die Zeitschrift, griff in die Innentasche seines Jacketts, zog einen Druckbleistift hervor, setzte sich ganz eng neben mich, löste seine Armbanduhr mit Sekundenzeiger vom Handgelenk und drückte sie mir in in die Hand.
Zunächst auf den schmalen Rand der Zeitschrift begrenzt, schrieb Vater die von mir gestoppte Sekundenzeit auf. Proportionalrechnung: Soundsoviele Sekunden braucht der Zug für einen Kilometer. Wie viele Kilometer legt der Zug demnach in einer Stunde zurück?
Ich begriff und begriff den mathematischen Zusammenhang nicht. So wurden nach und nach immer wilder und hastiger die mit Text bedruckten Seiten mit Zahlen beschrieben. Seite um Seite folgte. Je mehr Vater schrieb, mich messen ließ, desto unklarer wurde es mir in meinem Kopf, um so feuchter und nasser wurden meine Augen.
Kurz vor Magdeburg passierte es.
Eine Frau, die uns seit dem letzten Halt gegenüber saß, sprang plötzlich auf, packte meinen Vater am Kragen, schüttelte ihn und fuhr ihn an: Wenn Sie nicht sofort aufhören, das Kind zu quälen, dann weiß ich nicht, wie ich mich vergesse. Schämen Sie sich nicht, Sie Ungeheuer?
Schwer atmend und puterrot in ihrem bebenden Gesicht ließ sie sich auf ihren Platz zurückfallen.
Nie in meinem Leben werde ich vergessen, wie mein Vater, der weder Widerspruch von meiner Mutter noch von sonst jemandem gewohnt war, wie er die Augen weit aufriss, wie erstarrt dasaß und den Mund offen hielt.
Längst waren bei mir alle Tränendämme gebrochen. Verstört rückte mein Vater zunächst ein Stück von mir ab, um im nächsten Moment wieder zu mir zu rücken. Sacht legte er seinen Arm um meine Schulter, drückte mich fest an sich und flüsterte: Entschuldige bitte, das hab ich so wirklich nicht gewollt.
Nach drei Tagen bei seinen Eltern fuhr er wieder zurück zu Mutter. Dass ihm sein Tun ehrlich leid tat, fühlte ich, und ich glaubte ihm. Wir redeten nicht mehr darüber. Doch mit meinen Augen versprach ich ihm, dass ich die Sache den Großeltern gegenüber nicht erwähnen würde.