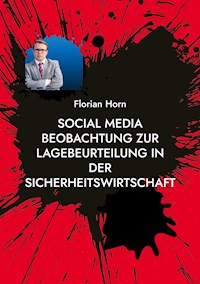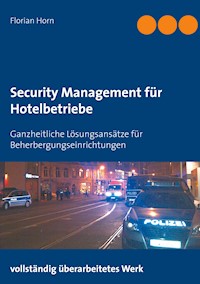Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie schafft man Sicherheit in Unterkünften, in denen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auf engem Raum zusammenleben? Dieses Buch zeigt, warum klassische Objektschutzmaßnahmen allein nicht ausreichen und wie soziale Faktoren, Prävention und klare Strukturen entscheidend zur Sicherheit beitragen. Basierend auf praktischer Erfahrung liefert es wertvolle Denkanstöße, konkrete Lösungsansätze und Argumentationshilfen für Sicherheitsverantwortliche, Kommunen und Betreiber von Flüchtlingseinrichtungen. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die nachhaltige Sicherheitskonzepte entwickeln und umsetzen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
1.0. Einleitung
2.0. Objektbeschreibung
3.0 Definition der Schutzziele
4.0 Einschätzung der Bedrohungslage
5.0 Risiko- und Schwachstellenermittlung
6.0 Maßnahmen
7.0 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
8.0 Checkliste
9.0 Stichwortverzeichnis
Literaturverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1 Aktuelle Ereignisse und Straftaten zu Flüchtlingsunterkünften (Quelle: Google)
Abbildung 2 Stimmungslage zur Flüchtlingsunterkunft (Quelle: Google)
Abbildung 3 Hinweise auf Bürgerinitiativen (Quelle: Google)
Abbildung 4 Die strukturierte Medienanalyse verlangt ein systematisches und zielgerichtetes Vorgehen
Abbildung 5 Einsatzbereiche nach Unfallaufkommen 2022
Abbildung 6 Entwicklung des Unfallgeschehens in Einrichtungen für Geflüchtete
Abbildung 7 Opfer von Gewalt in Geflüchtetenunterkünfte
Abbildung 8 Kriminalitätsatlas Berlin
Abbildung 9 Bewertungskategorien, Quelle: COSO/WBCSD in: Everling (et. al) (2020), S. 396
Abbildung 10 Faktoren der falschen Einschätzung von Risiken, Quelle: Vogt (et. al) (2022), S. 290
Abbildung 11 Vierklang der Identifikation, Quelle: eigene Darstellung
Abbildung 12 Abhängigkeit von Schwachstelle, Bedrohung und Risiko, Quelle: Königs (2017), S. 14
Abbildung 13 Triggerfaktoren in Gemeinschaftsunterkünften
Abbildung 14 Abhängigkeit von Anforderungen und preislichen Differenzen (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung 15 Qualitätsstandards und -niveau in Abhängigkeit der zu leistenden
Aufgabe (Quelle: eigene Darstellung)
VORWORT
Als ich im Jahr 2023 angefragt wurde, ein Sicherheitskonzept für eine Flüchtlingsunterkunft in Süddeutschland zu entwickeln, war ich überzeugt, dass es dazu bereits eine breite Literatur, bewährte Herleitungen und fundierte Empfehlungen geben müsste. Schließlich lag die viel beschriebene und intensiv diskutierte sogenannte „Migrationskrise“ zu diesem Zeitpunkt fast ein Jahrzehnt zurück. Ich nahm an, dass es etablierte Standards für den Schutz solcher Einrichtungen, für den Umgang mit möglichen Konflikten und für präventive Maßnahmen geben würde – doch zu meinem Erstaunen fand ich kaum verwertbare Informationen.
Es gab zwar allgemeine Leitfäden zum Thema Sicherheit, doch diese waren meist auf klassische Objektschutzmaßnahmen wie Zäune, Überwachungssysteme und Zugangskontrollen fokussiert. Die besonderen Herausforderungen einer Flüchtlingsunterkunft – in der Menschen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, Sprachen und Erfahrungen oft auf engem Raum zusammenleben – wurden darin kaum berücksichtigt. Ebenso wenig fand ich systematische Ansätze zur Frage, wie soziale Faktoren und Betreuungskonzepte in Sicherheitsüberlegungen einbezogen werden können. Also begann ich, mir die notwendigen Informationen selbst zusammenzutragen.
Ich stellte mir grundlegende Fragen: Welche Risiken entstehen, wenn viele Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen unter einem Dach leben? Welche psychologischen und sozialen Faktoren spielen dabei eine Rolle? Geht es hier wirklich in erster Linie um bauliche Sicherheit – oder sind nicht vielmehr Aspekte wie ein angemessener Betreuungsschlüssel, gezielte Integrationsmaßnahmen und ein strukturierter Alltag entscheidend? Welche Konflikte können entstehen, und vor allem: Wie lassen sie sich wirksam lösen? Welche Rolle spielt das unmittelbare Umfeld der Einrichtung – und muss nicht auch die gesellschaftliche und politische Stimmung in die Analyse einbezogen werden?
Diese Überlegungen führten schließlich zur Entwicklung eines Sicherheitskonzepts für die spezifische Unterkunft. Dabei wurde schnell klar: Ein nachhaltiges Sicherheitskonzept kann nicht nur auf Technik, bauliche Maßnahmen oder Bewachung setzen, sondern muss weit darüber hinausgehen. Die wirksamste Sicherheit entsteht dort, wo Konflikte und Eskalationen von vornherein verhindert werden. Und das bedeutet, dass soziale Strukturen, klare Kommunikationswege und frühzeitige Prävention eine mindestens ebenso große Rolle spielen wie klassische Schutzmaßnahmen.
Die Erfahrungen, die ich bei der Erstellung dieses Sicherheitskonzepts gesammelt habe, und die Antworten auf viele dieser Fragen möchte ich nun mit Ihnen teilen. Ich erhebe dabei nicht den Anspruch, eine universelle oder gar perfekte Lösung zu präsentieren. Aber ich hoffe, Ihnen wertvolle Denkanstöße zu liefern, die Ihnen bei Ihren eigenen Herausforderungen weiterhelfen.
Sie werden feststellen, dass ich in diesem Buch bewusst viele Ansätze gewählt habe, die weit über die klassischen baulich-technischen und personellen Sicherheitsmaßnahmen hinausgehen. Denn dort, wo es gelingt, Probleme präventiv zu vermeiden, sind aufwendige Sicherheitsmaßnahmen oft gar nicht erst erforderlich. Diese Perspektive stößt nicht immer auf Zustimmung – vor allem, weil Einrichtungen dieser Art meist nicht zu den Bereichen gehören, für die Kommunen oder Betreiber großzügige Budgets bereitstellen können oder wollen. Sozialarbeiter, die durch gezielte Betreuung langfristig Probleme abfedern können, sind nun einmal teurer als ein Zaun um das Gelände. Gleichzeitig zeigt sich immer wieder, dass rein technische Maßnahmen ohne ein durchdachtes Konzept zur Konfliktprävention und Integration nur begrenzten Nutzen haben. Ein Sicherheitszaun mag Einbrüche verhindern, doch er kann keine internen Spannungen lösen oder das Vertrauen zwischen Bewohnern und der Umgebung stärken.
Deshalb finden Sie in den einzelnen Kapiteln nicht nur praxisnahe Lösungen, sondern auch Argumentationshilfen und Verweise auf relevante Rechtsvorschriften. Denn wer ein nachhaltiges Sicherheitskonzept entwickeln möchte, muss nicht nur wissen, welche Maßnahmen funktionieren – sondern auch, wie er sie gegenüber Entscheidungsträgern, Vorgesetzten oder politischen Gremien begründen kann.
Vielleicht erscheint Ihnen die Struktur dieses Buches unkonventionell im Vergleich zu anderen Fachbüchern, die Sie kennen. Ich spreche Sie bewusst direkt an und schreibe aus der Perspektive eines Dienstleisters, der Sicherheitskonzepte für seine Kunden entwickelt. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Der fachliche Inhalt ist genauso relevant für Sicherheitsverantwortliche in Kommunen, Betreiber von Flüchtlingseinrichtungen oder andere Entscheidungsträger im Sicherheitsbereich. Ersetzen Sie den Begriff „Kunde“ einfach durch „Vorgesetzter“, „Auftraggeber“ oder „Stakeholder“ – je nachdem, was für Ihre Situation am besten passt. Denn die Diskussionen, die Sie in Ihrem beruflichen Umfeld führen werden, ähneln sich – ebenso wie die Argumentationsgrundlagen, die Sie dafür benötigen.
Ich hoffe, dass dieses Buch Ihnen nicht nur praktisches Wissen vermittelt, sondern auch eine neue Perspektive auf das Thema Sicherheit in Flüchtlingseinrichtungen eröffnet. Sicherheit bedeutet weit mehr als Kameras, Zäune und Wachpersonal – sie beginnt mit einem Verständnis für die Menschen, ihre Bedürfnisse und die Dynamiken, die in solchen Einrichtungen wirken. Wenn es gelingt, Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen und präventiv gegenzusteuern, können viele Probleme erst gar nicht entstehen. Das ist nicht nur kosteneffizienter, sondern schafft auch ein sichereres und humaneres Umfeld – sowohl für die Bewohner als auch für die Menschen, die dort arbeiten und für die Sicherheit verantwortlich sind.
Ihr
Florian Horn
1.0. EINLEITUNG
Als Dozent für (angehende) Sicherheitskräfte und Lehrbeauftragter für Studierende des Sicherheitsmanagements bin ich mit den unterschiedlichen Herangehensweisen an ein Sicherheitskonzept vertraut.
Wenn Sie Ihren Meister für Schutz und Sicherheit oder einen Studienabschluss im Sicherheitsmanagement haben, dann werden Sie vielleicht schon einmal an den Punkt gelangt sein, dass Sie festgestellt haben, dass die IHK andere Herangehensweisen in der Abschlussprüfung sehen will als Ihr Dozierender in der Semesterprüfung. Meiner persönlichen Meinung nach haben alle Methoden ihre Berechtigung, sodass Sie sowohl:
den Prozessablauf zur Definition von Schutzmaßnahmen nach dem VdS,
das Sektorenkonzept,
Prozessschritte des Business Continuity Managements (BCM) oder
jede andere Herangehensweise nutzen können.
Wichtig ist, dass Sie verstanden haben, dass es sich bei einem Sicherheitskonzept um eine strukturierte Problembearbeitung handelt, bei der man in der Regel mit einer Problembeschreibung beginnt und sich dann über weitere Fragen bis zur Lösung vorarbeitet.
Meine Konzepte haben in der Regel folgende Struktur:
Objektbeschreibung und Aufnahme der vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen, Vorgaben, spezifischen internen oder externen Vorschriften
Definition der Schutzziele
Einschätzung der Bedrohungslage mit einer Medienrecherche und politischer Bewertung der Standortsituation
Risiken, die in personelle, organisatorische und technische Aspekte unterteilt werden
Maßnahmen, die den identifizierten personellen, organisatorischen und technischen Aspekten zugeordnet werden
Abschließende Empfehlungen und weitere zu berücksichtigende Themen
In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Schritte anhand der hier zu betrachtenden Objekte vorgestellt und Hinweise gegeben, wie diese zu bearbeiten sind. Natürlich müssen die hier verallgemeinerten Punkte dann ganz spezifisch auf das zu betrachtende Objekt angewendet werden. Achten Sie dabei auch darauf, ob sich die Rechtslage geändert hat oder ob es spezielles Landesrecht gibt.
1.1 Was ist „Sicherheit“?
Deutschland hat ein „Sicherheitsproblem“, denn unsere Sprache kennt für alle Aspekte des Schutzes nur ein Wort: Sicherheit. Sicherheit umfasst aber alle rechtlichen und nicht rechtlichen Formen: Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit, Sicherheitsdienst, physische Sicherheit, IT-Sicherheit, Lebensmittelsicherheit etc.
Wenn in der Fachliteratur von „Sicherheit“ die Rede ist, muss dieser Begriff zunächst weiter differenziert werden. Eine eigene Begriffsdefinition für „Unternehmenssicherheit“ ist in der Wissenschaft nicht zu finden, so dass hier zunächst die beiden englischen Begriffe „Safety“ und „Security“ unabhängig von einer Branchenspezifizierung betrachtet werden müssen.
In der Corporate Security wird zwischen diesen beiden Fachbegriffen unterschieden, die jeweils auf unterschiedliche Schutzgüter abzielen. Security wird dabei als Begriff für die Abwehr von vorsätzlichen kriminellen Handlungen durch Menschen verstanden und umfasst sowohl materielle als auch immaterielle Güter.
Safety umfasst „alle Sicherheitsaufgaben, die direkt oder indirekt mit dem Betriebsprozess [...] verbunden sind1“ und schützt das Rechtsgut Individuum - durch Schutzvorschriften - vor allem im Bereich des Arbeitsschutzes vor fahrlässigem menschlichen Verhalten und/oder technischem Versagen von Maschinen im Produktionsprozess.
Man könnte also auch einfach sagen: kriminelles Verhalten versus Unfallschutz, auch wenn das nicht immer so sauber zu trennen ist und in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis steht.
Während in anderen Arten von Wirtschaftsunternehmen dem jeweiligen Mitarbeiter im Rahmen seiner Arbeitsleistung Verantwortung übertragen wird (z.B. Einhaltung von Compliance-Richtlinien, Clean-Desk-Policies etc.), sind für die aktive Abwehr von Schäden am und im Unternehmen andere Funktionen zuständig: Sicherheitsbeauftragte und Sicherheitsdienste (Werkschutz).
Insbesondere in Bereichen, in denen die Kosten eine relevante betriebswirtschaftliche Größe darstellen, kann dies auch anders erfolgen: Die Aufgaben zum Schutz der definierten Assets werden an bereits vorhandene Mitarbeiter delegiert oder es wird versucht, die Sicherheitsaufgaben in der Breite der Belegschaft zu organisieren. Häufig bzw. bei erkannten Schwerpunkten werden dann Sicherheitsdienste beauftragt, die aber nur selten Einfluss auf die internen Prozesse nehmen.
Gleichzeitig stellt sich aber grundsätzlich die Frage, wer im privatrechtlichen Bereich die Verantwortung trägt. Für den Bereich „Sicherheit“ ist dies eindeutig: Alle von der Berufsgenossenschaft geforderten und gesetzlich vorgeschriebenen Akteure, wie z.B. der Sicherheitsbeauftragte nach § 22 SGB VII, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsrat, der Betriebsarzt, der Unternehmer, die Belegschaft etc.
Problematisch wird es allerdings beim Aspekt „Security“, da es keine gesetzliche Verpflichtung des Betreibers gibt, einen Mindeststandard an „Sicherheit“ zu erfüllen. Die Pflicht zur unternehmerischen Risikovorsorge würde ich - auch wenn es Überschneidungen gibt - eher dem Bereich „Safety“ zuordnen.
Kann man sich dann ausschließlich auf die öffentliche „Sicherheit“ verlassen? Eher nicht, denn wenn die Polizei gerufen wird, ist eine Straftat bereits geschehen oder im Gange. Dann ist das Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefallen und man kann nur noch die Scherben zusammenkehren. Wenn das Ihr Verständnis von Sicherheit ist, dann können Sie das Buch an dieser Stelle schon zuschlagen. Wer aber mit präventiven Ansätzen und Konzepten Konflikte bereits im Vorfeld lösen oder deren Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren will, der sollte unbedingt weiterlesen.
Denn eine Unterkunft ist weniger ein um Hilfe rufendes Opfer, sondern ein eigenständiges soziales Konstrukt, das eine Sicherheitsstruktur für alle Nutzerinnen und Nutzer erfordert.
1.1 Nachhaltige Sicherheitskonzepte
Bevor ich aber in die Materie einsteige, möchte ich Ihnen meine Philosophie eines nachhaltigen Sicherheitskonzeptes mit auf den Weg geben. Vielleicht ist dies auch ein Ansatz für Ihre Kundengespräche und hilft bei der Argumentation, warum der Verantwortliche zunächst - aus seiner Sicht - mehr Geld ausgeben muss, als es auf den ersten Blick notwendig erscheint.
Nachhaltigkeit, ein Begriff, den wir eigentlich eher aus dem Bereich des Umweltschutzes kennen, hat sich mittlerweile auch in anderen Wirtschaftsbereichen etabliert, auch wenn wir diesen Begriff - zugegebenermaßen - im Sicherheitsmanagement eher selten finden. Hinterfragen wir aktuelle, auch politische Sicherheitsmaßnahmen, so stellen wir fest, dass diese überwiegend reaktiv betrachtet werden, sofern Sicherheitslücken oder Risiken im bestehenden Basisschutz aufgetreten sind. Anders formuliert: Wir reagieren als Sicherheitsverantwortliche in der Regel erst dann, wenn ein Problem entstanden ist.
Vielleicht haben Sie schon einmal vom Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie gehört, der bereits Ende der 90er Jahre von dem Wiener Sozialwissenschaftler Georg Franck geprägt wurde. Damals waren seine Erkenntnisse noch stark davon geprägt, dass er die Aufmerksamkeit der Konsumenten als ökonomisches und knappes Gut beschrieb, um das die Informationsanbieter konkurrieren. Heute wird der Begriff eher so verstanden, dass wir es in den Medien mit Themen zu tun haben, die plötzlich massiv im Fokus stehen und relativ schnell wieder abkühlen. Schnell werden sie gegebenenfalls nahtlos von einem anderen Thema abgelöst und führen für den Außenstehenden zu teilweise widersprüchlichen Handlungen. Ende 2024 können einige Beispiele genannt werden:
die Diskussion um Messerverbote im Sommer/Herbst,
die Diskussion um den Schutz von Weihnachtsmärkten (eigentlich jedes Jahr, aber diesmal mit entsprechender Brisanz durch den Anschlag in Magdeburg),
die Forderungen nach schnelleren Abschiebungen, wenn ein „Ausländer“ eine Straftat begangen hat
und sicher noch viele andere Beispiele, die ich hier vergessen habe. Haben wir für eines dieser Probleme eine langfristige und damit nachhaltige Lösung gefunden?
Wir können auch kleinere Beispiele nehmen, bei denen mir vor allem die Sicherheitskräfte im öffentlichen Raum zustimmen werden: Der Umgang mit Menschen in prekären Lebenssituationen („Obdachlose“, „Drogenabhängige“ oder „Bettler“). Sie werden aus Einkaufszentren, Bahnhöfen und anderen öffentlichen Räumen verwiesen, erhalten ein Hausverbot und - welch Überraschung - tauchen kurze Zeit später wieder auf. Denn die Sicherheitsmaßnahme „Durchsetzung des Hausrechts“ bekämpft nur das Symptom, nicht aber die Ursache. Die logische Konsequenz: Die Sicherheitsmaßnahmen werden erhöht, um die Sichtbarkeit der Symptome zu bekämpfen und das Problem bestenfalls auf weniger gut „geschützte“ Personen abzuwälzen.
Nach dem Anschlag in Magdeburg stand ich mit meiner Behauptung, dass bessere Schutzmaßnahmen am Weihnachtsmarkt nur den Tatort, nicht aber den Täter beeinflusst hätten, auch bei befreundeten Fachkollegen allein auf weiter Flur. Hätte eine Zugangssicherung den Anschlag verhindert? Vielleicht nur insofern, als der Täter ein Messer, eine Schusswaffe oder im schlimmsten Fall Sprengstoff eingesetzt hätte, um sein Ziel zu erreichen. Vielleicht wäre er auch, wenn er keine anderen Tatmittel zur Verfügung gehabt hätte, nicht mit dem Auto auf den Weihnachtsmarkt gefahren, sondern in das nächste Einkaufszentrum, in die Schule während der Hofpause oder durch die Fußgängerzone während der Lieferzeiten. Wäre die Situation dadurch besser geworden?
Merkmale eines nachhaltigen Sicherheitsmanagements sind daher eine grundsätzliche Resilienz der Einrichtungen, ein präventiver statt repressiver Umgang mit Störfällen und eine vom Top-Management geprägte und in der Vorbildfunktion gelebte Sicherheitskultur.
Damit soll eine nachhaltige Sicherheitskultur in Einrichtungen implementiert werden, die von einem präventiven Ansatz geprägt ist. Dabei ist zu beachten, dass Bedrohungsrisiken und Schutzziele im Unternehmenskontext zunehmend vernetzt sind. Dies liegt vor allem daran, dass Unternehmensprozesse voneinander abhängig sind. Angriffe auf einen Prozessschritt können massive Auswirkungen auf das Endprodukt haben.
1.2 Nachhaltige Sicherheitskonzepte in Flüchtlingsheimen
Wie können wir diese Aspekte nun auf Flüchtlingseinrichtungen anwenden? Ohne den folgenden Kapiteln vorgreifen zu wollen, möchte ich kurz einige Ansätze zum besseren Verständnis skizzieren:
Wir werden es in diesen Einrichtungen mit unterschiedlichen Kulturen und Wertvorstellungen zu tun haben. Nachhaltigkeit bedeutet hier, dass ich diese zunächst akzeptiere, für mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Problemverständnis schaffe und mich nicht auf den einfachen, populistischen Punkt zurückziehe: „Die sind jetzt hier in Deutschland, also müssen sie sich an unsere Kultur anpassen!“
Wir werden es in diesen Einrichtungen mit traumatisierten Menschen zu tun haben. Natürlich kann ich den Sicherheitsdienst mit entsprechenden „Hausrechten“ ausstatten, mich darauf verlassen, dass die Polizei die Person für ein paar Stunden in Gewahrsam nimmt, wenn sie auffällig ist, und eine Hausordnung erlassen. Aber dann bekämpfe ich wieder nur die Symptome. Nachhaltiger wäre es, geschulte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einzusetzen, die sowohl für die Mitarbeitenden und die Untergebrachten als auch für die Sicherheitskräfte Ansprechpartner sind, Situationen deeskalieren und langfristige Lösungen anbieten können.
Oft genug selbst erlebt, die Erwartung an die „deutsche Sprache“ - Hausordnungen, die nur auf Deutsch vorliegen und dann der Ärger und die Konsequenzen, wenn sie nicht eingehalten werden können. Warum nicht Regeln, die es geben MUSS, auch in der entsprechenden Sprache aushändigen, damit die Erwartung, dass sie verstanden werden MUSS, auch erfüllt werden kann.
Und wer sich jetzt beschwert, dass wir uns zu sehr „den Flüchtlingen anpassen“, der hat das Ziel eines nachhaltigen Sicherheitsmanagements nicht verstanden. Es geht nicht darum, sich „den Anderen“ anzupassen. Es geht darum, Konfliktpotenziale zu erkennen und präventive Maßnahmen zu etablieren, die den Beteiligten in der Umsetzung Arbeit, Stress und im schlimmsten Fall körperliche Übergriffe ersparen.