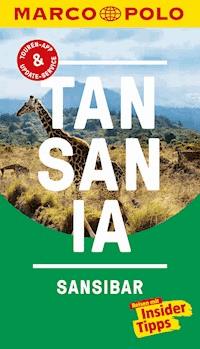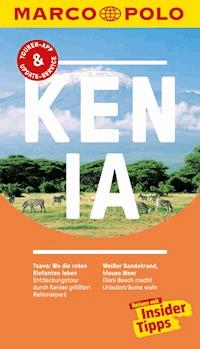Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Demokratie und dauerhaften Frieden wird es auf der Welt nur dann geben, wenn auch Frauen die Möglichkeit haben, die Entwicklungen in Politik und Gesellschaft zu beeinflussen: So hat das Nobelpreiskomitee 2011 seine bisher beispiellose Entscheidung begründet, gleich drei Frauen mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen. Doch wer sind Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee und Tawakkul Karman? Marc Engelhardt stellt die drei Preisträgerinnen vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Engelhardt
Starke Frauen für den Frieden
Die Nobelpreisträgerinnen Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee und Tawakkul Karman
Impressum
HERDER spektrum – Band6488
Originalausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption:
Agentur R•M•E Roland Eschlbeck
Umschlaggestaltung:
Verlag Herder
Umschlagmotiv: © AFP/Getty Images
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
ISBN (E-Book): 978-3-451-33912-7
ISBN (Buch): 978-3-451-06488-3
Inhaltsübersicht
1. Frauen verändern die Welt – von Westafrika bis in den Nahen Osten: Einleitung
2. »Dieses Kind wird führen«: Ellen Johnson Sirleafs Aufstieg in Liberia
3. Nichts als Gewalt und Tod: Leymah Gbowees Leben im liberianischen Bürgerkrieg
4. Kein Sex bis die Waffen ruhen: Wie Liberias Frauen den Krieg beenden
5. Endlich die Ketten abstreifen: Warum Tawakkul Karman eher zufällig zur Frauenrechtlerin wurde
6. Frau Präsidentin soll den Frieden sichern: Männer haben Liberia zerstört, Frauen bauen es wieder auf
7. »Das habe ich in meinen wildesten Träumen nicht erwartet«: Der arabische Frühling lässt die Frauen aufblühen
8. Eine, zwei, viele Heldinnen: Die Zukunft gehört – hoffentlich – den Frauen
Zeittafel
Wichtige Literatur
Für meine Mutter Ingrid
|7|1.Frauen verändern die Welt – von Westafrika bis in den Nahen Osten
Einleitung
Als die Nachricht vom Friedensnobelpreis Tawakkul Karman erreicht, ist sie dort, wo sie seit acht Monaten fast jede Minute verbracht hat: in einem kleinen Zelt aus Plastik, das vor der Universität von Jemens Hauptstadt Sanaa steht. Hier hat sie getrauert, als Scharfschützen des jemenitischen Regimes mehr als fünfzig ihrer Mitstreiter auf offener Straße erschossen haben. Hier hat sie gefeiert, als der autoritäre Präsident Ali Abdullah Saleh außer Landes geflogen wurde, wenn auch nicht für lange. Hier hat sie gehofft, gebangt, gestritten, vor allem aber ist sie standhaft geblieben. Sie will Frieden für den Jemen, Demokratie und Gleichberechtigung. Nahezu unbeachtet von der Welt, die seit Beginn der Arabischen Revolution nach Tunesien, Ägypten, Libyen schaute, haben sie und Tausende andere junge Jemenitinnen und Jemeniten hier ausgeharrt. Und jetzt werden sie belohnt. »Ich widme diesen Preis dem jemenitischen Volk und der Jugend des arabischen Frühlings«, ruft Tawakkul Karman der jubelnden Menge zu. »Und den Märtyrern, die für die Freiheit ihr Leben gegeben haben.«
Drei Frauen hat das Nobelpreiskomitee in diesem Jahr ausgezeichnet. Das gab es noch nie. Neben Tawakkul Karman werden auch Leymah Gbowee und Ellen Johnson Sirleaf geehrt, die beide für ein Ende des Bürgerkriegs in Liberia gekämpft haben – jede auf ihre Weise. Die eine, Leymah Gbowee, bewegte Frauen zu monatelangen Sitzstreiks und |8|Gebeten für den Frieden und beendete so schließlich Mord und Gewalt in dem westafrikanischen Land. Ellen Johnson Sirleaf sorgte nach dem Krieg dafür, dass der Frieden blieb. Als Afrikas erste Präsidentin setzt sie sich seitdem bewusst für Frauenrechte ein.
Die Preisträgerinnen unterscheidet vieles. So kommen sie aus unterschiedlichen Generationen: Johnson Sirleaf ist 73, Gbowee 39, Karman 32.Sie stammen aus unterschiedlichen Kulturkreisen: Johnson Sirleaf und Gbowee sind gläubige Christinnen, Karman ist bekennende Muslimin. Aber die Gemeinsamkeiten überwiegen. Alle drei stammen aus Gesellschaften, in denen Frauen wenig politischen Einfluss haben. Alle drei fanden sich auf einmal in Extremsituationen wieder, in denen sie mit überkommenen Traditionen brachen. Alle drei bewegten Frauen, es ihnen gleich zu tun, und schufen damit eine machtvolle Gegenbewegung zur patriarchalischen Elite – ohne Gewalt anzuwenden. Alle drei wurden bedroht, verhaftet, gedemütigt, aber sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie sind Heldinnen, alle drei. Und während sie für den Frieden streiten, sorgen und kümmern sie sich auch noch um ihre Familien. Alle drei, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee und Tawakkul Karman sind Mütter. In den Autobiografien, die Johnson Sirleaf und Leymah Gbowee geschrieben haben, wird immer wieder deutlich, wie sehr sie hin- und hergerissen sind zwischen dem oft gefährlichen Kampf für ihre Ideale und der Liebe für ihre Angehörigen.
In der Begründung für die Auszeichnung beruft sich das Nobelpreiskomitee auf die UN-Resolution 1325, die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat beschlossen worden ist. Erstmals werden darin Kriegsparteien dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen zu schützen und Frauen gleichberechtigt |9|in Friedensverhandlungen, Konfliktschlichtung und den Wiederaufbau nach einem Konflikt miteinzubeziehen. Die bis dahin weitgehend ignorierte Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflikten wird dadurch, etwa im Sicherheitsrat, auf einmal immer wieder zum Thema – genauso wie die Notwendigkeit, nicht nur Männerrunden über die Zukunft von Konfliktgebieten entscheiden zu lassen. »Das norwegische Nobelkomitee hofft, dass die Auszeichnung von Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee und Tawakkul Karman helfen wird, die immer noch verbreitete Unterdrückung von Frauen zu beenden«, heißt es in der Begründung weiter. Zugleich hoffe das Komitee, »das große Potenzial für Demokratie und Frieden, das Frauen darstellen, zu fördern.«
Leymah Gbowee hat es zu ihrem Beruf gemacht, die UN-Resolution 1325 mit Leben zu erfüllen. Im Frauennetzwerk für Frieden und Sicherheit in Afrika (WIPSEN), das sie 2006 mitgegründet hat, gibt sie ihre Erfahrungen weiter und trainiert Frauen für die Arbeit als Mediatorinnen und Aktivistinnen. Gbowee ist überzeugt, dass Frauen besser Frieden schaffen können als Männer. Als Direktorin von WIPSEN hat sie dafür gesorgt, dass Frauen bei der Bewältigung zahlreicher Konflikte in Westafrika Gehör gefunden haben. Und sie ist selbst aktiv, um Konflikte bereits zu lösen, bevor sie überhaupt in Bürgerkriegen münden.
Kurz nachdem sie erfahren hat, dass sie mit dem Friedensnobelpreis geehrt wird, sitzt Leymah Gbowee wie damals im Bürgerkrieg auf einem nackten, matschigen Feld in Liberias Hauptstadt Monrovia und betet. Die »weißen Ladies«, wie die von Gbowee angeführte Bewegung wegen ihrer weißen T-Shirts auch genannt wird, beten für friedliche Wahlen in ihrem Heimatland. Nicht einmal ein Jahrzehnt nach Ende des Bürgerkriegs schlagen die Wellen im Wahlkampf hoch, |10|die Töne sind aggressiv geworden. Die Stimmung ist angespannt und die mehr als 8.000UN-Soldaten im Land bereiten sich auf eine Eskalation vor. Die Frauen aber tun, womit sie berühmt geworden sind: zehn Tage lang demonstrieren sie öffentlich, bei Sonne oder Regen. Sie sind ein lebendes Mahnmal für den Frieden. »Hier sind alle Frauen so richtig aufgeregt«, gibt Leymah Gbowee in einem Interview mit der tageszeitung (taz) zu. »Es ist doch ihr Preis. Für mich gibt es also keinen besseren Platz, als bei meinen Frauen zu sein.«
Einmal in diesen Tagen treffen sich die beiden liberianischen Nobelpreisträgerinnen und nehmen sich in die Arme. Es ist ein seltener Moment der Freude über die Auszeichnung, den sich Ellen Johnson Sirleaf gönnt. Ansonsten verliert sie kein Wort über den Preis, auch – oder gerade – nicht in den vielen Reden, die sie dieser Tage hält. In wenigen Tagen wird in Liberia gewählt, und Johnson Sirleaf ist voll und ganz damit beschäftigt, die Mehrheit der liberianischen Wähler von ihren Potenzialen für Demokratie und Frieden, aber auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Linderung der immer noch großen Not im Land zu überzeugen. Was ein Komitee im fernen Norwegen entschieden hat, spielt dabei keine Rolle – im Gegenteil, schon vor der Bekanntgabe hatte der beliebteste Oppositionskandidat Johnson Sirleaf vorgeworfen, die Präsidentin nutze die internationale Anerkennung, um über ihre Misserfolge zu Hause hinwegzutäuschen. Jetzt kommt noch die Kritik dazu, das Nobelpreiskomitee versuche, das Wahlergebnis in letzter Minute zu manipulieren. Johnson Sirleaf weiß aus ihrer Erfahrung, dass sie dazu am besten schweigt. Stattdessen redet sie über den stetigen Aufschwung, neue Jobs und die Verbesserungen, die Liberia in ihrer ersten Amtszeit erlebt hat – nicht nur, aber auch für Frauen. Johnson Sirleaf hat ein Gericht ins Leben |11|gerufen, das sich speziell mit der Gewalt gegen Frauen beschäftigt. Neue Gesetze drohen Vergewaltigern zudem mit harten Strafen. In weiten Teilen Afrikas hingegen gilt Vergewaltigung bis heute als Kavaliersdelikt. Leymah Gbowee glaubt, dass sich dank solcher Maßnahmen auch das Frauenbild in Liberias traditionell patriarchalischer Gesellschaft ändert. »Besonders bei jüngeren Männern haben wir das Gefühl, dass sie Frauen nicht mehr als bloßes Anhängsel ansehen.«
Die Reaktionen zeigen, mit welch unterschiedlichen Mitteln die Nobelpreisträgerinnen für Frieden und Frauenrechte kämpfen. Doch sie alle verändern die Welt. Dabei sind Tawakkul Karman, Ellen Johnson Sirleaf und Leymah Gbowee keine Heiligen. Sie haben Ecken und Kanten, haben – auch nach eigenem Bekunden – immer wieder Fehler gemacht und nicht selten Kritiker auf den Plan gerufen. Zum Weltverändern gehört das wohl dazu. Und gerade weil das Leben der drei Frauen weder stromlinienförmig noch strikt logisch verlaufen ist, ist die Geschichte jeder einzelnen von ihnen so spannend und inspirierend zugleich.
|12|2. »Dieses Kind wird führen«
Ellen Johnson Sirleafs Aufstieg in Liberia
Wenn die Regenzeit mit ihren heftigen Niederschlägen über Liberia hereinbricht, leuchtet das Laub des Dschungels so grün, dass einem die Augen schmerzen. Liberia, die Heimat von Leymah Gbowee und Ellen Johnson Sirleaf, ist ein fruchtbares Land. Die Regenwälder, die weite Teile des Landes bedecken, gehören zu den global wichtigsten Hotspots der Artenvielfalt. Dort, wo der Regenwald abgeholzt worden ist, wuchern riesige Kautschukplantagen. Die größte von ihnen beginnt gleich hinter dem Flughafen Roberts Field außerhalb von Monrovia. Stünden die Kautschukbäume, die sich über Kilometer und Kilometer nach Westen erstrecken, nicht so ordentlich in Reih und Glied, könnte man meinen, es handle sich bei den vom US-ReifenherstellerFirestone angelegten Plantagen um einen Märchenwald. Doch der Schein trügt, wie so mancher Schein in Liberia.
Liberia, so heißt es in der Wikipedia, ist Afrikas älteste Republik, einer der ältesten unabhängigen Staaten des Kontinents – und ist, formal, nie eine Kolonie gewesen. Doch die wirkliche Geschichte sieht anders aus. Sie ist, wie in den »offiziellen« Kolonien, gezeichnet von Habgier und Gewalt. Dabei begann alles mit guten Absichten. 1816 wurde in den USA die American Colonization Society (Amerikanische Kolonisierungsgesellschaft) gegründet. Ihr Ziel: die Rückführung der seit dem kurz zuvor erlassenen Sklavereiverbot befreiten Schwarzen zu organisieren. »Nach Afrika« sollten sie zurückkehren |13|– Männer und Frauen, von denen etliche in den USA geboren worden waren und die noch nie ein anderes Land erblickt hatten. Vier Jahre später landete die erste Gruppe von Ex-Sklaven nicht weit von Liberias heutiger Hauptstadt Monrovia entfernt.
Die meisten Siedler der ersten Stunde überlebten nicht lange: Tropische Krankheiten, vor allem Malaria, rafften Tausende dahin. Außerdem stellten die »Rückkehrer« fest, dass die Küste bereits besiedelt war: Die Kru, ein Volk renommierter Schiffbauer und Fischer, hatten kein Interesse, ihr Land – wie von der Society vorgesehen – an die Neuankömmlinge zu verkaufen. So nahmen die Siedler sich das Land mit Gewalt. Mit Kanonen und Gewehren und immer neuen Schiffen voller Siedler – nach Schätzungen von Historikern trat nur ein Drittel von ihnen freiwillig die Reise an – war den Amerikoliberianern der Sieg sicher. Zu den Siedlern stießen zudem Afrikaner aus anderen Staaten, die in die Sklaverei verkauft worden waren, auf hoher See aber von britischen und amerikanischen Booten aufgebracht und nun ebenfalls an der ehemaligen »Pfefferküste« abgesetzt wurden. Gemeinsam übernahmen die Siedler die Herrschaft im von vermeintlichen »Wilden« bevölkerten Land.
Die schwarzen Amerikaner gebärden sich wie Kolonialisten, auch wenn sie auf dem Papier keine sind. Im Binnenland schließen sie Verträge mit gierigen Häuptlingen, die in Naturalien bezahlt werden. Wer keinen Frieden schließen will, wird militärisch besiegt. So baut die kleine Elite, von den Einheimischen nach dem Herkunftsland mancher Schiffe »Kongos« genannt, in Liberia an ihrem afrikanischen Glück. Ihr Land taufen sie nach ihrer neu gewonnenen Freiheit Liberia; die Hauptstadt benennen sie nach US-Präsident Monroe: Monrovia. Zunächst ist das Land noch einem US-Gouverneur|14|unterstellt, doch 1847 gründen die inzwischen gut 18.000Siedler ihre eigene Republik. Am 26.Juli 1847 wird erstmals der Lone Star gehisst, eine Abwandlung des amerikanischen Sternenbanners, den im blauen Feld nur ein einzelner Stern schmückt.
Die Verfassung, die das Land sich gibt, ist nach dem Vorbild der US-Constitution ausgerichtet – mit der entscheidenden Ausnahme, dass die Bürgerrechte nur für die Siedler gelten. Die sechzehn anderen Völker, Liberias Ureinwohner, die gut 97Prozent der Bevölkerung ausmachen, werden von Staats wegen entrechtet und faktisch zu Sklaven der Minderheit gemacht. Sie schuften auf Kaffeeplantagen, beim Abholzen des Regenwalds und später auch in den Minen im Norden Liberias und auf den Kautschukplantagen, von denen Anfang des 20.Jahrhunderts immer mehr errichtet werden. 1926 bekommt die Firestone-Company eine Konzession für den Anbau von Kautschuk und legt nicht weit von Monrovia entfernt die größte Kautschukplantage der Welt an. Sie hat mehr als 400.000Hektar Anbaufläche, die bis heute nicht komplett genutzt werden. Das westafrikanische Liberia, Afrikas älteste Republik, ist für afrikanische Verhältnisse ein kleines Land: etwa so groß wie Portugal, ein bisschen kleiner als die ehemalige DDR.Mit seinem feuchtwarmen Klima– Liberia zählt zu den immerfeuchten Tropen – ist das Land trotz seiner oft armen Böden ideal für die Plantagenwirtschaft geeignet – auch dank der billigen Arbeitskräfte.
Selbst dürfen die Indigenen kein Land besitzen, solange sie nicht etwa durch den Bau eines Hauses nachweisen können, dass sie »zivilisiert« worden sind. Erst 1951 erhalten sie das Wahlrecht. Auf dem Kapitolshügel von Monrovia, auf dem nach Washingtoner Vorbild das Repräsentantenhaus und |15|der Senat tagen, regiert die amerikoliberianische True Whig Party. Auch der Präsident, nach amerikanischem Vorbild mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet, gehört selbstverständlich der Elite an. Mehr als 130Jahre lang leben die Liberianer in einem faktischen Apartheidsstaat. Erst in den 80er-Jahren, mit der Machtergreifung des Militärherrschers Samuel Doe, endet die Vorherrschaft der Amerikoliberianer. In Does brutaler Regierungszeit und den darauf folgenden 14Jahren Bürgerkrieg wird die Herkunft jedes Liberianers instrumentalisiert. Und auch heute, acht Jahre nach Ende des Kriegs, spielt die Herkunft vor allem im politischen Leben eine große Rolle.
Als Ellen Johnson Sirleaf am 29.Oktober 1938 in Monrovia das Licht der Welt erblickt, ahnt noch niemand etwas von der blutigen Zukunft des Landes. In ihren Memoiren erinnert sich Johnson Sirleaf an die damalige Hauptstadt als »nicht wirklich eine Stadt, eher ein großes Dorf am Meer«. Es gibt keine Straßenlaternen, keine Telefone und keine öffentlichen Verkehrsmittel. Wer etwas zu besorgen hat, geht zu Fuß. Jenseits der Hauptstadt beginnt der Busch. Auch in den 30er- und 40er-Jahren reisen die, die sich überhaupt ins Landesinnere hineinwagen, auf den Flüssen in Kanus oder in Sänften, die von Einheimischen getragen werden. Der britische Autor Graham Greene, der zwei Jahre vor Johnson Sirleafs Geburt eine Reise durch Sierra Leone und Liberia unternimmt, beschreibt die Strapazen seiner Reise ausführlich in seinem Bericht Journey Without Maps. Auf der letzten Etappe, einer Seefahrt nach Monrovia, spricht ihn plötzlich ein zahnloser Mann an. »Wissen Sie«, fragt er, »dass es in Monrovia eine Karte von ganz Liberia gibt? Sie ist seit Generationen im Besitz einer einzigen Familie und ich werde sie mir ansehen gehen.« Auf den meisten Karten ist das Land nicht mehr als |16|ein weißer Fleck. »Hic sunt Leones«, hier sind Löwen, steht auf manchen geschrieben, mehr nicht.
Womöglich auch der langen Reise durch die Wildnis geschuldet, beschreibt Greene das Monrovia von Ellen Johnson Sirleafs Kindheit wohlwollend. »Monrovia ist wie ein Neuanfang; gut, ein Neuanfang, der über zwei mit Gras bedeckte Hauptstraßen und ein paar Holzhäuser nicht weit hinausgekommen ist, aber immerhin.« Greene macht nur wenige Steingebäude aus: die Kirchen, die dreistöckige präsidiale Residenz, das Finanzministerium und die Staatskanzlei. Die einzige asphaltierte Straße führt den Hafen entlang. »Sie ist nur für den motorisierten Verkehr freigegeben, aber es gibt kaum Autos, weswegen sich auch hier die Fußgänger drängen.« In den Wohnvierteln macht Greene die Rohbauten einiger Steinhäuser aus, an denen nur gebaut wird, wenn der Bauherr Geld hat. »Sie sind eine Wertanlage; wer sein Geld nicht bei der Firestone-Bankparkt, legt es in solchen Häusern an.«
Greene, der mit dem für die Imperialisten dieser Zeit typischen Rassismus nicht spart, schreibt auch, es sei nicht schwer, sich über diese schwarze Hauptstadt lustig zu machen, »in der jeder Zweite ein Rechtsanwalt und ausnahmslos jeder ein Politiker ist«. Von den Indigenen bekommt Greene mit, dass 6.000 von ihnen von den Dorfchefs zur Arbeit auf die Firestone-Plantagegeschickt worden sind. »Niemand ist in der Lage zu sagen, ob sie freiwillig dort arbeiten oder Zwangsarbeiter sind«, schreibt er. »Wobei fest steht: wenn jemals die ganze Fläche bewirtschaftet werden sollte, reichen die freiwilligen Arbeitskräfte dafür niemals aus.«
|17|Wenn Ellen Johnson Sirleaf an ihre Kindheit denkt, erinnert sie sich an Häuser aus Zink, Straßen aus Lehm, Papaya-Bäume und Cassava-Felder. Alles war einfach und freundlich, fröhlich und verbreitete ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität– Zuhause eben. Die Familie wohnt im Zentrum der Stadt in einem Haus an der Benson Street, einer der von Greene beschriebenen »grasbestandenen« Hauptstraßen. Ellen ist die Drittgeborene. Die Nachbarschaft ist gemischt, Lehrer, Kaufleute und Politiker leben hier. Vor allem aber erinnert sich Johnson Sirleaf an die zahlreichen Kinder, die ständig miteinander spielen. »Das hatte eher etwas von einem Dorf als von einem Stadtquartier.« Ihre Eltern gehören zum Mittelstand. Das zweistöckige Familienhaus aus Beton beschreibt sie als »größer als manche und bescheidener als andere«. Im Laufe ihrer Kindheit wächst der Wohlstand der Eltern weiter. Der Vater, ein Rechtsanwalt, geht in die Politik. Bald sitzt der mit Präsident William Tubman befreundete Vater im Repräsentantenhaus, »der erste Indigene, der dort saß«, schreibt Ellen Johnson Sirleaf.
Ob es sich bei ihrem Vater tatsächlich um einen indigenen Liberianer handelte, wird bis heute vor allem von Johnson Sirleafs politischen Gegnern bestritten. Viele von ihnen werfen ihr vor, amerikanische Wurzeln zu besitzen, was ihre Wahlchancen deutlich mindern würde. Johnson Sirleaf selbst nimmt sich daher gerade im Wahlkampf oft die Zeit, ihre Abstammung en détail zu erklären. Ihr Großvater, sagt sie dann, war ein ethnischer Gola und ein bedeutender Clanchef, der Jahmale der Friedensstifter genannt wurde. Mit seinen acht Frauen lebte er in einem Dorf in Bomi, einer Provinz nordwestlich von Monrovia. Sein Ruf war so bedeutend, dass sich eines Tages Liberias Präsident Hilary Johnson auf den Weg machte, um Jahmale persönlich kennenzulernen. Bei diesem Treffen, so erzählt Johnson Sirleaf, habe Johnson |18|persönlich sich dafür eingesetzt, dass ihr Vater– Jahmales Sohn Karnley – als Ziehkind zu einer Siedlerfamilie nach Monrovia gebracht werden sollte. Und so geschah es.
Ziehkinder in die Familie aufzunehmen, war unter den Siedlern zu dieser Zeit üblich. Es galt als schick und ehrbar, »Wilde« auf diese Art zu »zivilisieren«. Vor allem aber waren die Ziehkinder kostenlose Arbeitskräfte im mühsamen Haushalt oder im Nutzgarten. Viele der ersten Siedler waren zu alt, um noch genügend eigene Kinder zu erwarten. Unter den Amerikoliberianern und ihren Kindern war zudem die Sterberate immer noch hoch. Bei den indigenen Stämmen indes war es, wie in weiten Teilen Afrikas, durchaus üblich, Kinder an wohlhabendere Verwandte oder Dritte abzugeben, wenn man sich davon eine bessere Zukunft für die Kinder versprach. Und das war in den Städten der Siedler, vor allem in Monrovia, zweifellos der Fall. Johnson Sirleafs Vater genoss nicht nur eine gesicherte Ernährung und ärztliche Versorgung, sondern auch eine formale Ausbildung und den Erwerb der Bürgerrechte. Zur »Zivilisierung« gehörte auch, dass die Adoptivfamilie ihrem Ziehkind einen neuen Namen gab: aus Karnley wurde Carney, aus Jahmale Johnson. Carney Johnson musste hart arbeiten, aber er wurde gut behandelt. Misshandlungen musste er, anders als andere Ziehkinder, nach eigenen Angaben nie erdulden.
Auch die Mutter wächst als Ziehkind in Monrovia auf. Ihre Mutter, Ellen Johnson Sirleafs Großmutter, eine Marktfrau aus Greenville im Süden Liberias, verliebte sich in einen der deutschen Kaufleute, die Kaffee, Palmöl und andere Kolonialwaren in die Heimat exportierten. Gemeinsam hatten sie eine Tochter, Johnson Sirleafs Mutter. Doch im Ersten Weltkrieg wurde der Vater ausgewiesen; er kehrte nie zurück. Das hellhäutige Kind mit langen, gewellten Haaren wuchs im Haus einer prominenten liberianischen Siedlerfamilie, |19|den Dunbars, auf. Ihre Pflegemutter, die selbst keine eigenen Kinder hatte, kümmerte sich um das Ziehkind, als wäre es die eigene Tochter. Die Tochter einer Marktfrau wuchs auf wie eine Siedlerin.
Auch das Leben, das Ellen Johnson Sirleaf bei ihren Eltern in Monrovia führt, unterscheidet sich in kaum einer Hinsicht von dem der amerikoliberianischen Elite. Die Eltern sind in der Gesellschaft angekommen, gehören dazu – obwohl sie hart arbeiten müssen, um sich und ihren vier Kindern ein komfortables Leben und eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Von den Entbehrungen der Bevölkerungsmehrheit wächst die jugendliche Ellen zunächst geschützt auf.
Immer wieder erzählt die Mutter – selbst gläubige Christin – von dem Tag, als ein alter Mann kurz nach Ellens Geburt einen Blick auf die Neugeborene warf und vorhersagte: »Dieses Kind wird Großes vollbringen. Dieses Kind wird führen.« Obwohl die Geschwister sich oft über die angebliche Prophezeiung lustig machen – die junge Ellen ist ein Raubein, verbringt viel Zeit auf Bäumen und verursacht allerlei Missgeschicke–, vergisst sie niemand. Der Glauben an das Übernatürliche ist in Liberia mehr noch als in anderen westafrikanischen Gesellschaften etwas Selbstverständliches. Selbst heute sagt Ellen Johnson Sirleaf, trotz ihrer wissenschaftlichen Ausbildung frage sie selbst sich immer wieder einmal, ob es nicht doch Vorbestimmung gebe – und die Prophezeiung von einst Wirklichkeit werden musste.
Wirtschaftlich geht es in Ellens Kindheitstagen bergauf. Liberia boomt. Präsident William Tubman verkündet kurz nach seinem Amtsantritt 1944 eine »Politik der offenen Tür«, die ausländischen Direktinvestitionen Tür und Tor öffnen soll – ohne Auflagen. »Die Investitionen werden |20|unsere natürlichen Ressourcen nutzbar machen, sodass Geld in Hülle und Fülle ins Land fließen wird«, sagt er voraus. Sägewerke und Kautschukplantagen entstehen. Vor allem aber wird mit dem Abbau von Eisenerz begonnen, das erst kurz zuvor in den Nimba-Bergen im Norden Liberias und an weiteren Stellen entdeckt worden ist. Die ausländischen Firmen investieren mehr als 500Millionen US-Dollar im Land. Und die Geschäfte lohnen sich. Unter den Investoren herrscht Goldgräberstimmung.
Die Liberian Mining Company (LMC) etwa, gegründet von einem ehemaligen US-Soldat, erwirbt exklusive Schürfrechte für eins der wertvollsten Eisenerzvorkommen auf mehr als 1,21Millionen Hektar Land in den Bomi Hills, nicht weit vom Dorf von Johnson Sirleafs Vater entfernt. Dafür zahlt der Unternehmer praktisch nichts: eine Gebühr von 100, später 250US-Dollar im Monat, dazu 5US-Cents pro Tonne exportierten Eisenerzes und ein ähnlich geringer Betrag, der nach ausgebeuteter Fläche berechnet wird. Innerhalb von knapp 25Jahren exportiert LMC Eisenerz im Wert von geschätzt 540Millionen US-Dollar. Die Regierung bekommt nicht einmal ein Fünftel davon an Steuern. Kein Wunder, dass der Umsatz des Unternehmens schon 1960 die Staatseinnahmen Liberias weit übersteigt.
Ähnlich stellt sich die Lage bei den Abholzungskonzessionen oder in der Plantagenwirtschaft dar. Firestone vereinbart als Pacht für die bald größte Kautschukplantage der Welt gerade einmal 15US-Cents pro Hektar plus einem Prozent des Exportwertes – ein Traumgeschäft. Doch das Unternehmen geht noch weiter: Es macht der klammen Regierung ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Firestone gibt Liberias Regierung fünf Millionen US-Dollar Kredit und erhält im Gegenzug die Garantie über vier Prozent der Landesfläche, gut zehn Prozent des bebaubaren Landes überhaupt, |21|für einhundert Jahre. Alle Unternehmen haben gemeinsam, dass sie ausschließlich Rohstoffe exportieren. Sie bauen keine verarbeitende Industrie auf, keine Infrastruktur. Viele asphaltieren nicht einmal Straßen und bauen keine Häuser für die Arbeiter. Ihre Arbeitskräfte sind generell ungelernte, schlecht bezahlte Gelegenheitsarbeiter, die die Drecksarbeit erledigen.
Präsident Tubman feiert seine Politik dennoch als Erfolg. Die Wirtschaft wächst in den Boomjahren bis zu den 60ern jährlich um bis zu 20