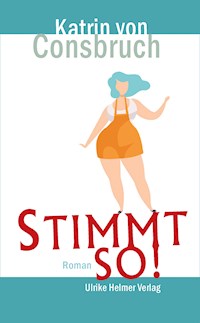
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten verschönern die Welt, findet Merle. Sie hat viel Phantasie und Schreibtalent, allerdings auch zwei Deutschlehrer als Eltern … und eine recht üppige Figur. So schwebt sie lieber in Traumwelten und jobbt im Supermarkt hinter der Kasse. Dort ist ihre Bühne, da lässt sie die Leute an sich vorüberziehen, und am laufenden Band rollen neue Inspirationen auf sie zu: Weshalb Taxifahrer Hansen regelmäßig Flachmänner kauft? Was für eine Vergangenheit die alte Frau mit dem Katzenfutter wohl hat? Und wieso die kleine Lilofee Schokoriegel klaut? Merle schreibt alles auf. Doch ihr Kassenthron wird zum Schleudersitz … Katrin von Consbruchs wunderbar skurriler, lebensfroher Roman erzählt von einer jungen Frau, die es lernt, zu sich selbst zu stehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Autorin
Katrin von Consbruch
Stimmt so!
Roman
ULRIKE HELMER
ISBN (eBook) 978-3-89741-943-8
ISBN (Print) 978-3-89741-436-5
© 2019 eBook nach der Originalausgabe
© 2019 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Roßdorf b. DarmstadtAlle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NLunter Verwendung der Fotografie »Beautiful plus size woman with blue dyed hair«, © Copyright topvectors / Adobe Stock
www.ulrike-helmer-verlag.de
Bewegungslos, die stillen Zeiger.
Selten im Einklang
kommt ihr Moment,
weil Zeit vergeht.
Verlässlich.
Vergänglich.
Bewegung im Stillstand.
Im Stillen bewegt.
1
Es ist ein wunderschönes Bild.
Nichts von dem, was man sieht, ist außergewöhnlich, aber gerade deshalb wirkt es so harmonisch und bedeutungsvoll. Genau wie die farbenkräftigen Bilder im französischen Film:
Eine Frau liegt nackt in einer Badewanne.
Um die Wanne herum Gegenstände, denen man ansieht, dass sie liebevoll zusammengestellt wurden.
Ein altmodisches Bonbonglas voller Badekugeln. Ein hölzernes Apothekerschränkchen mit kleinen Schubfächern. Eine aus winzigen Perlen gefertigte flache Schale, in der selbstgemachte Broschen und Haarspangen liegen. Birnchen, die rund um einen brüchigen Spiegel zwischen Papierblumen hervorleuchten, tauchen den Raum in ein warmes Rosa.
Die Frau in diesem atemberaubend alltäglichen Badewannenbild bin ich. Merle. Mit ungewöhnlicher Wachheit nehme ich mich selbst in diesem Bild wahr. Spüre die Konturen meines Leibes, die Enge der Wanne, den Verlauf der Grenze, die markiert, bis wohin ich reiche und wo die übrige Welt beginnt.
Ich liege da und fülle die Wanne. Fast jedenfalls. Und die Wanne liegt im Bad und füllt das rosawarme Zimmer. Und das Zimmer liegt in der Wohnung. Und die Wohnung im Haus. Das Haus in der Straße. In der Stadt, in der Gegend, im Land, Welt, Himmel – Universum! Als würde der französische Kameramann langsam aus der Szene herauszoomen, entferne ich mich immer weiter und weiter und nehme aus immer größerem Abstand wahr, wie ich in der Wanne liege. Ich spüre mich in Relation zum Zimmer, zum Haus, zur Stadt, bis hin zum Universum und wundere mich. Wie winzig ich bin! Wie begrenzt. Wie wenig zu mir gehört, gemessen an dieser Weite! Während ich mich so mit der Welt ins Verhältnis setze, staune ich darüber, dass es mich trotzdem überhaupt gibt, Tag für Tag, wo meine relative Masse doch so unglaublich gering ist.
Als ich aus dem Universum zurück ins abgestandene Nass komme und auf meine wasserschrumpeligen Fingerspitzen sehe, wundere ich mich einen Augenblick lang, dass ausgerechnet ich so empfinde. Denn in Wahrheit bin ich riesig. Meine Wanne ist randvoll, sobald ich darin Platz nehme. Die meisten Speckrollen meines Bauches und meine irrsinnig großen Brüste ragen weit aus dem Wasser. Und auch meine Arme ruhen im Trockenen, weil sie nur auf dem Wannenrand Platz finden. Ich könnte mich darüber ärgern, weil ich auf diese Weise schnell anfange zu frieren, aber ich habe aufgehört, mich wegen meiner Körperfülle zu bedauern. Immerhin spare ich dadurch Wasser. Passt ja nicht viel rein, wenn ich schon drin bin.
Das heißt, ich könnte Wasser sparen. Stattdessen ziehe ich den Stopfen nun mit dem Zeh. Das kühl gewordene Bad fließt ab, während ich mit dem Knie den Griff über dem Hahn nach oben schiebe und heißes Wasser nachlaufen lasse.
Als es die richtige Temperatur hat, lege ich das linke Bein hoch. Jetzt ist zwischen meinen Schenkeln genau so viel Platz, dass ich den festen Strahl der Dusche dorthin richten kann.
Mich hat noch nie ein Mann berührt. Aber ich stelle mir vor, dass sich eine begehrliche Zunge ebenso wundervoll anfühlt wie das drängende Wasser aus dem Duschkopf. Es dauert nicht lange, ehe ich meine Erschöpfung genießen kann.
Ich warte, bis der letzte Wassertropfen im Abfluss verschwunden ist, dann hieve ich mich aus der Wanne. An einem Haken neben der Tür hängt ein riesiges, weiches Saunatuch, in das ich mich einhülle. Ein kleineres Tuch schlinge ich über meinen Haaren zu einem Turban.
Natürlich! Natürlich könnte ich permanent unglücklich darüber sein, dass mir Badetücher im Standardformat nichts nutzen, weil sie mich nicht annähernd bedecken. Dass mich schon kleinste Bewegungen fürchterlich anstrengen. Dass ich schwitze, sobald ich ein paar Stufen hoch muss. Dass meine Oberschenkel sich selbst dann noch berühren, wenn ich im Grätschstand bin, und meine Arme schlabbern, wenn ich winke. Ich könnte gekränkt sein über die abschätzigen Blicke, die mich seit der Kindergartenzeit verfolgen, und eine ganze Buchreihe über Situationen schreiben, die zeigen, dass die Welt für meinen Körper nicht gebaut ist. Ich könnte weinen über die abwertenden Kommentare meiner Mitmenschen und verzweifeln über den fehlenden Rückhalt meiner Eltern, die sich für ihre dicke Tochter immer nur geschämt haben.
Doch ich verziehe nur kurz den Mund und vertreibe die trüben Gedanken mit einem Kopfschütteln. Denn statt mich mit meiner Vergangenheit zu quälen, verschönere ich mir lieber die Gegenwart! Stolz lasse ich meine Finger über das schmucke Waschbecken gleiten, das ich letzte Woche aus dem Keramikladen abgeholt habe.
Im französischen Film würde jetzt eine leichte Melodie eingespielt. Ein beschwingter Schifferklavierwalzer, oder ein unbekümmertes Chanson …
Ich habe das Waschbecken selbst bemalt, und nach dem Brennen sieht es noch viel hübscher aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Die meisten Menschen dekorieren ihre Badezimmer mit Strand- und Meermotiven, sodass man sich beim Klogang zwischen Fischen, Muscheln und Seepferdchen wiederfindet. Mein Waschbecken dagegen sieht aus wie die Seerosenbilder von Monet! Wenn ich mal Zeit habe, dann möchte ich auch die Kloschüssel noch passend bemalen.
Mir ist völlig klar, dass die meisten Menschen meine Wohnung überladen und geschmacklos finden würden. Aber irgendeinen Vorteil muss es ja haben, dass ich alleine lebe und so gut wie nie Besuch bekomme. Da brauche ich keine Rücksicht auf Stilfragen zu nehmen und kann meine Vorliebe für Kitsch und Selbstgebasteltes in vollen Zügen ausleben.
Überhaupt habe ich entschieden, dass mein Leben zu kurz ist, um es mit Grübeln und Trübsal zu vergeuden. Das Leben hat doch viel mehr zu bieten als die Auseinandersetzung mit Körperfett und wundgeriebenen Hautfalten, denke ich voll Überzeugung, drücke eine Bepanthen-Wurst aus der Tube und creme die schmerzenden Stellen unter der Brust und zwischen den Schenkeln großzügig ein. »Jedenfalls meins«, sage ich laut und nicke meinem Spiegelbild selbstbewusst zu.
Immerhin habe ich eine Beschäftigung gefunden, die mir wertvoll und wichtig erscheint. Das kann nicht jeder von sich behaupten.
Dabei denke ich jetzt nicht in erster Linie an meine alltäglichen Pflichten im EMMA. Obwohl ich wirklich gerne dort arbeite. Als ich vor zehn Jahren die Stellenausschreibung »EMMA sucht engagierte Mitarbeiterin« las, dachte ich unwillkürlich an einen gemütlichen, engen Laden mit einem Tresen vor dunklen Regalen, die nach einem undurchschaubaren System vollgestopft sind mit Dosensuppe, Spülmittel, Keksen und Klorollen in Plastikfolie, verwaltet von einer Frau, die mit altersfleckigen Händen die Registrierkasse bedient.
Ein Tante-Emma-Laden eben, in dem der Kunde, ein schrulliger Nachbar oder gelegentlich auch ein Unbekannter, beim Warten an der Kasse viel Zeit findet, der Schülerin, die in den Sommerferien ihr Taschengeld auf einer Leiter mit dem Beräumen aufbessert, unter den kurzen Supermarktkittel zu schauen. Ein Laden, in dem die Schülerin, verwirrt von den Blicken des Mannes, die Dose fallen lässt, die sie gerade wegstellen wollte, worauf diese an seinem Kopf für eine Platzwunde sorgt, ehe sie mit einem dumpfen Schmatzen am Boden zerplatzt. Ein Laden, in dem die grummelige Alte erst die Tomaten mit einem Lappen vom Boden aufwischt und dann die Kopfverletzung mit einem Steak kühlt, während die Schülerin verzweifelt versucht, den bewusstlosen Fremden ins Leben zurückzureden.
Ich wasche mir die Wundcreme mit selbstgeschöpfter Pfirsichseife von den Fingern und schenke meinem Spiegelbild ein spöttisches Lächeln.
Nachdem ich am Tag meines Bewerbungsgespräches das erste Mal in den Regalgängen die psychologisch erforschte Idealreihenfolge von Gütern des täglichen Bedarfs abgelaufen hatte, während Supermarkt-Pingelmusik meine Willenskraft lahmlegen sollte, war mir natürlich sofort klar, dass es sich beim EMMA nicht im Entferntesten um das von mir phantasierte Lädchen handelte. Mein Spiegelbild lächelt spöttisch zurück.
Ich nehme das Nachthemd von der Heizung und tauche zwischen die Stoffbahnen. Dabei stoße ich erst mit der Hüfte die Seifenschale von den Seerosen und dann einen wütenden Fluch aus: »Verdammt! Schon wieder!« Mein schmales Bad und mein breites Becken sind einfach nicht füreinander bestimmt. »Völlig falsch lag ich trotzdem nicht«, versichere ich mir, als ich den Kopf wieder frei habe, und strecke dem Spiegel die Zunge raus. »Immerhin ist das EMMA auch kein ganz gewöhnlicher Supermarkt!«
Das EMMA ist nämlich insofern eine Seltenheit, als es nicht einer Handelskette gehört, sondern Herrn Behnke, unserem Chef. Die Töchter von Herrn Behnke heißen Emilia und Maria, und weil ihm der Laden genauso sehr ans Herz gewachsen ist wie seine beiden Mädchen, hat er das Geschäft nach ihren Anfangsbuchstaben benannt: Em-Ma. Jedenfalls baut er diese Anekdote zu jeder Weihnachtsfeier und jedem Firmenjubiläum in die feierlichen Ansprachen an seine Mitarbeiter ein.
Ich habe seine Töchter noch nie gesehen, falls er denn überhaupt welche hat, und weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Aber ich finde die Vorstellung wunderbar, dass Herr Behnke die Namen seiner Töchter als Talisman für das Gelingen seines kaufmännischen Schicksals verwendet.
Ich stelle mir vor, wie er Emilia und Maria, die mittlerweile erwachsene Frauen sein müssen, eines Morgens kurz nach der Firmengründung mit einem Küsschen weckt. Dabei ahme ich vor dem Spiegel seinen Gesichtsausdruck nach, hebe die Augenbrauen, dehne meine Mundwinkel übertrieben und beobachte, wie sich auf meinem Gesicht ein spitzbübisches Grinsen breitmacht. Herr Behnke ist viel aufgeregter als seine Zwillinge, denn zu ihrem heutigen sechsten Geburtstag hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er hat über dem neu eröffneten Laden einen leuchtenden Schriftzug mit ihren Initialen anbringen lassen. Noch verhängt ein Bettlaken die vier Buchstaben. Aber wenn er gleich mit seinen beiden Geburtstagskindern vor der automatischen Schiebetür stehen wird, dürfen sie an einer Kordel ziehen und den Schriftzug enthüllen. Ja, dann werden die Mädchen sehen, wie viel sie ihrem Vater bedeuten! Ergriffen wird er die Kinder im Arm halten … Meinem Spiegelbild zittert die Unterlippe und mit flatternden Lidern vertreibe ich gekonnt ein paar Tränen.
Ich seufze vor Rührung.
Dann stütze ich meine Arme auf den Waschbeckenrand und nicke mir zufrieden zu. Doch. Genau so könnte es gewesen sein. Das würde zu Herrn Behnke passen. Er ist so ein stolzer Mensch. Voller Begeisterung für die Dinge, die er tut. Ich arbeite sehr gerne für ihn.
Natürlich erwartet er, dass wir unsere Arbeit erledigen. Aber er verlangt nichts Unmögliches und er hat einen guten Blick für die Stärken und Schwächen seiner Mitarbeiter. Das Einräumen der Regale während der Öffnungszeiten überlässt er möglichst nicht mir. Schließlich passt kein Kunde mehr vorbei, wenn ich im Gang stehe, um Äpfel und Bananen aufzustocken.
Dafür bin ich unschlagbar an der Kasse. Die Kunden mögen mich und ich mag die Kunden. Die Wünsche und Nöte der Stammkunden kenne ich in- und auswendig. Ich weiß, wer Hilfe beim Geldabzählen benötigt, wer unbedingt den Beleg mitnehmen möchte, wer schnell fertig werden will und für wen das kurze Gespräch beim Bezahlen der einzige Sozialkontakt und Höhepunkt des Tages ist. Ich weiß, wer seinen Autoschlüssel liegen gelassen hat und wer immer vergisst, Obst und Gemüse zu wiegen. Wer eine Tüte braucht und für wen ich die Zigaretten freischalten muss. Eine Kundin, die regelmäßig in der Mittagspause vorbeigeeilt kommt, um eine Salatbox und einen Joghurt zu kaufen, hat mir trotz ihrer knapp bemessenen Zeit mal zugerufen: »Ich freue mich immer, wenn Sie an der Kasse sitzen! Sie strahlen so gute Laune aus, das färbt richtig ab.« Seitdem finde ich meine Arbeit im Supermarkt wichtig und wertvoll.
Dass ich stundenlang an der Kasse sitzen kann, ohne mich zu langweilen, hat aber auch noch einen anderen Grund: Während ich die Waren über den Scanner ziehe, erfinde ich Geschichten. Die Kunden liefern mir von früh bis spät die Ideen dazu. Ich sehe die Ware, die sie auf das Einkaufsband legen, sehe den Menschen, der den Einkauf tätigt, und sofort stelle ich die Verbindung her. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Und sie ist deshalb so wichtig und wertvoll, weil meine Geschichten die Welt verschönern. Einfach, weil ich die Geschichten so erzähle, dass sie mir guttun.
»Geschichten verschönern die Welt!«, rufe ich ins Bad hinein, während ich den Bademantel überziehe und eine grünlich schimmernde Gesichtsmaske auftrage.
Jeden Tag denke ich mir Hunderte von Geschichten aus. Unter der Kasse habe ich neben dem Stapel mit den Papiertüten ein Büchlein versteckt. Dort trage ich zwischendurch Stichworte ein. Meistens reicht es schon, die Ware zu notieren, damit mir die Idee später wieder einfällt. Abends schaue ich dann in mein Büchlein und halte die besten Storys auf meinem Laptop fest.
Der Gedanke an mein Geschichtenbüchlein bringt mich in Schwung. Ich schlüpfe in Hauspantoffeln, die ich vor zwei Jahren mit Pailletten bestickt habe, ziehe den Gürtel meines Bademantels enger und schlittere hinüber ins Wohnzimmer. Die Kombination aus den Dielen meiner Altbauwohnung und dem Filz an meinen Sohlen verpflichtet mich jeden Abend zu dieser albernen Sporteinheit. Mittlerweile habe ich ein gewisses Schlittergeschick entwickelt. An guten Tagen gelingt es mir, mit dem richtigen Schwung aus dem Badezimmer durch den Flur bis direkt vor die Wohnzimmercouch zu rutschen. Heute schaffe ich nicht mal den halben Weg, was vorherzusehen war, weil die Hausschuhe feucht geworden sind und nicht gut gleiten. Ich nutze die ungewollte Bremsung für einen Umweg in die Küche, wo ich ein Gläschen Aperol mit Sekt aufgieße, ehe ich mich ächzend auf dem Sofa niederlasse und den Laptop hochfahre.
Von dem Büchlein und meinen Geschichten habe ich noch nie jemandem erzählt. Wem auch? Meinen Kollegen? Die würden eh nicht verstehen, weshalb ich mich in meiner Freizeit freiwillig mit Kundschaft beschäftige. Meinen Eltern? Immerhin sind sie beide Deutschlehrer. Aber ich fürchte den vorwurfsvollen Blick meiner Mutter, wenn sie zum Angriff übergeht und mir einen Vortrag darüber hält, dass ich nichts Ordentliches aus meinem Leben mache. Dass sie es mir schon immer gesagt hat und dass ich mit ein bisschen Mühe viel mehr erreichen könnte als einen Sitzplatz im Supermarkt.
Mein Vater würde mich behandeln wie damals, als ich das erste Mal mit Wasserfarben gemalt habe. Er würde »Merle, meine Perle« murmeln, beiläufig nicken und sich wichtigeren Dingen zuwenden.
Meiner Schwester mag ich auch nichts erzählen. Wir haben ohnehin seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr. Sie würde wahrscheinlich denken, dass ich die Geschichten irgendwo abgeschrieben habe, um mich wichtigzumachen. Und das bloß, weil ich in der achten Klasse mal einen Sommer lang vorgegeben habe, an einer Kreativwerkstatt teilzunehmen, wo angeblich selbstgeschriebene Texte für einen landesweiten Literaturwettbewerb ausgewählt würden. In Wirklichkeit hatte ich mich jeden Mittwochnachmittag unter einer Autobahnbrücke verkrochen, in der Hoffnung, dort von niemandem entdeckt zu werden. Das Ganze flog auf, als es kühler wurde. Ich hatte mich eine gefühlte Ewigkeit draußen herumgedrückt und war, als ich schließlich klitschnass zu Hause ankam, nur noch ein Häufchen Elend. Zitternd, frierend, heulend und mit einer heftigen Erkältung gestand ich meiner Mutter, dass es gar keine Kreativwerkstatt gegeben hatte. Sie hat mich damals ins Bett geschickt und nie wieder ein Wort darüber verloren. Aber die mütterliche Enttäuschung stand ihr tagelang dermaßen ins Gesicht geschrieben, dass mich auch der letzte Funken Selbstwertgefühl für lange Zeit verließ.
Wie um eine neuerliche Erkältung abzuwenden, ziehe ich den Kragen meines Bademantels enger. Ich gönne mir einen Schluck vom gespritzten Aperol und schlage in meinem Büchlein die Stichwörter des Tages auf. Einwegrasierer steht ganz oben auf der Liste, und ich erinnere mich sofort an den nervösen Geschäftsmann, der außer den Rasierern nichts weiter aufs Band gelegt hat. Dabei hat er sich so sehr bemüht, nicht aufzufallen, wie sonst nur die Kunden, die ihre Kondome unter einer Schachtel Schoko-Herzen verstecken. Ich öffne den Ordner Eintagsfliegen, in dem ich meine Kurzgeschichten ablege, und versuche mich an Marc Seltner, den verschämten Rasur-Einkäufer, zu erinnern. Herr Seltner und seine Rasierer kommen mir gerade recht. Sie sind prädestiniert für eine Hannah-Geschichte!
Hannah ist eine von meinen Strickfrauen. Streng genommen müssten die Strickfrauen Kochfrauen heißen, denn ich habe sie vor acht Jahren bei Mittag machen mit Molligen kennengelernt. Hinter diesem verboten blöden Titel verbirgt sich ein von den Krankenkassen finanzierter Präventionskochkurs, der dazu anregen sollte, dysfunktionale Essgewohnheiten zu identifizieren, um gesunde Mahlzeiten gemeinsam mit anderen Betroffenen zuzubereiten und bewusst zu genießen. Zwar hat der Kurs bei keiner von uns dazu geführt, den BMI nennenswert in gesellschaftlich akzeptierte Bereiche zu senken, trotzdem würde ich sagen, dass es die erste und einzige meiner zahlreichen Kampfansagen ans Übergewicht war, die für irgendetwas taugte. Immerhin habe ich dabei Hannah, Jasemin und Carola kennengelernt. Blitzschnell haben wir uns wortlos und vermutlich dysfunktional darauf geeinigt, die gesundheitsbewussten Vorsätze rund ums gemeinschaftliche Kochen den angeregter Betroffenen zu überlassen und uns stattdessen auf das Genießen zu konzentrieren.
Bei einer dieser Gelegenheiten identifizierten wir das Stricken als ein von uns allen geteiltes Hobby und funktionalisierten es zu einem wöchentlichen Treff. Jeden Mittwoch. Wirklich. Richtig schön und ganz ohne Autobahnbrücke! Und als uns nach ein paar Jahren beim besten Willen nichts mehr einfiel, was sich noch stricken ließe, haben wir das anfängliche Strick- in ein allgemeines Bastelkonzept umgewandelt.
Nur schade, dass die Finanzierung unserer Gruppe nicht über den Präventionsetat der Krankenkassen läuft! Wolle ist teuer. Genau wie selbsthärtende Knetmasse. Oder Schmelzgranulat. Auch Kleber gibt es nicht umsonst und winzige Glasperlen, ja, sogar alte Papierreste kosten einen Haufen Geld. Wenn ich ein Bastelgeschäft betrete, verabschiede ich mich innerlich gleich von der Hälfte meines Monatsgehalts, obwohl das Material, das ich dafür aus dem Laden tragen darf, nur die Hälfte meines Einkaufkörbchens füllt. Wenn’s hochkommt.
Zur Wertschätzung der in Knete & Co. investierten Geldsummen habe ich irgendwann angefangen, meine Bastelgeschäft-Kassenbelege aufzubewahren. Etwas später habe ich sogar die Belege selbst verbastelt. Sozusagen als stille Rebellion gegen überteuerte Bastelpreise. Getreu dem Motto Lieber die Wohnung verschandelt, als schlecht gehandelt! habe ich damals die Wand hinter meinem Bett weinrot angestrichen, zwei pummelige Putten darauf projiziert und ihre Umrisse mit Bleistift nachgezogen. Das Malen der Engel ist mir recht gut gelungen, aber um alles schön plastisch wirken zu lassen, mache ich seither das, was früher wohl vor allem gelangweilte englische Damen der gehobenen Gesellschaft getan haben: Ich quille. Erst schneide ich alle Bastelbelege in schmale Streifen, dann wickele ich sie auf einen Zahnstocher und klebe die so entstandenen Kassenbelegkringel (natürlich ohne den Zahnstocher) auf. Der rechte Engel ist schon fertig und sieht richtig kunstvoll aus mit seinen vielen geschwungenen Streifchen. Ich nenne ihn KaBeQue. Kassenbeleg-Quillengel. Wie ich den linken nennen werde, wenn er einmal fertig ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht KaBeQue junior.
Die phantasielose Psychoanalytikerin, die ich vor vielen Jahren auf Wunsch meiner Mutter aufsuchen musste, hätte das Engelsmotiv vermutlich so gedeutelt, dass ich damit mein schlechtes Gewissen beruhigen will. Es ist nämlich so, dass ich beim Verlassen des Bastelgeschäftes meist nicht nur die Sachen bei mir trage, die das Körbchen bis zur Hälfte füllen, sondern auch noch dringend benötigte Dinge, die unauffällig in meine Jackentasche passen. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Strickfrauen ihr Hobby finanzieren. Bei meinem Gehalt ist es mir jedenfalls nie gelungen, jeden neuen Basteltrend mitzumachen und gleichzeitig sämtliche Zivilgesetze einzuhalten. Vermutlich ein nicht ganz unbedeutender Nachteil meiner geruhsamen Kassenfrau-Karriere …
Leider würde ich mich nie trauen, den Strickfrauen von meinem Geschichtenbüchlein oder dem unrechtmäßigen Erwerb meines Bastelzubehörs zu erzählen; trotzdem sind sie mit Abstand die Menschen auf diesem Planeten, bei denen ich mich am wohlsten fühle. Irgendwie sitzen wir halt alle in einem Boot. In einem Boot, das wir niemals ›Molly‹ nennen würden!
Wir sind eine seit Jahren aufeinander eingespielte Crew. Hannah, die uns ihre Wohnung zur Verfügung stellt, ist die Kapitänin. Sie plant und organisiert unsere Treffen. Sie ist auch diejenige gewesen, die unsere Gruppe ins Leben gerufen hat. In der Kombüse sorgt Jasemin für eine gelungene Abwechslung aus fettig-süßer und salzig-fettiger Verpflegung. Carola gibt mit ständig neuen Ideen den kreativen Kurs vor. Ich glaube wirklich, dass es auf dieser Welt keine Basteltechnik gibt, von der sie noch nicht gehört hat.
Und ich bin zuständig fürs Seemannsgarn. Das heißt, ich sorge für Stoff, wenn die Unterhaltung mal ins Stocken gerät. Anfangs hat sich das wohl so ergeben, weil ich Gesprächspausen nicht gut aushalte. Sobald es ruhig wird, gebe ich einfach schnell irgendeinen Blödsinn von mir, damit sich keine beklemmende Stille ausbreiten kann. Aber mittlerweile sind meine Strickfrauengeschichten zu einem festen Bestandteil unserer gemeinsamen Abende geworden. Offiziell erzähle ich einfach drauflos, aber insgeheim habe ich immer ein klares Konzept und weiß genau, welche Strickfrau welche Art von Geschichte braucht. Na ja, und was Herrn Seltner angeht, kann es gar nicht anders sein, als dass er in einer Hannah-Geschichte landet!
Hannah ist die einzige von uns, die schon mal in einer festen Partnerschaft gelebt hat. Wir haben alles im wöchentlichen Stricktreffen-Rhythmus begleitet: Ralph, den Physiotherapeuten, der ihr während der Behandlungen schöne Augen gemacht hat. Die von wundersamer Gewichtsabnahme begleitete Verliebtheit, die Aufregung rund um das Hochzeitsfest inklusive gemeinschaftlich genähtem Hochzeitskleid, die Sorgen während der Risiko-Schwangerschaft, die Anstrengungen der Geburt, die Enttäuschung über die Kilos, die sich trotz schweißtreibender Rückbildung nicht rückbilden wollten, und die Verzweiflung über die Kilos, die Hannah zugelegt hat, als Ralph seine schönen Augen einer anderen Patientin zuwandte. Seitdem teilen wir Hannahs Mehrfachbelastungen als alleinerziehende Mutter und ihre Rachsucht gegenüber Ralph. Und hier, beim Stichwort Rachsucht, kommt Herr Seltner mit seinen Rasierern ins Spiel.
Die Haut unter meiner Gesichtsmaske fängt langsam an zu spannen. Ich müsste die Maske abnehmen, bin aber zu faul, aufzustehen. Stattdessen lege ich ein Dokument an mit dem einfallsreichen Titel Herr Seltner kauft Rasierer und beginne zu schreiben.
Wenn ich meine Ideen in den Computer hämmere, vergesse ich die Welt um mich herum. Beim Tippen der letzten Wörter merke ich, dass mir diesmal dabei sogar die Füße eingeschlafen sind. Aber das schmerzhafte Kribbeln hat sich gelohnt. Herr Seltner hat ungefragt dazu beigetragen, dass Hannah als Fleisch gewordene Weiblichkeit unter frenetischem Jubel der Massen Ralph der Lächerlichkeit preisgeben konnte. Ich freue mich schon sehr darauf, den Mädels am Mittwoch die Geschichte zu erzählen!
Während ich mit der einen Hand meine Füße wiederbelebe, öffne ich mit der anderen noch schnell den EMMA-Blog.
Das ist auch etwas, was ich an Herrn Behnke mag: Als ich ihm vor ein paar Jahren vorgeschlagen habe, einen Supermarkt-Blog zu starten, war er sofort begeistert. Seitdem beende ich den Tag, indem ich die Kundschaft über interessante Neuigkeiten rund um unsere Produkte informiere und mit Anekdoten über Ereignisse des Stadtviertels versorge.
Seit Neuestem habe ich eine Rubrik für Kleinanzeigen eingerichtet, wo Gegenstände oder Dienstleistungen gesucht und angeboten werden können. Außerdem gibt es einen Kummerkasten, in dem Beschwerden und Wünsche hinterlassen werden können. Natürlich sind diese Beiträge nicht öffentlich einsehbar, und ich musste mich verpflichten, den Chef über jedes negative Feedback zu informieren. Herrn Behnkes Befürchtungen haben sich bislang als unbegründet erwiesen. Wenn hier mal jemand etwas einträgt, dann eigentlich nur, um sich zu erkundigen, wann sein Lieblingsprodukt wieder im Angebot ist. Gelegentlich beschwert sich auch mal ein Anwohner über frühmorgendlichen Lärm bei der Anlieferung.
Unter meiner Gesichtsmaske juckt es mittlerweile ziemlich unangenehm. Ich tippe schnell noch zu den Suchanfragen, dass Frau Ringer für regelmäßige abendliche Termine (Wochentag flexibel auszuhandeln) eine Babysitterin braucht, und gebe unter EMMA-Infos bekannt, dass ab kommender Woche aufgrund von Bauarbeiten die Parkmöglichkeiten vorübergehend eingeschränkt sein werden, alternative Stellplätze ums Eck, da taucht im Kummerkasten eine neue Nachricht auf. Ich will die Maske loswerden, gleichzeitig fühle ich mich aber dem Kunden verpflichtet, der sich so spät am Abend noch meldet. Also öffne ich pflichtbewusst das Postfach und werde einigermaßen überrascht, denn jemand hat geschrieben:
Ich möchte mich darüber beschweren, dass die Angestellten im EMMA keine Namensschilder tragen. Auf diese Weise muss ich nämlich dauernd rätseln, wie die schöne Frau an der Kasse wohl heißt …
Ich lese die Nachricht gleich mehrere Male hintereinander. Als sich am Inhalt auch beim dritten Durchlesen nichts ändert, gehe ich erst die Maske entfernen. So eine Mail kann man nicht beantworten, wenn das Gesicht von einer bröckelnden Schicht überfälliger Chemie bedeckt ist. Beim Aufstehen stolpere ich. Die sonderbare Nachricht hat meine Füße offenbar nicht halb so wach gemacht wie meinen Kopf. Ich verlangsame meinen Schritt, um den tausend Nadeln Zeit zu geben, zu verschwinden, und bleibe einen Moment stehen.
Was am unteren Ende meines Körpers funktioniert, lässt das obere Ende allerdings unberührt. Meine Gedanken überschlagen sich. Innerhalb eines Sekundenbruchteils prüfe ich die Liste der infrage kommenden Frauen an der Kasse, berechne Wahrscheinlichkeiten, indem ich Schönheitsmerkmale und körperliche Defizite in imaginierte Waagschalen werfe, checke die Dienstpläne der letzten Wochen (Bingo! Ich saß am häufigsten an der Kasse!), spiele alle Varianten denkbarer Motive des Nachrichtenverfassers durch, von Liebe-auf-den-ersten-Blick bis Einsatz-für-eine-verlorene-Wette, und formuliere sachliche, entrüstete, flirtende, drohende und kokette Antwortschreiben, ehe ich etwa in der Mitte des Sekundenbruchteils auf die Frage stoße, wer wohl hinter der Nachricht steckt. Hier stockt mein Gehirn für einen winzigen Moment. Vielleicht vor Schreck, weil es realisiert hat, dass da draußen – so oder so – wirklich echt und ehrlich jemand existiert, der diese Nachricht verschickt hat. Die Denkpause gibt mir die Möglichkeit, das Stück Körper zwischen lahmen Beinen und rotierendem Kopf wahrzunehmen, das in den letzten Millisekunden zahlreiche Veränderungen durchlaufen hat. Mein Herz pumpt auf Hochtouren, meinen Magen lässt der Aperol prickelnde Loopings drehen und beim Gedanken an den unbekannten Verfasser schießt mir überraschenderweise auch noch eine Hitze in den Unterleib, wie sie sonst nicht einmal der heißeste Duschstrahl hinbekommt.
Die Scham darüber, dass eine dreißig Wörter umfassende Beschwerde-Mail mich derart in Aufruhr versetzen kann, führt am Ende des Sekundenbruchteils zur Wiederaufnahme der Denkvorgänge im Frontalhirn. Noch bevor ich im Badezimmer angekommen bin, habe ich alle männlichen Kunden der letzten Wochen vor meinem geistigen Auge antreten lassen und in Dreierreihen sortiert:
Links, in der ersten, langen Reihe stehen diejenigen, denen ich auch unter Einsatz meiner gesamten blühenden Phantasie einen Anmachversuch mittels digitalem Kummerkasten nicht zutraue.
In der zweiten, ebenfalls recht stattlichen Reihe sind diejenigen Männer gelandet, bei denen ich ein internetbasiertes Flirtvorgehen nicht völlig ausschließe.
Eine Handvoll Kandidaten der zweiten Kategorie lasse ich noch einen Schritt nach rechts hinaustreten, wodurch sich eine kleine, aber feine Reihe von Männern ergibt, bei denen es mich ausdrücklich freuen würde, wenn sie die Urheber der Mail wären. Ein Gedanke, der meine Unterleibstemperatur unwillkürlich noch ein paar Grad in die Höhe schnellen lässt.
Am Waschbecken löst sich die Hitze in laue Lüftchen auf, als mich aus dem Spiegel unter einem zerzausten Turban ein rissiges, grünes Monster mit weit aufgesperrten Augen anstiert. Aber noch bevor ich den Satz Mich hat er eh nicht gemeint zu Ende gedacht habe, unterzieht mein Gehirn schon wieder sämtliche Kolleginnen einem Vergleich, bei dem ich gar nicht so schlecht abschneide, und alles beginnt von vorne. Mir wird schwindelig, schnell tunke ich den Gruselkopf ins Waschbecken. Das kalte Wasser sprengt nicht nur die Paste von meiner Haut, sondern lenkt auch die wilden Gedankenflüsse in ruhigere Bahnen. Ich beschließe, unverkrampft großartig zu sein und eine Antwort zu verfassen, die gleichzeitig unverfänglich und verführerisch klingt.
Guter Plan! Der mir jetzt, wo ich meine normale Gesichtsfarbe wiederhabe und die Haare aus dem Handtuch befreit sind, sogar realisierbar vorkommt. Ich zwinkere beim Aufrichten meinem Spiegelbild zu und setze mich mit Laptop und Aperol II ins Bett unter den Quillengel. Das scheint mir der richtige Ort für das Verfassen meiner allerersten (und großartigen) Blind-Date-Mail.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich mich beeilen muss, wenn ich dem unbekannten Schreiber nicht das Gefühl vermitteln möchte, er wäre mir wichtig und ich würde seinetwegen stundenlang Zeit in eine Antwort investieren. Dieser Gedanke setzt mich einigermaßen unter Druck, weshalb ich mich von meinem ursprünglichen Plan verabschiede und mir vornehme, irgendwas zu schreiben, Hauptsache schnell.
Zum Glück habe ich in der letzten Sekunde schon einmal alle möglichen Antwortalternativen durchgespielt. Die lasse ich jetzt durch meinen Kopf kullern wie die Zahlen bei der Lottoziehung und würfle sie zusammen, bis mir die Kombination gefällt. Dann versuche ich, nicht weiter darüber nachzudenken und versende meine Antwort:
Haben Sie vielen Dank für Ihren anregenden Vorschlag. Schade, dass Sie Ihre Beschwerde nicht unterzeichnet haben, weil ich auf diese Weise nämlich dauernd rätseln muss, wie wohl der Mensch heißt, der die schöne Mail geschrieben hat.
Kurz bin ich versucht, ein paar unnötige Änderungen im EMMA-Blog vorzunehmen, um den Posteingang noch eine Weile im Blick zu behalten und eine Antwort auf meine Nachricht herbeizustarren, aber ich zwinge mich, den Rechner auszuschalten.
Wenn der französische Film noch immer liefe, würde die Kamera jetzt langsam über meine Patchwork-Decke gleiten und dann mein erhitztes, glückliches Gesicht in einer wunderschönen Nahaufnahme zeigen. Zum Ende der Szene sähe man vielleicht noch den KaBeQue, wie er an der Wand über mir seufzt und belustigt die Papierschnipselaugen verdreht, als habe er von seiner Wand aus ähnliche Szenen schon viele tausend Male beobachtet.
2
Mit routiniertem Schwung drehe ich den Stuhl so, dass meine Beine genau unter der Kasse zum Stehen kommen. Ich atme tief durch. Dieser Morgen mag nach außen einen alltäglichen, meinetwegen auch langweiligen Eindruck machen. Aber mein Inneres fühlt sich an, als wäre ich an Starkstrom angeschlossen und jemand hätte den Voltregler bis zum Anschlag aufgedreht.
Als ich heute Morgen wach wurde, hielt ich meine Augen noch eine Weile geschlossen, um die verrückte Geschichte zu rekonstruieren, die ich in der Nacht geträumt hatte. In meinem Traum saß ich an einer Kasse, die in einer riesigen, schillernden Seifenblase über einen Seerosenteich schwebte. Aus der Kasse quoll eine immer länger werdende Liste mit Männernamen. Um meine Seifenblase herum flog der Quillengel und rief mit schriller Stimme: »Heute back ich, morgen brau ich!« Ich begriff, dass ich ihm den Namen des E-Mailschreibers sagen musste, um nicht für immer davonzufliegen, und versuchte verzweifelt, die Buchstaben zu entziffern, aber sie verschwammen mir vor den Augen. Der Papierhaufen wuchs und wuchs, bis er meine Nase erreichte. Da musste ich niesen, die Seifenblase platzte und der KaBeQue löste sich in unzählige Papierschnipsel auf, die wild tanzend auseinanderwirbelten, während ich unsanft am Boden aufschlug.
Natürlich war mir beim Aufwachen sofort klar, dass dies nur ein Traum gewesen sein konnte. Noch dazu einer, der so peinlich mit meinen Wünschen und Ängsten durchsetzt war, dass die Analytikerin ihre wahre Freude daran gehabt hätte. Trotzdem öffnete ich abergläubisch erstmal nur ein Auge und prüfte, ob der Papierengel noch genau dort hing, wo er hängen sollte. Erst dann erlaubte ich auch dem zweiten Auge, das Licht meiner frühmorgendlichen Welt zu erblicken.
Sofort stahl sich mein Blick zum Laptop. Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, so zu tun, als würde mich das Geheimnis um den Verfasser der nächtlichen E-Mail kaltlassen. Noch im Bett fuhr ich den Rechner hoch und hielt den Atem an, weil tatsächlich eine Nachricht im Kummerkasten auf mich wartete. Die Aufregung hätte ich mir allerdings sparen können. Sie enthielt bloß die Nachfrage, ob die Salami – Sie wissen schon, die mit dem Pfefferrand und diesem grünen Aufdruck an den Zipfeln – bald wieder ins Sortiment käme.
Nichts war mir gerade mehr Wurst als diese grünen Zipfel!
Was aber die Tatsache unberührt ließ, dass mein Körper nun trotz der frühen Stunde bereits von Adrenalin überflutet wurde und an ein erneutes Einschlafen nicht mehr zu denken war. Den ganzen Morgen tigerte ich zwischen Küche, Bad und Kleiderschrank hin und her, stieß noch öfter als sonst Gegenstände um und musste nach dem Verlassen der Wohnung zweimal umkehren, weil ich erst meinen Helm, dann den Zündschlüssel vergessen hatte. Die Nervosität legte sich erst, als ich mich im EMMA auf meinen Platz an der Kasse schwang.
Hier sitze ich jetzt und komme langsam wieder zu mir. Wie eine Schauspielerin, die auf der Bühne das Lampenfieber nicht mehr spürt, werde ich mit dem Betreten des Verkaufsraumes zur gelassenen, allzeit fröhlichen Kassiererin. Das EMMA hat schon immer diesen beruhigenden Effekt auf mich.
Tatsächlich fühle ich mich an meinem Arbeitsplatz wie in einem Theater. Wenn sich die draußen vorbeieilenden Passanten Zeit nehmen würden, könnten sie als Zuschauer durch die großen Schaufenster meine Bühne sehen. Im Vordergrund würden sie zwei Kassen erblicken und dahinter, wie geschickt gestellte Kulissen, links die Regale mit den alkoholischen Getränken und dem Knabberkram, rechts die Zeitschriften und Haushaltswaren. Dazwischen haben meine zahlreichen Mitspieler ihren kurzen Auftritt an der Kasse.
Sobald der Vorhang sich hebt, die Rollgitter morgens hochgehen und den Blick auf die beiden Kassen freigeben, könnte das Publikum mich sehen, wie ich hinter einer dieser Kassen sitze. Mein Kostüm, das immer gleiche weinrote Supermarkthemd, peppe ich mit selbst entworfenem Schmuck auf und bin damit unverwechselbar: Eine gefilzte Blume im Haar, große Perlen um den Hals oder lange, bunte Ohrringe. Nicht zu viel, damit die Accessoires nicht mit dem farbenfrohen Make-up konkurrieren, für das ich jeden Morgen ausreichend Zeit in der Maske einplane. Unser Lichttechniker hat seit Jahren keinen Auftrag mehr bekommen, weshalb ich bei Neonlicht auftreten muss. Da ist ein beherztes Make-up unerlässlich.
Ich spiele täglich die Hauptrolle, egal welches Stück gerade gegeben wird. Meine Textpassagen sind kurz: »Guten Tag. Haben Sie alles gefunden? – Das macht dann zweiunddreißig achtzig. – Einmal hier unterschreiben, bitte. – Danke. – Plastik oder Papier? – Für die Tüte bekomme ich zehn Cent. – Beleg? – Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. – Danke.« Aber ich halte mich ohnehin nicht ans Drehbuch und improvisiere.
Als ich gerade mein Geschichtenbüchlein an seinem Geheimplatz verstaue, hat der erste Kunde seinen Auftritt: Ob er derjenige ist, der die Mail geschrieben hat?! Ich könnte behaupten, dass mir die Frage in den Sinn gekommen wäre, kaum dass ich den dunkelhaarigen Mann sehe, der breitbeinig am Zeitungsregal steht und die Fernsehzeitschriften durchblättert, mit bemühter Coolness – irgendwie trotzdem nicht unsympathisch. Aber das wäre nicht ganz richtig. Die Frage kommt mir nicht. Sie lauert schon in mir, hockt auf ihrem Spähposten, seit ich aus dem Haus gegangen bin, und wird mich wohl den ganzen Tag nicht loslassen.
Ich beobachte, wie der Dunkelhaarige einer Kundin, die an ihm vorübergeht, eine ganze Weile hinterherschaut, bevor er sich schließlich für eines der Hefte entscheidet und zur Kasse kommt. Das ist das Zeichen für meinen Einsatz.
»Guten Tag. Haben Sie alles gefunden?«
»Ja. Alles gut«, brummt er zurück.
»Das macht dann vier fünfundsiebzig.«
Er reicht mir einen Schein. Dabei beugt er sich zu mir und sagt leise: »Stimmt so!«
Die Intensität, mit der er mich dabei bedeutungsvoll ansieht, lässt mein Herz schneller schlagen. Stimmt so, wiederhole ich seine Worte im Stillen. Als hätte er mich damit gemeint …
Als hätte er gemeint, dass mit mir alles stimmt. Dass ihm passt, was er sieht …
Irgendwo im Hinterkopf weiß ich, dass ich seine Worte falsch interpretiere. Aber komischerweise erreicht mich dieses Wissen erst, als er sich verabschiedet und ich mit dem Wechselgeld in der Hand zurückbleibe. Da sickert die eigentliche Botschaft zu mir durch. Die Geldsumme stimmt. Ich stecke das überzählige Kleingeld als Spende in die Sammelbüchse, auf der ein »Herz-für-Kinder«-Logo klebt.
Zum Glück beansprucht sofort der nächste Kunde meine Aufmerksamkeit. Wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich ja den Dunkelhaarigen als geheimen E-Mail-Korrespondenten gewählt, aber es kann natürlich auch der kleine Mann sein, der jetzt vor mir steht. Die Prüfung seiner EC-Kartenzahlung bringt mich erstmal auf ganz andere Gedanken. Denn seine Unterschrift, die mir sofort ins Auge springt, weist ihn als Dirk Seltner aus. Und gekauft hat er, genau wie der gestrige Mark Seltner – ausschließlich Einwegrasierer! Das hätte mich aus jeder noch so tiefen Grübelei gerissen.
Ist es Zufall, dass sich zwei Männer mit dem gleichen Nachnamen an aufeinanderfolgenden Tagen mit unseren Rasierern eindecken? Oder sind sie verwandt?
Geht es vielleicht um eine Wette? Oder um ein ungewöhnliches Heimwerker-Projekt?
Als keiner guckt, notiere ich schnell die entscheidenden Schlagworte in mein Geschichtenbüchlein und freue mich auf den Abend, wenn ich Hannahs Geschichte um den zusätzlichen Seltner ergänzen werde. Während ich die länger werdende Schlange abarbeite, denke ich mir so lange neue Varianten der Geschichte aus, bis ich schließlich Hannah vor mir sehe, wie sie in einer griechischen Heldinnentoga triumphierend die Hände in die Luft reißt, zu ihren Füßen nicht nur ein, sondern gleich zwei reumütige Ralphs.





























