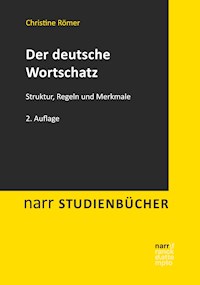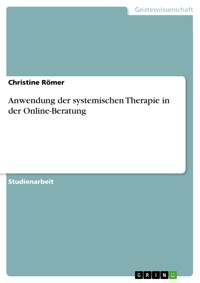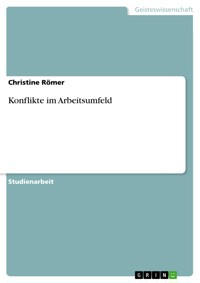Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Dialoge
- Sprache: Deutsch
Immer wieder werden in Politik und Gesellschaft teils heftige Debatten um die 'richtigen' Wörter geführt, beispielsweise darüber, ob mit die Lehrer auch Lehrerinnen und Diverse gemeint sind oder ob Wörter wie Mohr und Zigeuner diskriminierend sind und deshalb verboten werden müssen. Dieser Band analysiert ausgewählte Streitpunkte und versucht, den Argumenten, aber auch den Überzeugungen und Gefühlen der Streitenden auf den Grund zu gehen. Dabei geht es nicht darum, zu harmonisieren oder andere zu dominieren, sondern darum, wesentliche Argumentationslinien anschaulich und nachvollziehbar zu machen. Die Prämisse ist, dass gegenseitiges Verstehen das Finden von Wegen aus dem Streit erleichtert. Die Publikation hilft, Tendenzen der Sprachentwicklung zu verstehen und eigenes und fremdes Sprachhandeln zu beurteilen sowie Ablehnungen oder Mitvollzug von Entwicklungen auf Sachkenntnis zu gründen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Römer
Streit um Wörter
Sprachwandel zwischen Sprachbeschreibung und Sprachkritik
Umschlagabbildung: Wörterbuch Unwort © ollo/iStock
Dr. Christine Römer lehrte als Hochschuldozentin am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft der Universität Jena. Sie beschäftigt sich besonders mit sprachtheoretischen Themen, der Lexikologie und Morphologie.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783893086658
© 2022 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
ISSN 2626-0697
ISBN 978-3-89308-465-4 (Print)
ISBN 978-3-89308-017-5 (ePub)
Inhalt
Vorbemerkungen
Das Ziel jeder Diskussion sollte nicht Triumph, sondern Fortschritt sein.
(Joseph Joubert)
Das mentale Lexikon im Gehirn speichert das Wissen über Wörter und usuelle Wendungen im Langzeitgedächtnis einer jeden Person. Es ist kein passiver, statischer, abgeschlossener Wissensspeicher, sondern ein wichtiges dynamisches Organ der menschlichen Sprachfähigkeit. Die Dynamik wird von sprachinternen und äußeren Faktoren ausgelöst:
Der Klimawandel, die fortschreitende wirtschaftliche Globalisierung, das Vordringen von Informationstechnologien in einer globalen Wissensgesellschaft, nachhaltiger, verantwortungsvoller Konsum, Protest per Mausklick haben gesellschaftliche Veränderungen zur Folge.1 Begriffe wie Nachhaltigkeit, Tierrechte, Cancel Culture, Woke und Diversität bestimmen die ideologischen Diskussionen über solche Veränderungen. Aber im Zuge dieser Diskussionen finden nicht nur neue Begriffe Eingang in den Wortschatz. So sind neue Kinderbetreungsmodelle mit neuen Wörtern verbunden, beispielsweise Wechselmodell mit Pendelkindern. Verlangte und angestrebte Umbenennungen führten und führen zu heftigen Diskussionen. So verwahrt sich der Sprachwissenschaftler Munske gegen eine „gesetzliche Gleichstellung von Ehe und Partnerschaft“ mit einem lexikalischen Argument: „Es ist auch die Anmaßung des Gesetzgebers, das Sprachwissen um das Wort Ehe neu definieren zu wollen. […] Dazu ist kein Gesetzgeber befugt. Er darf und soll vieles regeln, aber die Sprache soll er gefälligst in Ruhe lassen.“ (Munske 2019:3) Andererseits hat in den letzten Jahren das Framing, das aus der Kommunikationswissenschaft stammt, Furore gemacht. Man meint beim Framing, dass über unterschiedliche Formulierungen desselben Inhalts das Verhalten der Angesprochenen über Deutungsrahmen beeinflussbar, gesellschaftliche Verhältnisse gar damit veränderbar sind. Wenn Abtreibungsgegner:innen von Baby anstatt von Fötus sprechen, rufen sie bestimmte Bedeutungsfelder auf, die von informierten Kommunikationsteilnehmer:innen verstanden werden, jedoch nicht deren Meinungen verändern werden. Letztlich, so meine Meinung, bestimmt die Wirklichkeit die Wahrnehmung, Einordnung und Kommunikation. Ob ein Glas als halbvoll oder halbleer wahrgenommen wird, hängt beispielsweise davon ab, ob man noch etwas davon trinken möchte oder nicht bzw. ob man eine optimistische oder pessimistische Einstellung hat. Der Focus-Kolumnist Fleischhauer spitzte diese Problematik folgendermaßen zu:
Vielleicht muss man wieder zur Sprachkritik zurück. Nicht weil Sprache Wirklichkeit konstruiert, wie es heute heißt, sondern weil der Sprachgebrauch Auskunft über die Zurechnungsfähigkeit des Sprechenden gibt. (20.08.2021)
Dass man sich mit „falschen“ Wörtern um Kopf und Kragen reden kann, haben die Olympischen Spiele in Tokio gezeigt. Der deutsche Sportdirektor Moster musste, nachdem er arabische Radsportler als Kameltreiber bezeichnete, seine Koffer packen. Nach einer sexistischen Äußerung, musste Japans Olympia-Cheforganisator Mori zurücktreten.
Der Streit um die „richtigen“, angemessenen Benennungen wird teilweise erbittert geführt, sowohl innerhalb der Linguistik, Journalistik als auch der Öffentlichkeit. Offensichtliche Überziehungen, wie dass das Wort Curry rassistisch sei oder ein Leitfaden für geschlechtergerechte, der die Mehrfachmarkierung vorschlägt „Frau Prof.in Dr.in Lise Meitner“2, fachen die Diskussionen weiter an.
Diese Publikation hilft durch das Aufzeigen und Analysieren aktueller Streitthemen zum Wortschatz, einen Dialog aufzubauen. Es geht nicht darum, Positionen abzuurteilen, sondern vielmehr darum, das Wesentliche in unterschiedlichen Sichtweisen herauszuarbeiten und einzuordnen. Die Prämisse ist, dass gegenseitiges Verstehen das Finden von Wegen aus dem Streit erleichtert.
Während Streit dadurch gekennzeichnet ist, dass jeder der Beteiligten seinen Willen bzw. seine Meinungen durchsetzen will, sind Dialoge zwar auch durch Rede und Gegenrede charakterisiert. Dialoge sollen jedoch ermöglichen, Annahmen, Überzeugungen und Gefühlen auf den Grund zu gehen. Dabei geht es weder darum zu harmonisieren noch andere zu dominieren, sondern um den Gewinn von neuen Einsichten und Erkenntnissen.
Auch von der ideologisch rechten Seite gibt es Aktionen, die Meinungsfreiheit einschränken wollen, beispielsweise wenn undifferenziert Demonstrationen gegen „die Lügenpresse“, „die gleichgeschalteten Medien“ und „den Journalismus“ veranstaltet werden3. Oder bei Amazon T-Shirts mit dem Aufdruck „Lügenpresse halt die Fresse“ verkauft werden4 und es im Anpreisungstext heißt:
Lügen gibt es von der Lügenpresse im TV, Radio und in Print Zeitungen. Du bist gegen diese Art von Schlagzeilen und Nachrichten? Dann zeig es mit dem „Lügenpresse halt die Fresse“ Motiv auf der nächsten Demonstration gegen den Journalismus.
Gegenstände dieses Buches sind einerseits aktuelle populäre, laienlinguistische sprachkritische Äußerungen in der Publizistik und andererseits linguistisch-fachwissenschaftlich fundierte Reflexionen zu den gleichen Gegenständen. Die Streitthemen werden in den ersten Kapiteln linguistisch eingeordnet und nachfolgend die verschiedenen Formen des aktuellen natürlichen und gelenkten Sprachwandels charakterisiert und an ausgewählten, besonders diskutierten Beispielen vertieft.
Zusammenfassend gesagt, zeigt diese Publikation, die aktuellen Streitpunkte um Wörter auf, differenziert sie und ordnet sie ein. Dabei ist es ein zentrales Anliegen für einen Dialog und Meinungsfreiheit zu plädieren, weshalb keine Schiedsrichterposition eingenommen wird.
Die Publikation ist wissenschaftlich fundiert, richtet sich jedoch an alle, die an der Thematik interessiert sind und sieht deshalb von extensivem Fachbegriffgebrauch und vielen Literaturhinweisen ab. Die behandelten Streitbeispiele und Diskussionen werden in den Fußnoten nachgewiesen, damit sie nachvollziehbar bleiben. Sie können auch ignoriert werden.
Kursiv gesetzte Wörter sind Sprachbeispiele, wenn sie in Anführungszeichen stehen, stehen sie als Begriffsbezeichnung. Längere Zitate sind eingerückt und semantische Beschreibungen, wie in der Sprachwissenschaft üblich, in einfache Anführungszeichen gesetzt. Zusammenfassende Aussagen erscheinen in einem Kasten und wichtige Inhalte sind fett gedruckt.
Für Hinweise, Vorschläge und Kritiken zum Text möchte ich mich bei Josef Bayer, Peter Gallmann, Inge Pohl und Tillmann Bub vielmals bedanken.
Jena, im Juni 2022 Christine Römer
1 Streit, Kritik und Sprachbewusstsein
In jüngerer Zeit streitet man in unserer zunehmend politisierten Gesellschaft erbittert um die „richtigen“ Wörter und Wendungen. Beispielsweise darüber, ob das Wort Rasse aus der Verfassung gestrichen werden solle, ob man die Mohrenstraßen umbenennen müsse, ob Aktivist durch den ausufernden Gebrauch ein ideologisches Leerwort geworden sei oder ob die Lehrer Lehrerinnen einschließt oder nicht. Dieser Streit um die richtigen Benennungen und um ihren Inhalt ist nicht neu. So stritt man schon in der Vergangenheit u. a. darüber, ob die Menschen, die nach 1945 aus den ehemaligen östlichen deutschen Gebieten gekommenen waren, Heimatvertriebene oder besser Flüchtlinge bzw. Evakuierte genannt werden sollten.
Der Streit um die Wörter wird oft mit der Vorstellung eines Verfalls der deutschen Sprache verknüpft. „Diese Vorstellung lässt sich mindestens bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen, als Schulmeister sich beschwert haben, dass ihre Schüler wegen der um sich greifenden Variation nicht mehr wüssten, was korrektes Deutsch sei.“ (Durell 2014: 11) Diese Klagen blenden aus, dass es eine Wesenseigenschaft von natürlichen Sprachen ist, sich zu ändern und nicht homogen zu sein. Die sprachliche Vielfalt hat auch im deutschsprachigen Raum zugenommen: Die Standardsprachen, regionale Umgangssprachen, Soziolekte, Fachsprachen, mündliche und schriftliche Alltagssprachformen festigen den Zusammenhalt in sozialen Gruppen und grenzen diese auch nach außen ab. Dies geht einher mit einer verstärkten Differenzierung der Gesellschaft in soziale Milieus, die durch gemeinsame Werthaltungen und ähnliche Prinzipien der Lebensführung gekennzeichnet sind.
Der aktuelle Streit um Wörter geht aber über die Sprache hinaus. Er ist verbunden mit der Diskussion darüber, ob es eine sog. Cancel Culture (Absage- oder Löschkultur) und ob es einen Versuch gebe „eine Einheitsmeinung“ durchzusetzen, wie z. B. der Historiker Wolffssohn meint: „Nach dem Ende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sehnen sich offenbar viele Deutsche in Ost und West zumindest nach einer Einheitsmeinung. Sie, nicht nur Linke und Linksliberale, sollten sich an Rosa Luxemburg erinnern: ‚Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden.‘“1
Der Wortschatz, die Gesamtheit der Wörter und festen Wendungen, ist ein dynamisches System, das in ständiger Veränderung ist. Viele neue Wörter und Wortbildungsbausteine kommen hinzu, etliche verschwinden auch. Die vorhandenen Wortschatzelemente verändern ihre äußere Form und Aussprache, ebenfalls verändern sich ihre Bedeutungen, Verknüpfungs- und Verwendungseigenschaften. Diese natürlichen Wandelprozesse erfolgen nicht von einem Tag auf den anderen.
Wortverwendungen sind immer bestimmt durch die Kommunikationsgemeinschaften, die Kontexte und spezifischen Situationen. Die Bedeutungen von Wörtern und festen Wendungen verfestigen und wandeln sich in kulturtypische Wortschatznetze. Mit Wortgraphen wie in Abbildung 2, die man aus Korpora gewinnt, kann man diese Netze veranschaulichen. Historische und aktuelle Beispiele für den Blick aus Deutschland auf Angehörige fremder Länder und Kulturen zeigen, was mit den Wortschatznetzen gemeint ist.
In der „Steierschen Völkertafel“2, ein Ölgemälde eines unbekannten Malers aus dem 18. Jahrhundert, kann man eine bebilderte historische Quelle für ethnische Stereotype in Augenschein nehmen. Italienern werden dort beispielsweise die Eigenschaften „Hinterhältig, Eifersüchtig, Scharfsinnig, Opportunistisch …“ zugeschrieben. Solche Stereotype können über längere Zeit fortwirken. Sie ändern sich aber auch.
„Kurze Beschreibung der In Europa Befintlichen Völckern Und Ihren Aigenschafften“, genannt „Die Steirische Völkertafel“, Gemälde eines unbekannten Malers, 18. Jahrhundert, Völkerkundemuseum Wien
Ein Blick in alte Enzyklopädien ist diesbezüglich sehr hilfreich. In „Meyers Konversations=Lexikon“ von 1876 (S. 252) kann man unter dem Lemma „Indianer“ u. a. Folgendes lesen:
Indianer, allgemeine Bezeichnung der Ureinwohner Amerika’s (mit Ausnahme der Eskimo), rührt von den spanischen Entdeckern her, welche die Neue Welt anfangs für einen Theil Indiens ansahen und demgemäß die Eingeborenen benannten. Im Besonderen versteht man darunter jedoch die Jägervölker Nordamerika’s, die sogen. Rothäute.
Während im „Duden Deutsches Universalwörterbuch“ von 2001 der Ausdruck „Rothaut“ nicht mehr auftaucht, werden dort andere körperliche Merkmale herausgestellt:
Angehöriger der in zahlreiche Stämme verzweigten Ureinwohner Amerikas mit glänzend schwarzem Haar u. rötlich brauner bis gelblicher Hautfarbe“ (S. 825).
2021 wurde in der Wikipedia ausgeführt:
Indianer ist die im Deutschen verbreitete Sammelbezeichnung für die indigenen Völker Amerikas, mit Ausnahme der Eskimovölker, der Aleuten, der arktischen Gebiete und der Bevölkerung der amerikanischen Pazifikinseln. Ihre Vorfahren haben Amerika in urgeschichtlicher Zeit von Asien aus besiedelt und dort eine Vielzahl von Kulturen und Sprachen entwickelt. Indianer ist dabei eine Fremdbezeichnung durch die Kolonialisten, eine entsprechende Selbstbetitelung der weit über zweitausend Gruppen besteht nicht. Allerdings gibt es übergreifende Begriffe in Kanada, in den USA sowie im ehemals spanischen und portugiesischen Teil Amerikas.3
Im Unterschied zur Vergangenheit wird heute nicht mehr auf äußere Merkmale referiert, da es als diskriminierend angesehen wird, Menschen über körperliche Eigenschaften einzuordnen. Auch die Ausdrücke „Ureinwohner, Naturvolk“ werden nicht mehr verwendet, da mit ihnen teilweise negative Konnotationen einer primitiven und unentwickelten Lebensweise verbunden werden. Seit den 1980er Jahren ist international die Bezeichnung „Indigene“ bzw. „indigene Völker“ an ihre Stelle getreten.
Mit den oben schon angesprochenen maschinell erstellten Wortgraphen (Diagrammen) kann man lexikalische Informationen aus Textkorpora ableiten und objektivieren. Auch sog. Wortwolken, die Wörter eines Textes bzw. Textkorpus je nach der Häufigkeit flächenhaft zusammenstellen, können objektiv Auskunft über den Zeitgeist in den analysierten Texten geben, da die ermittelten Komponenten der Graphen bzw. Wolken die in einem Diskurs zusammenhängenden Lexeme hervorheben und so Auskunft über ihre Wichtigkeit geben.
Der Wortgraph zu Indianer macht deutlich, dass in dem verwendeten deutschen Nachrichten-Korpus der Universität Leipzig Indianer eher im literarischen und Verkleidungskontext verwendet wird.
Wortgraph Indianer
Die folgende Textwolke, die vom DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache) abgeleitet wurde, spiegelt die Bedeutungsveränderung des Lexems Indianer deutlich wider, indem „Ausrottung“ und „eingeboren“ hinzugekommen sind.
Wortwolke Indianer
Die aus dem DWDS-Zeitungskorpus (Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute) abgeleitete Verwendungs-Verlaufskurve zeigt, dass die Verwendungshäufigkeit rückläufig ist:
Verwendungsverlauf Indianer
Die Analyse der aktuellen Verbindung von Indianer mit Verben offenbart auch, dass eine Bedeutungsveränderung stattgefunden hat: Indianer wird in dem untersuchten Korpus des DWDS am häufigsten mit ausrotten verbunden.
Vorstellungen spezifischer Eigenschaften von Gruppen (Stereotype) ermöglichen es dem Gehirn, die Welt zu kategorisieren und Informationen schneller zu verarbeiten. Komplexe Informationen werden durch Stereotype reduziert und damit bestimmte Merkmale generalisiert. Sie können zum Hindernis für die Wahrnehmung werden, wenn sie nicht ständig hinterfragt und angepasst werden. Sie sollten jedenfalls nicht zu Vorurteilen werden. Beispielsweise haben psychologische Untersuchungen ergeben, dass bestimmte Namen stark vorurteilsbehaftet sind und von ihnen öfter auf den gesellschaftlichen Status und die Intelligenz einer Person geschlossen wird, wie in folgendem Zeitungsausschnitt betont wird, der entsprechende Studienergebnisse zusammenfasst:
„Kevin“ und „Jakob“, „Jacqueline“ und „Charlotte“: Der Vorname eines Kindes kann schon in der Grundschule schwere Bürde oder Startvorteil sein. Viele Lehrer hegten Vorurteile zu bestimmten Namen, heißt es in einer Studie der Universität Oldenburg. Die GEW warnt vor Verallgemeinerungen. „Besonders der Name Kevin stellt sich hierbei als stereotyper Vorname für einen verhaltensauffälligen Schüler heraus“, fand die Wissenschaftlerin Julia Kube heraus und zitiert den Kommentar eines Lehrers: „Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose!“4
Mit den Namen Kevin und Jacqueline seien eher negative Eigenschaften wie Verhaltensauffälligkeit und Leistungsschwäche verbunden; mit Jakob und Charlotte dagegen Freundlichkeit und Leistungswille. Diese Vorurteile hätten auch Einfluss auf die Notengebung.
Wandelprozesse rufen öfters die Sprachkritiker aus der Öffentlichkeit und Wissenschaft auf den Plan und führen zu Diskussionen in der Wissenschaftsgemeinschaft. Es ist dann auch schnell von Sprachverfall oder von einer „allgegenwärtigen Trivialisierung“ (Kaehlbrandt 2016: 26) die Rede. Andere, wie der populäre Journalist Bastian Sick, empfinden Neuerungen in der Sprache als störend und behaupten, sie verunstalteten die deutsche Sprache. So meint er, dass „den meisten Deutschen das Gespür für wohlklingende und missklingende Wörter abgeht“ (Sick 2004: 190). Sich mit der alltagssprachlichen, populären Sprachkritik in der gesellschaftlichen und auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit auseinanderzusetzen, die Zurückweisung von Pauschalurteilen und das Bewusstmachen von Differenzierungen sind auch eine wichtige Aufgabe für das Sprachenlehren und die Publizistik. Dafür braucht es Bewertungskriterien auf denen die Bewertungen beruhen, um Orientierung für den Sprachgebrauch geben zu können. Deshalb muss man sich ins Bewusstsein rufen, dass Sprachen sich in den verschiedenen Sprachmodulen im Gegensatz zu künstlichen Sprachen verändern und sich so den sich ändernden Anforderungen anpassen. Dieses Wissen ermöglicht es, Wörter und feste Wendungen zu verstehen und richtig zu verwenden. Dieses Wissen ist auch der Reflexion zugänglich. Anhand von aktuellen Beispielen aus den verschiedenen Subsystemen werden die spezifischen Veränderungen im Sprachgebrauch in den folgenden Kapiteln veranschaulicht.
Sprachbewusstsein, auch Sprachgefühl, meint „das intuitive, unreflektierte und unbewusste Erkennen dessen, was als sprachlich richtig und angemessen empfunden wird (insbesondere in Wortwahl und Satzbau)“5. Es erschöpft sich nicht in der Kenntnis von Normen. Es umfasst auch die positive bzw. negative Bewertung von sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten und sprachlichen Entwicklungen. Es gilt zwischen Alltagssprachbewusstsein und wissenschaftlichem Sprachbewusstsein zu unterscheiden. Das Alltagssprachbewusstsein basiert auf den individuellen Sozialisierungsprozessen und ist von traditionsgebundenen Vorstellungen geprägt. Es sollte auch von den Sprachwissenschaftler:innen nicht unbeachtet bleiben. Es ist eine linguistische Aufgabe, die auf Alltagssprachbewusstsein beruhenden sprachkritischen Äußerungen zu registrieren, ihren Motivationen nachzugehen und sie mit linguistischen Erkenntnissen zu verknüpfen. Die begründende Zurückweisung von Pauschalurteilen und das Bewusstmachen von Differenzierungen gehört zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Sprachkritik. Gleichzeitig sollte es ihr aber nicht darum gehen, Vorschriften zu machen, sondern Raum für einen rationalen Diskurs zu geben (Gauger 1995: 60).
Zwischen öffentlicher Sprachkritik, die auch als Laienlinguistik bezeichnet wird, und Sprachwissenschaft besteht ein schwieriges Verhältnis, da sich nach Meinung vieler Linguist:innen bewertende, polemische Argumentation und das Objektivitätsgebot für Wissenschaften ausschlössen. Die Sprachwissenschaft wurde und wird von vielen als ausschließlich beschreibende und erklärende Wissenschaft verstanden. Die publizistische, wertende Sprachkritik wird im nichtakademischen, bildungsbürgerlichen Bereich verortet. Die laienlinguistische Sprachkritik hingegen ist zumeist subjektiv und häufig normativ auf Richtig-falsch-Urteile ausgerichtet. Sie artikuliert Angst vor dem Sprachverfall und hat Sprachpflege als Ziel.
Grundsätzlich existieren unterschiedliche Zugänge zur nichtwissenschaftlichen Sprachanalyse in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. So meinen einige Wissenschaftler:innen, das sollte uns nicht interessieren (a), andere meinen, dass sie diese Öffentlichkeit zu belehren haben (b), andere wieder denken sich in sie hinein, um sie zu verstehen (c), und dann gibt es noch die Reflexionsvariante, die eigene mentale Konzepte, Gefühle und Haltungen wahrnimmt und in Bezug zur Umwelt kritisch hinterfragt (d).
So wurde und wird das Bestreben nach einer geschlechterinklusiven Sprache auch mit dem Argument abgelehnt, dass das ein ideologisches Problem sei und deshalb kein Gegenstand der Sprachwissenschaft (siehe dazu Kap. 6.3). Dies ist dem Zugang (a) zuzuordnen. Wie u. a. Dieter Zimmer (2005: 13) schrieb, sind Sprachwissenschaft und Sprachkritik nicht gut aufeinander zu sprechen.
Mit Laienlinguistik wird nicht nur eine von Laien betriebene Sprach- und Kommunikationsuntersuchung sondern auch eine außerwissenschaftliche Linguistik für Laien bezeichnet. Sprachkritik von Wissenschaftler:innen wird meist hier eingeordnet.
Wie die nachfolgenden Kapitel zeigen werden, ist der aktuelle Streit um Wörter kein Beleg für Sprachverfall, sondern auch ein Zeichen für die zunehmende Differenzierung der Sprache und der Gesellschaft in soziale Milieus. Anstelle des erbitterten Streits sollte ein Dialog treten, der auch die laienlinguistische Artikulation des Sprachbewusstseins ernst nimmt.