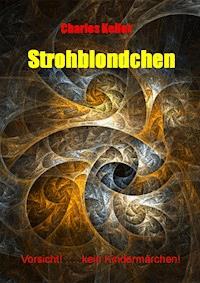
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Strohblondchen (Lene) und ihr großer Bruder Wolf wachsen auf im ländlichen Süden der noch jungen Republik. Musterschüler Wolf besucht das Gymnasium im benachbarten Städtchen, während Lene die Aufnahme schulischen Wissens tunlichst verweigert, lieber mit Tieren und unsichtbaren Gefährten spielt – und malt, malt, malt. Ihrer beispiellosen Geschwisterliebe tut das keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil! Unzertrennlich stellen sich die Zauberhafte und der Gescheite (?) den zahlreichen Widrigkeiten ihrer Kindheit und dem allerorten lauernden "braunen Restdreck" – bald auch unter Zuhilfenahme von Drogen. In die Katastrophe führt dann allerdings die Begegnung mit einem Verbrecher ganz anderer Art.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Keller
Strohblondchen
Vorsicht! .... kein Kindermärchen!
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Impressum neobooks
Kapitel 1
Sommer 1965: Ein krakeelendes Quartett, allesamt in kurzen Lederhosen steckend, saß fröhlich spielend auf einem schwäbischen Sandhaufen. Dieser war eigentlich gar nicht zum Spielen da – vielmehr diente er als Ingredienz für die graue Pampe, die die fleißigen Erwachsenen davon anrührten. Speis nannten die das Zeug und pappten Stein auf Stein damit.
Tagsüber war die Baustelle ganz in den Händen von Lene, Wolfi, Gerd und Enno – da die Ritters, die Eltern der beiden Erstgenannten, immer erst um fünf kamen, wenn auch Onkel Hans Feierabend hatte bei HALTER u. Co. Dann hieß die Devise: Fliege machen – ansonsten lief man Gefahr, womöglich mithelfen zu dürfen.
Bis dahin jedoch war noch jede Menge Zeit für jede Menge Blödsinn. Das Springen oder "Jumpen", wie die Älteren sagten, die bereits Englisch hatten in der Schule, vom bedrohlich wackelnden, aus jungen Tannenstämmchen und Holzdielen zusammengezurrten Gerüst mitten auf den immer flacher werdenden Sandhügel – das trauten sich natürlich nur die Mutigsten. Und selbst bei denen brauchte es stets eine ganze Weile, bis sie sich gegenseitig so aufgestachelt hatten, dass ein Rückzieher einen kaum wieder gutzumachenden Verlust des Ansehens bedeutet hätte.
Kurz vor vier war es dann wieder einmal soweit. Mit hochroten Köpfen machten sich Wolfi und Gerd daran, die erste Etage des Gerüsts zu erklimmen. Die für legale Besteigungen vorgesehene Holzleiter war selbstverständlich sicherheitshalber weggesperrt in der schon fertigen Garage. Dort lag sie gut, und ihre Unverfügbarkeit machte das Unterfangen erst zur richtigen Mutprobe.
Die beiden weniger Mutigen fingen schon mal an, den Haufen wieder in seine ursprüngliche Form zu bringen, indem sie den weit verstreuten Sand zurückschaufelten. Vielleicht wollten die zwei Jüngsten und Kleinsten auch nur ein paar Zentimeter mehr des weichen Materials zwischen den harten Erdboden und die Helden da oben bringen. Wie auch immer – mit dem sofortigen Absprung der beiden war erfahrungsgemäß sowieso nicht zu rechnen, da die Festlegung der Reihenfolge, ein unumgänglicher Bestandteil der Zeremonie, meist ewig dauerte.
So sah denn der renovierte, in der Sonne glitzernde Sandberg aus, als sei er gerade eben von der Ladefläche eines Kieslasters gerutscht, wie endlich Bewegung in die Sache kam.
„Es ist bald fünf, du musst jetzt runter, Wolfgang!“
Die eher unübliche Verwendung seines vollständigen Vornamens bedeutete ihm die Ernsthaftigkeit der Lage.
„So, wie die den Sand hoch geschippt haben, ist’s ja nicht mal mehr halb so gefährlich wie das Hochklettern!“
Was hätte auch passieren können, wenn zwei solche Hänflinge aus bestenfalls fünf Metern Höhe auf einen annähernd mannshohen Berg allerfeinsten Rheinsandes herunterhüpften? Nix, wie sich ein jeder zu glauben zwang.
Trotzdem sah Wolfi nicht eben glücklich aus, als er dann endlich unter dem Geländer durchschlüpfte und ohne eine weitere Verzögerung in dieses Meer aus funkelnden Sandkörnern hineinplumpste.
Bis zu den Knien steckte er mitten im Haufen, grinsend wie ein Honigkuchenpferd. Nur die dicken Schweißperlen, die durch den sanft gebremsten Aufprall von der Stirn über Wangen und Nase hinuntergelaufen waren und nun drohten, vom Kinn herabzutropfen, verrieten noch die immense Anspannung, die auch den beiden Kleinen nicht verborgen geblieben war. Dennoch zollten sie dem Akrobaten gehörig Respekt, indem sie ihm halfen, seine Beine wieder ans Tageslicht zu befördern und vom anhaftenden Sand zu befreien.
Die abrupte Einstellung der Adrenalin-Produktion führte auch umgehend zur Wiederauflockerung seines keinesfalls zu klein geratenen Mundwerks.
„Auf, spring jetzt, du Flasche!“
Drei weit aufgerissene Augenpaare fixierten nun den armen Gerd, dem jetzt wirklich nichts anderes mehr übrig blieb, als zu springen. Seine pfeilschnellen Gedanken kreisten einzig um die Tatsache, dass er sich wohl auf unbestimmte Zeit Wolfis Willen zu unterwerfen hätte, wenn er jetzt den Schwanz einzöge.
„Da kann ich mich ja gleich im Weidenbach ersäufen!“, dachte er – wohl wissend, wie ihn Wolfi schon früher drangsaliert hatte, wenn er in irgendeiner Disziplin nicht mindestens gleichzuziehen vermochte.
„Was du kannst, kann ich schon lange!“, murmelte Gerd – mehr zu sich als zum Gemeinten, während er sich unter der Brüstung durch duckte, um sich davor wieder vollständig aufzurichten.
Nur mehr mit den Absätzen stand er auf den mit ihm zitternden Dielen, und seine feuchten Finger krallten sich in die trockene Borke des Tannenholzes, als wollten sie’s nie mehr loslassen. Seine Schweißtropfen schillerten noch über den Augenbrauen, darauf wartend, bei der Landung ebenso schöne Salzwasserbächlein wie bei Wolfi im Gesicht zu hinterlassen.
Dessen Visage war zwar immer noch rot wie ein Feuermelder, die Spuren des Angstschweißes hatten Sonne und Wind jedoch schnell auf ein paar dünne, weißliche Streifen reduziert.
Keiner ahnte in diesem Augenblick, dass man in Gerds Gesicht alsbald nicht mehr würde unterscheiden können – zwischen Schweiß und Tränen.
„Ich springe jetzt!“, rief er eher kleinlaut – nicht ahnend, den gesamten Rest der Ferien im Weidenbacher Kreiskrankenhaus verbringen zu müssen.
Obwohl allen Zuschauern einzig nur einleuchten mochte, dass doch eigentlich rein gar nichts passiert sein könne, starrten sie wortlos in Gerds Antlitz, aus dem in wenigen Sekunden die Farbe entwich – und es kam ihnen dennoch wie eine Ewigkeit vor, bis der dann ein noch nie gehörtes Geschrei anstimmte.
In Windeseile erklommen die drei den Sandhaufen, auch wenn die Schmerzensschreie des armen Spielkameraden kaum zu ertragen waren. Die beiden Jungen packten ihn unter den Achseln und zerrten ihn nicht gerade vorsichtig aus dem Sand. Sie bemerkten auch nicht, dass Gerds Gebrüll dabei wohl noch lauter geworden war, um dann mit einem Mal zu verstummen, angesichts dessen, was sie da – und er vor allem – zu sehen bekamen.
Ein etwa sechzig Zentimeter langes, rostiges Moniereisen ragte aus des Geschockten linker Wade, und sein Blut strömte in rhythmischen Schüben den pulvrigen Abhang hinunter, bildete kleine, rotbraune Kügelchen, die, vorbei an der kreidebleichen Lene, zu Tal kullerten und vor den Füßen von Antonio und Miguel zum Stillstand kamen. Diese beiden waren nämlich, alarmiert vom erbarmenswerten Gekreische, herbeigeeilt und durften auch gleich helfend eingreifen, indem sie das kleine Mädchen auffingen, das urplötzlich seine grünen Äuglein verdreht hatte, mit dem Popo in den Sand gesackt war und dann mittels einer ungewollten Rolle rückwärts auf eben jenen blutigen Murmeln zu landen drohte, die wahrscheinlich seine Ohnmacht ausgelöst hatten.
An Händen und Füßen trugen die beiden Gastarbeiterkinder Lene in den Schatten, unter den einzigen noch auf dem Grundstück verbliebenen Baum, wo die dann gerade noch rechtzeitig wieder zu sich kam, um mit anzusehen, wie ihr Vater, mit beiden Armen wild umherfuchtelnd, auf die Baustelle stürmte.
Als der den Ort des Geschehens erreicht hatte, landeten zunächst einmal eine nicht mehr nachvollziehbare Anzahl von Schlägen an Wolfis Kopf. Mit beiden Händen trommelte er auf den Ärmsten ein. Erst als der flüchten wollte, halbierte sich die Schlagzahl – weil er ja dann eine Hand brauchte, um den Delinquenten festzuhalten.
Unterdessen waren auch Mama Ritter und ihr Bruder Hans eingetroffen, die sich jedoch nicht an der wüsten Hauerei beteiligten, sondern dem Verunglückten zu Hilfe eilten, der wohl den ersten Schock überwunden hatte und anfing, zu stöhnen und zu jammern. Ein Mal schrie er noch auf, als sie ihm das Bein am Oberschenkel abbanden, direkt über dem Knie – mit dem hastig abgerissenen Träger von Mutter Ritters Küchenschürze.
Onkel Hans trug Gerd zur Straße und wuchtete ihn auf den Rücksitz seines "Goggomobils" – natürlich nicht ohne seiner Schwester die spätere Reinigung des Fahrzeugs zu befehlen. Seinen Schwager, der dann doch nicht mehr länger auf das winselnde Häuflein Sohn eindreschen wollte, zitierte er auf den Beifahrersitz, zwängte seinen eigenen, für dieses kleine Vehikel viel zu groß erscheinenden Körper daneben und startete den unfreiwilligen Krankentransporter. Der gab selbstverständlich eine dem Ereignis gerecht werdende Qualmwolke von sich.
Der Zweitaktmotor des rollenden Winzlings war schon lange nicht mehr zu hören, da weilten die Zurückgebliebenen noch immer reglos inmitten der grässlich stinkenden Auspuffgase – und außer dem Gewimmer von Wolfi herrschte eine gespenstische Ruhe. Es schien, als hätten selbst die Vögel eine Schweigeminute eingelegt – für den Verletzten und den Geschlagenen sowie für die beiden Kleinen, deren restliche Ferientage nun gewisslich auch kein Zuckerschlecken mehr werden sollten.
Das große Schweigen beendete dann die unbeschürzte Rittersfrau – und der strohblonden Lene wurde schnell klar, dass sie wieder einmal, eine noch nicht abzuschätzende Zeit lang, auf ihren selbst gewählten und ungleich mehr geliebten Spitznamen würde verzichten müssen.
„Magdalena! Wolfgang! Sofort ab nach Hause! Ich bring noch Enno zu seiner Oma und sag schnell Gerds Eltern Bescheid. Die werden eine Freude haben!“
Magdalena ging noch einmal zum Sandhaufen und half ihrem daneben kauernden und schluchzenden Bruder auf die von Schlägen verschonten Beine – und so trotteten sie Hand in Hand von dannen. Beide sollten das Grundstück Bachweg Nr. 15 erst am Tage des Einzugs wieder betreten.
Kapitel 2
Sommer 1970: Es war der letzte Schultag vor den großen Ferien. Alles deutete auf einen wunderschönen Sommertag hin, als Wolf sich auf den Weg ins drei Kilometer entfernte Weidenbach machte. Dort besuchte er das Erwin-Rommel-Gymnasium und ging – nun ja, gerade mal diesen Vormittag noch – in die siebte Klasse.
Das verniedlichende "i" in seinem früheren Spitznamen hatte Wolfgang Ritter nicht mit auf die Oberschule genommen. In der zweiten Dekade seines Lebens sollte ihn keiner mehr "Wolfi" rufen – ihn, der nun bereits fast einen Meter und achtzig maß.
Kein Lüftchen war zu spüren, als er seinen Drahtesel aus der Garage schob. Die hohen Pappeln am See bewegten sich nicht einen Millimeter. Ihre Blätter hingen so schlapp an den Ästen, dass Wolf einige der Löcher erkennen konnte, die er in den letzten Tagen mit Vaters Spatzengewehr hineingeschossen hatte.
„Wolfgang, du musst jetzt los!“, rief seine Mutter hinter dem aufgeklappten Küchenfenster, und sie zeigte dabei gut ein Dutzend Mal auf ihr linkes Handgelenk, an dem sich, soweit er wusste, noch nie eine Armbanduhr befunden hatte.
Und da hörte er auch schon das unverwechselbare Gepolter auf der Treppe, mit dem sich Lene anzukündigen pflegte. Die ging noch auf die Volksschule im Weidenbacher Ortsteil Friedberg, und dabei würde es wohl auch bleiben – „weil sie zu doof ist!“, wie ihr der Papa bei jeder Gelegenheit bescheinigte.
Dabei war sie genau das Gegenteil – fand Wolf. Er selbst war fast drei Jahre älter und konnte heute noch nicht so gut mit Pflanzen und Tieren sprechen wie die allseits verkannte Schwester. Auch Geister, Dämonen und ganz besonders Feen mochten auf ihn lange nicht so gut hören wie auf Strohblondchen – wie sie seit einiger Zeit schon, aber einzig und ausschließlich in diesen illustren Kreisen genannt wurde.
Den Feen, diesen zarten Wesen, hatte sie es auch zu verdanken, dass sie nicht schon wieder, für die ersten Ferienwochen zumindest, in Magdalena umgetauft zu werden brauchte. Die Bachfeen, die freundlichsten dieser Spezies, hatten nämlich dafür gesorgt, dass die im blauen Brief dokumentierte gefährdete Versetzung dann doch noch außer Gefahr geraten sollte. Dass der nicht zu überhörende sonntägliche Besuch von Papa Ritter bei Lehrer Mönk, der gerade mal einen Steinwurf entfernt bei Witwe Görsmayer zur Untermiete wohnte, etwas mit ihren verbesserten Zensuren zu tun gehabt haben könnte, stand daher für Lene absolut außer Frage.
Er, Wolf, liebte seine Schwester wie niemand anderen, was er noch keiner Sau je erzählt hatte – und auch sonst keinem. Nichtsdestotrotz verhinderte er ein des Verquasselns verdächtiges Zusammentreffen mit ihr, indem er schnell auf sein Rad stieg und reichlich Gummi gab.
Es war ohnehin zu spät, um den kürzesten Weg über die Austraße nehmen zu können, weil jetzt sämtliche Knalltüten, die nicht weiter weg wohnten als Ecke Bahnhofstraße und deshalb zur Ludwig-Uhland-Schule nach Friedberg mussten, in einem grölenden Konvoi entgegenkommen würden. Der holprige Weg übers Zornfeld war die einzige Möglichkeit, dem zu entgehen, und gleichfalls allem, was sich mit einem Aufeinandertreffen hätte verbinden können – spätere Rache an der doofen kleinen Schwester inklusive.
Irgendwie war ihm der kleine Umweg sowieso lieber, und er nahm ihn immer öfter, auch wenn kein Gegenverkehr zu derlei Befürchtungen Anlass gab. Wolf war nämlich, vielleicht nicht so sehr wie seine Kleine, Gott erbarme, aber doch auch eher den weniger belebten Zonen auf dieser Welt zugetan. Zu keiner Zeit jedoch wäre er, zudem eine ganze Schulstunde lang, von einem jungen Salamander, dem die Hinterbeine abgefahren wurden, aufzuhalten gewesen.
„Hättest du ihn wenigstens mit in die Schule genommen – als Entschuldigung sozusagen!“
Da sie es allerdings vorgezogen, gar für ihre oberste Pflicht angesehen hatte, den Sterbenden ins Salamanderjenseits zu geleiten und an einem ihrer Lieblingsplätze am Weidenbach feierlich zu bestatten, war dieser gleichermaßen abwegige wie verspätete Ratschlag auch auf wenig bis gar kein Verständnis gestoßen.
Er, der selbst nie zu spät zum Unterricht kam, obwohl auch er gelegentlich gerne die eine oder andere Minute abseits des Wegs verbummelte, erkannte nun, wie er nochmals darüber nachdachte, dass er da wohl doch einen rechten Scheiß verzapft habe. Schließlich wäre, ebenso an seiner Schule, ein Eintrag für verspätetes Eintreffen ins Klassenbuch – auch mit einem halb toten Kriechtier im Gepäck – so gut wie gar nicht zu verhindern gewesen. Ganz zu schweigen von den spitzen Bemerkungen seiner Klassenkameraden, für die er ohnehin ein Landei war – und nicht bloß, weil auf dem Weg zwischen Schule und Bachweg 15, der zweiten Hälfte auch nur, genau vier Misthaufen vor sich hindufteten.
Die meisten seiner Mitschüler kamen entweder gar nicht aus Weidenbach oder aber wohnten auf der anderen Seite der Stadt, von wo das letzte ländliche Fäkalienen-Depot bereits 1967 verbannt worden war.
Wie erhofft, begegnete ihm erst bei der Firma "Klobrillen-Wirtz" eine menschliche Kreatur. Max, einer der zahlreichen Schluckis, die dort arbeiteten, hatte bestimmt mal wieder verschlafen und schlüpfte gerade durch ein eigens für solche Vorkommnisse herausgeschnittenes Loch im Zaun. Eilig verschwand er im Fertigteilelager zwischen den großen Holzkisten, die auch andere Produkte enthielten als Klobrillen, wohl aber keinen solch schönen Firmennamen abgegeben hätten.
Schon überholten ihn, im Zehn-Sekunden-Abstand, die Karossen der Muttis und Vatis, die ihre handgebadeten Sprösslinge, nicht nur bei schlechtem Wetter, bis vors Portal des ehrenwerten Sandsteinbaus chauffierten. Dort würden die ihn dann bei den Fahrradständern erwarten, weshalb er sein Tempo auf ein Mindestmaß drosselte. Immer die Kirchturmuhr im Blick, wollte er es schaffen, die Zeitspanne von seiner Ankunft bis zum Klingeln so kurz zu halten, dass nicht einmal Schnellschwätzer Alfons einen ganzen Satz würde formulieren können. Ohnehin war heute noch einmal mit dem vollen Programm zu rechnen; es musste ja schließlich für sechs Wochen reichen!
So kam es dann auch, dass sein Eintreffen schon von der Schulglocke begleitet wurde, wodurch sich das Landeier-Begrüßungs-Ritual mindestens bis zur ersten Pause verschob.
In der Klasse hatte Wolf den Platz neben Eva – was ihm persönlich gar nichts ausmachte, aber häufig Anlass für Spötteleien der anderen Jungs war.
Offiziell hatten sie Englisch in der ersten Stunde. Buschmann jedoch, der wegen seines komischen Ganges – er setzte beide Füße immer mit dem Absatz zuerst auf und rollte sie dann zur Spitze hin ab, sodass sein Körper stets auf- und abhüpfte – von allen heimlich Skippy genannt wurde, hatte bereits gestern angekündigt, wieder einen Schwank aus seiner Zeit als Studienreferendar in England erzählen zu wollen.
So lauschten denn auch alle den Ausführungen des Lehrers, den sie im nächsten Schuljahr, mit Ausnahme der Lateiner, auch in Französisch haben sollten, als es draußen auf dem Gang mit einem Mal mächtig laut wurde.
„Diese kommunistischen Verbrecher“, hörte man Rektor Mahnwitz brüllen, „nicht genug damit, dass die unser halbes Volk ausgerottet haben, jetzt vergiften diese russischen Schweine auch noch unsere Kinder!“
Keiner in der Klasse hatte den Hauch einer Ahnung, was denn vorgefallen sein könnte. Skippy stand regungslos in der weit geöffneten Tür und sah, wie das kleine, drahtige Männlein die Treppe zum nächsten Stockwerk hochrannte. Eva und Wolf waren, dank ihres Sperrsitzplatzes, die Einzigen im Raum, die noch sehen konnten, wie Mahnwitz’ Oberhemd, das hinten über den Hosenbund gerutscht war, nun fast bis zu seinen Kniekehlen herunterbaumelte.
Wolf hatte vom ersten Tag an Angst vor diesem Mann, von dem man sagte, er habe den Kriegshelden, der unserer Anstalt seinen Namen gab, sogar persönlich gekannt.
„Bestimmt hat er ihn mal bei einem Afrika-Urlaub kennengelernt!“, hatte sein Vater einmal gewitzelt, als sie über diesen ehrenwerten Herren redeten.
Es war anzunehmen, dass der Recht und Ordnung liebende Rektor und Oberaufseher, wie er es schon bei früheren skandalösen Ereignissen praktiziert hatte, nun von den beiden dreizehnten Klassen an abwärts sausen würde, um jede Tür unangeklopft aufzustoßen und die dahinter befindlichen Räume mit seinen gefürchteten Schimpfkanonaden zu befüllen.
Leider machte er dabei dann – über die hoch akademische Bewertung der Russischen Seele hinaus – keine weiteren Angaben, sodass für die meisten nach des Meisters Abgang immer noch nicht klar war, was denn zu diesem neuerlichen Zwergenaufstand geführt hatte.
Da an Unterricht jetzt nicht mehr zu denken war, schickten alle Pauker ihre Schüler auf den Hof – eine Art vorgezogene große Pause. Sie selbst begaben sich schleunigst ins Lehrerzimmer, in der Hoffnung, doch noch Näheres zu erfahren – aber Mahnwitz musste zuerst von seiner Sekretärin, Fräulein Keck, frisch gerichtet werden.
Inzwischen hatten die paar wenigen Wissenden unter den Schülern jeweils einen Kreis Neugieriger, und das waren heute fast alle, um sich geschart und begannen, ein jeder auf seine Art, zu berichten.
„Der Carl-Uwe Wenger isch dood“, erklärte Luise Rath, bei der Wolf in der dritten Reihe stand, mit pietätvoller Miene, „der hat sich wahrscheinlich z’viel Haschisch g’schpritzt!“
Schon hatte der nachdenkliche Schüler genug gehört und wandte sich ab. Er setzte sich auf das Geländer der mächtigen Sandsteintreppe, die vom Schulhof zur Straße hinunterführte, und versuchte, seine Gedanken wenigstens ein bisschen zu ordnen.
Da war zunächst Carmen, die jüngere Schwester des Verstorbenen, die ihn beschäftigte – die er zwar nur vom Sehen kannte, ihm aber ganz gut gefiel.
„Wenn die ihren Bruder ähnlich lieb gehabt hat, wie ich meine Lene, dann ...!“
Wolf bemühte sich, so gut er eben konnte, den Gedankenfluss, wenn er ihn schon nicht anzuhalten vermochte, wenigstens in eine andere Richtung zu lenken.
„Z’viel Haschisch g’schpritzt?“, murmelte er gleich mehrmals vor sich hin.
Zum zweiten Mal hörte er jetzt von diesem Zeug. Letztes Wochenende erst war dieses schwabenzungenfreundliche Wort gleich mehrmals gefallen, als er mit seinen beiden Cousins Gerd und Walter am Bach zelten durfte. Nicht von den beiden, sondern von Volker und Berthold, zwei älteren Nachbarjungen, die ihr Tipi ein paar Meter entfernt aufgeschlagen hatten. Die sahen sogar ein wenig aus wie Indianer, da sie beide die Haare schon weit über den Ohren trugen, was in jener Zeit eine immer stärker aufkommende Unart manch junger Menschenkinder war.
Allerdings meinte sich Wolf zu erinnern, dass vom Haschisch-Rauchen gesprochen worden sei, was ja möglicherweise nur eine andere Variante des Genusses sein mochte. Er nahm sich jedenfalls fest vor, die beiden Bachindianer bei der nächsten Gelegenheit danach zu fragen.
Bevor weitere Gedankenschübe von seinem Knobelapparat Besitz ergreifen konnten, bimmelte die Schulglocke und Wolf sprang auf. Ihm war überhaupt nicht bewusst, dass es ja jetzt erst zur Fünf-Minuten-Pause klingelte – und so wunderte er sich, warum die Pennälergruppen auf dem Hof sich nicht augenblicklich auflösten, nicht allesamt ins Gebäude stürmten. Sollten die Ereignisse des Morgens etwa eine derart anarchisierende Wirkung auf die Schüler gehabt haben?
Doch mit einem Blick auf die Uhr am Haupteingang hatte ihn die Realität wieder, und seine Schritte wurden zwar langsamer, aber er marschierte dennoch, zwischen all den mehr oder weniger schockierten Oberschülern hindurch, schnurstracks in den ersten Stock, wo er auf seinem Weg in die "7 c" allerlei Gesprächsfetzen aufschnappte, die ihm bedeuteten, dass dieses Thema wohl noch lange nicht durch sei.
Zu allem Übel saß auch noch Fräulein Schmidt, bei der sie die nächste Stunde Deutsch hatten, mutterseelenallein am Lehrerpult – und sie sah überhaupt nicht glücklich aus. Die jüngste, aber nicht nur deshalb am wenigsten hässliche Lehrkraft war, was Wolf nicht wusste und auch nie erfahren sollte, die einzige, die sich im Lehrerzimmer kritisch zu Mahnwitz’ Auftreten geäußert hatte.
„Herr Oberstudiendirektor, woher wollen Sie eigentlich so genau wissen, dass der tragische Tod des jungen Wenger in irgendeinem Zusammenhang mit dem Kalten Krieg steht?“
Diese kecke Frage, die im Übrigen für alle Zeit unbeantwortet blieb, war dann wahrscheinlich auch der Hauptgrund dafür, dass es nach den Ferien keine Ulrike Schmidt mehr gab im Lehrerkollegium des elitären Erwin-Rommel-Gymnasiums zu Weidenbach.
Sie ahnte es wohl schon – und Wolf spürte, es ging etwas in ihr vor, was jetzt so überhaupt nicht zu einem letzten Schultag passen wollte. Ohne den Hauch einer Idee, was er denn zu ihr sagen, wie er sie bloß trösten könne, stellte sich Wolf neben das Pult – und wie sich ihre Blicke trafen, realisierte er, Gleiches oder auch nur Ähnliches noch bei keinem anderen Lehrkörper unaufgeforderterweise getan zu haben. Gewiss wären beider Äuglein noch feuchter geraten, hätten sie bereits gewusst, dass sie sich im ganzen Leben nie mehr begegnen würden.
So schwiegen sie sich eine halbe Ewigkeit lang an, und Wolf wurde mal heiß, mal kalt. Er bekam, wie so oft, einen knallroten Schädel, aber bei ihr – und nur bei ihr – machte es ihm nicht das Geringste aus. Weshalb er sich auch keinesfalls befreit, erlöst oder sonst irgendwie besser fühlte, als die Tür aufging und seine Mitschüler hereinstürmten – von denen sich die meisten, allem Anschein nach, vom ersten Schock bestens erholt hatten.
Nach dem Klingeln ordnete Fräulein Schmidt zunächst einmal eine Gedenkminute zu Ehren des viel zu früh Verstorbenen an. Mit einer eher unverfänglichen Thematik, der sich Wolf dann allerdings gänzlich entzog, schleppte sie sich durch ihre wohl denkwürdigste Stunde an dieser höheren Lehranstalt.
Mit Wolfs Hirnströmen hätte man unterdessen ein mittleres Einfamilienhaus versorgen können. Sein Kopf fühlte sich an wie ein Umspannwerk. Unaufhörlich kollidierten die viel zu vielen Gedanken mitten in seinem Gehirn – und dass er sie nicht unter Kontrolle bekam, lag mit ziemlicher Sicherheit an eben dieser viel zu klein geratenen Landeier-Erbse.
Nur der unbeschreibliche, wohlmeinende Blick, den er nach dem Klingeln vom scheidenden Fräulein Schmidt noch mitbekommen hatte, und den er – für alle Zeiten – an einem ganz besonders hübschen Plätzchen in seinem schnuckeligen Oberstübchen aufbewahren wollte, erhellte und entlastete ihn noch eine Weile.
„Hey, Ritter, was machst du eigentlich in den Ferien“, hallte es durch den Raum, „kriegen wir wieder eine druckreife Story aus dem Allgäu, hä?“
Alfons, natürlich! Da müssten die Bolschewiken schon die halbe Schule vergiften, dachte der Verhöhnte, auf dass der nicht mehr die Muße hätte, irgendeinen armen Tropf niederzumachen. Auch die Unsitte, seine Mitschüler mit dem bloßen Familiennamen anzureden, missfiel Wolf in jeglicher Weise. Die das taten, konnten es sich nur von den Paukern abgeschaut haben, weil über deren Lippen lediglich dann Vornamen kamen, wenn zwei denselben Nachnamen trugen oder persönliche Bekanntschaft mit den Eltern, mitunter auch Verwandtschaft, sie dazu zwang. Im Übrigen war dies eine weitere Geisteshaltung, durch die sich Fräulein Schmidt vom restlichen Kollegium unterschied.
Alfons war der älteste Sohn des größten, weil einzigen Verlegers am Ort, der unter anderem auch den "Weidenbacher Anzeiger" herausgab. Besonders unbesonnen Herausgegebenes war dem vorlauten Journalistenspross vor nicht allzu langer Zeit Anlass und unterwürfigste Verpflichtung gewesen, tatsächlich einmal, sogar mehrere Tage lang, seine große Schnauze zu halten.
Der Staufenberg-Verlag hatte es nämlich gewagt gehabt, ein Buch zu veröffentlichen, welches von der ersten bis zur letzten Seite nichts als die reine Wahrheit enthielt – was ihm, und somit auch Alfons, überhaupt nicht gut bekam. Der Titel dieses für viele dennoch verleumderischen Machwerks war Wolf zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Er wusste lediglich, dass es von jener dunklen Zeit handelte, in der die besonders honorigen zusammen mit den nahezu bildungsfreien Weidenbachern die politische Mehrheit gebildet und sich in beispielhafter und vollkommen uneigennütziger Weise die Ärsche aufgerissen hatten – für Führer, Volk und Vaterland.
Nachdem dieser literarische Vaterlandsverrat bereits mehrere Wochen im örtlichen Buch- und Schreibwarenladen ausgelegen hatte, mussten ihn dann doch noch ein paar Leute gekauft haben – wahrscheinlich Fremde – bestimmt aber Kommunisten!
Wenn eben diese Herrschaften das Gelesene tunlichst für sich behalten hätten, wäre der Schinken sicher noch lange lieferbar gewesen. So aber hatte es zwangsläufug kommen müssen, dass es sich so ziemlich alle besonders rechtschaffenen Weidenbacher Großbürger nicht wollten nehmen lassen, einmal persönlich in der Bergstraße 35 bei Staufenbergs vorzusprechen. Und es war nicht anzunehmen, dass die dort, ob ihrer unfreiwilligen Mitwirkung in diesem schändlichen Wälzer, lediglich ein angemessenes Honorar zu fordern gedachten. Nein – wenn die armen reichen Staufenbergs nach diesen strengen Tagen eines nur kannten, dann war das, wie ihnen aufs Heftigste gezeigt wurde, genau der Platz auf der Welt, wo der Bartl den Most zu holen pflegt!
Als ob dieser Ort noch irgendwem unbekannt gewesen wäre! Wo doch in jenen Tagen, und auch in früheren schon, ein großmäuliger, kugelrunder und nahezu halsloser bayrischer Einser-Abiturient die ganze Republik ständig darauf hinzuweisen beliebte.
Außer Alfons’ zeitweiligem Verstummen war die Herausnahme dieses verabscheuungswürdigen Geschmieres aus dem Programm des Verlags nicht die einzige Folge geblieben. Der sich eigendynamisch verbreitende Skandal hatte außerdem dazu geführt, dass sich Tausende von Weidenbachern nun ganze fünf Exemplare mit deren fünf kommunistischen Besitzern teilen mussten.
Wolfs Vater erzählte damals – erfundenerweise natürlich und gleich mehrmals, wenn er mächtig angeheitert vom Stammtisch nachhause kam – der Nachthimmel habe stundenlang taghell geleuchtet, wie in der sparsamst entnazifizierten Kleinstadt der schöne Brauch des nächtlich-feierlichen Bücherverbrennens wieder eingeführt worden sei.
Erwartungsgemäß hatte es dann aber nicht allzu lange gedauert, bis der Anzeigenteil im "Weidenbacher Anzeiger" wieder von allen ortsansäßigen Geschäftsleuten im vormaligen Ausmaß genutzt wurde.
Ebenso verhielt es sich mit dem Schweigen des Alfons. Jener hatte nämlich, just an dem Montag, als er seine vorwiegend einseitige Kommunikationsfreudigkeit wiedererlangte, zumindest einmal so viel von seinem früheren Selbstbewusstsein zurück, dass es ausreichend war, um – strammstehenderweise – am morgendlichen Kommando zur herzlichen Willkommensheißung von allen Außenseitern, Armen und Schwachen im Allgemeinen und im Besonderen von Wolf teilzunehmen.
Der war jedoch kurz zuvor, mit tatkräftiger Unterstützung der zauberhaften Lene, in den Besitz einer äußerst wirkungsvollen Waffe gelangt, mit der er nun allen Anfeindungen verbaler Natur, von wem auch immer und auf alle Zeiten hinaus, Paroli bieten konnte. Unter ihren zerebralen Schaltstationen hindurch hatten sie sich nämlich, in einer nächtlichen, traumgesteuerten Operation, eine ganz besonders belastbare (Um-)Leitung für akustisch Unerquickliches von Ohr zu Ohr verlegen lassen. Der Einbau eines solchen Feenhaares sollte für die hypersensiblen Geschwister dann auch zum gewisslich wichtigsten medizinischen Eingriff ihres Lebens werden.
Und daher erwartete in der ganzen Klasse bereits kein Einziger mehr, dass der erfahrene Italienurlauber Alfons eine Antwort auf seine Frage erhalte. Dennoch nahm sich Wolf vor, trotz der neu erlangten Fähigkeit, in Zukunft auf allzu intime Enthüllungen in seinen Aufsätzen verzichten zu wollen – oder aber auf die Wahrheit, wenigstens teilweise, zu pfeifen. Im Hinblick auf die bevorstehenden Ferien – die sich dieses Jahr, so viel war schon klar, in der Hauptsache an den postkartentauglichen Ufern des Weidenbaches, im heimischen Garten und gelegentlich noch im benachbarten Berg- und Talstadion mit seinen schier unüberwindlichen Grasbüscheln abspielen würden – müsse er allerdings ganz schön tief in die Karl May’sche Trickkiste greifen, um Alfons’ hochtrabenden Geschmack zu treffen.
Noch aber waren zwei mal fünfundvierzig Minuten, gespickt mit wissensvermehrenden Maßnahmen, zu absolvieren. Im Gegensatz zu Fräulein Schmidt verkniff es sich Herr Brecht (Geschichte und Erdkunde) nicht, noch einmal auf das allererste Rauschgiftopfer des Landkreises zu sprechen zu kommen. In einer doch wesentlich seriöseren Version dessen, was die "7 c" von Rektor Mahnwitz’ verbalem Amoklauf mitbekommen hatte, wurde der seinem pädagogischen Auftrage gerecht und appellierte in angenehmer Zimmerlautstärke an eines jeden Vernunft. Des Weiteren verriet er, dass es schon früher Menschen gegeben habe, die einem ausschweifenden Lebensstile frönten und mit allerlei krank machendem Teufelszeug experimentierten.
„Da gab es, gerade unter unseren Herren Schriftstellern, einige, die aus eben diesem Grunde mit verfaulten Hirnen im Irrenhaus landeten!“
Gerne hätte Wolf ein paar Namen gehört, aber diese würde er wohl anderweitig in Erfahrung bringen müssen.
„In den Lazaretten aller Kriegsschauplätze arbeiteten mitunter Ärzte“, fuhr der Lehrer fort, „die sich das schmerzstillende Morphium gerne auch mal selbst injizierten – und abhängig wurden. Viele konnten nie mehr davon lassen!“
Sogar die allseits beliebte amerikanische Fertigbrause, ohne die ja bekanntlich auf Partys rein gar nichts mehr gehe, habe vormals – ganz unnötigerweise – die Droge Kokain enthalten, um die Konsumenten süchtig zu machen. Dieser feige Anschlag auf die Volksgesundheit, aus einer ganz anderen Richtung halt, müsse wohl lange verziehen sein, dachte Wolf – zumal ja das jährlich stattfindende Schulfest gemeinhin als "Cola"-Ball bezeichnet wurde.
Brecht, der mit seinem Namen nicht immer ganz glücklich zu sein schien, ließ es gerne offen, mit welchem Fach er seine beiden Stunden zu beginnen gedachte. Nach dem Klingeln war Wolf jedoch sicher, eine Geschichtsstunde hinter sich gebracht zu haben. Schon alleine deshalb, weil er sich von Erdkunde noch ein paar Inspirationen erhoffte, wo er die diversen Abenteuer der nächsten sechs Wochen stattfinden lassen könnte.
Wenngleich die Eltern mit ihrem kleinen Betrieb gleichermaßen ein- wie angespannt waren, so brauche dies noch lange nicht heißen, dass er nicht jeden Morgen nach dem Frühstück seine Lene bei der Hand nehmen könne, um jedweden Ort auf dem Planeten anzusteuern. Mit den Rädern gar und Schwesterchens paranormalen Kräften würden sie auch von den entferntesten Zielen stets pünktlich zu Mittag- und Abendessen zurück sein.
„Gehst du nicht auf den Hof?“, riss ihn Eva jäh aus seinen Reiseträumen.
Bei ihr funktionierte besagter Durchzug-Schalter nämlich nicht automatisch – da sie auf jeden Fall zu den eher liebenswerten Menschen gehörte. Trotzdem missfiel es Wolf, wenn sie, so wie jetzt auch, nach dem Klingeln einfach auf ihn wartete, um dann mindestens bis zum Ausgang nicht von seiner Seite zu weichen.
Sie war es auch, durch die er erstmalig im umgekehrten Sinne der Diskrepanz zwischen "wollen" und "haben dürfen" gewahr zu werden hatte. "Wollen" aber "nicht haben dürfen" mochte bei ihm nämlich die weitaus häufiger vorkommende Variante sein – bis dato jedenfalls!
Schon beim "Hasenauer", der Bäckerei gegenüber der Schule, sah er, in der Schlange vor dem Tresen wartend, durchs Schaufenster ein Prachtexemplar der Kategorie "nicht zu haben" auf dem Bürgersteig stehen – Biggi Unruh aus der Parallelklasse. Er linste zwischen dem Korb mit den Zuckerschnecken und dem auf einem Zirkuspodest sitzenden, uralten Marzipanschwein hindurch – und dabei fühlte er sich wie "Tom Sawyer", als die süße "Becky Thatcher" das erste Mal an "Tante Pollys" Häuschen vorbeistolzierte. Hätte sie, die Biggi, auch noch ein rosa Schirmchen getragen, wäre es ganz sicherlich sein Wunsch gewesen, gleich am Nachmittag mit "Huck Finn" auf ein Bad im Mississippi loszuziehen und bei einem gepflegten Maiskolben-Pfeifchen von der Schönen zu träumen.
„Was darf’s denn sein, junger Mann?“
„Ähm, ..... eine Butterbrezel, bitte!“
Warum, um Gottes willen, dachte der Absente, könne die Welt nicht einmal ein paar Minuten stillstehen, wenn er doch gerade .....? Wolf nahm seine Brezel, zahlte und eilte zurück, ohne einen weiteren Blick auf die kleine Unruh zu werfen, die ihn eben noch derartig in ihren Bann gezogen hatte, dass es ihm selbst unheimlich wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war er noch felsenfest davon überzeugt, schon baldigst an ein Mädchen zu geraten, das, wie er von ihr, gleichermaßen von ihm angetan sein würde.
Auf der Mauer des Pausenhofes saßen Eva und alle ihre Freundinnen – also Dagmar und Sabine. Ihre Beine baumelten an den moosgrünen Sandsteinen herunter. Mit einem Schwenk, von Evas traurigem Gesicht hinunter über den Zebrastreifen, direkt in "Hasenauers" Schaufenster, wurde gewiss, dass sie wohl alles beobachtet hatte. Ob es nicht vielleicht weniger verletzend sei, schoss es ihm durch den Kopf, Eva ebenso links liegen zu lassen, wie es die hübsche Biggi mit ihm so selbstverständlich tat. In dem Moment, als Wolf, unter den nackten Mädchenfüßen durchmarschierend, den rechten Arm hochnahm, um Eva kurz an den Fußsohlen zu kitzeln, war dieser letzte Gedanke aber auch schon wieder verworfen.
Was, wenn alle diejenigen, scherzte er im sicheren Gefühl der auf seinem Kreuz lastenden Blicke, die gerade nicht beiderseits ineinander verknallt sind, sich mit gegenseitiger Nichtbeachtung belegten, wäre das für eine Ruhe auf der Welt? – Die eine Hälfte der Menschheit würde wohl rumknutschenderweise in allen möglichen Ecken stehen oder hocken, während der Rest, jeder jeden ignorierend, einsam durch die Gegend zu rennen hätte. Das dürfte auch Eva kaum gefallen, resümierte er und winkte der nunmehr wieder fröhlicher dreinschauenden Mitschülerin noch einmal, bevor er hinter der alten Kastanie neben dem Hauptportal im Getümmel verschwand.
Er wollte sich auch noch kurz auf dem Innenhof sehen lassen. Nicht alleine, um der von Alfons angeführten Highsociety eine letzte Gelegenheit zu bieten, sich gebührend von ihm zu verabschieden, sondern auch, um die einwandfreie Funktion seiner Superwaffe einem weiteren Härtetest zu unterziehen.
So trabte er alsbald mitten zwischen den oberen Zehntausend hindurch, und tatsächlich, er hörte nichts als den langsam aufkommenden Wind, der in den Blättern der jungen Birken spielte, die den Hof nach dem Westen hin begrenzten. Ebenso wenig vernahm er den einen Glockenschlag vom Turm der evangelischen Kirche vis-a-vis.
Zehn Uhr fünfzehn – in einem Deutschland, in dem es noch kein "Knoppers" gab und gleichfalls keinen "Walkman", mit dem man sich hätte schützen können vor verbalen Übergriffen. Als umso wertvoller erwies sich nun seine bahnbrechende naturmedizinische Errungenschaft. Der partiell Taube war total fasziniert davon, wie die Münder der wortgewaltigsten Rhetoriker aller Gewichtsklassen ohne Unterlass in Bewegung sein konnten und, obwohl deren Augen zweifelsfrei die Richtung ihrer Botschaften verrieten, beim Adressaten jedoch kein Ton ankam.
Dieser verstand dafür umso besser das infantile Geschnatter des Fünftklässlerinnenquintetts nebenan, genauso störungsfrei, wie die von Karin Hahn aus der Sechsten nicht ganz fehlerlos vorgetragene Etüde "Für Elise", die aus dem Musiksaal herüberdrang. Ihr lauschte er gespannt, immer in der Hoffnung, der nächste Fehler möge ausbleiben – und obgleich sie ihm diesen Gefallen nicht zu tun imstande war, beschloss Wolf, ihre weitere Karriere in Auge und Ohr zu behalten.
Mitten im Takt verstummte der edle "Steinway"-Flügel, und um den vertieften Kunstgenießer herum setzte sich alles in Bewegung – was nur bedeuten konnte, dass das unangenehme Geräusch der Schulglocke, zusammen mit allen anderen unreinen Schwingungen, mit Karacho durchs Feenhaar ins Weltall hinausgerauscht sein musste. Er würde äußerst vorsichtig sein müssen in Zukunft, um nicht irgendwann einmal, total weggetreten, auf dem Schulhof zurückzubleiben, ermahnte er sich und flitzte los.
„Eine Stunde noch!“, jubilierte er leise und ließ sich auf seinen Stuhl plumpsen.
Evas Miene jedoch sah nicht ganz so aus, als ob sie seine Freude darüber uneingeschränkt teilte. „Sieht man sich mal – in den Ferien?“, wollte sie kaum hörbar wissen, und Wolf bemerkte erstaunt, dass sie ihre Brille abgenommen hatte.
„Kann gut sein!“, flüsterte er noch leiser und schmunzelte verhalten.
Verbindlicher mochte er allerdings nicht werden – und war froh, zu sehen, wie sich die Tür öffnete und Klassenlehrer Brecht eintrat. In seiner Rechten trug der wie immer seine alte braune Schultasche, während er auf seiner flachen linken Hand den Stapel aus siebenundzwanzig Zeugnisheften balancierte.
„Die gibt’s aber erst am Ende der Stunde!“, stellte er gleich klar und knallte die Hefte aufs Pult. „Bis dahin wollen wir uns noch ein wenig der Geographie widmen, wo wir doch bereits eine Geschichtsstunde verbummelt haben. – Aus gegebenem Anlass natürlich, aber das Leben muss ja weitergehen! Ich will einfach mal davon ausgehen, dass ihr Jungstifte noch keinen Kontakt mit so etwas hattet – und auch nie haben werdet!“
Sein besorgter Blick verriet allerdings, wie Wolf glasklar zu erkennen meinte, dass wohl eher der Wunsch der Vater dieses Gedankens war.
Brecht zog einen Stoß fast gänzlich weißer Blätter aus der Tasche, und ein jeder wusste sogleich, was das zu bedeuten hatte. Darum ging auch umgehend ein Raunen durch die Reihen, was den Pädagogen wieder etwas fröhlicher werden ließ. Im Eilschritt verteilte er die Aufgaben, die darin bestanden, die in den Konturen der amerikanischen Ostküste bereits eingezeichneten Städte, Flüsse und Seen mit den Namen zu versehen, die er alsbald an die Tafel zu schreiben begann.
Wolf war ganz gut in dieser Disziplin, und er liebte es ohnehin mehr, für sich arbeiten zu können, ohne die ansonsten stets präsente Befürchtung, in einer Phase geistiger Abwesenheit ertappt zu werden. So machte er sich denn eifrig daran, alle geforderten Eintragungen, von Nord nach Süd, vorzunehmen, um dann, vom Golf von Mexiko aus, gemächlich seinen Lieblingsfluss hochzuwandern.
In solchen Momenten war seine Fantasie von grenzenloser Extravaganz. Ihm träumte, wobei er seine Augen tunlichst offen hielt, dass das schmutzig-braune Wasser dieses gigantischen Stromes nun gut vernehmlich vor seinen Füßen plätscherte, und weit draußen vermochte er ein Floß mit einem Zelt darauf zu erkennen. Zwei Gestalten winkten ihm zu, und er hegte nicht den geringsten Zweifel daran, dass es sich bei den beiden nur um "Huck" und "Tom" handeln könne, seine besten amerikanischen Freunde – deren Lebensstil solch großen Eindruck auf ihn machte und gleichfalls Anregung war, ihre Abenteuer wieder und wieder, so detailgetreu wie möglich, am beziehungsweise auf dem Weidenbach nachzustellen. Allerdings – ein Floß dieser Größe müsse man am heimischen Gewässer wohl eher als Brücke bezeichnen.
„Zeit! Sofort abgeben!“, platzte Brecht derart lautstark in Wolfs Tagtraum, dass es gewisslich noch in St. Louis zu hören war.
„Ritter! Einsammeln! Auf, auf! Zack, zack!“
Der Befehligte schlenderte jedoch eher gemach von Bank zu Bank. Denn dort, wo er sich vor Minutenfrist noch aufgehalten hatte, gingen die Uhren bekanntermaßen um einiges langsamer.
„Mal sehn – für den Fall, dass ich in den Ferien Lust haben sollte, korrigiere ich die Arbeiten. Vielleicht schmeiß ich sie auch weg – wenn ihr Glück habt!“
Des Paukers breites Grinsen verdeutlichte allen, dass auch er sich wahnsinnig darauf freute, der Penne sechs Wochen lang fernbleiben zu dürfen.
Wolf legte die eingesammelten Werke neben die Zeugnisse.
„Die kannst du gleich austeilen, wenn du schon stehst!“, lautete sein neuer Befehl.
Dabei trommelte Brecht mit den Fingerspitzen auf die gleichermaßen geliebten wie gehassten Hefte, deren fast ausnahmslos bereits bekannter Inhalt von so außerordentlicher Wichtigkeit für jeden Einzelnen war.
Der derart schamlos überbeanspruchte Schüler schnappte sie sich und marschierte abermals los, während der über die Maßen verschmitzt dreinschauende Lehrer in seine Tasche fasste und drei in Geschenkpapier verpackte Bücher zum Vorschein brachte – die Preise für die Besten!
Wolf blieb absolut unbeeindruckt von der Tatsache, dass keines für ihn bestimmt war. Ebenso wenig würde er diesmal, im Gegensatz zum letzten Jahr, eine Belobigung erhalten. Wie hatte er sich damals noch, gemeinsam mit Eva, über eine solche gefreut – und einhellig hatten sie beschlossen, im nächsten Jahr einen Preis anzupeilen.
Doch nun lag lediglich ein Buch auf ihrem Tisch, als er wieder dort ankam – und die Preisgekrönte vermochte ihm nicht in die Augen zu sehen, wie er ihr gratulierte und das Zeugnis in die feuchte Hand drückte.
„Mädchen, jetzt freu dich halt ein bisschen – ich bleib ja nicht sitzen!“, ermunterte er seine gescheite Nebensitzerin und versah sie obendrein noch mit einem leichten Klaps auf die Schulter.
Es lag eben in Wolfs Wesen, sich auch mit anderen freuen zu können – zumal er ja wenige Zehntel nur schlechter geworden war. Und schon lächelte sie wieder. Einen zweiten Anlauf, was ein Treffen während der Ferien anging, traute sie sich allerdings nicht zu machen, sondern setzte sich, nachdem sowieso jegliche Ordnung in der Klasse abhanden gekommen war, zu ihren beiden Freundinnen.
Von draußen hörte man das Gegröle derer, die von ihren Lehrern überhaupt nicht mehr zu halten waren. Brecht hatte seit einigen Minuten keinen Laut mehr von sich gegeben. Doch jetzt stand er auf.
„Alles klar! Keiner sitzen geblieben! Dann sehen wir uns allesamt am Montag in sechs Wochen wieder! Ich wünsche euch schöne Ferien – und schaut auch mal in ein Buch! Auf Wiedersehen!“
Kapitel 3
Wolf stand am Gartenzaun und beobachtete die kleine Entenfamilie, wie sie gerade am Ufer entlangglitt – und wieder, konstatierte er bestürzt, fehlte ein Küken. Die Natur schien ihm erbarmungsloser denn je zu sein, zumal jetzt schon fünf Entenkinder abhanden gekommen waren. Krampfhaft versuchte er sich vorzustellen, wer denn wohl die Mörder der wehrlosen Geschöpfe sein könnten. Vielleicht gar nur ein einziger großer Hecht, der für ein bisschen Abwechslung auf seinem Speiseplan sorgen wollte? Die unzähligen blutrünstigen Füchse etwa? Oder war es womöglich Herxheimers Georg, der gerade eine Lehre als Metzger absolvierte und von dem man wusste, dass er vor Jahren einmal einem guten Dutzend Hühnerküken genüsslich die Hälse umgedreht hatte, bevor ihn seine Oma erwischen und nach allen Regeln der Kunst verdreschen konnte?
„Komm mal rauf und zeig mir dein Zeugnis!“
Als habe er sich mächtig erschrocken, fuhr Wolf herum und sah seine Mutter rauchend am offenen Fenster stehen.
„Schmeiß mir auch eine runter!“, witzelte er frech.
„Du darfst für jeden Einser ein Mal ziehen!“, versprach sie – wohl wissend, dass es für keine zwei Züge reichen könne – wenn überhaupt für einen.
Er riss seinen Ranzen vom Gepäckträger und wetzte los, seine gesundheitsschädliche und keineswegs jugendfreie Belohnung abzuholen – für die allerletzte Traumnote seiner Schulzeit, wie er bereits selbst befürchtete.
Der Jungraucher war schon wieder zurück in der Garage angelangt, und es kam noch immer weißer Zigarettenqualm aus seinem Mund – so einen deftigen Zug hatte er genommen von Mamas "Ernte 23". Er stieg aufs Rad und preschte los in Richtung Friedberg.
Lene war einmal mehr überfällig, und er wollte sie aufspüren, was nie ganz leicht fiel ob der zahllosen Umwege, die sie genommen haben konnte. Letztendlich hing ohnehin alles davon ab, ob sie überhaupt gefunden werden wollte.
Wolf hatte Glück – sie wollte! Rad und Ranzen fand er schon nach wenigen hundert Metern, angelehnt am Geländer der kleinen Brücke bei der Eisenbahnunterführung. Ohne noch lange zu überlegen, ging er durch den schmalen Tunnel, am Quellbach entlang, bis zu der dicken Sandsteinplatte, die hinüberführte ins Sumpfwäldchen, wo er seine Schwester vermutete. Nein – er wähnte sie nicht nur dort – er wusste ganz sicher, dass sie da war!
Die Kunst, sich auf telepathischem Wege orten zu lassen, gehörte nun mal auch zu ihrem Zauber. Wolf ging vorsichtig zwischen den Tümpeln, ehemaligen Fischzuchtbecken, die sich der Sumpf teilweise wieder zurückerobert hatte, hindurch, und schon hörte er dieses liebenswürdige, sanfte Stimmchen, dem nicht nur er so gerne lauschte. Auch jetzt würden wieder etliche mehr oder minder glitschige Zuhörer an ihren Lippen hängen, weshalb er sich, er wollte ja nicht stören, in einiger Entfernung auf einen Baumstumpf setzte. Sie würde, zu gegebener Zeit, ihre Worte auch an ihn richten – aber noch galt ihre Aufmerksamkeit den Stichlingen, Olmen und Lurchen, denen sie eben von dem verschwundenen Entlein berichtete.
„Das weiß sie also auch schon“, dachte Wolf, indes Lene wen auch immer fragte, ob er oder sie denn wisse, welch schlimmer Strolch das getan habe.
„Der Schlawiner war das also!“, erzürnte sie sich sodann und warf dem Bruder, dessen Ankunft ihr natürlich nicht entgangen war, einen fragenden Blick zu. „Hast du’s gehört, Wolfi? Der große alte Fuchs war’s, der das arme Entchen geholt hat!“
„Ich hab’s mir gedacht“, log er und schämte sich gleich ein bisschen dafür – wo doch Schweinekiller Georg eigentlich sein Favorit war. „Komm jetzt, Lene, wir müssen nach Hause!“, erklärte er mit einem Hauch von Strenge, worauf sie sich von allem Getier freundlich verabschiedete.
Er ließ sie vorangehen. So konnte er unterdessen anfangen, ihr Blätter, Halme und dergleichen von Kleid und Haaren zu zupfen, solange sie elfengleich vor ihm herschwebte.
Bei den Rädern angekommen, wurde noch ihre Vorderseite in Ordnung gebracht. Einigen Spuren der vormittäglichen Urwald-Expedition war jedoch nicht beizukommen und mussten auf ihrem Kleidchen verbleiben.
Sie schwangen sich auf ihre Rösser und trabten dem heimischen Stall entgegen. Auf den letzten Metern kam ihnen eine Wolke Duft von gerösteten Zwiebeln in die Nasen, und sie rieten, was es denn heute wohl gebe. Wolf tippte letzlich auf Grieß-Suppe und Lene auf "Gaisburger Marsch", ihre Lieblingsspeise.
Mit so einem liederlichen Zeugnis, meinte der ach so gescheite große Bruder, dürfe sie nun wahrlich nicht mit ihrem Lieblingsessen rechnen und war siegesgewiss.
Lene blieb in der Waschküche, um vielleicht noch den ein oder anderen Dreckfleck loszuwerden. Wolf stürmte nach oben in die Küche, wo er – wie hätte es auch anders sein können – umgehend eines Besseren belehrt wurde.
Papa Ritter saß schon im Esszimmer und las im "Weidenbacher Anzeiger". Er roch, vielmehr er stank nach Werkstatt, dem ölig-metallischen Duft des Wirtschaftswunders – der entsteht, wenn harte Männer noch härteren Stahl bearbeiten, unter Zugabe von Kühlmittel drehen, fräsen, bohren und so weiter. Er trug Überschuhe aus Filz, um den Fußboden nicht zu versauen.
Anfangs hatte sich Wolf ja noch interessiert für den Betrieb des Vaters, und dafür, was der und seine Leute da fabrizierten. Nicht nur das, nein, er hatte dort schon im einstelligen Alter geholfen und, zum Leidwesen des Herrn Papa, aber sehr zur Freude der Mitarbeiter, auch gelegentlich den Juniorchef gegeben. Im Laufe der Zeit jedoch mochte er die Atmosphäre dort, nicht nur wegen des furchtbaren Gestanks, immer weniger. Er konnte und wollte sich nicht stundenlang konzentrieren. Wenn man bei dieser kniffeligen Arbeit nur mal kurz die Seele baumeln ließ, war ruck, zuck etwas kaputt – futsch! Und er machte doch nun mal nichts lieber.
Bei einem von Wolfs letzten Arbeitseinsätzen war Onkel Horst urplötzlich aus der Werkstatt geeilt, und alle dachten, er sei nur aufs Klo. Als er dann nach einer halben Stunde immer noch nicht zurück war, durfte der mit den jüngsten Beinen nach ihm suchen. Und der fand ihn auch schnell – neben der alten Holzbrücke am Weidenbach sitzend und mit feuchtem Blick auf das Wasser starrend. Vor seinen Füßen eines der silbrig glänzenden Werkstücke, die er auf der Drehbank zu bearbeiten hatte. Dieser erwachsene Mensch schluchzte doch tatsächlich, er habe – „verdammt nochmal!“ – das teure Teil geschrottet, gleich ein paar Hundertstel zu viel abgetragen, und gedenke sich nun im Bach zu ersäufen.
Eine viel zu harte Strafe, wie Wolf fand, für einen klitzekleinen Augenblick der Unaufmerksamkeit, ein winziges bisschen Seelengebaumel, aus dem Leben scheiden zu wollen. Wie oft hätte er sich da schon .......? Aber für einen gepflegten Abgang im Wasser konnte er sowieso viel zu gut schwimmen.
„So, meine Herrschaften, Essen ist fertig! Zeitung weg!“
Die Mama stellte den Topf mit dem Gaisburger Marsch auf den Tisch.
„Lene, wo steckst du denn? Auf, komm jetzt!“, rief sie zum Fenster hinaus.
„Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm!“, hallte es eben noch durchs Treppenhaus herauf, dann knallte die Wohnungstüre zu und schon schlüpfte sie zu ihrem angestammten Platz auf der Eckbank.
Sie hatte es zwar geschafft, die schlimmsten Flecken aus ihrem Kleid zu waschen, dafür war dieses jetzt klitschnass.
„Na, war mal wieder eine Zwischenwäsche nötig?“, frotzelte der Vater und befüllte ihren Teller mit der dampfenden Kartoffel-plus-Spätzle-Suppe.
Sicher, sogar todsicher war ihm entfallen, was man denn heute für einen Tag hatte, und seine drei Mitesser dachten keinesfalls daran, das zu ändern. Deshalb unterblieb jegliche Konversation, bis der Herr des Hauses die Nahrungsaufnahme einstellte und sich auf seine geliebte Chaiselongue zurückzog.
Die Geschwister halfen noch ihrer Mutter mit dem Geschirr, bevor sie in Richtung Keller entschwanden, um zu beratschlagen, was man denn am Nachmittag anstellen könne. Lene vollführte ein Tänzchen, während Wolf sein geheimstes Versteck durchstöberte. Taschenmesser, Angelschnur und -haken, Munition fürs Spatzengewehr, ein kleiner Kochtopf mit Deckel, zwei Tütensuppen und .... „Hey, da ist sie ja!“ ... die Tabakpfeife, die er letzten Herbst aus einem Maiskolben und einem Schilfrohr gebastelt hatte.
„Bist ja noch ganz gut in Schuss!“, lobte er das gute Stück nach eingehender Prüfung. „Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Tabak“, flüsterte er und kramte weiter, „Streichhölzer müssten auch da sein – sind da. Na, wer sagt’s denn!“
Hastig verbarrikadierte er seinen Safe, bevor er dann Lene in ihrer Rotation stoppte, um sie zu einer ungeheuren Schandtat anzustiften.
„Lene, Schatz, kannst du mir einen Gefallen tun?“, setzte er dezent an.
„Vielleicht! Du weißt, dass ich nicht die Hellste bin!“
„Quatsch mit Soße!“, kam es augenblicklich und äußerst überzeugend zurück. „Du zählst jetzt gaaaaanz langsam bis zehn, dann rufst du die Mama ans Fenster und zeigst ihr, wie toll du tanzen kannst!“
„Damit du eine Zigarette stibitzen kannst!“, kicherte sie sofort.
Man konnte ihr eben nichts vormachen.
„Eeeeiiins, zweeeiii, .....“
Wolf flitzte los, die Treppe hoch, öffnete die Wohnungstüre und wartete im Gang auf Lenes Rufen. Dann stahl er sich lautlos in die Küche, zog eine Kippe aus der Schachtel und machte sich wieder aus dem Staub.
„Wunderschön, wie du tanzen kanst!“, hörte er noch, als er sacht die Türe schloss.
Auf Zehenspitzen schlich er zurück in den Keller, durch die Waschküche nach draußen und schleppte die bereits wieder unbeachtete Tänzerin unter den Balkon.
„Wunderschön, wie du tanzen kannst!“, hauchte er ihr ins Ohr und belohnte sie zudem mit einem Kuss auf die Nasenspitze.
„Mama, ich geh mit Lene zum Bach!“, rief der perfide Zigarettendieb alsbald laut und überprüfte, ganz unnötigerweise, ob er auch alles einstecken habe. „Feuer, Pfeife, "Stanwell" – alles, was der Mann braucht!“, zitierte er dabei leise einen bekannten Werbeslogan.
„Seid aber zum Kaffee wieder da – ich hab auch einen feinen Kuchen!“
Die beiden lümmelten auf dem Trottoir den Bachweg entlang, um dann zwischen den Mehrfamilienhäusern von HALTER u. Co. durchzugehen und den Trampelpfad über die Auwiese zum Bach zu nehmen. Lene hatte sich zu Hause noch mit einem Haselnussstöckchen bewaffnet, welches ursprünglich einmal für den Bau einer Flöte vorgesehen war.
Bis zum heutigen Tag war sie ja bei ihren übersinnlichen Tätigkeiten ohne jedwede Hilfsmittel ausgekommen. Dieser bolzengerade Stab jedoch, von Menschenhand der Natur entwendet – und gewiss nicht von ihrer – durfte nun den Grundstock bilden für eine umfangreiche Sammlung von Utensilien, denen sie bald ausnahmslos andere Kräfte zusprechen sollte, als der Durchschnittsschwabe das gemeinhin zu tun pflegt.
Sie benutzte ihn nicht wie andere Kinder, um damit den blühenden Grashalmen die Köpfe abzuschlagen, sondern bemühte sich im Vorbeigehen, bereits abgeknickte Pflanzen wieder aufzurichten. Hierbei murmelte sie Zaubersprüche in sämtlichen Fremdsprachen, derer sie mächtig war. Wolf verstand davon ebenso wenig wie vom Geschrei von Frau Ortega, das der Wind von den HALTER-Häusern herübertrug. Der hysterische Tonfall ließ ihn jedoch annehmen, dass Antonio wieder einmal einen ausgewachsenen Anschiss über sich ergehen lassen musste. Zu schlechtes Zeugnis vielleicht? Jedenfalls könne es dann nicht mehr lange dauern, bis auch der die Ruhe des Tales suchen und zu ihnen stoßen würde.
Was die Häufigkeit der Streitigkeiten anging, unterschieden sich die spanischen Eltern nicht von den deutschen. Wohl aber darin, wie schnell die ihre Sprösslinge wieder herzten, hätschelten, sogar knutschten – obwohl es zumeist Buben waren. Wolf konnte sich nicht einmal erinnern, wann er das letzte Mal von seinen Eltern in den Arm genommen worden war – und schon gar nicht, wann er den letzten Kuss bekommen hatte. Die Schwester beliebte sich ihre Streicheleinheiten ganz frech selbst abzuholen, indem sie sich allen Verwandten ungefragt auf den Schoß setzte und quasi darum bettelte. Ansonsten wäre auch sie diesbezüglich äußerst unterversorgt geblieben.
„Da kommt der Toni mit dem Ball!“
Lene zeigte mit ihrem Zauberstab über Wolfs Schulter in Richtung der Häuser, während der damit anfing, die Hälfte der gemopsten Zigarette aufzubröseln und den hellbraunen Feinschnitt aus seiner hohlen Hand in die Pfeife zu leeren.
„Seid ihr schon wieder am Qualmen!“
Kopfschüttelnd blickte der junge Spanier auf das vorsintflutliche Rauchgerät.
„Lasst uns lieber Fußball spielen!“, schlug er vor.
„Zuerst paffen wir eine Runde!“, entgegnete Wolf barsch, nahm ein Streichholz aus der Schachtel, zündete es an und hielt die Flamme über den Pfeifenkopf.
Noch ohne zu inhalieren, saugte er in kurzen Abständen an dem Schilfrohr.
„Das alte Ding schmeckt noch richtig gut!“, pries er das vertrocknete Naturprodukt, sog sich einen mächtigen Zug in die Lunge und hielt es dann Antonio unter die Nase.
„Nein, danke! Wenn meine Mutter das riecht, krieg ich gleich die nächsten Prügel.“
„Aber ich will ....!“, meldete sich stattdessen die Kleine und streckte begierig die Hand aus.
„Und wenn du nach Rauch stinkst, dann bekomm ich die Schläge, hörst du!“, schlug ihr der Bruder das ungeheuerliche Anliegen zunächst schroff ab.
Jedoch gab sie keine Ruhe, bis er ihr tatsächlich die Pfeife überließ. Genüsslich nuckelte die hartnäckige Göre am Rohrende.
„Wie eine Große!“, kicherte Antonio.
Als aber immer mehr Rauch kam, kriegte sie wohl eine Schwade davon in die Lunge und bekam einen gewaltigen Hustenanfall, den sie erst nach ein paar ordentlichen Schlucken Bachwasser wieder loswurde.
Unterdessen hatte Wolf die Pfeife fertig geraucht, ausgeklopft und zusammen mit den "Welthölzern" sowie der halben Kippe in einem hohlen Baumstumpf deponiert.
„So, jetzt können wir kicken!“, signalisierte er seine Bereitschaft.
Dazu mussten sie allerdings auf die andere Seite des Baches, wo das Gras schon gemäht war, und Antonio marschierte los, in der Absicht, über den etwa zweihundert Meter entfernten Holzsteg zu gehen.
„Toni, halt! Wir können doch hier an der schmalen Stelle rüberspringen. Lene, du läufst allein über den Steg!“
„Nein, ich will springen!“, quengelte sie abermals.
Wolf erhob drohend den Zeigefinger.
„Du läufst jetzt augenblicklich los, du elende Nervensäge!“
Die so schmählich Beschimpfte schmollte zwar, aber setzte sich in Bewegung. Die beiden Jungs gingen ein paar Schritte zurück, um genügend Anlauf zu haben.
„Zusammen – eins, zwei, drei!“
Sie rannten los, und schwuppdiwupp waren sie auf der anderen Seite, was keine allzu große Leistung darstellte für zwei so großgewachsene Kerle. Wie ein Torwart schlug Antonio den Ball aus der Hand ab, und sein Mitspieler sprintete nicht eben wie ein richtiger Stürmer der fliegenden Kugel hinterher, sondern schlenderte eher im Stile eines raucherbeinigen Frührentners zu der Kuhle, die das Leder letztlich zum Stillstand gebracht hatte.
Endlich dort angekommen, platzierte er es, nach reiflicher Überlegung selbstverständlich, auf einer geeigneten Erhöhung. Als er dann den schussgewaltigen Sportkameraden anpeilte, sah er, wie der urplötzlich die Arme hochriss und zum Bach zurückstürmte.
„Wolf, Wolf, Wolf!“, schrie er nur.
Lene! Wo war Lene? Sein suchender Blick schweifte in Windeseile hoch bis zum Steg und wieder zurück – aber die Schwester war nicht zu sehen. Wie eine angestochene Sau flitzte er los, und sein Herz schien sich zu überschlagen, als er am Bach ankam. Antonio stand bis zum Bauch im Wasser und mühte sich, den regungslosen kleinen Körper die Böschung hochzuschieben. Wolf packte sie an den Handgelenken, schleifte sie auf die Wiese, wo er das triefende Bündel umdrehte und klatschte ihr mehrmals mit den flachen Händen auf die nassen Wangen. So, wie es auch die Mama machte, um sie aus ihren gelegentlich auftretenden Ohnmachten zurückzuholen. Ohne Erfolg – Strohblondchen lag da wie tot!
Zwischenzeitlich war Antonio dem kalten Nass entstiegen.
„Wir müssen sie zur Seite drehen – hat bestimmte eine Menge Wasser geschluckt!“
Gesagt, getan – und beide rüttelten nun ohne Unterlass am Oberkörper der Kleinen. Dicke Tränen liefen über Wolfs rote Backen und tropften hinunter auf das Engelsgesicht der geliebten Schwester. Er war der Verzweiflung nahe. Mund-zu-Mund-Beatmung, fiel es ihm ein, könne noch helfen. Also schnell wieder auf den Rücken. Mit zwei zitternden Fingern drückte er ihre Lippen auseinander, holte tief Luft und blies sie ihr in den Rachen, wonach Antonio ein paarmal mit dem Handballen auf ihren Brustkorb drückte. Aber nichts passierte!
„Mein Gott!“, plärrte er bereits – und wie er eben zum zweiten Versuch ansetzte, kam mit einem Mal ein Schwall Wasser auf ihn zu, stoppte kurz vor seiner Nase und ergoss sich dann über Brust und Hals der Wiederbelebten – zur riesigen Freude ihrer Retter.
Als die beiden Lene aufsetzten, fing die zu husten an und spuckte noch mehr Wasser aus, welches dann auch, wie unschwer zu erkennen war, etliche handgeschabte Spätzle vom Gaisburger Marsch enthielt. Antonio schlug die Hände über den Kopf und schaute schon ziemlich erleichtert aus, bevor er dann gar richtig lachte. Wolf kniete vor der Entleerten und zog sie, Spätzle hin oder her, an seine Brust und drückte sie so fest er nur konnte.
„Ich hab wohl zu wenig Anlauf genommen“, schluchzte sie, „sonst hätt ich’s bestimmt auch geschafft!“
Die mutigste aller kleinen Schwester hatte nach dem Sprung der beiden Großen wieder kehrtgemacht, ihren Zauberstab hinübergeworfen, um dem dann auf gleichem Wege zu folgen. Sie landete zunächst auch mit beiden Beinen am anderen Ufer, verlor dort aber das Gleichgewicht und kippte rückwärts in den Bach. – Gott sei Dank nicht, ohne vorher noch einen glockenhellen Schrei auszustoßen!
„Was machen wir jetzt mit dir, meine kleine Kaulquappe?“
Mit allen zehn Fingern kämmte Wolf liebevoll Strohblondchens nasses Haar.
„Ihr kommt erst mal mit zu uns!“, empfahl Antonio fast im Befehlston – mit dem Hintergedanken, dass, wenn seine Mutter die verdreckte Lene sehe, ein erneuter Anpfiff eher zu vermeiden sei. Schließlich sah auch er aus wie ein frisch gesuhltes Schwein. Also trotteten sie bachaufwärts zum Steg, nachdem sie Lenes Stöckchen gesucht und gefunden hatten. Eine andere Form des Übertritts wäre heute wirklich nicht mehr in Frage gekommen.
„Madre mia! Que has hecho, Pequeña?”
Antonios Mutter war trotz ihrer viel zu vielen Pfunde herunter in den Garten gerannt, hatte das Havaristen-Trio schon vom Balkon aus kommen gesehen.
„Lene ist in den Bach gefallen – und euer Toni hat sie rausgezogen!“, erklärte Wolf theatralisch, und der Gelobpreiste nickte zufrieden.
„Kommt mit in die Waschküche und zieht die nassen Sachen aus!“, befahl die resolute Spanierin, wobei sie ihren Antonio am Ohr packte und über die halbe Strecke hinter sich herzog, bis der sich losreißen konnte und vorausrannte.
Lene bekam ein ewig langes Hemd von Señor Ortega, mit dem sie, zumindest bis zu den Knien, vollständig angezogen war. Dazu ein Handtuch, um sich die Haare trocken zu rubbeln. Wolf half ihr dabei und kämmte sie anschließend mit Antonios Lausrechen, den der stets in der Gesäßtasche mit sich herumschleppte – und der jetzt ebenfalls frisch gebadet war.
Inzwischen hatte la Mama Kleid, Höschen und Socken von Hand gewaschen, die Ledersandalen mit dem Schlauch abgespritzt und alles in Reih und Glied auf eine Wäscheleine gehängt.
„Bei dem warmen Wind ist in einer Stunde alles trocken, Chica!“, meinte sie noch und verschwand in den Korridor.
Lene quiekte ihr ein dünnes, aber grundehrliches „Muchas Graçias!“ hinterher.
„De nada, de nada!“, hallte es aus dem Treppenhaus zurück.
Als Antonio, der sich natürlich vor einem Mädchen nicht komplett hatte ausziehen wollen, in frischen Klamotten wieder herunterkam, setzten sie sich nach draußen in die Sonne. Lene kuschelte sich eng an den Bruder und begann das Erlebte beziehungsweise das Überlebte aus ihrer Sicht zu schildern:
„Unter Wasser hab ich so viele Leute gesehen – Mama und Papa, Onkel Hans und Tante Grete, Lehrer Mönk, euch beide natürlich, Oma Emilie und – stell dir vor – sogar die ganze Familie der Bachfeen stand vor einer riesigen, schneeweißen Sonne und alle winkten mir zu. Unglaublich, gell!“
Wolf legte behutsam einen Finger auf ihre wieder blutroten Lippen.
„Lene, mein Goldstück, wir wollen den Eltern aber nichts von alledem verraten! Das gibt nur Ärger! Versprichst du mir das?“
Strohblondchen nickte sogleich heftig und freute sich über dieses neuere Geheimnis, das sie nun fortan zusammen haben sollten. Der spanische Freund gelobte, gleichfalls dichtzuhalten – wollte allerdings für seine redselige Mutter keine Garantie übernehmen.
„Du bleibst hier bei Toni! Ich geh schnell meine Pfeife holen. Okay?“
Wolf schob Lene vorsichtig von sich, strich ihr nochmal durchs fast trockene Haar, stand auf und entschwand im Laufschritt. Auf den Schrecken brauchte er erst mal ein paar Züge.
Beim hohlen Baumstumpf angekommen, klaubte er zunächst nur die Streichhölzer und die halbe Kippe heraus. Zumal es die Hälfte mit dem Filter war, wollte er sie so, nicht in der Pfeife rauchen. Nachdem er sich in alle Richtungen umgeblickt hatte, zündete er sie an und nahm einen wohltuenden Zug, den er tief in die Lungen presste und einige Sekunden lang den Atem anhielt, um dann den Rauch, vergnüglich pustend, durch seine angespitzten Lippen in die Atmosphäre zu entlassen. Er genoss es, wie das mit Nikotin angereicherte Blut in seinen Kopf stieg und wiederholte den Vorgang. Dann griff er nach seinem Rauchutensil, verbarg es in der Hosentasche und machte sich auf den Rückweg. Bevor er von den Häusern aus wieder gesehen werden konnte, schnippte er den Stummel ins Gras. Mit der Schuhsohle gab er ihm den Rest.
Im Vorbeigehen kontrollierte er Lenes Sachen. Noch war alles feucht – besonders die Sandalen. Antonio hatte seine Gitarre geholt, und die beiden trällerten ein Liedchen, das zwar nicht Wolfs Ansprüchen genügte, jedoch auch seine Laune wieder etwas anhob.
„Zeig mir ein paar neue Griffe – bitte!“, unterbrach der Musikant seine Begleitung und hielt Wolf die Klampfe hin.
Die wenigen Akkorde, die er schon kannte, hatte er gleichfalls vom befreundeten Nachbarn, Spiel-, Sport- und ehemaligen Schulkameraden vermittelt bekommen. Genau wie die Bezeichnungen der einzelnen Töne, die er auf Heftpflasterstreifen geschrieben und über das gesamte Griffbrett zwischen die Bundstäbchen geklebt hatte. Das Pflaster für die leeren Saiten pappte auf dem Kopf vor dem Steg.
„Also gut! Ich zeig dir Lenes Lieblingsakkorde – alle in Moll, versteht sich.“
„Au ja!“, stimmte die zu und rieb begeistert ihre Handflächen aneinander.





























