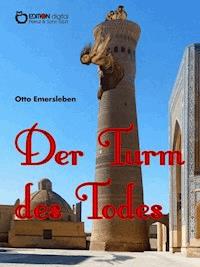8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unter wehenden Standarten, im Gepränge ihrer Rüstungen und begleitet von Fanfarenklängen brechen Anfang des Jahres 1540 dreihundertfünfzig Spanier mit einem Tross von dreitausend indianischen Trägern im peruanischen Quito zu einer Expedition auf. Ziel ist das Traumland aller spanischen Eroberer, das Land der Schätze, reich an Gewürzen und Gold, das Land mit den Namen Canela, Eldorado, Curicuri. An der Spitze des Unternehmens steht Gonzalo Pizarro, der jüngste Bruder des berühmt-berüchtigten Konquistadors. Unter großen Entbehrungen und Verlusten gelangt der Zug über die östlichen Anden hinweg bis in die Urwälder des Amazonastieflandes. Hier, am Ufer des Rio Napo, einem Zufluss des Amazonas, lässt Pizarro ein Schiff bauen und schickt es unter dem Befehl seines Stellvertreters Orellana stromab. Es soll so schnell wie möglich mit Proviant für die Zurückbleibenden wiederkehren und sie nachholen. Damit fällt die Entscheidung über das Schicksal der Expedition. Der Roman aus der Reihe „Spannend erzählt“ des Verlages Neues Leben, Berlin erschien erstmals 1980.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Otto Emersleben
Strom ohne Brücke
Roman
ISBN 978-3-86394-476-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1980 beim Verlag Neues Leben, Berlin als Band 164 der Reihe „Spannend erzählt“.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Was nicht in einem Jahr geschieht, geschieht in einem Augenblick
Spanisches Sprichwort
1. Kapitel
Plötzlich hatten Sonnenstrahlen das ewige Halbdunkel unter dem Blätterdach durchlöchert, waren zu baumstarken Lichtbündeln angeschwollen; dann hatte gleißende Helligkeit alles ringsum eingehüllt.
Jetzt, da er zwischen Hernando und einem der Träger lagerte, erschöpft, aber nicht ausgepumpt wie sonst bei einer Rast, entsann sich Sanchez, dass die herabflirrenden Strahlen ihn zunächst müde an eine Sumpflichtung hatten denken lassen. Eins jener widrig stinkenden Löcher im Urwalddickicht, die nur mit großer Mühe zu durchqueren waren. Verdammt ... Laut hatte er auf die Männer an der Spitze des Zuges geflucht. Sie machten sich nicht einmal mehr die Mühe, solchen Kloaken auszuweichen, platschten hindurch wie Schweine. Und alle folgten ihnen blind und taub, nur heraus aus der ewigen Dämmerung wollten sie, nur heraus auf dem schnellsten Weg ...
Wie lange waren sie schon unterwegs?
Ein Jahr? Einen Monat? Das ganze Leben?
Konnte die Zeit allein überhaupt einen Menschen so gleichgültig machen und so gefühllos?
Sanchez sah auf den Indio neben sich, sah, wie der Träger die Last auf einen Stein stützte, das Gesicht verzerrt, als bekäme er keine Luft. Müde wandte Sanchez den Kopf und blickte in Hernandos aschfahles Gesicht. Er erschrak. Er dachte: So siehst auch du aus, so grau und so knochig und mit Bartfransen behangen.
Das Erschrecken machte sein Denken klarer: Es war die zweite Trockenzeit seit Beginn ihres Marsches, der sich also fast schon ein halbes Jahr hinzog.
Vom Licht geblendet, hatte Sanchez die Augen geschlossen, als sie aus dem Dunkel getreten waren. War mit gesenktem Kopf dem Vordermann nachgestolpert und hatte sich schließlich gewundert. Kein Sumpfloch schien sie da zu erwarten, vielmehr ein leicht geneigter Hang, der die Schritte beschleunigen würde. Als schließlich der Mann vor ihm hielt, hatte Sanchez aufgeschaut und die Schlange der Hidalgos und Träger am Ufer lagern sehen.
Ein Fluss!
Da war alle Angst der letzten Monate von ihm abgefallen. Es schien Sanchez, als hätten sie jetzt schon das Land der Verheißung erreicht, das zu erobern sie aufgebrochen waren. Jenes Land Canela, in dem Gewürze und Spezereien an den Bäumen wuchsen - Zimt, Pfeffer und all die anderen Schätze, für welche die spanische Heimat traumhaft hohe Preise zu zahlen bereit war. Und wo es wohl auch großlaibige Brote und Kalebassen voll Maisbier gab gegen Hunger und Durst. Jenes Land Canela, über das der Vergoldete herrschte - ein Kazike, den seine Zauberpriester allmorgendlich vor dem Bade salben und mit Goldstaub einpudern mussten.
Eldorado ...
Zwar war noch nie ein spanischer Konquistador in diesem Reich gewesen, und doch - oder war es gerade deshalb?-zogen die spärlichen Nachrichten, die ihnen darüber zu Ohren gekommen waren, sie an wie Worte einer magischen Formel. Um sie für den Marsch zu gewinnen, hatte Gonzalo Pizarros Versprechen genügt, sie aus seiner Statthalterschaft Quito dorthin zu führen. Sie alle - dreihundertfünfzig Spanier, zu jeder Anstrengung bereit, und dreitausend indianische Träger.
Sanchez kniff die Augen zusammen vor dem Glitzern des Lichts auf der Wasserfläche. Riesige Baumleichen sah er zwischen den graubraunen Strudeln dahintreiben, Grasinseln, einzelne Äste. Als sein Blick schließlich das andere Ufer erreichte, war ihm, als stünde sein Herz still. Zwei Dutzend Hütten duckten sich dort auf dem Steilhang im Schatten übermächtiger Baumriesen. Und waren die Dächer auch mit Zweigen und Blattwedeln gedeckt und nicht mit goldenen Platten - es würde etwas zu essen geben. Und Kalebassen voll Maisbier, vielleicht. Auf jeden Fall aber Indiofrauen, Mädchen mit braunen, bei der Flucht wippenden Brüsten ...
Sanchez’ Blick ging zurück zu den Kameraden. Wie oft hatte er schon die Hoffnung aufgegeben, jemals aus dem Urwald herauszukommen. Er hatte die Bilder vom Goldreich verflucht als Eingebungen des Teufels - gelegentlich laut, mit den anderen, wenn sie abends am Feuer saßen, und oft unter vier Augen mit Hernando.
Wieder sah Sanchez auf den Freund neben sich, auf die faltigen Lider tief in den Augenhöhlen, die geschwollenen Lippen.
Viel gemeinsames Erleben verband sie. Zusammen waren sie schon nach Lima gelangt, der eben gegründeten Hauptstadt der Statthalterschaft von Gonzalos Bruder Francisco Pizarro. Hatten zusammen erkennen müssen, wie voreilig ihr Schwur gewesen war, nun, da sie von Spanien aus fast die halbe Welt umrundet hatten, nicht mehr weiterzuziehen. Was es für Konquistadoren zu holen gegeben hatte an Gold und Silber, war dort in Peru längst schon in festen Händen oder gar auf dem Weg in die Alte Welt.
Mit Hernando war er auch zusammengeblieben, als dieser sich eines Tages entschlossen hatte, in die alte Inkahauptstadt Cuzco zu ziehen. Wer wollte ausschließen, dass es dort im Hochland, hinter der Kordillere, nicht doch noch ungeahnte Schätze zu heben gab?
Aber auch Cuzco war für sie beide eine Enttäuschung geworden, und so hatten sie zugegriffen, als Francisco Pizarro seinen erst dreißig Jahre alten Bruder Gonzalo zum Marsch in eine eigene Statthalterei im Norden des Inkareichs aufbrechen ließ: Quito. Diesmal war es Sanchez gewesen, der zum Weiterziehen gedrängt hatte. Ein Hidalgo taugt nicht zum Wachhund für fremde Schätze. Ein spanischer Edelmann strebt nach Reichtum, über den er selbst gebieten kann.
„Hierher! Sammeln! Alle Spanier zu mir!“
Wie ein Trompetenstoß klang plötzlich die Stimme Don Gonzalos über den Uferstrich, brach sich an der Wand der Bäume. „... zu mir!“
Sanchez stand auf, stieg über Gurte und Tragstangen, umging einen Ballenstapel, aus dem rostüberzogene Sägeblätter hervorragten, blickte sich noch einmal um, bevor er eintauchte in den Strom der anderen, die sich mit ihm erhoben hatten. Er sah, dass Hernando ihm folgte.
All die Männer, die zu Pizarro drängten, waren ebenso krumm vor Erschöpfung, bebartet und dürr wie die beiden Freunde. Der Ruf aber hatte sie hochgerissen, als gälte es jetzt schon die Verteilung aller Reichtümer Eldorados. Diesem Ruf waren sie gefolgt, seit er sie aus der bescheidenen Behaglichkeit jener erst eben gegründeten Stadt Quito in den Schnee und die eisigen Schründe der Kordillere gerufen hatte. Ihm würden sie überall auf der Welt gehorchen - so, wie sie ihm bis zu dieser Stelle gefolgt waren.
Dem Generalkapitän vertrauten sie grenzenlos. Er hatte sie die steilen Hänge des Gebirges hinabgeführt, für die es keinen Vergleich in der Bergwelt irgendeiner spanischen Sierra gab. War ihnen dann, als sie die Kordillere hinter sich gelassen hatten, vorausgegangen durch Wälder und Sümpfe, die niemals ein Ende zu nehmen schienen und in denen man bei keinem Schritt wusste, ob es auch wirklich ein Schritt vorwärts war. Bis hierher hatte er sie geführt, an das Ufer des Flusses, dessen Namen niemand von ihnen kannte und der - obgleich sicher nur ein ganz unbedeutender Einschnitt in der endlosen Waldwüste - doch auch eine Grenze zu sein schien, die sie ohne Gottes Hilfe nie hätten erreichen können. Sie ... Nicht die Verdursteten, die vor Hunger Krepierten nicht und nicht die in der Kordillere Erfrorenen. Sie allein waren hierhergelangt von den dreihundertfünfzig, wenn auch zerlumpt und von Kräften gekommen bei dem langen, ermüdenden Marsch. Sie nur konnte der Generalkapitän noch zu sich rufen.
„Alle Spanier sammeln!“
Wie Fray Caspar die Männer sich vorwärts schieben sah über das abschüssige Ufer dieses Flusses Namenlos, ihre abgerissenen, von der Entbehrung geduckten Gestalten, war es ihm, als habe nicht der Generalkapitän Gonzalo Pizarro sie gerufen. Hatte doch Gott, der Herr, ihnen selbst verheißen, sie in jenes Land des Glücks und des Überflusses zu führen - das Land, von dem weder sie noch ihre Väter vorher etwas gewusst hatten. Denn wahrlich, ich sage euch, kommen wird der Tag, da ihr dieses Land schauen werdet. Und ihr werdet den Herrn rühmen und werdet dort seine Knechte sein und das austilgen, was alles ihm ein Gräuel ist.
Er, Caspar de Carvajal, ein Knecht Gottes, war ausgezogen, das Himmelreich auf Erden zu suchen. Er würde die Männer um Gonzalo Pizarro mitreißen dorthin, würde die Heiden, die das Paradies bevölkerten, für den wahren Glauben retten und die Störrischen unter ihnen in die Verdammnis stoßen.
Der Augustiner raffte den fransigen Saum seiner Kutte. War nicht auch sein zerschlissenes geistliches Kleid dem Herrn ein Gräuel, den es zu tilgen galt mit prunkvollen, golddurchwirkten Gewändern?
Fray Caspar verhielt einen Atemzug lang inmitten der drängenden Männer. Er sah sich um und hob die Arme, als wolle er sie alle der Gnade, die er schon hatte erleben dürfen, teilhaftig werden lassen: ein Knecht Gottes zu sein. Mit vollen Händen wollte er ihnen geben, wovon ihm übergenug war durch Gottes Ratschluss. Hatte er doch auch deshalb sein Amt als Bischof von Lima aufgegeben, um den Konquistadoren geistlichen Zuspruch zu spenden bei ihrem Vorstoß ins östliche Tiefland.
„Vorwärts, Hidalgos! Auf, meine Brüder! Gemeinsam sind wir heute an den Fluss Jordan gelangt, über den Gott der Herr uns sicher geleiten wird mit der festen Hand seines Dieners Gonzalo.“
Wie sehr er auch für einen Moment erschrak bei der Nennung jenes Wüstenstromes im Heiligen Land, so beschloss er doch, nicht davon abzulassen, all das zu verkünden, was seine innere Stimme ihm eingab.
„Vorwärts, Hidalgos ...!“
Er ließ die Arme sinken und schritt weiter voran inmitten der Männer.
Im Tragsessel ruhend, sah Gonzalo Pizarro zufrieden die Spanier seinem Ruf gehorchen. Er winkte den beiden Indios, die ihm mit großen Palmwedeln Luft zufächelten, hieß sie sich abseits zu seinen Sänftenträgern setzen und entließ auch Felipillo, den Dolmetscher.
Das furchtbare Fieber, das ihn seit Tagen schüttelte, hatte sich noch verstärkt beim plötzlichen Anblick des Urwaldstromes. Er spürte mit jedem Atemzug, wie sein Plan, das Goldland zu erreichen, nun kein Traum mehr war, kein Hirngespinst irgendeines indianischen Häuptlings, von Felipillo, dem Inkabastard, beim Übersetzen zusätzlich aufgebläht. Denn wo dieses gewaltige Wasser hinfloss, da gab es Nahrung, Siedlungen, gab es vor allem aber neue Hinweise ortskundiger Indios für den Weg in das Reich Canela.
Die Hütten dort drüben, am anderen Ufer, würden die erste Station auf diesem neuen Weg sein. Schluss war jetzt mit dem blinden Herumirren. Sie würden dem jenseitigen Ufer folgen, würden dabei die Wege der Indios nutzen und sich von den Hüttenbewohnern führen lassen.
Nur erst hinüber mussten sie ...
Wie aber sollte er den Übergang zu jenem anderen Ufer erzwingen - mit müden, hungrigen, durch die langen Entbehrungen mutlos gewordenen Männern?
Im Grunde verabscheute Gonzalo die Erbärmlichkeit dieser Gestalten. Waren das noch die Hidalgos, mit denen er vor Monaten sein Schicksal verbunden hatte? Hunger, Lumpen, Gereiztheit. Nichts mehr von den blitzenden Rüstungen, den Lanzen, Standarten, Fanfarenklängen, unter denen sie vor einem halben Jahr hoch zu Roß Quito verlassen hatten.
Was aber zählte das alles? Nichts, wenn nur eins nicht verloren gegangen war: das Feuer, mit dem er sie beim Aufbruch von Cuzco erlebt hatte, als es hieß, nach Quito zu ziehen. Und dort, unter der schattenlosen Äquatorsonne, als er die Hand nach Osten ausgestreckt und nur zwei Worte gesagt hatte: „Canela“, und: „Eldorado“; da waren sie aufgezuckt wie ein getretener Schlangenleib. Aber auch das zählte nicht. Auch dafür konnte er sie verachten. Denn es waren doch seine Worte gewesen, und er hatte sie sorgsam abgewogen, bevor er sie ihnen vorschrie.
Wenn nur das Feuer geblieben war, das diese Worte in ihnen angesteckt hatte. Dann würden sie ihm auch weiter folgen, und nur das zählte jetzt noch.
„Freunde, Hidalgos! Spanische Landsleute!“
Unter Gonzalos Aufrichten stöhnte das Sesselgeflecht, ließ vierhundert Ohren erleben, dass alles dort unter dem Blattbaldachin nur für sie geschah. Ließ sie lauschen und wieder gläubig erscheinen.
„Ich habe euch hier versammelt - ohne die Indios. Denn das, was wir zu bereden haben, geht nur euch etwas an, Hidalgos. Euch und mich und unseren Gott.“
Er ließ sich zurückfallen und fuhr leiser fort: „Wir haben heute einen Punkt unseres Marsches erreicht, der die Entscheidung bedeutet. Als Cäsar sich anschickte, Rom zu erobern, ging er über den Rubikon. Danach gab es kein Zurück mehr. Heute wissen nicht einmal die Schreiberlinge zu sagen, welcher Fluss denn nun eigentlich dieser Rubikon war. Der Name aber ist geblieben. Ihr wisst es. Geblieben für eine entschlossene Tat. Dabei war Rom zu jener Zeit ein elendes Drecknest, Hidalgos. Von den paar Tempeln abgesehen jedem Marktflecken in Estremadura vergleichbar. Und bei Gott - diejenigen unter euch, die den römischen Feldzug unseres Kaisers Carlos mitgemacht haben, sollen sie doch erzählen, wie wenig sich daran bis heute geändert hat.“
Ihr zögerndes, raukehliges Lachen half ihm weiter. Er würde das Feuer neu anfachen, selbst in jenen Männern, in denen es schon ganz erloschen schien.
„Das aber, was ihr zu erobern euch anschickt, ist das strahlendste Reich auf Gottes Erde. Götzentempel, bis zum Dach voll mit goldenem Flitter. Straßen und Plätze, die mit Goldplatten gepflastert sind. Und so können wir voller Stolz sagen: Der Rubikon war nur ein harmloser Bach - kein Vergleich mit dem Flüsschen, das wir überschreiten werden.“
Nun lauschte Gonzalo. Aber kein neues Lachen flog auf. Dem Generalkapitän schien, als schwiege in diesem Moment sogar der Wald. Kein Ächzen der Stämme, kein Vogelgeschrei. Nicht einmal die ewig keifenden Brüllaffen waren zu hören.
Wieder reckte sich Gonzalo.
„Ich sagte: Wir werden es überschreiten, das Flüsschen. Ich werde euch hinüberführen wie Moses sein Volk übers Meer.“
Er musste sie reizen, und sei es zum Widerspruch. Musste die Glut finden unter der Asche ihrer niedergebrannten Begeisterung.
Die Augen zu schmalen Schlitzen gekniffen, sah er sich um. Aber er erkannte seine Männer nicht wieder.
Bis endlich ...
„Das ist unmöglich, Don Gonzalo!“
„Was ist un...?“ Ein Aufatmen - trotzdem.
„Sanchez meint, dass wir nicht durch den Fluss kommen.“
„Jedenfalls nicht in unserem jetzigen ausgehungerten Zustand, Don Gonzalo. Ja, das meine ich.“
„Was also schlägst du vor, Sanchez de Vargas?“
„Schick Felipillo hinüber mit deinen Sänftenträgern. Sie sind von allen Indios, die uns geblieben sind, noch am kräftigsten. Schwimmend werden sie hinüber und wieder herüber gelangen. Im Dorf sollen sie Flöße mit Brot, Früchten und Fischen beladen.“
„Das sollen sie, ja.“
„Mit Fresserei voll bis zum Rand.“
„Und dann sehen wir weiter.“
„Ein guter Gedanke.“
„Aber leider unmöglich wahr zu machen, Don Sanchez!“
Das war Orellana. Dankbar sah Gonzalo hinab auf ihn - den Mann, den er schon beim Abmarsch zu seinem Stellvertreter ernannt hatte. Er genoss für einen kurzen Augenblick das verblüffte Schweigen der anderen.
Hinüber mussten sie. Alle. Und nicht nur ein paar aus der Meute der Indios. Wenn es nur um die Fresserei ginge, ja, dann genügte vielleicht wirklich ein Floß, wenn auch nicht gerade bemannt mit den allerkräftigsten Peruanern. Aber sie brauchten in Wahrheit mehr als nur etwas, um sich einmal den Wanst vollzuschlagen. Sie brauchten Gewissheit über den Weg vor allem, denn so wie bisher, sich ins Unbekannte vortastend, würden sie nicht mehr weit kommen.
„Es gibt einen Gegenvorschlag, mein Generalkapitän.“
„Sprich, Orellana!“
Gonzalo hob die Hand. Er spürte das Schweigen über den Köpfen zu jäher Gespanntheit erstarren. Währenddes verwandelte sich seine Dankbarkeit gegen den Vizegeneral in ein zufriedenes Lächeln über die eigene Weisheit: Er hatte diesen Mann zu seinem engsten Helfer erwählt trotz der Vorbehalte, die sein Bruder Francisco gegen „den Fuchs“ Orellana - wie er ihn nannte - immer gehabt hatte. Er war ihm zu schlau und zu pfiffig gewesen, wohl auch zu umsichtig, jedes Aas witternd, jeden Knochen, an dem es noch etwas zu nagen gab.
Hatte Francisco nicht „den Fuchs“ bei der Verteilung der Inkabeute einfach stillschweigend übergangen? Dunkel erinnerte sich Gonzalo an einen Streit zwischen den beiden, ausgerechnet in jenen Tagen, die dem großen Goldregen vorausgegangen waren. Irgendeine Lappalie - er wusste heute nicht mehr, worum es gegangen war. Aber dass Orellana deshalb leer ausgegangen war und seinen Teil, der ihm zustand wie jedem anderen, nicht bekommen hatte, ja, das wusste er noch. Francisco hatte „den Fuchs“ dann auf andere Fährten gehetzt, hatte ihn schnuppern und stöbern und zubeißen lassen, wo niemand mehr auf versteckte Goldvorräte und Tempelschätze gefasst gewesen war. Und so waren die beiden wieder als Freunde geschieden, äußerlich jedenfalls, nachdem Orellana sich zum Mitmarschieren nach Quito entschlossen hatte.
Seither sah Gonzalo unter dem Pelz des „Fuchses“ auch den Schakal Orellana. Was ihn davon abhielt, in eine Falle zu laufen, war nicht so sehr Schläue als vielmehr Feigheit - oder doch Schläue, die aus dieser Feigheit entsprang. Und wenn er getreten wurde oder man ihn mit Steinen warf, dauerte es nicht lange, bis er unterwürfig winselnd zurückkam. Denn er wusste genau, wo es etwas zu holen gab.
Es war gut, einen solchen Schakal als Stellvertreter zur Seite zu haben.
Gonzalo sah Orellana das zerschlissene schwarze Wams straff ziehen, sah ihn die Hand an den Degen legen.
„Du wirst uns trockenen Fußes ans andere Ufer bringen, wie du es gesagt hast, mein Generalkapitän. Wie Moses sein Volk übers Meer. Ich schlage vor, eine Brücke über den Strom zu bauen. Oder vielmehr über das Flüsschen, wie du es scherzhaft genannt hast.“
Voll wohlwollender Dankbarkeit hörte Gonzalo Orellanas beflissenes Lachen.
Er konnte zufrieden sein.
2. Kapitel
Fast ein Monat verging, ehe ausreichend Holz für den Brückenbau am Ufer bereitlag: Zurechtgestutzte armdicke Äste, angespitzte Stämme und lange Taue, gedreht aus Lianen und Wurzelenden.
Im Wasser stehend, gegen die Strömung gestemmt, trieben Indios mit schweren Holzhämmern Pfähle in den Uferschlamm. Das schnell fließende graubraune Wasser zog schwarze Fahnen mit sich.
Neben den ersten Pfeilern der Brücke, an der sie bauten, ragten Indiokörper über das Wasser. Bebende, von Wirbeln und Wellen bewegte Stützen, ohne die keine Brücke je den Fluss überspannen würde. Das Pochen und Hämmern war überlagert vom Geschrei am Ufer und dem Klatschen der Bretter beim Stapeln. Ein frisch zugesägter Stamm wurde herübergereicht. Und neues Hämmern ...
Da plötzlich begann sich das Wasser neben einem der Pfähle rot zu färben, in einer kräftigen, wie Zunderbrand ausgreifenden Strähne. Der grelle Schrei, mit dem das Rot aufgetaucht war, erstickte sofort. Stumm gestikulierend sprangen die Indios auf die schmalen Plattformen zwischen den Pfählen, zogen den letzten hinauf. „Pirayas, Pirayas!“, schrien sie, ängstlich bemüht, ihr Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Erst jetzt merkte Orellana, dass einer der indianischen Brückenarbeiter fehlte. Er ließ Felipillo holen.
Schnell war die Sache geklärt mit den kleinen, bluthungrigen Fischen, die im Zusehen jeden Knochen bloßlegten und den Mann, war er erst einmal verwundet, sofort zu Tode brachten.
So blieb keine andere Wahl, als die Pfähle nun von der Höhe des jeweiligen Vorpostens aus in den Grund zu treiben. Gleichzeitig wurde der bereits fertige Brückensteg, von dem aus der Bau der eigentlichen Brücke, der Hängebrücke, erfolgen sollte, mit einem am Ufer gezimmerten Laufrost belegt.
Nun zeigte sich, wie umsichtig es gewesen war, den unterwegs krepierten Pferden jeden Hufnagel zu ziehen und auch die Eisen nicht liegen zu lassen. Und da Andreas Durante - Zimmermann seines Standes und der einzige, der wirklich etwas von solch einem Bau verstand - gut bei Kraft und Gesundheit war, stockte die Arbeit auch nach diesem Zwischenfall nicht.
Umsichtsvoll hieß er die Anderen Holz zuschneiden, passte es selbst in die Laufbretter ein. Orellana ließ Andreas gewähren, wenn er auch in keiner Minute seinen Blick vom Fortgang der Arbeit abwandte. Denn dies würde seine Brücke werden.
Gonzalo hatte die restliche Verpflegung in seine Gewalt gegeben. Er ließ sie von Pluto bewachen, dem letzten am Leben gebliebenen Bluthund, und teilte sie denen zu, die am härtesten arbeiten mussten - auch den Indios.
Alle, für die es beim Brückenvortrieb nichts zu tun gab, schickte Orellana in den Urwald zur Jagd.
Zwischen den Hütten am gegenüberliegenden Ufer schien das Leben erstorben zu sein, seit die Spanier den Ort bei ihrer Ankunft vor einem Monat zum Brückenkopf bestimmt hatten.
Sanchez, dessen Jagdtrupp einem Sumpfhirsch nachstellte, entdeckte eines Abends den Grund dafür.
Er hatte das Tier an einem Wasserloch beobachtet und war entschlossen, in der Dämmerung endlich zum Schuss zu kommen. Die Armbrustschützen verteilte er hinter Bäumen und Bodenwellen rund um den Tümpel. Selbst kletterte er, die Waffe umgehängt, über Lianenstränge und Äste in einen hohen Baumwipfel. Er sah sich die Augen aus, solange das Licht noch reichte, aber das Tier zeigte sich nicht mehr.
Da wandte er den Kopf. Blickte hin, wo noch Helligkeit war, zum offenen Himmel über dem Fluss. Sah dann am anderen Ufer hinab und entdeckte Rauchwolken, die aus dem Blätterdach der Bäume stiegen. Dort also saßen sie - und sicher auch wie er in den Bäumen.
Schnell fiel die Nacht auf den Teppich der Baumkronen. Fraß das letzte Licht über dem Fluss, erdrückte die Schreie einiger später Waldvögel.
Sanchez ertastete seinen Weg hinab über die Astansätze, schwang sich, an einer Liane hängend, kräftig und doch behutsam nach allen Seiten aus, bis er einen glatten Baumstamm zu greifen bekam. Lautlos glitt er zur Erde.
„Hernando!“
Keine Antwort.
„Hernando!“
Hatte er nicht hier in der Nähe den Freund postiert? Und - warum schwiegen die anderen?
Er tastete sich von Stamm zu Stamm, kletterte über umgestürzte Bäume, die in der Dunkelheit das Ausmaß riesiger Felsbrocken annahmen. Zum Fluss ... Er musste so schnell wie möglich die anderen finden. Zur Nacht war man in diesem feindlichen Wald nur am Feuer sicher - vor dem Würgegriff der riesigen Anakondaschlange, vor dem Biss der Insekten und Spinnen, vor den Krallen des Pumas und den scharf schneidenden Zähnen bluthungriger Vampire.
Er musste die anderen finden ... die anderen oder das Lager am Fluss.
Sanchez vergaß seinen Hunger und auch die Müdigkeit. Als seine Augen sogar in der undurchdringlich scheinenden Waldnacht zu sehen begannen, wählte er sich einzelne Bäume als Richtpunkte. Nur schnell vor zum Ufer, damit er nicht im Kreis lief - alles andere würde sich finden.
O Santa Maria la Bianca, betete er. Heilige Muttergottes von Toledo, bitte für mich armen Sünder. Ich habe mich über die anderen zu erheben versucht als ihr Truppführer. Nun aber bin ich von ihnen verlassen. Und doch habe ich nicht aus Eitelkeit gehandelt, war nicht hoffärtig, denk das nicht von mir, o Santa Maria la Bianca ... In der Dunkelheit begannen die Lianenschlangen zu kriechen und die Bäume auf ihren Luftwurzeln wie riesige Lamas einherzustelzen.
Er raffte sich auf, hastete weiter. Fühlte sich plötzlich mit beiden Füßen im Wasser stehen.
Ob das die Hirschtränke war? Oder - war er endlich in Ufernähe? Sanchez sah sich um, aber die schwarz ausladenden Baumkronen starrten so riesig und so drohend auf ihn herab, dass seine Erinnerung an den Ort, wie er ihn im Dämmer des Tages gesehen hatte, verblasste. Er trat zurück aufs Trockene, umging den Tümpel. Plötzlich wusste er, dass er den Sinn für die Richtung verloren hatte.
O Santa Maria la Bianca!
Er horchte ins Dunkel. Aber nichts war zu hören als das Flügelwischen eines Fledermausschwarms, der sich langsam entfernte.
Der Morgen am Ufer begann lärmend und heiß. Die wenigen Tage bis zum Beginn der Regenzeit wollten genutzt sein. Später würde der Fluss anschwellen und unpassierbar sein - nicht ohne Grund lagen die Hütten des jenseitigen Ufers hoch oben am Steilhang.
„Gib mir die Axt, Hernando!“
Orellana packte den Stiel, hart ließ er das Eisen sich in den Stamm graben. Und wieder ...
Heute konnte er mit dem Fortgang der Arbeit zufrieden sein, hatten die Männer doch Fleisch zu essen bekommen. Die gestrige Jagd hatte nicht nur zwei Sumpfhirschen das Leben gekostet. Kurz vor Erreichen des Lagers am Fluss hatten die Schützen auch noch einen Tapir aufgestöbert und ihn nach kurzer Hatz zur Strecke gebracht.
Orellana unterbrach die Arbeit.
„Wir müssen heut mit dem festen Brückenteil im flachen Uferwasser fertig werden und ein erstes Seil für die Hängebrücke hinüberspannen. Sag das den Indios, Felipillo.“
Er stützte sich auf die Axt.
Solange der Generalkapitän den Tragstuhl nicht verließ und das Fieber mit Laubaufgüssen kurierte, würde er freie Hand haben: beim Einsatz der Indios, mit der Verteilung des Essens, bei den Absprachen mit Andreas, dem Zimmermann. Ihm gefiel, wie sie ihm gehorchten. Und er unterließ nichts, was nötig war, damit sie schnell hinüberkamen zu jenen Hütten. Freilich - Essbares würde es dort geben. Weiber auch. Und vielleicht Gold. Aber eins war doch wichtiger als das alles: Sie würden herausgelangen aus der Falle, in der sie hier inmitten des weglosen Urwaldes saßen. Hinter den Hütten würden Pfade sein, ausgetretene Wildwechsel vielleicht nur, aber eben doch Richtungen, denen man sich anvertrauen konnte mit den Männern.
„Ist Sanchez noch nicht aufgetaucht?“
Orellana sah Hernando stumm den Kopf schütteln. Er spürte die Verbissenheit, mit der jener die Balken warf.
„Wie habt ihr nur ohne ihn abrücken können?“
Wieder sagte Hernando kein Wort, hob nur die Augen. Orellana erschrak. Sicher - sein Besorgtsein war nur zum Teil in Anteilnahme begründet, und doch beleidigte ihn der Blick, mit dem Hernando aufsah.
„Wenn er bis heute zum Einbruch der Dunkelheit nicht zurück ist, werden wir die Nacht über einen Indio die Holzklapper schlagen lassen. Und nun mach schon weiter.“
Unmutig warf Orellana die Axt auf die Erde. Er ließ Hernando stehen, sah sich noch einmal um und war es zufrieden, auch diesmal seinen Befehl befolgt zu sehen.
Sie würden hinüberkommen, und ihre gereizte Unruhe würde verschwinden wie Morgennebel nach einem Gewitter.
Arme und Beine von sich gestreckt, mit flachem, unhörbarem Atem - kaum dass die nackte Brust sich dabei hob oder senkte - lag Sanchez unter einem mannshohen Farnbusch. Die Züge um Nasenansatz, Augen und Mund hatte der Schlaf nicht zu entkrampfen vermocht.
Obwohl die Erschöpfung ihn erst spät in der Nacht niedergeworfen hatte, träumte er. Er sieht sich über eine Waldlichtung wanken, spürt die sengende Hitze des Mittags auf seiner von Striemen und Kratzwunden zerrissenen Haut lasten und spürt das Pochen des Blutes so mächtig, dass er Angst hat, der Kopf könne zerspringen.
Das Gekreisch der grellfarbigen Papageien, das Zirpen der kleinen, schmetterlingsbunten Vögel, die vor weit geöffneten Blüten auf und ab schwirren, scheint ihm lauter geworden zu sein, unerträglich fast, seit er aus dem schützenden Dämmer des Waldes ins Helle getreten ist. Das Licht hat ihn angelockt wie nachts die Käfer und Falter, und er fühlt, wie es ihn zu versengen droht.
Da sieht er einen äsenden Hirsch vom gegenüberliegenden Waldrand her auf die Lichtung wechseln und duckt sich. Aber kein Strauch wächst dort, wohin er geraten ist - nichts, was ihn verbergen könnte. Doch das Tier scheint ihn nicht zu bemerken, obwohl es im Wind steht. Ruhig umfasst es mit Zunge und Lippe die Kräuter und Gräser am Boden, reißt sie aus mit der Kraft einer Kopfdrehung. Das Geweih wankt dabei wie ein Schiff auf den Kronen haushoher Wellen.
Ist das der Hirsch, den er gestern Abend verfehlt hat? Unsicher mustert Sanchez das Tier.
Jetzt erkennt er am fleckigen Fell, an dem weit ausladenden Schaufelgeweih einen Damhirsch seiner Heimat Kastilien. Und doch: Die Lichtung, auf der das Tier dort vor ihm weidet, ist eine Lichtung im feuchtheißen Urwald der Neuen Welt ..., ist ...
Plötzlich weiß Sanchez im Traum, dass er träumt, dass er hier liegt, weil seine Kameraden ihn gestern in der anbrechenden Dunkelheit allein gelassen haben auf seinem Baumansitz. Er spürt auch, wie sinnlos das Jagdfieber ist, das nach ihm greift beim Anblick des grasenden Tieres. Aber er ist machtlos - sein Hunger ist stärker als alles Traumdenken. Und so tastet er neben sich, nach einem Stein, einem Knüppel wenigstens, denn die Armbrust hat er längst verloren bei seinem Verzweiflungsmarsch durch die Nacht.
Da zieht das Wild plötzlich weiter, tritt, als sei es der Bewegung auf dem baumlosen Stück Erde vor sich innegeworden, erschreckt in den Wald zurück. Im Schutz des Dickichts verhält es und schreitet dann, mit dem Kopf das Gewirr der Äste und Schlingpflanzen teilend, ruhig dahin.
Sanchez sieht sich aufspringen. Seine Kraftlosigkeit ist vergessen. Nur den Hunger spürt er in seinem Innersten nagen. Er setzt dem Hirsch nach, stolpert über einen halb vermoderten Ast, lehnt sich an eines der dicken Lianentaue.
Das Tier schreitet weiter, ohne den Kopf zu wenden. Es bückt sich nicht mehr nach Gras wie eben noch auf der Lichtung. Scheinbar mühelos bahnt es sich einen Weg durch das verfilzte, klammheiße Waldgewirr. Auch Sanchez bereitet es keine Beschwerde, ihm zu folgen. Vorbei scheinen die Plagen der letzten Nacht, als er sich seinen Weg Schritt für Schritt hatte erobern müssen: kriechend, auf blutig gerissenen Händen und Knien. Die Angst hatte ihn vorwärtsgetrieben, die Angst vor den Höllentieren dieses gespenstischen Waldes, aber auch vor plötzlich heranschwirrenden Pfeilen versteckter Waldindios.
Jetzt ist diese Angst vergessen.
Je weiter Sanchez vordringt, je schneller er vorwärtsstürzt, dem zwischen den Hindernissen hindurchschwebenden Hirsch folgend, desto leichter spürt er seinen Gang werden. Immer rasender wird die Jagd durch das Dickicht. Über umgestürzte Bäume geht es, aus deren Rinde neues Gesträuch quillt, um schuppengepanzerte Baumriesen herum, deren Stämme zwölf Männer nicht würden umspannen können. Und doch verringert sich der Abstand zwischen ihm und dem Tier, das er töten will, nicht.
Tiefer und immer tiefer ins Dickicht hinein geht es bei der Verfolgung - aber wie dunkel es auch unter dem Dach der lückenlos ineinander verzahnten Baumkronen wird, Sanchez verliert den Hirsch, der ihm voranschwebt, nicht aus den Augen. Vielmehr ist ihm, als ginge im Dämmer des Waldes ein Lichtschein von dem Tier aus, ein zartes, fast unmerkliches Leuchten, das er nur sieht, wenn er direkt dem voranstürzenden Wild nachschaut.
Ein Hubertushirsch ...
Im Laufen greift Sanchez einen kräftigen Ast vom Boden auf, denn er ist entschlossen, die Jagd zu einem glücklichen Abschluss zu bringen und seinen Hunger zu stillen, sogar dann, wenn in diesem verzauberten Tier die Seelen aller Heiligen stecken sollten. Hubertushirsch ...
Mit ein paar schnellen Griffen bricht er den Knüppel zurecht.
Ist es, dass der Hirsch das Knacken gehört hat? Oder hat er dort in der Dunkelheit plötzlich ein Hindernis entdeckt?
Sanchez sieht das Wundertier stocken, im Verhalten stutzend den Kopf wenden und dann in neuem Davonstürmen die Richtung ändern. Er eilt ihm nach, aber die Wolke der Leichtigkeit, auf der er noch eben zu schweben schien, hat ihn abgesetzt. Hart spürt er den Waldboden unter seinen Füßen, stößt sich an herabgebrochenen Ästen, stolpert über armdicke Schlingpflanzen.
Immer tiefer gerät er in das dunkle Gewirr der Zweige, der Riesenblätter, der schreiend bunten Blütendolden. Und plötzlich merkt er, dass die Erde unter ihm nachgibt und er in einem klebrigen heißen Morast zu versinken beginnt.
Als er aufschaut, ist auch das Leuchten vor ihm verschwunden.
Da erwachte Sanchez.
Er blickte sich um, sah den Farnstrauch, unter dem er zusammengebrochen war, stützte sich auf seine Ellenbogen.
Wieder schüttelte ihn der Hunger.
Kein Hubertushirsch also.
Sanchez hob seine leeren Hände. Kein Knüppel, nichts.
Er hatte von Curupira geträumt, dem Waldgott, von dem Felipillo wieder und wieder erzählt hat. Curupira, den die Indios anbeten und den sie fürchten, der ihnen in Hirschgestalt erscheint und sie in die Sümpfe lockt.
O Santa Maria la Bianca!
Warum nur bin ich in dieses gottverfluchte Land gekommen? Warum nur habe ich die Neue Welt nicht Neue Welt sein lassen mit all ihren Schätzen und ihren Verlockungen? Hätte nicht auch in Kastilien das Leben vor mir gelegen?
Als Sanchez in Vargas - einem kastilischen Flecken, wenig nördlich der alten Krönungsstadt Toledo gelegen - zur Welt kam, war das Land schon von jenem Fieber geschüttelt, das die Entdeckung der über das Ozeanische Meer nach Sonnenuntergang gelegenen Inseln und Küstenstreifen ausgelöst hatte. Jeder Tag brachte neue wundervolle Nachrichten über Reiche und Schätze, die es dort zu erobern gab. Jeder Planwagen, der von der Küste kam, führte eine kleine Probe dessen mit sich, was ohne Unterlass in den spanischen Häfen anlangte: Gewürze, Gold, fremdartige Waffen und bunte, mit Federn geschmückte Kleider.
Sanchez hatte, als Junge neugierig am Wege lagernd, auch seltsam bemalte, fast nackte Menschen zu Gesicht bekommen: Indios. Und für sein ganzes weiteres Leben hatte sich ihm der stolze Blick eines Mannes ins Herz gegraben, der, ohne auf die Rufe und neugierigen Zudringlichkeiten ringsum zu achten, mit unverständlichen Worten seine Leidensgefährten um sich gesammelt hatte. Männliche Größe und Verachtung des übermächtigen, allgegenwärtigen Feindes schien dem kleinen Sanchez damals aus diesem Blick und den Gesten des Mannes zu sprechen.
Er war herangewachsen, der Unterweisung im Waffenhandwerk und dem höfischen Dienst hatte das ungebundene Spiel und das freie Herumstreifen seiner Knabenjahre weichen müssen. Wiewohl sein Vater ein in Armut geratener, den reichen Kaufleuten von Toledo hoffnungslos verschuldeter Landedelmann war, hatte er doch nichts unterlassen, was nötig gewesen wäre, seinen einzigen Sohn - eben Sanchez - in den Idealen spanischen Rittertums zu erziehen: Edelmut, Ehre, Kühnheit, Vasallentreue. Denn das Leben eines de Vargas hatte dem König geweiht zu sein.
Sprach nicht noch heute, nach dreihundert Jahren, alle Welt voller Hochachtung von Don Garcia de Vargas, einem Ritter, der mit Mut und kühner Entschlossenheit bei der Belagerung des damals noch durch die Mauren gehaltenen Sevilla von sich reden gemacht hatte? Hieß es doch, er habe unter den Augen des Königs sieben maurischen Kriegern die Stirn geboten, ohne zurückzuweichen.
Zwar hatte Sanchez von seinem Fechtmeister unter der Hand erfahren, der kühne Don Garcia sei nur deshalb so standhaft gewesen, weil er auf eine im Gefolge des Königs befindliche Dame Eindruck habe machen wollen, was ihm auch gelungen sei. Aber - war deshalb die Ritterlichkeit des Ahnen etwa geringer zu achten?
Nach Sevilla waren die anderen Städte Andalusiens den Mauren entrissen worden - als letzte das türmereiche Granada am Fuße der Sierra Nevada, und zwar in demselben Jahr, in dem die Schiffe des Genuesers Kolumbus den Weg zu den Inseln Westindiens fanden.
Seither hatten Spaniens Ritter den Weg über das Ozeanische Meer gehen müssen, wenn sie für ihren König Ruhm zu erwerben trachteten. Denn grenzenlos wie der Anspruch der göttlichen Macht und der allein selig machenden Kirche schien die Welt zu sein, die es für die Katholische Majestät zu erobern galt. Nach den Inseln Karibiens das goldreiche Mexiko. Ein Dutzend Jahre darauf das Inkareich des Sonnengottkönigs Atahualpa.
Sanchez war, ein Hidalgo von neunzehn Jahren, überschäumend von Unternehmungslust und Kreuzfahrergeist, in dem Augenblick nach Santo Domingo gelangt, als dort - am Nabel der Neuen Welt - Gerüchte von einem goldträchtigen heidnischen Reich die Runde zu machen begannen: Eldorado ... Zum ersten Mal hatte er damals die Wucht zu spüren bekommen, mit der dieses Wort die Konquistadoren ansprang. Hatte sich abermals eingeschifft - nach Darien, an der Landenge zwischen Ozeanischem Meer und Südsee. Auf der anderen Seite des Isthmus, in Panama, war er Hernando begegnet, einem Bauernsohn aus dem spanischen Baskenland. Die Not zu Hause, das Drängen der vielen Münder, die satt werden wollten vom Acker des Vaters und es doch niemals wurden, hatten diesen über das Ozeanische Meer in die Neue Welt getrieben. Nicht Ritterträume und keine Bekehrerwut. Ein stiller, nachdenklicher Geselle, der Sanchez gefiel und mit dem er zusammenblieb.
Bald hatten sie einen Schiffspiloten gefunden, der sie nach Lima mitnahm. Alle Wege schienen damals ins Reich Eldorado zu führen.
War es nur die Erinnerung an die Armut seines Vaterhauses gewesen, die Sanchez weitergetrieben hatte? Oder gab es da auch noch die Treue zu seinem König, in der er aufgewachsen war und die von ihm verlangte, die Heiden der Neuen Welt zum Christentum zu bekehren und ihre Länder der Krone Spaniens zu unterwerfen?
Heute hätte er diese Frage nicht mehr beantworten können.
Mit aller Kraft, die er nach der erzwungenen Pause noch aufzubieten vermochte, erhob sich Sanchez. Unsicheren Schrittes wankte er auf den nächststehenden Baum zu und klammerte sich zittrig an die rissige Rinde. Übermächtig wurde die Versuchung, sich wieder auf die Erde fallen zu lassen. Dabei war er entschlossen weiterzulaufen - immer weiter, bis er das Lager wiedergefunden hatte. Denn ohne die anderen würde er nicht überleben.
Sanchez sah sich um. Erschrak.
War da nicht ein Knacken? Er duckte sich und kroch um den Baum herum.
Vielleicht suchten sie ihn. Allzu weit vom Flussufer konnte er nicht entfernt sein.
Er richtete sich wieder auf und lief weiter, blieb stehen, lauschte. Die Stille nahm seine Angst auf.
Zwischen zwei Farnstämmen zwängte er sich hindurch, sah dahinter das Halbdunkel heller werden. Stand schließlich am Rand des Waldes.
Da schien es ihm plötzlich, als hätte er diesen Blick schon einmal getan - die versetzte Linie des Waldrandes gegenüber, der von riesenhaften Baumkronen aufgelockerte Riss der Erde gegen den Himmel. Die beiden kaum spürbaren Hügel dort rechts. Ja, natürlich. Dieselbe Landschaft hatte er von seinem Baumauslug gesehen: darüber die Rauchschwaden von den versteckten Feuern der Indios am anderen Ufer.
Er hob die Hände, presste sie an die Schläfen und spürte im Schmerz: Ein Traum war es diesmal nicht.
Wenn die Bluthunde - bis auf Pluto freilich - noch nicht geschlachtet und dem allgemeinen Hunger geopfert worden wären, könnte er sie jetzt bellen hören im Lager.
Sanchez setzte sich. Nur einen Augenblick ausruhen.
Jetzt war alles zum Greifen nah. Er würde die anderen wiederfinden - und wenn er auf allen Vieren hinkriechen müsste.
Er würde leben.
„Ihr werdet mit diesem Floß am anderen Ufer anlegen und das Lianentau um einen Baum schlingen.“
Felipillo sah auf die drei Indios, die Orellana für das Unternehmen bestimmt hatte. Er sah ihre unentschlossenen Gesichter und hörte die Frage: „Und dann?“
„Dann kommt ihr zurück, bevor euch die Blasrohrpfeile einholen.“
Seit Don Gonzalo sie vom Hochland herabgeführt hatte, gab es versteckte Angriffe aus dem Wald. Warum sollte es dort drüben anders sein? Wozu also fragten sie.
„Nun - fahrt schon los!“ Unwillig bückte er sich, legte die Hand an den Eckstamm des Floßes, vermochte es aber nicht anzuschieben.
Ungerührt standen die drei Ruderer da.
„Warum sollen gerade wir?“
„Weil ihr die Kräftigsten seid.“
Nun richtete sich auch Felipillo auf. Wozu, verdammt, fragten sie?
„Ich werde die Spanier rufen, euch mit der Peitsche die Fragen austreiben lassen!“
Er strich sein grünes Wams über den Hüften glatt. Löste es sich auch schon auf, so war es doch noch immer sein Stolz: Es hob ihn ab von der Nacktheit der anderen Indios, machte ihn jedem beliebigen Spanier gleich. Ihn, in dessen Adern adliges Inkablut floss.
„Also - was ist?“
Stumm wandten sich die drei Männer ab, schoben das Floß zu Wasser und saßen auf.
„Ihr müsst scharf rudern, schräg gegen den Strom!“
Mochte ihnen jetzt der Christengott helfen ...
Neugierige scharten sich um Felipillo. Sahen das Floß in der Strömung schwanken. Nur das Tau, das es nachschleppte, hinderte es am Drehen.
Hoch stand die Sonne über den Bäumen. Bevor sie unterging, musste die Brücke am Haltetau hängen - vom Ende des Brückenstegs zum anderen Ufer.
„Morgen bei Hellwerden beginnen wir mit dem Übergang.“
Felipillo blickte sich um. Neben ihm stand Orellana.
„Wo sind die nächsten drei - falls etwas passiert?“
„Was soll passieren, Herr ...?“
„Mir schien eben, du hättest schon mit den ersten deine Schwierigkeiten gehabt.“
„Schwierigkeiten?“
„Ich dachte nur, weil die Abfahrt sich hinzog. Und wenn sie vom anderen Ufer nicht zurückkehren?“
„Sie wissen, dass eure Arkebusen hinüberreichen.“
„So, wissen sie das? Hast du es ihnen noch einmal sagen müssen?“
„Sie haben es oft genug erlebt, Herr.“
„Keiner von euch fürchtet die Arkebusen mehr. Die Dinger treffen nicht sicher genug. Und an den Donner habt ihr euch längst gewöhnt. Die Bluthunde, ja, das war etwas anderes. Wo also sind die nächsten drei, Felipillo?“
„Dort, Herr, bei dem Kommando, das am Halteseil hinüberklettern soll.“
„Wissen sie ...?“
Ein Aufschrei der Umstehenden riss die Blicke zum Fluss. Einer der drei Indios auf dem Floß war zusammengebrochen. Jetzt duckten sich auch die anderen beiden.
„Zieht sie am Seil zurück!“, schrie Felipillo den Indios am Ufer zu - zuerst in ihrer Quechuasprache, dann auch auf spanisch. „Zieht doch das Seil.“
„Nein!“, rief da Orellana. „Das Seil wird nicht gezogen. Keiner fasst mir das Seil an. Noch leben zwei. Sie sollen das andere Ende am Ufer festmachen.“
Die auf Ästen und Stöcken in Stellung gebrachten Büchsen krachten. Blind in die Bäume der gegenüberliegenden Böschung hinein hielten die Arkebusiere.
Unter der Wucht der Strömung begann sich das Flechtseil zu straffen, holte das Floß, das fast schon das Ufer erreicht hatte, auf die Strommitte zurück. „Sie sollen rudern, verdammt. Sag ihnen das, Felipillo!“
„Rudern!“ Der Schrei ging unter in einer neuen Salve.
„Wenn sie es nicht schaffen, fährst du mit den nächsten!“
Jetzt sah einer der beiden Unverletzten auf, griff nach dem Ruder. Begann den Kampf mit der Strömung.
Am Ufer trat Stille ein. Spanier und Indios blickten auf das Wasser. Es war, als verzöge sich nach den ersten Donnerschlägen der Hakenbüchsen das Gewitter über ihren Köpfen.
Sanchez hatte das Krachen der Schüsse gehört, als er schon ganz nahe beim Lager war. Er hatte all seine Kraft zusammengenommen und war weitergekrochen, bis er den Fluss durch die Bäume schimmern sah. Das war das Leben, war kein trügerisches Bild wie das des Hirschgottes Curupira im Traum.
Hellwach blickte Sanchez sich um. Er erkannte den Lagerplatz am Ufer nicht wieder. Sollten sie ... ohne ihn ... ? Die Brücke! Sie würden doch nicht an diesem einen Tag fertig geworden sein ...
Sanchez warf sich vor, lief an leer stehenden Blätterhütten vorbei, hastete über liegen gelassene, kaum bearbeitete Balken. Wenn nur die Brücke noch da war! Ein paar Balken wenigstens, ein Tau noch hinüber zum anderen Ufer, damit er den anderen würde folgen können ... Allein würde er nicht überleben! Nach dieser Nacht wusste er es.
Dann, endlich, sah er die am Ufer versammelten Männer, sah die erst halb fertige Brücke und das Floß, auf dem die Indios sich hinüberarbeiteten.
Da krachte die nächste Salve.
Hätten sie nicht schon gestern Abend ... ? Erschöpft blieb Sanchez liegen.
Der blaue Himmel, die grünen Schatten spendenden Bäume - es war, als habe Gott diesen Augenblick nur für ihn geschaffen.
„Verdammte Schweine - rudern sollt ihr!“
Das war Orellanas Stimme. Sanchez riss die Augen auf und stemmte den Oberkörper hoch.
Also hatte Don Gonzalo sein Krankenlager noch nicht verlassen. Wenn das so weiterging, würde Orellana bald übermächtig. Und das war nicht der Mann, der Pulver vergeudete für ein Signal an Verlorengegangene ...
Sanchez entsann sich des Tages, an dem er Orellana zum ersten Mal in Peru begegnet war, kurz nach ihrem Eintreffen in Cuzco. Hernando hatte damals Wind bekommen von einem Inkadorf in den Bergen, von dem es hieß, dort sei Goldgerät aus dem Sonnentempel von Cuzco versteckt. Sie waren dreißig oder auch vierzig Mann gewesen, hatten sofort aufbrechen wollen. Alles war schon bereit - Verpflegung, Bewaffnung, ein indianischer Führer -, als Orellana plötzlich Einspruch erhob. Ohne direkten Befehl Don Francisco Pizarros, so hatte er gesagt, seien solcherart Ausflüge nicht gestattet, sie würden - wenn nötig, mit Waffengewalt - zu verhindern gewusst: Man sei schließlich im Auftrag des Königs hier und nicht auf eigene Rechnung.
Da war die Sache abgeblasen worden. Aber Gras wuchs deswegen darüber noch lange nicht. Eines Tages nämlich war plötzlich der indianische Führer verschwunden. Und mit ihm ein paar Männer aus Orellanas direkter Umgebung. Zwar hatte es später geheißen, die Sache mit dem Goldgerät aus dem Sonnentempel sei leeres Gerede gewesen, aber hatte nicht auch ein solches Gerücht seine Ursachen? Vielleicht war Orellana selbst ein betrogener Betrüger. Schließlich war er auch bei der Aufteilung des Inkaschatzes leer ausgegangen ... Sanchez fand eine Wurzel, an die er sich lehnen konnte.
Sollte dieses Floß ..., so wie er es vorgeschlagen hatte?
Der Gedanke riss ab, denn unweit, schräg vor den Köpfen der gaffenden Männer, schnellte jenseits des Flusses ein armdickes Tau empor, das Ende schoss in einiger Höhe über einen starken Ast und fiel neben dem mächtigen Baum aufs Ufer. Sofort zog sich einer der Floßmänner am Gestrüpp hoch.
Sanchez sah den Mann das Tau um den Stamm schlingen. Dann sich ducken und das Ende zwischen den Wurzeln verknoten.
Geschafft!
Hatte Don Gonzalo also doch seine, Sanchez’, Idee aufgegriffen: ein Floß hinüberzuschicken, um Nahrung für alle zu holen. Er war gerade zur rechten Zeit wieder ins Lager gelangt ...
Was aber sollte das Tau? Hatten sie Angst, das Floß würde abtreiben in der starken Strömung?
Auf und ab wippte die Pflanzentrosse, spannte einen Bogen aus herabtränenden, glitzernden Perlen vom letzten Brückenpfeiler hinüber zu jener Wachspalme am anderen Ufer.
Nein, nur um das Floß zu halten, war diese Lianentrosse zu stark. Also doch die Brücke! Darum führte Orellana das große Wort.
Die Angst, die er bei Erreichen des Lagerplatzes verspürt hatte, bekam für Sanchez plötzlich ein neues Gesicht. Er sah auf die Männer, die sich Kopf an Kopf drängten.
Sie alle würden hinübergelangen und er mit ihnen.
Aber das Bangen blieb. Noch war die Brücke nicht fertig. Noch konnte der Wald alle Pläne durchkreuzen, konnte mit Sturm und Regenfluten dreinhalten und mit den Giftpfeilen seiner Bewohner.
In welcher Gestalt würde Curupira zurückkehren?
Sie fanden Sanchez ohne Bewusstsein, trugen ihn in eine der Blätterhütten und stärkten ihn mit leichter Kost.
Solange der Tag Licht spendete, kletterten Indios, neue Halteseile um den hungergeplagten Leib geschlungen, hinüber ans andere Ufer. Die Brücke wuchs, als sei sie selbst eine Schlingpflanze, wurde kräftiger, dichter auch. Schließlich bog sie sich unter den ersten beladenen Trägern, die probeweise hinübergeschickt wurden.
Der Übergang am nächsten Morgen begann, ehe noch die Sonne über den Bäumen stand. Als erster Spanier betrat Gonzalo Pizarro, Generalkapitän und Statthalter der Provinz von Quito in Peru, das jenseitige Ufer. Im Namen des Königs von Spanien nahm er es in Besitz - ließ die Fahne aufpflanzen und sprach die feierliche Formel: “... erkläre ich dich bisher von Christenmenschen nicht betretene Erde ... und die Reichtümer in deinem Schoß zum Eigentum ... und deine Bewohner von Stund an zu Untertanen des Allerchristlichen Königs.“
Die Drängenden stockten, blieben stehen, bevor sie die Brücke betraten. Erst als die Standarte im Morgenwind auszuschlagen begann, geriet der Heerwurm in neue Bewegung. Glied um Glied schob er sich über den Fluss wie ein Tausendfüßler.
Die Vorhut fand die Hütten der Indiosiedlung leer - bis auf einen alten, am Boden liegenden Mann, der völlig von Kräften war und dessen Gebrabbel Felipillo nicht zu deuten vermochte. Mit seinem Degen tat Orellana den Alten ab, als sei er eine lästige Schlange, die ihm über den Weg kroch.
Noch einmal kamen die Übersetzenden ins Gedränge, als die Halterung der Hängebrücke an der Pfeilerbasis sich lockerte und das Flechtwerk ins Wasser zu fallen drohte. Ein Hidalgo, der sich hinabschwang und die Taue festziehen wollte, fiel ins Wasser. Er schrie auf und blieb verschwunden - niemand hätte zu sagen gewusst, ob er ertrank oder ob ihn auch die blutgierigen kleinen Pirayafische zerfleischt hatten.
Orellana ließ die Brücke in ihrer ganzen Länge räumen. Zwei Indios, mit Haltetauen gesichert, stiegen hinab und zurrten die auseinanderklaffenden Brückenhälften zusammen.
Erst als alle herübergelangt waren, gab Gonzalo die Dorfhütten zur Plünderung frei. Was darin an Nahrung gefunden wurde, war spärlich, zum Teil schon mit Schimmel bezogen. Man würde die Männer wieder auf Jagd schicken müssen.
Auch Gold gab es nicht, keinen Schmuck aus Federn und nicht den grünen Stein Esmeralda.
„Fray Caspar zu mir!“
Der Mönch trat vor Gonzalo.
„Hast du Papier und Tinte sicher über den Fluss gebracht? Gut. Da ich weder lesen noch schreiben kann ...“
Carvajal wich einen Schritt zurück und verneigte sich.
„Der Herr gibt jedem das Seine“, sagte er. „Dem einen die Kunst, das Geschehen zu formen, und dem anderen das Vermögen, dasselbe Geschehen für alle Zeit festzuhalten zum Ruhme des Herrn. Nichts wäre der eine ohne den anderen, Don Gonzalo.“
„Gut. Unser Marsch ins Zimtland ist ein solches Geschehen, des Aufzeichnens wert zum Ruhme Gottes. Ihm dienen wir alle, jeder an seinem Platz.“
„Und einig im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Ihn zu bekennen bist du an unsere Spitze gestellt, Don Gonzalo.“
„Ja, das bin ich.“ Pizarro presste die Arme fest auf die fellbelegten Lehnen seines Tragesessels.
„Und darum übermittle ich dir hiermit meinen Entschluss, Fray Caspar de Carvajal, über diesen unseren Marsch einen Bericht zu hinterlassen, den du verfassen wirst.“
„Jetzt, nachdem so viel schon geschehen und wieder vergessen ist ...?“
„Vieles wird noch geschehen. Und nichts ist vergessen, sonst stünden wir jetzt nicht hier.“
„Aber die vielen Tage des Irrens, der endlose Wald? Und vorher der opferreiche Weg die Kordillere hinab?“
„Mit diesem Brückenbau wirst du deinen Bericht beginnen, mit der Wahl des Platzes, an dem wir uns entschlossen, den Weg zum anderen Ufer zu nehmen, mit der Erwägung der Notwendigkeit, die uns dazu zwang trotz des für den Brückenbau erforderlichen Aufwandes.“
„Ich verstehe. Du hast vielleicht gar schon ... Vorschläge für den Beginn der Wegchronik, ich meine ein paar einleitende Worte, von dir formuliert, Don Gonzalo.“
„Hab ich, hab ich, Fray Caspar, aber nur Vorschläge. Du wirst alles so aufschreiben, wie du es für richtig hältst. Etwa, dass wir die Hoffnung schon aufgegeben hatten, aus dem Wald jemals wieder herauszukommen, aus der ewigen Dämmerung, als sich plötzlich Sonnenstrahlen zeigten. Wir taumelten weiter und standen dann an einem breiten Strom, auf dessen gegenüberliegendem Ufer ein Dorf lag. So war es doch?“
Der Mönch sah auf. Setzte die Feder ab. Mühelos hatte er dem schnellen Diktat folgen können.
„Genau so, ganz genau so, wie du es sagst, Don Gonzalo. Mir wären keine trefflicheren Worte eingefallen für das Erlebte.“
„Gut. Also: ein Dorf lag. Der Befehlshaber beschloss nun, auf das andere Ufer überzusetzen. Wir bauten eine Brücke, indem wir zunächst Baumstämme über das Wasser legten, auf Pfählen, die in den Grund gerammt wurden. Den tieferen Teil des Flusses überspannte ein an Seilen hängender Bretterweg. Hast du folgen können?“
Fray Caspar setzte den Punkt.
„Bretterweg. Natürlich“, sagte er.
„Einer der Leute hatte sich beim Jagen verirrt. Er stieß wieder zu uns, bevor wir den Übergang wagten. Alle gelangten sie heil hinüber bis auf einen einzigen, der ins Wasser fiel und ertrank. Gott sei seiner Seele gnädig. Punktum. - Ein Brückenbau braucht sein Opfer, das weiß jeder, der deinen Bericht lesen wird, Fray Caspar. Wenn keiner unserer Hidalgos zu Tode gekommen wäre, ich glaube, wir hätten einen von ihnen hineinstoßen und ertränken müssen, damit die Brücke die anderen trägt. Ein Brückenbau braucht ein Opfer. Das ist in der Heimat nicht anders ...“
„Du vergisst die beiden getöteten Indios, Don Gonzalo. Auch sie hat Gott der Herr dieser Brücke zum Opfer gegeben, denn auch sie sind seine Geschöpfe.“ Müdigkeit legte sich um Pizarros Mund. Und Unverständnis. Getaufte Indios. Das war nicht nach seinem Geschmack. Konnte denn ein Stein des Sakramentes teilhaftig werden? Oder ein Stier? Was tat es, dass die Indios eine Sprache hatten? Er verstand sie nicht, bekam nur so viel davon mit, wie Felipillo ihm übermittelte. Und Felipillo war ein ausgemachter Betrüger, wenn auch ein getaufter. Aber darüber jetzt mit dem Mönch zu disputieren, dazu war er nicht aufgelegt.
„Ich weiß, ich weiß. Du hast sie getauft vor dem Abmarsch. Aber - sind sie dadurch uns gleich geworden? Wer trägt denn diesen Sessel? Ich oder die Indios?“ Der Mönch verneigte sich. Ließ Feder und Rolle in den weiten Ärmeln seiner Kutte verschwinden. „Mit der Austeilung des Sakraments setzt der Herr jedem ein Zeichen. Und er hat in seiner Güte ...“