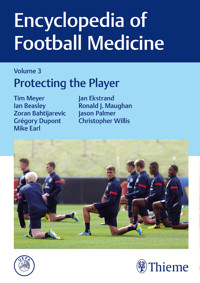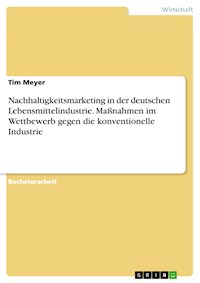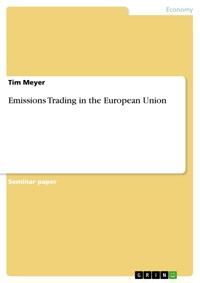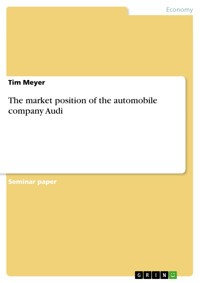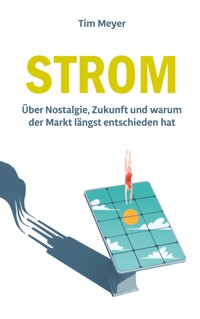
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Strom geht uns alle an. Doch die Diskussion über seine Zukunft ist viel zu politisch. Der Energiesektor steckt inmitten einer industriellen Revolution. So wie die Dampfmaschine die Pferdekraft verdrängt hat, das Auto die Kutsche oder das Smartphone das Handy, stellen heute erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Elektroautos weltweit die Märkte auf den Kopf. Aber warum findet diese Revolution statt - und wird sie erfolgreich sein? "STROM" erklärt die Zusammenhänge unter der Oberfläche: warum industrielle Massenfertigung von "Clean Tech" das Alte überrollt, was China damit zu tun hat, vor welchen Herausforderungen für Markt und Netze wir in Deutschland stehen und warum zu ihrer Bewältigung auch ein Kultur-Update erforderlich ist. Der breite Blick auf industrielle, energiewirtschaftliche und gesellschaftliche Logiken vergangener und aktueller Fortschritte liefert eine überraschend positive Aussicht: Der Markt ist unser stärkster Verbündeter und hat längst den Durchbruch für eine klimaneutrale Energiezukunft geschaffen. Doch wollen wir im internationalen Wettbewerb noch "vor die Welle" kommen, müssen wir diese Chance endlich ergreifen: für unsere Wirtschaft und fürs Klima.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Marlena und Benjamin
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Harald Lesch
Einleitung
KAPITEL 1: Unsere wirtschaftliche Zukunft beginnt jetzt
1.1 Die vierte Energierevolution hat längst begonnen
1.2 »It’s the efficiency, stupid!«
1.3 Die Transformation ist exponentiell
1.4 Industrielle Massenfertigung ist DER Gamechanger
1.5 China führt – die internationale Politik reagiert
1.6 Wer nicht CO2-neutral liefert, fliegt (bald) raus
KAPITEL 2: Ohne schnelles Handeln wankt auch unsere gesellschaftliche Zukunft
2.1 Auch ökologischer Bilanzbetrug fliegt irgendwann auf
2.2 Anpassung? Ein naives Konzept. Die Physik ist stärker als der Mensch.
2.3 Ohne Demokratie ist alles nichts – aber halten Demokratien Klimawandel aus?
KAPITEL 3: So retten wir Wirtschaft, Gesellschaft und Klima – im Vorwärtsgang
3.1 Innovation und Skalierung werden systematisch unterschätzt
3.2 Von Enten und Kannibalen – und den Opfern des eigenen Erfolgs
3.3 Unser Glück: Auch Batteriespeicher werden unterschätzt
3.4 Flexibilität ist das neue Gold
3.5 Weniger ist mehr: die große Elektrifizierung
3.6 Infrastruktur für die Dunkelflaute – Energie organisch denken
3.7 Preise statt Mastermind – den Umbau über Märkte organisieren
KAPITEL 4: Das wird uns im Weg stehen
4.1 Die Beharrungskräfte der Verlierer
4.2 Das Gestrüpp aus Regulierung und Bürokratie
4.3 Die unvorbereitete Infrastruktur: unsere Stromnetze
4.4 Die überflüssig werdende Infrastruktur: unsere Gasnetze
KAPITEL 5: Worauf wir nichts bauen können (außer Luftschlösser)
5.1 Kernkraft (Spaltung und Fusion)
5.2 Gefährliche Geister rufen? CCS in der Energieversorgung
5.3 Champagner für jeden Anlass
5.4 Das Ignorieren von Zeit und Wettmachen vertaner Chancen
KAPITEL 6: Was fehlt? Auf das richtige Mindset kommt es an!
6.1 Denken in Leitplanken – kompliziert ist einfach und komplex ist kompliziert
6.2 Eine neue Management- und Fehlerkultur
6.3 Lernen von anderen – wir können eben nicht alles selbst am besten
6.4 Lust auf Zukunft
Danksagung
Autorenvita
Glossar
Quellenverweise und Anmerkungen
Vorwort
Von Harald Lesch
Auf dieses Buch können Sie sich wirklich freuen. Wer an konstruktiven Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft in Deutschland, in Europa und der Welt interessiert ist, der muss »STROM« lesen.
Genau 20 Jahre vor dem Ziel »klimaneutrales Deutschland 2045« zeigt das Buch, welch starker Verbündeter der Markt ist und wie dynamisch globale Industrielogiken den Durchbruch für eine klimaneutrale Energiezukunft längst geschaffen haben. Es erzählt die große Geschichte menschlicher Energienutzung, warum wir erneuerbare Energien, Speicher, Elektroautos und Wärmepumpen systematisch unterschätzen und uns immer noch so schwertun, uns von der Verbrennung zu verabschieden.
Doch der Markt hat entschieden, auch das zeigen die Zahlen im Buch und wird wunderbar erklärt. Denn egal ob der Präsident der USA nach »Drill, Baby, drill« ruft oder uns irgendwer Kernfusion oder blauen Wasserstoff als Wunderlösung verkaufen will: Die energiewirtschaftlichen, technischen und ökonomischen Zusammenhänge, die Tim Meyer in seinem Buch anschaulich erläutert, lassen keinen Zweifel aufkommen. Die Kraft des Preises und die Wachstums- und Innovationsgeschwindigkeit von »Cleantech« entscheiden das Rennen. Am Ende wird die Wende sein – und sie wird mit erneuerbaren Energien sein. Wie das jetzt schon geht, wo wir in Deutschland zu langsam sind, wie wir schneller werden und sogar endlich mal Vergnügen daran haben können, mit Innovationen zusammen eine gute Zukunft zu schaffen, davon erzählt Tim Meyers Buch.
Ich bin froh, dass er das Buch geschrieben hat, denn seine höchst plausiblen Argumente für den Erfolg einer Energiewende sind so überzeugend, das müssen alle wissen. Vor allem diejenigen, die glauben, das wird nichts. Von wegen! Viel Vergnügen!
… und dass Sie das Buch weiterempfehlen werden, weiß ich jetzt schon.
Harald Lesch Mai 2025
Einleitung
Technikmuseen sagen uns nicht nur etwas über die Vergangenheit, sondern auch viel über die Zukunft. Sie sind voller Maschinen und Geräte, die in ihrer Zeit als große Errungenschaften gefeiert wurden, das alltägliche Leben auf heute kaum vorstellbare Weise vereinfacht haben, Wachstumstreiber für Unternehmen waren, Lohn, Brot und Identifikation für viele Menschen boten. Kurzum: Wirtschaftsgrundlage und Stolz ihrer Generation. Ob erste Dampfmaschinen, Glühbirnen oder Fluggeräte – sie waren allesamt Revolutionen, nach denen die Welt eine andere war. Denn große Erfindungen prägen umgekehrt die Menschen, Gesellschaften und Industrien ihrer Zeit, wie auch das Auto, der Fernseher oder das Internet.
Doch ein Gang durchs Museum verrät eben auch, wie zukünftige Generationen auf unsere heutige Technologie schauen werden. Öllampen oder Kerzen statt Kienspan, ein eigener Kohleofen, ein Automobil statt dem Kutschwagen, ein eigenes Telefon, irgendwann sogar mit Wählscheibe statt dem Fräulein vom Amt … Allesamt große Fortschritte für die meisten und hartes Schicksal für die Verlierer dieser Entwicklungen. Aus heutiger Sicht aber vor allem: rückständige Technik- und Lebensqualität. So wird Stolz zu Demut. Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor Einführung des ersten Smartphones im Jahr 2007? Aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar, wie das Leben ohne war.
Die Revolution ist längst im Gang
Im Technikmuseum von 2050 werden die dort ausgestellten Verbrennungsmotoren oder die Modelle von einhundert Meter hohen Brennkammern moderner Kohlekraftwerke allerdings nicht nur wohlmeinend als technische Wunderwerke ihrer Zeit betrachtet werden. Sondern auch als Verirrungen der Vergangenheit, als Zeichen menschlicher Hybris. »Haben die Leute damals wirklich in so großem Stil Öl und Kohle verbrannt und dabei fast drei Viertel der Energie ungenutzt durch Schornsteine und Auspuffe gejagt? Obwohl die Wirkung von CO2 auf das Klima seit über hundert Jahren bekannt war?« Ja, das haben sie – das war eben die gängige Hightech, die man damals hatte. Stolz und Demut auf engstem Raum.
Technik steht nie still. Im Energiesektor sind sogar gleich mehrere Technikrevolutionen parallel in vollem Gange. Wie viele andere technologische Sprünge zuvor werden sie im Hier und Jetzt von vielen noch übersehen, verdrängt oder belächelt. Manche Vertreter der »Oldtech« sind gedanklich schon weiter – sie bekämpfen den Fortschritt aktiv und handfest. Denn wenn Neues das Alte verdrängt, werden zugleich gute Geschäfte und persönliche Lebensleistungen infrage gestellt. Innovation ist immer auch anstrengend. Dennoch setzt sich am Ende die überlegene und günstigere Technik durch.
Die Geschichte ist voller Beispiele für einen solchen Umgang mit großen Umbrüchen. Viele Unternehmen haben auf diese Weise ihre Existenz eingebüßt, andere hatten Glück und haben nur Zukunftsmärkte verpasst. Legendär ist die Fehleinschätzung des damaligen Microsoft-CEO Steve Ballmer: »Das teuerste Telefon der Welt ist wegen fehlender Apps und nur virtueller Tastatur kaum für Geschäftskunden geeignet«, so sein Urteil über das erste iPhone bei der Markteinführung 2007.1 Im Smartphone-Markt hat es der Weltmarktführer für Betriebssysteme Microsoft bis heute nicht geschafft, ein eigenes Betriebssystem zu etablieren.2
»Bahnfahren führt zu Zittern, Ermüdung, Erschöpfung, nervöser Reizbarkeit und Verdauungsstörungen«. So lautete die gängige Diagnose »Eisenbahnkrankheit« ab Mitte des 19. Jahrhunderts für Reisende, die erstmalig statt mit der Kutsche ihre Reise mit der Dampflokomotive unternahmen. Den Markt der Stellmacher und Kutscher hat diese Diagnose nicht gerettet. Diese Berufsstände waren mit Aufkommen des Automobils Anfang des 20. Jahrhunderts vollends in die Nische für historische oder romantische Ausflüge verdammt. Dass der bemitleidenswerte Zustand der Deutschen Bahn heute wieder ähnliche Diagnosen auslöst, steht auf einem anderen Papier. Die Schwäche der deutschen Automobilindustrie hingegen geht auf ein ähnliches Muster zurück: industrielle Veränderungen ignorieren, kleinreden und mehr Kraft in Autosuggestion und Täuschungsmanöver stecken als in die eigene Neuerfindung.
Gegen den Trend helfen weder Subventionen noch Polemik
»Unsere Autoindustrie schafft Hunderttausende von Jobs und sichert Familien ein gutes Einkommen. Sie trägt ganz wesentlich zum Wohlstand Deutschlands bei. Das soll so bleiben«, lautet die Botschaft einer jüngeren Kampagne der CDU zum Erhalt des Verbrennungsmotors.3 Als Beschreibung des aktuellen Zustands stimmt die Aussage durchaus. Allerdings versagt sie als Beschreibung der Zukunft – denn schon seit Jahren findet auch im Mobilitätssektor eine Industrierevolution statt. Für neue Pkw gilt längst nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch wie schnell die Umstellung auf Elektroantriebe erfolgt. Der aktuelle Marktanteil beträgt in China bereits über 50 Prozent, in Norwegen 90 Prozent, weltweit über 20 Prozent.4 Das sind Marktanteile, die heute vor allem von chinesischen Herstellern gewonnen und von der deutschen Automobilindustrie verloren werden. Viele große Hersteller haben daher die Entwicklung neuer Verbrennungsfahrzeuge eingestellt und konzentrieren ihre Kraft auf die Aufholjagd bei Elektroantrieben.
Im Energiesektor ergibt sich das gleiche Bild: Erneuerbare Energien und Batteriespeicher sind weltweit längst als neue Arbeitspferde gesetzt. Hätten Sie beispielsweise gedacht, dass bereits seit 2019 jedes Jahr die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien diejenigen in fossile Stromerzeugung übersteigen – und mittlerweile sogar die Investitionen in Batteriespeicher diejenigen in neue Atomkraftwerke?5 Der Abstand wächst in großen Schritten, obwohl fossile Energieträger weiter mit atemberaubenden Summen subventioniert werden: allein im Jahr 2022 mit 7,1 Billionen US-Dollar. Eine Zahl, die vom in Bezug auf Ökofundamentalismus wenig verdächtigen Internationalen Währungsfonds IWF stammt.6 Und während in deutschen Talkshows noch mit dem Argument gepunktet wird, dass nachts ja die Sonne nicht scheine, deckt Kalifornien bereits bis zu einem Drittel der abendlichen Lastspitze im Stromnetz aus Batterien, die mittags aufgeladen wurden.7 Und der notorische Ölstaat Texas schickt sich gerade an, Kalifornien beim Solar- und Speicherausbau zu überholen.
Revolutionen kann man nicht aufhalten
Revolutionen schaffen Gewinner und Verlierer – auf welcher Seite wollen wir stehen? Energiewende und Klimaschutz werden in Deutschland oft als grüne Agenda, wirtschaftlicher Verlust oder persönlicher Verzicht missverstanden. Teils, weil sie in der Vergangenheit tatsächlich so kommuniziert wurden und teils, weil politische und mediale Diskussion von Abgrenzung und Polarisierung leben. Dabei wird übersehen, dass die Energiewende, aber auch die Verkehrswende und die Dekarbonisierung der Industrie längst keine rein politischen Vorhaben mehr sind, sondern Ausdruck begonnener industrieller Revolutionen. Diese aufzuhalten wird nicht gelingen. Aber wir haben es in der Hand, ob wir am Ende auf der Gewinner- oder Verliererseite stehen. Klar ist: Je später wir dieser Tatsache ins Auge sehen, desto breiter und tiefer werden die Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft sein – und desto stärker und härter trifft uns der Klimawandel. Dabei haben wir die Wahl, die Veränderung anzunehmen und aktiv zu gestalten – und mit neuer Stärke aus ihr hervorzugehen und unseren eigenen Beitrag zum Klimaschutz auch als Geschäftschance zu nutzen.
Es gibt also keinen Grund für Pessimismus. Denn noch lässt sich auch in Deutschland die große Chance ergreifen. Wir können die Flucht nach vorn antreten. Wirtschaftlich und gesellschaftlich, mit Mut zum Aufbruch und Ausgleich. Das heißt auch: mit einer offenen Diskussions- und Fehlerkultur. Und dem unternehmerischen Willen, den notwendigen Umbau zu einem guten Geschäft zu machen. Auch wenn Deutschland traditionell als Verbrennerland bekannt ist, hat es technologisch und unternehmerisch großartige Voraussetzungen, um die anstehenden Aufgaben zu lösen – und die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen zu Exportschlagern zu machen. Die Herausforderungen, die die neue Energiewelt stellt, sind weltweit überall gleich. Und die Zeit, in der man technologische Traditionen verklären konnte, ist definitiv abgelaufen. Es ist nicht zu spät für etwas Neues. Warum es Sinn ergibt, es endlich als Chance zu ergreifen, und wie genau das gehen könnte, erkläre ich in diesem Buch.
Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Als Autor wünscht man sich natürlich, dass das eigene Buch vom Anfang bis zum Ende durchgelesen wird und so jeder Gedanke, den man selbst für wichtig und anschaulich erklärt hält, alle Leserinnen und Leser erreicht. Doch sollten Ihnen Inhalte eines Kapitels bereits bekannt sein oder sollten Sie sich gerade brennender für andere Fragen und Antworten interessieren, können Sie jederzeit zum nächsten Kapitel springen. Das wäre zwar schade – denn erst zusammen ergeben die sechs Kapitel das ganze Bild in seiner historischen, technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Breite sowie der globalen und der spezifischen Deutschen Einordnung. Das Buch ist so aufgebaut, dass auch jedes der sechs Kapitel in sich geschlossen funktioniert. Und jedes dieser Kapitel hat einen anderen Charakter und eine andere Perspektive.
Ich habe mich bemüht, hauptsächlich genderneutral zu formulieren oder an manchen Stellen mit der sogenannten »Beidnennung« des männlichen und weiblichen Geschlechts zu arbeiten. Wenn es den Lesefluss jedoch zu sehr erschwert hätte, habe ich auch rein männliche Formulierungen verwendet. Wenn Sie also zum Beispiel von »Kunden« lesen und nicht von »Kundinnen und Kunden«, liegt das auch daran, dass »Kunden« eben nicht nur Menschen sind, sondern auch Unternehmen. An diesen Stellen habe ich es vorgezogen, jeweils nur ein Wort zu verwenden als eine Aufzählung aller gemeinten Bedeutungen. Ich hoffe, dass sehen Sie mir nach.
KAPITEL 1
UNSERE WIRTSCHAFTLICHE ZUKUNFT BEGINNT JETZT
Der Startpunkt unserer Reise ist besonders, nicht die Richtung
Spätestens seit der Energiekrise der Jahre 2021 bis 2023 ist die Energiewende eine der Generalverdächtigen bei der Frage, wie die auffällige Schwäche der Deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich zu erklären ist. Gern ist die Rede von »Deindustrialisierung«, vom »Deutschen Sonderweg«, von einer »Geisterfahrt« gar. Tatsächlich steht Deutschland – im Angesicht des Wegfalls russischer Gaslieferungen, gestiegener Energiepreise und des Klimawandels – stärker als viele europäische Nachbarn wirtschaftlich unter Druck. Also ja: Wir spielen eine Sonderrolle. Doch eine andere, als gern behauptet wird. Das Blöde: Mit der falschen Analyse zieht man falsche Schüsse und ergreift die falschen Maßnahmen. Daher brauchen wir zunächst eine ehrliche Bestandsaufnahme des »spezifisch Deutschen« der Energiekrise. Diese fördert drei Hauptgründe für eine tatsächliche Sonderrolle Deutschlands zutage:
Besonderheit #1: hoher Industrieanteil
Erstens lebt die deutsche Wirtschaft im europäischen Vergleich noch relativ stark von industrieller Produktion. Und industrielle Produktion lebt unter anderem von international wettbewerbsfähigen Energiepreisen. Andersherum leidet sie, wenn Energiepreise steigen. Tun sie das dauerhaft und kompensieren andere Standortfaktoren dies nicht ausreichend – also zum Beispiel die Verfügbarkeit von Fachkräften, rechtliche Rahmenbedingungen, Zugang zu Kapital etc. –, werden Produktionsstandorte in andere Regionen und Länder verlegt. So weit die simple betriebswirtschaftliche Logik.
In Deutschland erwirtschaftet die Industrie noch rund 19 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts (ohne den Bausektor). In Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Spanien oder Großbritannien liegt der Anteil nur noch zwischen 8 und 11 Prozent, in Italien und Dänemark bei bis zu 16 Prozent.8 »Nur noch« bedeutet: Früher hatte die Industrie natürlich auch in diesen Ländern eine größere Bedeutung. Doch als Teil der Globalisierung und der weltweiten Verlagerung industrieller Produktion in Länder mit niedrigen Energie- und Lohnkosten, Umweltauflagen etc. sind unsere europäischen Nachbarn schon stärker »deindustrialisiert« als Deutschland. Und damit auch nicht mehr ganz so stark betroffen, wenn industrielle Fertigung unter gestiegenen Energiepreisen leidet.
Aber wie haben wir es nur geschafft, so viel mehr Industrie in Deutschland zu halten? Sind unsere Unternehmen, das technologische Umfeld, unsere Fachkräfte, Ingenieurinnen und Ingenieure einfach besser? In einigen Branchen gilt das sicherlich: Deutschland ist stark in Technologie und Fertigung. Unzählige »Hidden Champions« gibt es über das Land verstreut, also Marktführer in ihren spezifischen technologischen Nischen. »Made in Germany« hat nicht ohne Grund einen besonderen Klang in der Welt. Doch mit Blick auf die Großindustrie gab es einen weiteren, wichtigen Standortfaktor – der mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine zu Staub zerfallen ist: der Zugang zu billigem Gas.
Besonderheit #2: billiges russisches Gas
Anders als beispielsweise die USA oder viele asiatische Länder verfügt Deutschland nicht über eigenes, billiges Erdgas in großen Mengen. Und wir waren nicht bereit, Umweltschäden der Förderung hierzulande zu akzeptieren. Daher hat Deutschland eine immer stärkere Abhängigkeit seiner Wirtschaft von Pipelinegas aus Russland nicht nur in Kauf genommen, sondern als Teil einer wirtschafts- und industriepolitischen Strategie aktiv vorangetrieben – sogar gegen massiven Widerstand seiner internationalen Partner aus Europa und den USA. So konnte Deutschland sozusagen die Zeit anhalten und entgegen dem Trend anderswo in Europa eine hohe Industriequote im Land halten. Das Projekt North Stream 2 ist zugleich Symbol und Menetekel dieser letztendlich gescheiterten Strategie. Jahrelang haben europäische und US-amerikanische Regierungen gegen das Projekt protestiert und Widerstand geleistet. In den Jahren 2019 und 2020 hat der US-Kongress sogar Sanktionen gegen Personen und Unternehmen verhängt, die North Stream 2 unterstützen, sei es durch die Bereitstellung von Schiffen, vorbereitende Arbeiten oder die Versicherung von Risiken. »Juristischen Personen, deren Geschäftsführern und Arbeitnehmern drohen Einreiseverbote, Einfrierungen ihres Vermögens und der Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe in den USA«, so das Fazit einer Stellungnahme des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags.9 Nicht nur die Projektgesellschaft North Stream 2 AG und ihr Geschäftsführer, sondern viele Zulieferer und Baufirmen und deren Vertreter waren betroffen. Wohlgemerkt: Wir reden nicht über Sanktionen gegen irgendeinen Despotenstaat, sondern gegen ein von der deutschen Regierung und deutschen Firmen aktiv unterstütztes und betriebenes Projekt. Verhängt von seinem damals noch engen Verbündeten, den USA.
Spätestens nach der Annexion der Krim durch Russland scheint eine solche Haltung der Partner nachvollziehbar. Dennoch wollte im Sommer 2021 der neue US-amerikanische Präsident Joe Biden ein Zeichen der Versöhnung senden und hat seine Zustimmung zu dem Projekt erteilt – unter Auflagen. Sollte Russland erkennbar »Energie als Waffe« einsetzen – so damals schon die Formulierung des deutschen Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel –, hat sich die Bundesregierung verpflichtet, unverzüglich zu handeln.10 Realität wurde jedoch das Gegenteil. Im Herbst 2021 stockten die russischen Gaslieferungen nach Deutschland, die deutschen Gasspeicher, die zuvor an russische Firmen verkauft worden waren, waren leer und russische Truppen wurden an der polnischen Grenze zusammengezogen. »Kriegsvorbereitungen« wäre die richtige Diagnose gewesen: Von langer Hand geplant wurde Energie als Waffe gegen Deutschland und Europa eingesetzt, um harte Reaktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine zu verhindern. Doch trotz dieser klaren Symptome lautete die offizielle Diagnose der Bundesregierung am 26. Oktober 2021, dem letzten formalen Tag ihrer Amtszeit, dass die deutsche Gasversorgung gesichert sei. Damit war die letzte rechtliche Hürde für die Inbetriebnahmegenehmigung für North Stream 2 genommen. Energiepolitischer Wunsch und geopolitische Wirklichkeit konnten kaum weiter auseinanderliegen.
Der folgende Lieferstopp russischen Gases und die anschließende Zerstörung der Pipelines von North Stream 1 und 2 in den Tiefen der Ostsee brachten einen der zentralen Stützpfeiler deutscher Energieund Industriepolitik zum Einsturz. Vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine stammten 55 Prozent der Gaslieferungen für Deutschland aus russischen Gasfeldern.11 Das war weit mehr als der europäische Durchschnitt von 40 Prozent.12 Mit Versiegen der russischen Lieferungen schossen die Gaspreise in Deutschland daher besonders in die Höhe – um mehr als das 18-Fache.13 Diese Entwicklung schlug in den Strommarkt durch, denn über das Marktdesign setzen Gaskraftwerke die Preise im Strommarkt (siehe Kapitel 3.6). Ergebnis: Auch Strompreise sind in der Spitze um das 13-Fache gestiegen.14 Einen solchen Schock musste die deutsche Wirtschaft der Nachkriegszeit noch nie verdauen. Gas und Strom machen zusammen rund zwei Drittel der deutschen Endenergieversorgung aus. Zwei Drittel der Energieversorgung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, des Exportweltmeisters Deutschland, aller unserer Unternehmen, Häuser und Fahrzeuge standen plötzlich im Feuer. Preise: vervielfacht. Infrastruktur für Ersatzlieferungen aus anderen Ländern? Fehlanzeige. Es fällt schwer, das Ausmaß dieser Krise angemessen in Worte zu fassen.
Im Rückblick ist die deutsche Wirtschaft deutlich besser durch die Krise gekommen, als viele zuvor befürchtet haben – dank zahlreicher Gegenmaßnahmen, gegenseitiger Hilfe europäischer Partner und einem letztendlich gelungenen Kraftakt von Unternehmen, Menschen und Politik. Keine der düsteren Prognosen ist eingetreten – es gab weder Gasrationierungen noch eine Rezession mit bis zu zehn Prozent Verlust an Wirtschaftsleistung. Doch die deutsche Wirtschaft hat stärker gelitten als die in anderen Ländern. Weil ihre Abhängigkeit von billigem russischem Gas größer war und weil Deutschland mehr Industrie und damit Energiepreisabhängigkeit hat als andere Länder.
Auch nach Abklingen der akuten Notsituation der Energiekrise der Jahre 2022 und 2023 bleiben Energiekosten für viele Unternehmen ein Standortfaktor. Die Preise für Gas liegen aktuell immer noch über Vorkrisenniveau aufgrund hoher Einfuhrmengen von teurem Offshore-Gas aus Norwegen und Flüssiggas (LNG) aus Übersee. An die niedrigen Kosten von Pipelinegas kommt per Frachter über die Weltmeere transportiertes verflüssigtes LNG strukturell nicht ran. Und die Preise für Strom? Liegen im Energiehandel ebenfalls noch deutlich über Vorkrisenniveau. Sowohl aufgrund der gestiegenen Gaspreise um den Faktor 2 im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2018, als auch aufgrund der im selben Zeitraum um den Faktor 3 gestiegenen CO2-Preise.15 Im Ergebnis zahlen industrielle Großverbraucher, deren Stromrechnung nicht von staatlichen Abgaben und Umlagen dominiert werden, noch immer deutlich mehr für Strom als früher. Hingegen zahlen die anderen 99 Prozent aller Stromkundinnen und Stromkunden sowie kleinere und mittlere Unternehmen heute für Strom weniger als vor der Krise. Zumindest, wenn sie einen neuen Vertrag abschließen und so verdeckte Preiserhöhungen von Versorgern vermeiden. Grund für diesen gravierenden Unterschied zwischen industriellen Großverbrauchern und allen anderen Stromkunden ist eine Umstellung der Finanzierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Früher wurde diese über die sogenannte EEG-Umlage von allen nicht-privilegierten Stromkunden über eine Umlage auf den Strompreis geleistet. Im Jahr 2023 wurde diese Umlage vollständig abgeschafft und die Finanzierung auf eine Steuerfinanzierung umgestellt. Diese entlastet die Endkundenpreise um immerhin 6,5 Cent pro Kilowattstunde (netto) gegenüber dem Jahr 2021 – in ähnlicher Höhe waren Energie- und Netzkosten seitdem gestiegen.
Für die deutsche Industriepolitik markieren die Krisen und die gescheiterte Gasstrategie einen tiefen Einschnitt. Denn so oder so ist klar: Die Zeiten extrem billigen Gases sind endgültig vorbei. Nicht nur aufgrund der höheren Kosten von Offshore- und LNG-Gas, sondern auch aufgrund steigender Preise für CO2-Emissionsrechte. Energie- und CO2-intensive Fertigung in Deutschland steht längerfristig unter großem Kostendruck.
Besonderheit #3: Deutschland ist Exportnation
Womit wir bei der dritten Sonderrolle Deutschlands im europäischen Vergleich wären: Deutschland ist Exportland. Über 43 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts stammten im Jahr 2023 aus dem Export. Die großen EU-Länder wie Frankreich, Italien und Spanien haben Exportquoten zwischen 33 Prozent und 38 Prozent.16 Leidet die Welt an Krisen wie Corona oder Energiepreisexplosion, leidet Deutschland besonders. Und sind Unternehmen in anderen Ländern besser in der Lage, Märkte mit neuen Produkten zu erobern, wie zum Beispiel die chinesische Automobilindustrie mit Elektrofahrzeugen, leidet Deutschland gleich doppelt.
Was also tun? Finden wir einen Weg zurück in die »gute alte Zeit« oder macht es mehr Sinn, sich auf eine dauerhaft veränderte Welt einzustellen? Ist die Modernisierung unseres Energie- und Mobilitätssektors Teil des Problems oder vielleicht doch Teil der Lösung?
Spoiler: Weltweit ist die Antwort längst klar. Denn die Welt steckt inmitten einer Industrierevolution bei Energie und Mobilität – in der vollen historischen Bedeutung des Wortes »Revolution«. Die Energiewelt dreht sich global in atemberaubender Geschwindigkeit und in der Menschheitsgeschichte nie da gewesenem Ausmaß. Grund genug also für einen historischen Blick von ganz weit oben auf die Geschehnisse.
AUF DEN PUNKT
Deutschland hat im internationalen Vergleich eine besondere Ausgangsposition bei der Dekarbonisierung seiner Wirtschaft: hoher Industrieanteil, hohe Exportquote und vormals billiges Pipeline-Gas aus Russland als wichtige industriepolitische Grundlage.Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat in den Jahren 2022/23 eine schwere Energiepreiskrise ausgelöst. Die deutsche Wirtschaft hat diese viel besser gemeistert, als zu Beginn befürchtet. Strukturell höhere Gaspreise belasten sie jedoch weiterhin.1.1 Die vierte Energierevolution hat längst begonnen
»Am Anfang war das Feuer«. In anderen Worten: Holz war die erste Energiequelle, die sich der Mensch systematisch zur Nutzung erschlossen hat. Als gesichert gilt diese Verwendung von Biomasse für Wärme, Licht und Schutz vor Raubtieren seit rund einer Million Jahren. Erst viel später kam die Wasserkraft als weitere, frei in der Natur verfügbare Energiequelle dazu. Erst diente sie dem Betrieb von Schöpfrädern und damit zur Bewässerung von Feldern, später als Antrieb für alle möglichen Arbeitsmaschinen. Historiker vermuten, dass die Geschichte der Wasserkraft bereits vor etwa 5.000 Jahren in China begann und vor etwa 3.500 Jahren in Europa. Wobei die damaligen Mengen der Biomasse- und Wasserkraftnutzung winzig waren im heutigen Vergleich: Rund um Christi Geburt lebten einige Hundert Millionen Menschen auf der Erde – ohne im globalen Maßstab nennenswerten Energieverbrauch.
Die erste Energierevolution: Kohle überflügelt Biomasse
Bis zum Jahr 1800 wuchs die Weltbevölkerung auf etwa 1 Milliarde Menschen. Wärme, Licht und Kraft wurden unverändert über Biomasse und Wasserkraft gedeckt sowie über Nutztiere. Doch die erste Energierevolution näherte sich. Im historischen Vergleich zu späteren Umbrüchen schlich sie sich auf vergleichsweise leisen Sohlen an. Bereits im Zuge der Vorindustrialisierung wurden immer größere Energiemengen und Leistungen benötigt. Kohle statt Holz war die Lösung. Sie war in großen Mengen verfügbar, hat eine hohe Energiedichte und lässt sich gut transportieren. Mit der immer weiter um sich greifenden Industrialisierung nahm die Kohleförderung und -verbrennung ab etwa 1850 immer schneller zu. Im Ergebnis hatte sich der weltweite Energieverbrauch bis zum Jahr 1900 mehr als verdoppelt.17 Der Löwenanteil dieses gewachsenen Energiehungers wurde mit der Verbrennung von Kohle gestillt. Ihr Marktanteil lag bereits bei über 45 Prozent des weltweiten Primärenergiebedarfs.18 Zwar sind auch die absoluten Mengen klassisch genutzter Biomasse und Wasserkraft bis 1900 weiter gewachsen. Sie machten dennoch nur noch knapp über 50 Prozent der weltweiten Energieversorgung aus.19 Die erste Energierevolution war entschieden, die Kohle blieb als Gewinnerin auf dem Platz. Davon kündete auch der Gestank aus den Fabrikschloten, der sich in den Straßen der Städte zunehmend festsetzte.
Es dauerte ungefähr 40 Jahre, bis sich auf diesem Weg der weltweite Energieverbrauch erneut verdoppelt hatte. Die Kohle blieb in dieser Zeit mit stabil über 50 Prozent Anteil der wichtigste Energieträger. Doch die nächste Energierevolution warf ihre Schatten bereits voraus.
Abbildung 1: Primärenergieverbrauch weltweit nach Energieträger ab dem jeweiligen Zeitpunkt der massenhaften Nutzung und zeitliche Einordnung der vier erfolgreichen Energierevolutionen. In der Menschheitsgeschichte ist noch keine Energietechnologie so schnell gewachsen wie die beiden Erneuerbaren Wind und Sonne
20
(eigene Darstellung).
Stammten im Jahr 1900 nur etwas über 1 Prozent des Weltenergieverbrauchs aus der Verbrennung von Öl, waren es 1940 bereits 11 Prozent.21 Auch die gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfundene Stromerzeugung aus Wasserkraft und die Verbrennung von Gas wuchsen, aber noch auf vernachlässigbarem Niveau.
Die zweite und dritte Energierevolution: Öl und Gas überflügeln Kohle
Nach dem Zweiten Weltkrieg polterte die zweite Energierevolution dann regelrecht durch die Tür – das Ölzeitalter hatte begonnen. Bereits in den 1950er-Jahren verdrängte das Öl die Biomasse von ihrem bisherigen zweiten Platz und klaute auch der Kohle Marktanteile. Um das Jahr 1965 stand Öl mit 34 Prozent Anteil am weltweiten Energieverbrauch schon auf Platz 1 vor der Kohle. Gleichzeitig hatte auch die nächste Verdopplung des Welternergieverbrauchs stattgefunden. Bereits 12 Prozent dieses Verbrauchs wurden zudem über die Verbrennung von Erdgas gedeckt.22 Dominierte Erdöl den Mobilitätssektor, bahnte sich mit der Nutzung von Erdgas bereits die dritte Energierevolution in der Wärmeversorgung und in der Industrie ihren Weg. Gasheizung und Gasherd statt Kohle, aber auch Gaslampen in der öffentlichen Beleuchtung steigerten den Komfort und die Leistungsfähigkeit der Energieversorgung deutlich. Und auch in großen Industrieprozessen wie etwa der Synthese von Ammoniak für den massenhaften Einsatz von Dünger oder als leistungsfähigerer Ersatz von Kohle wurde Gas schnell unabkömmlich. So kam es, dass seit dem Jahr 1967 Öl und Gas zusammen über 50 Prozent des Energiebedarfs der Menschheit decken.23
Die ausgefallene vierte Energierevolution: Atomenergie hebt nicht ab
Es überrascht nicht, dass die vierte Energierevolution zu diesem Zeitpunkt längst ausgerufen war. Denn der immer schneller wachsende Energiehunger der Menschheit rief nach der nächsten, noch gewaltigeren technischen Antwort. Und so begann Anfang der 1960er-Jahre die zivile Nutzung der Atomkraft. Wobei diese nur ganz zu verstehen ist, wenn man sie gleichzeitig als militärtechnische Grundlage des atomaren Wettrüstens begreift. Denn nur wer über eine eigene Atomindustrie verfügt, hat Zugang zu dem benötigten Know-how und zu waffenfähigem Material zum Bau eigener Atombomben.
»Too cheap to meter«, also zu billig, um sie überhaupt zu messen und abzurechnen, werde die Atomkraft eines Tages werden, hatte der Vorsitzende der US-amerikanischen Atomenergiekommission Lewis Strauss im Jahr 1954 vollmundig angekündigt.24 Doch anders als ihre revolutionären Vorgänger vermochte es die Atomenergie nicht, wirklich nennenswert ins weltweite Energiegeschehen einzugreifen. Als sich 1984 zum nächsten Mal der weltweite Energieverbrauch verdoppelt hatte – diesmal nach nur noch 19 Jahren –, lag der Anteil der Atomenergie erst bei 4 Prozent. Auch in den folgenden Jahrzehnten kam er nie über 6 Prozent hinaus.25 Die Atomenergie konnte ihr Versprechen geringer Kosten und Betriebsrisiken schlicht nicht einlösen (siehe Kapitel 5.1). Darüber hinaus war ein weiteres Wachstum für militärische Zwecke nicht mehr erforderlich. Alle Nuklearmächte sahen sich mit ausreichend industrieller Basis für Atomtechnologie und -materialien versorgt. Mehr Atomkraftwerke brauchte es für militärische Zwecke nicht, erst recht nicht nach dem Beginn von Glasnost und Perestroika. Ohne staatliche Unterstützung können aber in keinem Land die hohen Kosten und Risiken neuer Atomkraftwerke im Strommarkt erlöst werden. Daher fand die geplante atomare Energierevolution am Ende nicht statt. Ergebnis: Seit den 2000er-Jahren fällt nicht nur der Anteil, sondern auch der absolute Beitrag der Atomenergie zur weltweiten Energieversorgung, das heißt die reale weltweite Atomstromproduktion. Ihr Marktanteil ist heute wieder unter 4 Prozent gerutscht.26
Die längst begonnene vierte Energierevolution: Wind und Sonne überflügeln alles
Eine vierte Energierevolution findet dennoch gerade statt. Aber die dafür verwendeten Nuklearreaktionen sind sichere 150 Millionen Kilometer entfernt und laufen in der Sonne ab. Ihrer Dynamik schadet das nicht: Der Hochlauf der Nutzung erneuerbarer Energien seit den 2000er-Jahren wächst in einer Geschwindigkeit, die noch keine Energierevolution zuvor geschafft hat. Etwa 6 Prozent des Weltenergiebedarfs stammten im Jahr 2023 bereits aus diesen Quellen.27 In absoluten Zahlen entspricht das etwa 10.000 Terawattstunden. Wohlmeinend gerechnet hat Öl für diese Marke drei Jahrzehnte länger benötigt. Lag der Marktanteil von Öl und Gas im Jahr 2000 noch bei 55 Prozent, ist er im Jahr 2022 erstmalig seit den 1960er-Jahren wieder unter 50 Prozent gefallen.28
Und eine weitere gute Nachricht spielt dieser vierten, nunmehr endlich sauberen Energierevolution in die Karten: Die letzte Verdopplung des bis dato unstillbaren Energiehungers der Menschheit war erst im Jahr 2021 erreicht. Zeitkonstante: 37 Jahre. Hohe Dynamik bei der sauberen Energiebereitstellung aus Wind und Sonne und bald sogar sinkende Verbräuche (siehe Kapitel 3.5) bilden eine perfekte Welle. Kam das Kohlezeitalter noch auf leisen Sohlen daher und polterte das Öl- und Gaszeitalter bereits deutlich forscher durch die Tür, werden die erneuerbaren Energien die Nutzung fossiler Energien in den nächsten wenigen Jahrzehnten wie ein Tsunami überrollen.
Das klingt jetzt zu euphorisch? Die Zahlen sagen genau das. Und zwar sogar anhand der in diesem Abschnitt verwendeten Zahlen der Energieverbräuche und Anteile der Primärenergieträger.29 Doch Primärenergie ist das falsche Maß, um die Bedeutung eines Energieträgers zu bewerten. Denn bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas gehen über 70 Prozent der eingesetzten Primärenergie als Abwärme verloren. Bei der direkten Erzeugung von Strom aus Wind und Sonne, bei ihrer Nutzung in Motoren, Wärmepumpen und Industrieprozessen etc. fallen viel geringere Verluste an. Jede Kilowattstunde Wind- und Solarstrom verdrängt auf diese Weise etwa 3 Kilowattstunden Erdöl oder Erdgas (siehe Kapitel 1.2). Blickt man statt auf Primär- auf die Nutzenergie, also das, was wir in Maschinen aus der eingesetzten Primärenergie machen, ist die Entwicklung der erneuerbaren Energien nochmals um einen Faktor 3 beeindruckender. Hätten Sie gedacht, dass die Menschheit schon in wenigen Jahren mehr Nutzenergie aus Wind und Sonne zieht als aus der gesamten Erdölförderung (siehe Abbildung 2)?
Abbildung 2: Vergleich von Primär- und Nutzenergie weltweit für Öl (Mobilität) sowie Sonne und Wind. Unter 30 Prozent der Primärenergie aus Erdöl sind tatsächlich als Antriebsenergie nutzbar, der Rest geht als Abwärme von Motoren verloren oder bereits bei der Aufbereitung in der Raffinerie und beim Transport. Bei elektrischen Anwendungen liegt die Effizienz der Wirkungskette von der Stromquelle bis zur Straße im Schnitt bei über 70 Prozent. Im Vergleich der Nutzenergien beider Energieträger zeigt sich, dass die Menschheit bereits in wenigen Jahren mehr Nutzenergie aus Wind und Sonne ziehen wird als aus der gesamten Erdölförderung
30
(eigene Berechnung und Darstellung).
Das Neue: erstmalig wird nicht nur überflügelt, sondern verdrängt
Historisch ist die Entwicklung der erneuerbaren Energien aber nicht nur aufgrund ihres atemberaubenden Tempos. Die vierte Energierevolution ist die erste, die tatsächlich andere Energieträger aus dem Markt drängt. Kamen bisher neue Energieträger immer nur hinzu und haben ihren Vorgängern lediglich relative Anteile am wachsenden Energieverbrauch streitig gemacht, verdrängen Wind- und Solarstrom Kohle, Öl und Gas auch in absoluten Mengen. Die internationale Energieagentur IEA sagt »Peak Oil«, also den historischen Höchststand der weltweiten Nutzung von Erdöl, für das Jahr 2024 oder 2025 vorher.31 In vielen Ländern sinkt auch die Kohleverstromung bereits massiv. Im Heimatland der Kohleverstromung, UK, wurde im September 2024 das letzte Kohlekraftwerk abgestellt. Das erste hatte Thomas Edison im Jahr 1882 in London in Betrieb genommen. Weltweit treiben vor allem China und Indien noch die Gesamtnachfrage nach Kohle. Doch auch das wird am Ende Geschichte sein. Denn dieses Wachstum geht auf den gigantischen Energiehunger dieser Volkswirtschaften und Entscheidungen zum Bau neuer Kohlekraftwerke vor vielen Jahren zurück. Noch schneller wächst auch hier der Ausbau erneuerbarer Energien. Auch in China beginnen Wind und Sonne bereits die Kohleverstromung zu verdrängen.32
Aus historischer Perspektive und über Jahrzehnte hinweg betrachtet, sind Umbrüche auch in der weltweiten Energieversorgung also etwas ganz Normales. Und wie zuvor ist auch die aktuelle vierte Energierevolution eine industrielle Revolution. Sie ist zwar entscheidend für die Vermeidung einer harten Klimakatastrophe, aber das macht sie nicht zur politischen Revolution. Erneuerbare Energien verdrängen Kohle, Öl und Gas durch niedrigere Kosten und höhere Leistungsfähigkeit, so wie frühere Energieträger ihre Vorgänger verdrängt haben (siehe Kapitel 1.2).
So erklärt sich auch die Reihenfolge des Umbruchs in den einzelnen Sektoren: Gestartet im Energiesektor verdrängen Sonne und Wind erst die Kohleverstromung – die älteste mengenmäßig relevante »moderne« Energiequelle. Doch zusammen mit Batteriespeichern klauen erneuerbare Energien bereits heute auch der Gasverstromung erste Marktanteile. Über die »große Elektrifizierung« hat zudem die Verdrängung der Gasnutzung für Wärme sowie der Ölnutzung für Mobilität begonnen (siehe Kapitel 3.5).
Diese Entwicklungen sind so absehbar, dass weltweit Regierungen regelrecht aufgeschreckt sind und mit groß angelegten staatlichen Programmen massiv in den Aufbau von Technologie, Fertigung und Marktanteilen für ihre Länder und Unternehmen investieren (siehe Kapitel 1.5). Bitter, aber wahr: Der Klimawandel allein hätte ein solches Maß an Aktivität nie hervorrufen können. Aber was ist es dann? »It’s the efficiency, stupid!«
AUF DEN PUNKT
In der Geschichte menschlicher Energienutzung gab es bislang drei Energierevolutionen: mit der Industrialisierung (Kohle), der Entwicklung der Automobilität (Öl) und in der Heiztechnik (Erdgas).Noch keine Energietechnik ist in der Menschheitsgeschichte schneller gewachsen als die Stromerzeugung aus Wind und Sonne, der aktuellen vierten Revolution.Bereits in zwei bis drei Jahren wird die Menschheit mehr Nutzenergie aus Wind und Sonne beziehen als aus ihrem gesamten Erdölverbrauch.Der Beitrag der Atomenergie zur Energieversorgung ist seit dem Jahrtausendwechsel rückläufig. Diese versuchte Revolution wurde aus Kosten- und Zeitgründen abgebrochen.1.2 »It’s the efficiency, stupid!«
Mit dieser Anleihe beim früheren US-Präsidenten Bill Clinton ist eigentlich alles Wesentliche erklärt: Warum Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen mittlerweile die globale Investitionstätigkeit im Bereich Energie dominieren. Warum Elektrofahrzeuge in gut absehbarer Zeit den Verbrenner ablösen werden. Und warum Heizen mit Wärmepumpen bald das Normalste der Welt sein wird, sogar in Deutschland.
Zwar werden diese Themen bei uns noch immer leidenschaftlich diskutiert und von vielen mit parteipolitischen Vorlieben gleichgesetzt. Denn wenn man die Dinge »technologieoffen« betrachtet, analysieren einige, sei die Zukunft längst nicht so klar. Dabei übersehen sie allerdings, dass hinter der sogenannten großen Elektrifizierung eine simple, industrielle Logik steht. Diese Logik funktioniert in drei einfachen Denkschritten. Schritt eins: Effizienz senkt die Kosten. Schritt zwei: Elektrische Anwendungen sind in der Regel die leistungsfähigsten und komfortabelsten. Und Schritt drei: Sie sind auch die saubersten.
In vielen Lebensbereichen hat diese Logik schon längst dazu geführt, dass Verbrennungsprozesse verdrängt wurden. Bei der Stromerzeugung ist diese Entwicklung derzeit in vollem Gange, und auch beim Heizen und Fahren ist sie nicht aufzuhalten. Aber der Reihe nach.
Vom Lagerfeuer zur Wärmepumpe – eine kurze Geschichte des Heizens
Die Beherrschung des Feuers bestimmte von Anfang an die Entwicklung der Menschheit. Schon die Neandertaler nutzten es gezielt, es war ein Meilenstein für den Fortschritt. Flammen bedeuteten Licht, Wärme und Schutz. Ein guter Lohn für den hohen Aufwand des Entzündens und Unterhaltens von Feuer. Technikgeschichtlich war das Kochen von Speisen am Lagerfeuer ein gewaltiger Schritt, der unsere Ernährung massiv nach vorn brachte. Allerdings: Aus heutiger Sicht war es eine grotesk ineffiziente und gesundheitsschädliche Methode, Essen zuzubereiten. Ein gut aufgebautes Lagerfeuer überträgt nur wenige Prozent der im Holz enthaltenen Energie tatsächlich auf die Speisen – wenn man nur die Zeit des Zubereitens rechnet, also ohne das Anfeuern und Ausglimmen. In der Höhle verwendet, schafft ein Lagerfeuer zwar zusätzliches Licht und Wärme. Aber eben auch gesundheitsschädliche und im ungünstigsten Fall tödliche Verbrennungsgase. Gezielte Temperaturregelung: auch eher schwierig.
Es gehört zur Technologiegeschichte, dass der Mensch immer auch gegen die Unzulänglichkeiten seiner eigenen Erfindungen anarbeitet. Deswegen entwickelt er sie laufend weiter – oft in kleinen Schritten, manchmal aber auch in größeren Sprüngen. In der logischen Folge wurde Feuer zum Kochen in immer ausgeklügelteren Formen von Steinöfen und später Lehmöfen eingehegt und nutzbar gemacht. Die Ziele: die Effizienz des Vorgangs zu steigern, sparsamere und leistungsfähigere Brennstoffe einzusetzen und die schädlichen Verbrennungsgase von Mensch und Kochgut fernzuhalten. Es waren auch Effizienzgründe, aus denen man Bäckereien neben Badehäusern gebaut hat – Abwärmenutzung hat damals schon den Aufwand gesenkt.
Im 14. Jahrhundert begann dann der Siegeszug des Kachelofens, ab dem 18. Jahrhundert sogar in Verbindung mit Schornsteinen, um Rauchgase und Ruß aus den Räumen zu verbannen. Zwar wurde bereits auf der Weltausstellung 1851 in London der erste Gasherd vorgestellt, aber erst ab Ende des 19. Jahrhunderts und mit zunehmender Verbreitung von Gasnetzen konnte er sich nach und nach durchsetzen. Der Zwischenstand im Streben nach Effizienz und Sauberkeit, Leistung und Komfort: Bis zu 40 Prozent der im Gas enthaltenen Energie eines modernen Gaskochfelds kommen tatsächlich im Topf an. Methan verbrennt recht sauber, das Ein- und Ausschalten geht einfach.
Doch Menschen und damit die Geschichte stehen selten still (und wenn doch, dann nie sonderlich lange). Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts kam der Elektroherd ins Spiel, und der nächste bedeutsame Entwicklungsschritt folgte: vom Verbrennen von Holz oder Gas zum elektrischen Antrieb. Weitere rund 10 Prozent Effizienzsteigerung waren geschafft. Aus heutiger Sicht sind die Einwände amüsant, die es damals gegen die ersten Elektroherde gab: das Essen »schmecke elektrisch«, lautete etwa ein weitverbreitetes Vorurteil.
Dennoch, und obwohl Elektroherde langsamer reagieren und weniger präzises Kochen erlauben, haben sie sich durchgesetzt. Nach dem Zwischenschritt des Ceran-Kochfelds dominieren seit ungefähr zehn Jahren Induktionskochfelder den Markt. Der aktuelle Zwischenstand der Effizienz-Entwicklung: Über 80 Prozent der eingesetzten Energie landen im Topf. Abgase sind schon lange Geschichte, und kurze Ansprechzeiten sorgen für hohen Kochkomfort. Strom schlägt Verbrennen in allen Belangen.
Es werde Licht – von der Fackel zur LED-Lampe
Eine ähnliche Geschichte von Effizienz und Komfort erzählt die Entwicklung moderner Lichtquellen – vom Lagerfeuer über die Fackel, den mittelalterlichen Kienspan, die Fett- und Öllampen bis hin zur Kerze. Als sich elektrisches Licht nach 1880 erst im öffentlichen Raum und später in Privathäusern gegen Kerzen und Öllampen durchsetzte, war der so erzielte Fortschritt enorm. Davor hatte künstliche Beleuchtung maximal dafür gereicht, dass man nachts nicht stolperte oder gegen Gegenstände lief. Jetzt dagegen konnte man sich auch im Dunkeln sicher fühlen, abends arbeiten oder lesen.
Wer für abendliche Gesellschaften einen Innenraum hell erleuchten wollte, hatte zuvor unzählige Kerzenleuchter gebraucht. Was auf uns heute romantisch wirkt, war in Wahrheit ein gewaltiger Aufwand, große Energieverschwendung und auch nicht unbedingt gesund. Eine Kerze kann gerade einmal ein Prozent der im Wachs enthaltenen Energie in Licht umwandeln. Der Rest geht als Wärme verloren. Und leisten konnten sich Kerzen nur wohlhabende Menschen. Gleichzeitig verbrauchen Kerzen den Luftsauerstoff und geben Verbrennungsgase und Ruß ab. Schon mit der Edison-Glühlampe konnten nach 1880 wenige elektrische Lampen dieselbe Lichtleistung erbringen wie ein ganzer Raum voll Kerzenleuchter und dabei gleichzeitig ein breiteres und helleres Lichtspektrum bieten. Ohne Sauerstoffverbrauch und Ruß, dafür mit einem Knopf zum Ein- und Ausschalten. Am Ende der Entwicklung kamen moderne Glühlampen auf bis zu fünf Prozent Effizienz bei der Wandlung der eingesetzten Energie des Stroms in Licht. Nach den technischen Evolutionsschritten Halogenlampen (rund 10 Prozent) und Energiesparlampen (rund 20 Prozent) liegen moderne LED-Lampen heute bei über 35 Prozent bei Standardprodukten und noch höher für »High power«-Varianten.33 Auch hier geht die Entwicklung weiter und ist noch Luft nach oben.
Ein interessanter Nebenaspekt: Zu Beginn erschwerten der geringere Komfort, die schwächere Lichtqualität und die höheren Anschaffungskosten den Durchbruch der LED auch für die Anwendung in Räumen. Ihre durchschnittlichen Lebensdauerkosten waren zwar schon lange kleiner als die von normalen Glühlampen, auch wegen deren kürzerer Lebensdauer. Aber wer überschlägt schon ernsthaft Betriebskosten, wenn er im Supermarktregal schnell zugreift?
Am Ende hat die Europäische Union per Ordnungspolitik die Umstellung auf LED beschleunigt. Schaut man auf die heute massiv gewachsene Vielfalt an Leuchtmitteln – alle auf der Basis von LED-Technik –, lässt sich hier kein Schaden erkennen. Eher im Gegenteil: Von schicken Retro-Designs mit sichtbaren Glühwendeln bis zu den verrücktesten Bauformen und Farbeffekten ist alles zu haben. Und die Kosten? Aufgrund industrieller Massenfertigung sind sie auf einen Bruchteil gesunken.
Es werde Kraft – vom Pferd zum Elektromotor
Leistungs- und Effizienzsteigerungen und damit die Senkung von Kosten, ob für die Industrie oder für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sind immer Treiber industrieller Entwicklung gewesen. Auch als die ersten Elektromotoren in Fabrikanlagen Einzug erhielten oder die ersten Automobile die Pferdekutschen verdrängten, geschah das aus genau diesen Gründen. Und selbst wenn viele dieser Veränderungen aus heutiger Perspektive banal wirken: Oft waren es Revolutionen mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Alltag der Menschen. Ganze Branchen wurden abgeschafft oder in Nischen verbannt: vom Stellmacher bis zum Kutscher, vom Kerzenmacher bis zum Treidelknecht und kohlenschaufelnden Heizer.
Warum tun wir uns dann noch so unglaublich schwer, auch bei der Energieerzeugung, beim Fahren und Heizen die Segnungen des Fortschritts zu genießen? Oder gar eine wirtschaftliche Zukunft daraus zu entwickeln? Schließlich waren deutsche Unternehmen bei vielen der genannten Umbrüche ursprünglich Vorreiter und sind zu tragenden Säulen unserer Wirtschaft geworden. Wenn es um Verbrennungsmotoren, Kraftwerkstechnik, elektrische Maschinen oder Transformatoren geht, haben Namen wie Siemens, Otto, Benz oder Diesel die Technikgeschichte tief geprägt. Vielleicht fällt es ja gerade deshalb in Deutschland schwerer als anderswo, sich vom Alten zu verabschieden: weil das Verbrennen von Sachen bei uns regelrecht zum Kulturgut geworden ist.
Die Größe macht’s nicht, sondern die Menge
Hinzu kommt ein Missverständnis, das auch in anderen Industrien erst ausgeräumt werden musste: die falsche Annahme, dass Kostensenkungen vor allem über Größe und Leistungsdichte funktionieren. Von Kohle zu Öl und Gas oder gar zur Atomkraft: Die Energieumwandlung fand in immer beeindruckenderen Leistungseinheiten auf immer engerem Raum statt. Und jetzt sollen plötzlich Millionen relativ kleiner und räumlich weit voneinander entfernter Energiewandler wie Solar- und Windkraftanlagen dieselbe Leistungsfähigkeit entwickeln? Das soll ernsthaft Hightech sein? Wäre nicht Kernfusion die nächste, viel logischere Evolutionsstufe?
Dass weiträumig verteilte Systeme durchaus Vorteile bieten, mussten Firmen wie Nixdorf und IBM in den 1990er-Jahren lernen, als die sogenannte mittlere Datentechnik vom Personal Computer (PC) verdrängt wurde. Verteilte Systeme erzielen die Kostensenkungen über ihre Masse, nicht über ihre Größe. Sie sind resilienter, also weniger störanfällig. Zudem können sie am Ort der Nutzung viel zielgenauer organisiert werden. Die Energiewirtschaft von heute hat verstanden, dass die Abkehr von der Verbrennung und die Hinwendung zu erneuerbaren Energien solche Kosten- und Nutzenvorteile bietet. Zugleich bündelt sie größere Zahlen an Solarmodulen oder Windrädern in Kraftwerken bis zu Hunderten Megawatt Leistung – der früher üblichen Dimension auch im klassischen Kraftwerksbau. Doch dazu später mehr (siehe Kapitel 1.4). Zunächst zurück zur Effizienz, jetzt in der Mobilität.
Erster Blick nach vorn: Effizienz gewinnt auch beim Fahren
Für Elektrofahrzeuge gelten heute tatsächlich noch einige der bekannten, nachvollziehbaren Einwände. Die Anschaffungskosten sind relativ hoch, die Reichweiten der Batterien niedriger als gewohnt. In einigen Jahren werden wir aber auch darüber schmunzeln. Denn es ändert nichts daran: Es sind die großen Effizienz-, Leistungs- und damit auch Kostenvorteile, der Komfortgewinn und die ökologischen Vorzüge elektrischer Anwendungen, die die genannten Veränderungen treiben – auch bei der Mobilität.