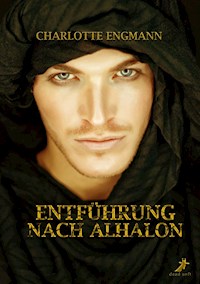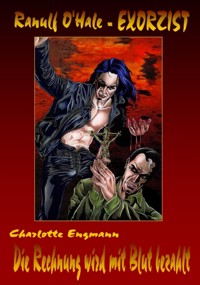Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Magier Ahrunan konnte den Scheiterhaufen der Inquisition lange entkommen, da er das Geheimnis seiner Zaubermacht zu bewahren versteht. Auf der Flucht vor den Schrecken des Krieges verschlägt es ihn jedoch auf die Feste Terredin, wo Markgraf Jandor um seine Hexenkräfte weiß. Der Graf verlangt von Ahrunan, dass er die Burg gegen die Armee des Königs verteidigt, aber der Magier weigert sich. Denn er sieht das Gewitter der Gewalt, das sich über Terredin zusammenbraut. Bald stehen die königstreuen Truppen vor der abtrün¬nigen Feste, unter ihnen Ranyth von Sarlingen. Der junge Adelige träumt von ruhmreichen Kämpfen und glorreichen Schlachten, doch er erwacht in einem Albtraum, als der Mahlstrom des Krieges Freund und Feind verschlingt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charlotte Engmann
und Christel Scheja
Sturmbrecher
Impressum:
© dead soft verlag, Mettingen 2007
http://www.deadsoft.de
© Charlotte Engmann und Christel Scheja
Cover: Irene Repp
http://www.deadsoft.de
Bildrechte:
© breaker maximus – shutterstock.com
2. Auflage 2016
ISBN 978-3-934442-37-5
Prolog
Glühender Schmerz riss Ahrunan aus seiner Ohnmacht. Die gleiche brennende Pein, die ihm das Bewusstsein geraubt hatte, rief ihn zurück aus der beschützenden Dunkelheit. Ein Schrei gellte über den Dorfplatz, doch erst, als der Schmerz nachließ, wurde ihm bewusst, dass er ihn ausgestoßen hatte.
»Gestehe, und ich werde dich von deinen Qualen erlösen!« Der Inquisitor in seiner roten Robe winkte dem Folterknecht, das glühende Eisen zurück in das Kohlebecken zu legen, damit es neue Hitze trank. »Nun sprich, Elender! Bekenne deine Schuld und zeige mir das Mal deiner Abscheulichkeit. Lass mich deine Schlangenaugen sehen!«
Niemals!, durchfuhr es Ahrunan. Wenn er den Illusionszauber aufhob, der seine senkrecht geschlitzten Pupillen verbarg, würde der Inquisitor ihn sofort den reinigenden Flammen Aurons übergeben. Er würde sein Leben auf dem Scheiterhaufen beenden, denn in Kallidorn musste ein jeder sterben, der über die Augen einer Schlange und somit über die Gabe der Magie verfügte.
Wortlos starrte Ahrunan den Inquisitor an. Wie alle Priester des Auron trug er eine blutrote Tunika, die bis zu seinen Fußknöcheln reichte. Über jede Schulter fiel eine breite, feuerfarbene Schärpe, wobei auf der oben liegenden das Zeichen der Inquisitoren prangte: Drei schwarze Flammenzungen verhießen allen Hexern und Ketzern den Tod. Unter dem kupferfarbenen Schopf funkelten saphirblaue Augen voller Hass, und die Wangen glühten vor fanatischem Eifer.
In hilfloser Wut zerrte Ahrunan an seinen Fesseln, doch sie banden ihn fest an den Boden einer Mistkarre, die die Tempelsoldaten in die Senkrechte gekippt hatten. Im Schutze der Nacht war der Inquisitor mit seinen Schergen wie ein Rudel Wölfe in das Dorf eingefallen. Sie hatten Ahrunan im Schlaf überwältigt, und ehe er sich verteidigen konnte, hatten sie ihn in Ketten geschlagen, in Fesseln aus gesegnetem Silber, die den Fluss seiner Magie hemmten. Er spürte die Kraft durch seinen Körper rauschen, geschürt durch Schmerz und Wut, doch anstatt wie sonst aus seinen Händen zu brechen, schoss die Zaubermacht aus den Armen zurück in seine Brust.
»Ja, winde dich nur wie die Schlange, die du bist«, wetterte der Inquisitor. »Mit dir ist das Verderben über diese Menschen gekommen. Du hast sie vom rechten Weg abgebracht, von der Straße der Erlösung, die allein Auron seinen Kindern bereitet. Du hast sie mit deinen Lügen verführt und ihre Söhne auf den Pfad der widernatürlichen Sünden gelockt.«
Ahrunan biss die Zähne zusammen. Er warf einen Blick auf die Bauern, die die Tempelsoldaten wie Schlachtvieh auf dem Dorfplatz zusammengetrieben hatten. Nein, er hatte keinen der jungen Männer verführt, obwohl es dafür mehr als eine Gelegenheit gegeben hatte. Sein Blick fiel auf den Großbauern Errock, der abseits von den anderen stand, mit zwei Wachen an seiner Seite. Er hatte Ahrunan an die Priesterschaft verraten und den Inquisitor ins Dorf geholt, denn sein Einfluss war durch den fremden Baumeister geschwunden. Unter Ahrunans Anleitung hatten die Bauern neue Bewässerungsanlagen für ihre Felder errichtet, sodass sie nicht mehr von dem Mühlenbach abhängig waren, für den Errock die Wasserrechte besaß.
»Du hast sie mit deiner Widerwärtigkeit vergiftet«, tönte der Inquisitor. »Doch die Saat des Bösen wird keine Früchte tragen!« Er befahl seinen Soldaten, die Dörfler in die nächste Scheune zu treiben, und Ahrunan fühlte, wie sein Herz gefror. Mit wachsender Angst hörte er eine Frau aufschluchzen, und ein paar Kinder weinten voller Furcht, als die Bewaffneten sie in das Dunkel der Scheune drängten. Das Tor schloss sich mit Donnerhall und wurde mit schweren Balken verschlossen.
»Wisse, dies ist allein dein Werk. Deine Schuld!«
»Nein!«, schrie Ahrunan. Wie eine eiskalte Woge schwemmte das Entsetzen über ihn hinweg. Er riss an seinen Fesseln, tobte, fluchte und brüllte, doch der Inquisitor beachtete ihn nicht weiter. Mit glühendem Blick befahl er seinen Soldaten, die Scheune anzuzünden, damit die Flammen die befleckten Seelen der Dorfbewohner reinigten. Und die Bewaffneten gehorchten. Sie warfen brennende Fackeln in das strohgedeckte Dach und legten Feuer an die Außenwände. Schnell erfassten die Flammen das trockene Holz. Sie eilten zum First hinauf und drangen in das Innere der Scheune. Die Dorfbewohner schrien in Todesangst, sie riefen um Hilfe und flehten um Gnade. Mit bloßen Fäusten hämmerten sie gegen das Tor, sie traten gegen die Wände, doch die Scheune blieb verschlossen. Es gab kein Entkommen.
Der Inquisitor griff nach dem Brandeisen. Wie trunken von seinem grausigen Tun wandte er sich wieder Ahrunan zu, um ihn erneut zu quälen. Das glühende Eisen berührte den Magier und biss in seine Haut. Der überwältigende Schmerz zerfetzte die Illusion. Die geschlitzten Pupillen wurden sichtbar in Ahrunans grünen Augen.
Der Inquisitor kreischte triumphierend. »Ich wusste es! Du dreifach verfluchtes Schlangenauge!«, bellte er. »Auron verbrenne dich!«
Er hob das Brandeisen, um das Herz des Magiers zu durchbohren, da brach der Sturm aus Ahrunans Augen. Eine Orkanböe traf den Inquisitor mit voller Wucht. Rücklings wurde er durch die Luft geschleudert und hart zu Boden geschlagen. Der Sturmwind erfasste ihn, schleifte ihn über den steinigen Platz und riss ihn erneut in die Höhe. Der Inquisitor wirbelte empor. Eine weitere Böe ergriff ihn und schmetterte ihn in die brennende Scheune, mitten unter seine Opfer. Schreie gellten. Panisch versuchten die Tempelsoldaten, ihren Herrn aus den Flammen zu retten, und Ahrunan nutzte den Moment ihrer Unaufmerksamkeit. Mit seiner neugewonnenen Kraft befreite er sich von seinen Fesseln. Die silbernen Ketten zersprangen unter der Wucht seines Zorns. Ein harsches Wort löste die Fußfesseln. Er streckte die Hand aus und wies auf den Großbauern.
»Errock!«, rief er den Verräter. Der Mann drehte sich zu ihm um. Er sah den Magier frei und ohne Fesseln, und seine Augen weiteten sich voller Entsetzen. Ein Wink mit lockerer Hand wob eine Illusion, verlieh Errock Ahrunans Erscheinung und dem Magier die Bauerngestalt.
»Wachen!«, rief Ahrunan nach seinen Feinden, die nun sein Werk vollenden sollten. »Das Schlangenauge! Es hat sich befreit! Ergreift den Hexer! Verbrennt ihn!«
Die Tempelsoldaten hörten auf seinen Ruf und packten den vermeintlichen Magier, um auch ihn ins Feuer zu stoßen. Ahrunan ergriff die Gelegenheit zur Flucht. Er wandte sich um und lief den Flammen davon, die an diesem Tag reiche Ernte gehalten hatten.
1. Gefährliche Geheimnisse
Ahrunan zügelte sein Pferd, als Zweige im Unterholz knackend zerbrachen. Eine zerlumpte Gestalt stolperte aus dem Dickicht, taumelte ein paar Schritte und brach auf dem steinigen Weg zusammen. Der Magier runzelte die Stirn. Lag vor ihm ein Bauer, ein Räuber oder Soldat? War der Mann krank oder verwundet? Der reglose Körper steckte in zerschlissenen Hosen und verdreckten Gamaschen, doch durch die Löcher der Wolljacke glänzte es metallisch wie von einer Rüstung hervor.
Also ein Räuber, der von Soldaten, oder ein Soldat, der von Räubern überfallen wurde – oder von feindlichen Truppen, überlegte Ahrunan. Er hob den Kopf und ließ seinen Blick über die hügelige Landschaft schweifen. Seit dem frühen Morgen folgte er einem schmalen Pfad, den zur rechten Hand ein leise glucksendes Bächlein begleitete. Vor ihm lichtete sich der Wald aus Ahornbäumen und Buchen und machte Feldern und Weiden Platz. In der Ferne konnte er die grünen Hügel erkennen, hinter denen sich die Ebene der Ysen erstreckte. Die Mittagssonne leuchtete warm vom klaren Himmel herab. Irgendwo krächzte ein Rabe. Im Unterholz raschelte ein unvorsichtiger Waldbewohner, und in den Wipfeln über seinem ergrauten Haupt knackte ein dürrer Ast, den der erste Herbststurm vom Baum fegen würde. Das Land schlummerte in Frieden. Von einer Horde Räuber oder einem Trupp Soldaten fehlte jede Spur.
Unschlüssig rieb Ahrunan das Leder der abgenutzten Zügel. Er hatte schon zu viele böse Überraschungen erlebt, um einem Fremden noch ungefragt zu helfen. Allzu oft war ihm seine Hilfsbereitschaft mit Undank vergolten worden, hatte ihn gar manches Mal in Lebensgefahr gebracht.
Der am Boden liegende Mann stöhnte schmerzerfüllt. Er hob den Kopf, doch nicht hoch genug, um das Gesicht unter dem zerzausten Schopf zu enthüllen. Flehend streckte er die Hand aus, dann verließen ihn die Kräfte, und sein Arm klatschte auf den steinigen Weg.
Ahrunan seufzte resignierend und glitt aus dem Sattel. Wenn er nicht zurück wollte in die Stadt Asgillimar, aus der ihn der Krieg vertrieben hatte, musste er sich den Fremden ansehen, der seinen Weg blockierte.
»Heda, Kamerad.« Er kniete neben dem Mann nieder und griff nach dessen Schulter. »Lebst du noch? Was ist dir widerfahren?«
Der andere hob den Kopf, und Ahrunan blickte in das Gesicht eines jungen Mannes mit auffallend attraktiven Zügen. Zu einem eckigen Kinn gesellten sich sinnliche Lippen, eine gerade Nase und eine hohe Stirn. Das struppige Haar durchzogen blonde, braune und schwarze Strähnen, und in den goldbraunen Augen glänzte die Wildheit eines Wolfs.
»Erwischt!«, rief der Bursche. In einer einzigen, schnellen Bewegung stemmte er sich hoch. Er zog die Knie unter den Leib, hechtete vorwärts und stürzte sich auf sein Gegenüber. Er riss den überraschten Magier zu Boden, setzte sich auf seine Brust und presste die Beine auf dessen Arme.
»Zirkel, Blei und Lot!« Wut über den Angriff und die eigene Dummheit kochten in Ahrunan hoch – aber auch ein ganz anderes, gänzlich unpassendes Gefühl übermannte ihn. Die leuchtenden Bernsteinaugen unter dem vielfarbigen Schopf wirkten vertraut. Es erschien ihm, als läge er nicht zum ersten Mal rücklings unter diesem jungen Räuber, aber nicht im Kampfe, sondern als Auftakt zum Liebesspiel.
»Was ist denn das?«, lachte der Bursche. »Ist das ein Messer, oder freust du dich, mich so hautnah kennen zu lernen?«
Ahrunan starrte ihn wortlos an. Der Räuber verlagerte sein Gewicht, sodass seine Knie mit schmerzhaftem Druck auf die Arme des Magiers pressten. Er schob seine Hand unter den eigenen Leib, um seinen Gefangenen abzutasten, und mit gespielter Enttäuschung zog er ein hölzernes Etui von Ahrunans Gürtel.
»Bloß eine Schatulle. Was ist darin?«
»Schreibfedern und Tintensteine«, antwortete Ahrunan, dessen Herzschlag sich langsam beruhigte. Das Gefühl der Vertrautheit, das er für seinen Angreifer empfand, nahm ihm jegliche Furcht. Was konnte dieser Bursche schon von ihm wollen? Wahrscheinlich sein Pferd und das bisschen Habe, das er aus Asgillimar hatte retten können. Denn wenn es den Räuber nach dem Leben seines Opfers gelüstet hätte, hätte er ihm längst die Kehle durchtrennt.
»Wusste ich es doch«, freute sich der Bursche. Er drehte den Kopf, steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen lauten Pfiff aus, ehe er in den Wald hineinrief: »Ich hatte recht: Er ist ein Gelehrter, und kein Soldat!«
Statt einer Antwort schälte sich ein Trupp Bewaffneter aus dem Unterholz. Das Sonnenlicht funkelte auf den eisernen Beschlägen ihrer Lederrüstungen und auf dem Zaumzeug der Pferde, die sie mit sich führten. Ahrunan wurde es flau im Magen. Eine Räuberbande war ein ernsteres Problem als dieser freche Bursche. Trotz seiner misslichen Lage besaß er immer noch seine Zauberkräfte, mit denen er sich seiner Angreifer erwehren konnte. Aber da das Geheimnis seiner magischen Gaben unter allen Umständen gewahrt bleiben musste, durfte kein Zeuge überleben, sollte er seine Macht einsetzen – ein zu hoher Preis für sein Pferd und das bisschen Habe, wie er fand.
»Was wollt ihr von mir?«, fragte er mit sorgsam erzwungener Ruhe.
»Vor allen Dingen ein paar Antworten.« Der junge Mann erhob sich von Ahrunan, streckte ihm die Hand entgegen und zog ihn auf die Füße. Sein Blick fuhr prüfend über den Magier, erfasste die moosgrünen Augen, die leicht gebräunte Haut und das ergraute, fast schon weiße Haar. Gestickte Borten in Gelb und Rot zierten die Säume der knielangen Tunika aus dunkelgrünem Leinen, die wie das kragenlose Hemd und die schmalgeschnittene Hose eine städtische Herkunft verriet.
»Wer bist du, und woher kommst du?«
»Mein Name ist Ardan, und ich komme aus Asgillimar«, antwortete Ahrunan bedächtig. Allmählich bezweifelte er, dass er in die Hände von Räubern gefallen war. Aber wer sonst hätte Grund, einem Fremden auf diese Weise aufzulauern?
»Wie steht es um die Stadt?« Unvermittelt klang der junge Mann besorgt. »Wir haben lange nichts mehr von dort gehört.«
»Die Stadt wurde von den Truppen des Königs erobert und fast vollständig zerstört.« Ahrunan ballte die Fäuste. Obgleich er sich glücklich schätzte, mit seinem Leben und einigen Besitztümern entkommen zu sein, traf ihn der Verlust seiner letzten Wahlheimat schwerer, als er erwartet hatte. Ich bin zu alt, um wieder und wieder von vorne anzufangen, klagte er in Gedanken. Und je länger ich lebe, desto öfter enttäuschen mich die Menschen.
»Du meinst Korobans Hunde.« Der Bursche spuckte auf den Boden. »Von denen haben wir schon viel gehört, doch niemals etwas Gutes. Aber an Terredin werden sie sich die Zähne ausbeißen, nicht wahr, Männer?«
Terredin. Voller Sorge erinnerte sich Ahrunan an den Namen. Der Markgraf von Terredin gehörte zu einer Gruppe aufständischer Adeliger, die vor zwei Jahren dem König die Treue gebrochen hatten. Das erklärt, warum sie mir aufgelauert haben, überlegte er. In dieser Gegend ist jetzt jeder Fremde verdächtig, ein Kundschafter für die königstreuen Truppen zu sein.Ich muss vorsichtig sein,damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, ich sei ein Spion. Er fühlte, wie sein Herz schneller schlug. Obwohl er vor wenigen Tagen seine Heimat, liebe Freunde und ein gutes Auskommen verloren hatte, wollte er nicht auch noch seine Freiheit verlieren.
»Keriban von Asgillimar hielt sich ebenfalls für unbesiegbar«, mahnte er die Umstehenden. Er hatte es ja kommen sehen: Nachdem sich die sieben Markgrafen von König Koroban losgesagt hatten, war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis dieser ein Heer schickte, um die Verräter zu richten. »Er hat viele kluge Vorbereitungen getroffen, doch all seine Bemühungen waren vergebens.«
»Was für Vorbe…?« Der junge Mann hob die Hand und unterbrach sich selbst. »Das ist nicht der Ort, solcherlei Dinge zu bereden.« Er winkte einem Bewaffneten, ihm sein Pferd zu bringen. »Du wirst uns nach Terredin zu meinem Vater begleiten.«
»Euer Vater, junger Herr?«, wechselte Ahrunan in eine untertänige Anrede. »Darf ich fragen, wer Ihr seid?«
»Ich bin Jandor von Terredin, Graf Baldors Sohn und anerkannter Erbe.«
Die Erinnerung traf Ahrunan wie ein Schlag. Jetzt wusste er, wieso ihm dieser junge Bursche so vertraut erschien. Einst hatte er einen verwegenen Krieger namens Baldor gekannt, der aus Terredin stammte, und Jandor war unverkennbar sein Abkomme. Doch wie lange war es her, dass er mit Baldor durch die Welt gezogen war, dass sie die Gefahren der Straße, aber auch die Freuden des Bettes geteilt hatten? Zwanzig, dreißig Jahre? Hastig rechnete er zurück. Nein, bald vier Jahrzehnte lag ihre Freundschaft zurück. Vierzig Jahre, in denen sich Ahrunan aufgrund seiner magischen Langlebigkeit kaum verändert hatte, während Baldor längst im Winter seines Lebens stand.
»Nein«, wisperte er. »Ich kann nicht.«
Jandor sah ihn scharf an. »Was kannst du nicht?«
»Mit nach Terredin kommen.« Es war eine Binsenweisheit, dass Lügen umso glaubwürdiger waren, je näher sie an der Wahrheit lagen, und deshalb blieb Ahrunan den Tatsachen so weit wie möglich treu. Doch in diesem Fall half nur eine ausgewachsene Lüge: »Ich will weiter nach Westen, nach Synaid. Und das bedeutet, ich muss die Ysen überqueren, ehe der Winter sie unpassierbar macht.« Er bemühte sich, seine Stimme gehetzt und unsicher klingen zu lassen. »Käme ich mit Euch, würde ich den großen Strom nicht mehr rechtzeitig erreichen.«
»Du hast noch den ganzen Winter Zeit, die Ysen zu überqueren, ehe die Schneeschmelze im Frühjahr das Hochwasser bringt. Und von Terredin aus gelangst du auf direktem Weg nach Ysenfurt, wo du den Fluss leicht und sicher passieren kannst.« Jandor grinste frech. »So wirst du sogar schneller in Synaid sein, als wenn du die Fähre im Norden nimmst.«
Ahrunan biss die Zähne zusammen. Wenn ihm seine Freiheit lieb war, durfte er Baldor nicht unter die Augen kommen. »Bitte, junger Herr, lasst mich meines Weges ziehen«, versuchte er es mit einfachem Betteln und Flehen. »Das wenige, was ich weiß, kann ich Euch unterwegs erzählen.«
»Ich denke, du weißt mehr, als du mir eingestehst, Ardan aus Asgillimar.« Unvermittelt verhärtete sich Jandors Gesicht. »Ich glaube sogar, dass du einer von jenen warst, die Graf Keriban bei seinen Vorbereitungen unterstützt haben.«
»Ach, junger Herr, Ihr überschätzt mich«, wehrte der Magier mit falscher Bescheidenheit ab. »Ich bin nur ein einfacher Schreiber.«
»Der wie ein Baumeister flucht?« Jandor ergiff Ahrunans Rechte und drehte die Handfläche nach oben. »Das ist weder die Hand eines Schreibers, noch die eines Steinmetzes oder Zimmermanns. Nein, Ardan, ich denke, dass du ein Baumeister bist und dass du mitgeholfen hast, Asgillimar zu befestigen.«
»Aber all die Arbeit war vergebens!«, widersprach Ahrunan, von der Heftigkeit seiner Worte selbst überrascht. Jandor hatte einen wunden Punkt berührt: Er war tatsächlich Baumeister in Asgillimar gewesen, und nach seinen Plänen waren viele Wehranlagen verstärkt worden. Doch nun lag die kleine Handelsstadt in Schutt und Asche, als hätte er müßig die Hände in den Schoß gelegt. »Junger Herr, ich bin bloß ein unbedeutender Flüchtling, der die Mühen nicht wert ist, die Ihr seinethalben auf Euch nehmt.«
»Was du wert bist, entscheide ich.« Jandor schwang sich auf sein Ross. »Du wirst mich nach Terredin begleiten, ob du willst oder nicht. Aber du hast die Wahl, ob du als mein Gast oder mein Gefangener mitkommst. So, wie du dich unter meinen Fragen windest, bin ich geneigt zu glauben, du seist ein Spion der Königstreuen.«
»Nein, junger Herr, das bin ich nicht.« Ergeben senkte Ahrunan den Blick. Für den Moment sah er keinen Ausweg aus der Misere. Ihm blieb allein die Hoffnung, dass Baldor ihn nach all den Jahren nicht wiedererkannte. Denn sein alter Freund würde ihn auf keinen Fall ziehen lassen: Zu wertvoll waren Ahrunans Zauberkräfte, um sie nicht zu verwenden in dem Krieg, der früher oder später Burg Terredin erreichen würde.
Ranyth sprang aus dem Sattel seines Rappen und warf dem Stallburschen die Zügel zu. Mit großen Schritten eilte er die Treppe zum Palas der Burg hinauf. Es war spät geworden; wer hätte gedacht, dass sich der schmucke Jäger so gern von dem jungen Herrn reiten ließ. Ein zufriedenes Lächeln erschien auf Ranyths Lippen. Diese Art von Jagdgesellschaft ließ er sich wahrlich gefallen!
Der junge Fürstensohn durchquerte die Eingangshalle und schritt die große, geschwungene Treppe in den ersten Stock hinauf. Der Korridor zu seiner Rechten lag in nächtlichem Dunkel, doch unter einer Tür fiel Lichtschein auf den steinernen Boden. Ranyth stutzte. Das war die Schreibstube, und darinnen stand die Truhe mit den Steuergeldern. Ein Dieb?, ging es ihm durch den Kopf.
Leise schlich er zur Tür und horchte angestrengt. Ein kaum hörbares Kratzen drang durch das Holz, als führe ein Federkiel über Pergament. Ranyth runzelte die Stirn. Für einen Dieb war der Bursche zu laut, und das ganze Licht … Kurzentschlossen zog er sein Schwert, er riss die Tür auf und stürmte in die Stube. Ein paar Kerzen schufen eine Insel aus Licht, während der Rest des Raumes in Dunkelheit schlummerte. Am Schreibtisch saß ein älterer, dunkelhaariger Mann über die Bücher gebeugt, eine Feder in der einen, eine Pergamentrolle in der anderen Hand.
»Wer bist du, und was machst du hier?«, blaffte Ranyth ihn an. Der Fremde war zumindest kein Dieb, viel eher ein Spion.
Der Mann musterte ihn ruhig. »Ich bin Nivedion von Kallimar, und ich überprüfe, ob der Fürst von Sarlingen seine Abgaben ordnungsgemäß entrichtet.«
Ranyth wurde es heiß, als brenne die Sommersonne auf ihn herab. Er hatte gerade den zweitmächtigsten Mann im Königreich Kallidorn angeschnauzt. Nivedion von Kallimar war der Vertraute von König Koroban und – wenn die Gerüchte stimmten – die eigentliche Macht hinter dem Thron. Ranyth hatte gewusst, dass ein Gesandter des Königs zu ihnen unterwegs war, doch er hatte nicht erwartet, dass es Nivedion persönlich sein würde.
»Ich …« Unter der unbewegten Miene des königlichen Beraters wurde der junge Sarlinger unruhig. Mit einem schiefen Lächeln steckte er das Schwert weg. »Ich dachte, ein Dieb …« Er zuckte die Achseln. »Ich wusste nicht, dass Ihr es seid, Erhabener Vater.«
»Jetzt weißt du es.« Nivedion entließ ihn nicht aus dem prüfenden Blick seiner blaugrünen Augen, und mit wachsendem Unbehagen fragte sich Ranyth, wie stark sein hellbraunes Haar zersaust war und ob seine grauen Augen noch immer lustvoll glänzten. War ihm anzusehen, wie hastig er seine Lederhose geschlossen und Hemd und Weste übergestreift hatte?
»Du bist Ranyth von Sarlingen? Setz dich.« Nivedion winkte ihm, auf dem Lehnstuhl vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen, und wandte sich wieder den Unterlagen zu.
Der Fürstensohn setzte sich. Warum soll ich bleiben?, überlegte er verunsichert. Wollte Nivedion ihn für sein Betragen zurechtweisen? Oder war es wegen der Bücher? Ranyth biss sich auf die Lippen. Er hatte sich größte Mühe gegeben, damit die Unregelmäßigkeiten bei ihren Abgaben nicht auffielen. Mit etwas Glück würde Nivedion nie dahinter kommen, dass sie einige Bauernhöfe mehr besaßen als angegeben.
Er musterte sein Gegenüber. Der Gesandte war nicht nur der Berater des Königs, sondern auch ein geistlicher Würdenträger, der Hohepriester von Kallimar. Doch statt der prächtigen Gewänder eines hochrangigen Aurondieners trug er ein schlichtes, weinrotes Leinenhemd und dunkle, wollene Hosen. Dann soll er sich nicht wundern, wenn man ihn nicht erkennt, dachte Ranyth trotzig. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und hängte ein Bein über die Armlehne.
»Füße auf den Boden«, sagte Nivedion leise, aber bestimmt.
Ranyth setzte sich gerade hin und stellte beide Füße auf den Boden.
Huh?, dachte er, über sich selbst überrascht. Nivedion war so ganz anders als Vater Goridion, der Priester der Sarlinger Fürstenfamilie, weder gläubig verklärt noch von dümmlicher Demut erfüllt. Mühelos nahm er Ranyth die Zügel aus der Hand und legte ihn stattdessen an die Kandare. Nun ja, immerhin war er der Hohepriester von Kallimar, der weit über dem jüngsten Sohn eines wenig angesehenen Fürsten stand.
»Die Berichte sind von dir?« Nivedion legte den Federkiel zur Seite und verschloss das Tintenfass. »Du hast eine schöne Handschrift.«
Ranyth grinste schief. Bedingt durch mehrere Brüche verschiedener Gliedmaßen hatte er im Gegensatz zu seinen Brüdern anständig Lesen und Schreiben gelernt. Zwar besaß er weder die Körperkraft der beiden Älteren noch ihr Geschick im Umgang mit Schwert, Axt oder Speer, doch in der Schreibstube war er ihnen überlegen. Die Unterrichtsstunden bei Vater Goridion waren stets eine Wohltat gewesen, trotz der Prügel, die er deshalb von seinen Brüdern bezogen hatte.
»Normalerweise verrät eine ordentliche Handschrift einen klaren Geist«, fuhr Nivedion ruhig fort. »Doch deiner scheint mir verwirrt zu sein.«
Ranyth fühlte sein Herz schneller schlagen. »Wie meint Ihr das, Erhabener Vater?«
»Komm her.« Nivedion winkte ihn zu sich und rechnete ihm einige Zahlenreihen aus den Büchern vor.
Bei allen Schlangenaugen!, fluchte Ranyth innerlich. Nivedion war ihm auf der Spur. Er schloss die Hand zur Faust und kaute unruhig auf seinem Zeigefinger, während der Hohepriester nach und nach die falschen Zahlen aufdeckte. Verdammt, was sollte er nun tun? Alles leugnen? Die Schuld einem anderen zuschieben? Der König hatte sowieso schon ein Auge auf Haus Sarlingen. Wem würde der versuchte Betrug am wenigsten schaden?
»Streck deine Hand aus«, unterbrach sich Nivedion. Verwirrt gehorchte Ranyth. Der Hohepriester packte einen hölzernen Linienzieher und schlug damit auf die ausgestreckte Handfläche.
Ranyth unterdrückte einen Aufschrei. Hohepriester hin oder her, Nivedion hatte nicht das Recht, ihn wie einen ungehorsamen Knaben zu bestrafen! Er war ein erwachsener Krieger, der Sohn eines Fürsten.
Wütend wollte er auffahren, doch ein kühler Blick aus blaugrünen Augen stoppte ihn. »Das ist für das Fingerkauen.« Der Hauch eines Schmunzelns erschien auf den fein gezeichneten Lippen. »Aber ich nehme an, ich kann die Wahrheit nicht mit einem einfachen Linienzieher aus dir herausprügeln.«
Ranyth fühlte, wie sein Herz einen Schlag aussetzte. Nivedion hatte den Betrug durchschaut! Doch so leicht gab sich ein Sarlinger nicht geschlagen. Drei ältere Brüder hatten Ranyth gelehrt, selbst im Angesicht der erwiesenen Schuld unbeugsam zu bleiben. Wo Vater und Goridion versagt hatten, würde auch der Hohepriester von Kallimar scheitern. Ranyth verlagerte das Gewicht auf ein Bein und grinste Nivedion herausfordernd an.
»Womit hat euch euer Vater in die Zucht genommen? Mit seinem Gürtel? Dem Stock?«
»Er ließ uns stundenlang den Großen Lobpreis sprechen. In der Kapelle. Auf den Knien.« Feixend hakte er die Hände in seinen Schwertgürtel. »Ich kann ihn dreißig Mal in der Stunde sprechen.«
Nivedion lächelte flüchtig, ein wenig traurig, wie Ranyth fand. »Zumindest kennst du deine Gebete.« Er wurde wieder ernst. Seine Augen verdunkelten sich. »Wie alt bist du, Ranyth von Sarlingen?«
»Einundzwanzig, Erhabener Vater.« Dem Fürstensohn entging nicht der Stimmungswechsel. Er hörte auf zu grinsen und ließ die Hände locker an den Seiten hängen.
»Ich muss gestehen, ich hatte gehofft, du wärst ein besserer Mann.« Nivedion stand auf. An Ranyth vorbei ging er zur Tür. »Ich bin sehr enttäuscht von dir, junger Sarlinger.« Er verließ das Zimmer.
Ranyth starrte ihm entgeistert nach. Ärger, Trotz und Übermut waren wie weggeblasen. Das sollte schon alles gewesen sein? So leicht gab Nivedion auf? Und wieso war er enttäuscht von ihm? Der junge Mann spürte einen Stich in seinem Herzen. Was hatte der Rotkittel von ihm erwartet? Ich hatte gehofft, du wärst ein besserer Mann, erklang die Stimme des Priesters in Ranyths Kopf. Sein Magen krampfte sich zusammen, als hätte er einen Schlag erhalten.
Er eilte zur Tür. »Erhabener Vater«, rief er Nivedion, der schon halb den Gang hinunter war. »Wartet!«
Doch der andere ging weiter.
»Bitte!«
Nivedion blieb stehen, drehte sich jedoch nicht um. Ranyth presste die Lippen zusammen und eilte ihm nach. »Wie habt Ihr das gemeint?« Unter dem starren Blick des Hohepriesters trat er unruhig auf der Stelle. »Dass ich ein besserer Mann wäre. Besser als wer?«
»Als deine Brüder.« Der Geistliche wies mit einer Geste zur Schreibstube, und sie gingen in den Raum zurück, wo Nivedion wieder hinter dem Schreibtisch Platz nahm. »Vater Goridion lobte deine Leistungen im Unterricht, die trotz deines ungehörigen Betragens überraschend gut seien.«
Ranyth hakte die Hände in den Schwertgürtel. Alle vier Söhne des Sarlingers hatten ihre rauen Späße mit dem alten Priester getrieben. Sie waren Krieger, keine Tempelschüler, und für die Leistungen, die Goridion so lobte, war Ranyth oft genug von seinen Brüder verhöhnt und verprügelt worden.
»Wie ich sehe, bist du recht aufgeweckt.« Nivedion legte die gefalteten Hände auf den Tisch. »Aber nicht klug genug, deinen König nicht zu betrügen.«
»Ich weiß nicht, wovon Ihr redet«, leugnete Ranyth gewohnheitsmäßig.
Nivedion sah ihn mit ausdrucksloser Miene an. Nur in seinen Augen funkelte ein blaugrünes Feuer. Die Kerzen flackerten im Luftzug, der unter der Tür hereinwehte. Die brennenden Scheite im Kamin knackten leise. Ranyth krampfte die Hände um seinen Gürtel. Was sollte er nur tun? Aufgeben und alles gestehen? Oder weiterhin leugnen und darauf hoffen, dass Nivedion einen anderen Schuldigen fand? Den Gerüchten zufolge strebte der Hohepriester nach dem Amt des Inquisitors, und Ranyth bezweifelte nicht im Geringsten, dass Nivedion die schlangenäugige Hexenbrut erfolgreich jagen würde.
Drückendes Schweigen erfüllte den Raum. Ranyths Herz schlug schmerzhaft in seiner Brust. Er dachte an seinen Vater Thivan, der den Steuerbetrug niemals gestattet hätte. Der Fürst hatte seinen jüngsten Sohn mit der Verwaltung ihrer Güter betraut, die Ehre und den Besitz der Familie in die jungen Hände gelegt, doch wie schändlich hatte Ranyth ihm sein Vertrauen vergolten. Enttäuscht würde sich der Vater von ihm abwenden, vor allem, wenn sich sein Sprössling als ein Feigling herausstellte, der sich weigerte, die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Ranyth seufzte lautlos. Er hatte keine Wahl, er musste seine Schuld bekennen. Mochte Auron ihm gnädig sein.
»Wie Ihr wisst, ist mein Bruder Wrogomar einer der beiden Feldherren, die den Feldzug gegen die abtrünnigen Markgrafen im Süden unseres Landes führen«, begann er mit Bedacht. »Er braucht Soldaten, Ausrüstung und Proviant.«
»Und?«
»Einen Teil stellt der König, der andere muss aus den Kassen der Feldherren kommen.« Ranyth setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch und stützte die Ellbogen auf die Knie. »Unser Familienbesitz ist nur bescheiden, und die Kosten des Feldzuges sind immens. Diese Erträge«, er wies auf die Bücher, »das Geld und die Ernte … ich wollte damit Wrogomar unterstützen.« Er sah den Priester offen an. »Ich habe es nicht für mich getan, sondern für den Feldzug. Und damit für den König.«
Täuschte er sich, oder huschte tatsächlich ein Lächeln über Nivedions Lippen? Der Hohepriester stand auf, ging um den Tisch herum und blieb vor ihm stehen. Nachdenklich sah er auf ihn herunter. »Was soll nur aus dir werden, Ranyth von Sarlingen?«
Der Fürstensohn holte tief die Luft. Obwohl die Frage nur rhetorisch gemeint war, antwortete er: »Ich will mich Wrogomar anschließen.« Den ganzen Sommer über hatte er seinem Vater mit diesem Wunsch in den Ohren gelegen, doch der alte Sarlinger hatte sich nicht erweichen lassen. »Ich will wie er ein Feldherr werden und die Feinde des Königs vernichten.«
Nivedion lachte leise. »So so.« Er lehnte sich gegen die Tischkante und verschränkte die Arme. »Wie ich sehe, bist du nicht nur gewitzt, sondern auch kühn und mutig. Ich denke, dein Wunsch soll erfüllt werden.«
Ranyth sah ihn groß an. Bei Auron, das war das Letzte, was er erwartet hatte. So einfach sollte er davonkommen? Ja, sogar belohnt werden, obwohl er den König hintergangen hatte?
»Du wirst mir jedoch regelmäßig Bericht erstatten«, fuhr Nivedion fort. »Ich will wissen, was in den abtrünnigen Grafschaften vor sich geht. Und auch, was dein Bruder und seine Schwertgesellen so treiben. Auf diesem Feldzug wird nichts geschehen, von dem ich keine Kenntnis erhalte. Ist das klar?«
Der junge Sarlinger schluckte. Er sollte also für den Hohepriester spionieren, sogar den eigenen Bruder bespitzeln. Oder war das eine Prüfung? Er schaute Nivedion an, und in dem funkelnden Blick las er, wie ernst der Hohepriester es meinte.
»Schwöre es mir bei deinem Schwert.«
Ranyth stand auf und legte die Hand auf den Griff der Waffe. Wenn er sich weigerte, würde Nivedion dem König von seinem Betrug berichten und der Souverän den Betrüger streng bestrafen. Das Haus Sarlingen würde in Schande fallen, und Ranyth konnte seinen Traum, selbst ein Feldherr zu werden, für immer begraben.
Er hob die Hand zum Schwur.
Terredin war bei Weitem nicht das uneinnehmbare Bollwerk, für das Jandor seine Heimatburg hielt. Mit Kennerblick erkannte Ahrunan, die Mauer auf der Nordseite war zu niedrig, um dem Beschuss durch die neu entwickelten Katapulte Stand zu halten. Das Zwingtor an der östlichen Schildmauer, das den Zugang über die Zugbrücke sicherte, würde sich ebenfalls einem entschlossenen Angriff ergeben – und die königstreuen Truppen waren zu allem entschlossen.
Durch zwei schwere, doppelflügelige Tore und unter einem Fallgitter hindurch, ritten Ahrunan, Jandor und dessen Soldaten in den Zwinghof, der Gnade vor den Augen des Baumeisters fand. Die Westseite des schmalen Innenhofes beherrschte der mächtige Wehrturm, der wohl seit einem Jahrtausend das Herz von Terredin darstellte, und die beiden Längsseiten bewachten zwei hohe Gebäude mit Schießscharten statt Fenstern, an denen auf halber Höhe ein Wehrgang entlangführte und deren flache Dächer ein Zinnenkranz krönte.
Durch den Torgang im nördlichen Haus gelangten die Reiter in den zentralen Burghof, um den sich die Wohn- und Werkstätten, die Ställe und Scheunen der Feste gruppierten. Sie saßen ab, übergaben die Pferde den Stallburschen, die eilfertig herbeisprangen, und mit einem knappen Befehl entließ Jandor seine Soldaten bis auf zwei Mann, die Ahrunan wachsam in die Mitte nahmen. Die kleine Gruppe umrundete den Wehrturm, der die Burg wie ein Vater seine Kinder überragte, und strebte dem mehrstöckigen Palas zu, der die Südwestseite der Anlage einnahm. Zwischen den beiden Gebäuden entdeckte Ahrunan die Überreste einer Mauer, die einst zusammen mit einem Graben den inneren Teil der Feste geschützt hatte, und er fragte sich flüchtig, warum man diesen Teil der Verteidigungsanlage niedergerissen hatte.
Doch egal ob mit oder ohne diese Mauer, Terredin wird fallen, dachte Ahrunan. Baldor sollte sich besser sofort ergeben und den König auf Knien um Verzeihung bitten, dann würde zumindest ein Teil seiner Leute überleben. Doch der Baldor, den er kannte, würde seine Meinung nicht ändern, nur weil er allein gegen eine Übermacht stand.
Über die große Freitreppe betraten sie den Palas, wo Jandor schließlich vor einer Holztür mit kunstvollen Schnitzereien stehen blieb. »Wir sind da.« Mit Schwung öffnete er die Tür und trat in den dahinterliegenden Raum. »Vater, ich habe Besuch für dich!«
Stickige Luft und der Geruch von schwerer Krankheit schlugen Ahrunan entgegen. Über Jandors Schulter hinweg blickte er in das von einer großen Schlafstatt beherrschte Gemach. Unter dem hohen Fenster stand ein Tisch, auf dem Verbände und Salbentöpfe ihrer Verwendung harrten. Daneben befanden sich zwei Truhen mit den Besitztümern ihres Eigners. Bunte Wandteppiche verdeckten das grobe Mauerwerk der Wände, und unter den Schritten der Eintretenden raschelte frisch aufgeschüttetes Stroh.
Auf einem Schemel neben dem Himmelbett saß ein blondes Mädchen, das jetzt aufsprang und auf Jandor zu eilte. An ihren schlanken Körper schmiegte sich ein hellblaues Gewand aus feinem Tuch, in das sich ein Edelfräulein kleiden würde, darüber jedoch trug sie die schlichte, weiße Schürze einer Magd.
»Bitte sei leise«, flüsterte sie. »Vater ist gerade eingeschlafen.«
»Schon gut, Miria.« Jandor umarmte das zarte Mädchen herzlich. »Ich habe jemanden mitgebracht, den sich Vater unbedingt ansehen sollte.«
»Geh schon, Mann!« Eine Wache stieß Ahrunan in den Rücken, sodass er einen Schritt vorwärts taumelte.
Miria riss erschrocken die Augen auf. »Wer ist …?« Sie wurde von einer brüchigen Stimme aus dem Bett unterbrochen: »Was macht ihr hier für einen Lärm und lasst einen alten Mann nicht sehen, was los ist?«
Sofort eilte Miria zurück an das Bett und half dem darin Liegenden in eine sitzende Position. Ahrunans Augen weiteten sich. Nur mit Mühe erkannte er seinen alten Freund, dessen leichenblasses Gesicht im Fieber glänzte. Die Wangen waren eingefallen, und tief lagen die einst so funkelnden Augen in ihren Höhlen. Steingrau verfärbte Haut überzog seine Arme und verschwand auf Schulterhöhe unter dem verschwitzten Hemd. Kaum konnte der Kranke die Augen offen halten, so schwach war er bereits.
Ehe ihn jemand hindern konnte, trat Ahrunan neben das Bett. Er schluckte hart, um den Kloß in seiner Kehle zu vertreiben. »Oh Baldor, mein lieber Freund. Wie konnte das nur geschehen?«, wisperte er betroffen.
»Ahrunan«, erkannte ihn der Markgraf, und der Magier fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. Nicht Baldor hatte ihn erkannt, er selbst hatte sich verraten. Doch all seine Bedenken waren verschwunden, vertrieben von dem Anblick seines Freundes, der im Sterben lag.
»Ahrunan Sturmbrecher.« Der Markgraf lächelte schwach. »Du hast dich überhaupt nicht verändert.« Ein trockener Husten schüttelte ihn. »Es ist das Graue Fieber, und ich befürchte, nicht einmal du kannst diese auronverdammte Krankheit heilen.«
Wortlos schüttelte Ahrunan den Kopf, denn er wusste, ihm würde die Stimme versagen. Mit Baldor hatte ihn mehr als die Bruderschaft zwischen Waffengefährten verbunden oder das flüchtige Gefühl von Lust und Begehren. Er hatte in dem Krieger einen wahren Freund gefunden, der sich nicht von ihm abgewandt hatte, nachdem er Ahrunans Zauberkräfte entdeckt hatte. Und selbst jetzt noch bewahrte der Sterbende das Geheimnis des Magiers.
»Du hast recht, gegen das Graue Fieber bin ich machtlos.« Ahrunan nahm auf dem Schemel neben dem Bett Platz und bedeckte Baldors Linke mit seiner rechten Hand. In einem frühen Stadium hätte er die Krankheit vielleicht abwenden können, aber nun war es zu spät. Wahrscheinlich würde noch in dieser Nacht der Tod den Markgrafen ereilen.
Er nickte Miria zu. »Geh und hol ihm ein wenig Wintermohn. Ich bin sicher, euer Heiler hat einen kleinen Vorrat davon.«
»Aber Wintermohn ist doch giftig.« Miria knetete unschlüssig ihre Schürze. Ein Hauch von Röte färbte ihre Wangen, als schäme sie sich, Ahrunan zu widersprechen.
Baldor lachte keuchend. »Geh schon, Kind. Daran sterben werde ich wohl nicht mehr.« Er wandte sich Ahrunan zu. »Manchmal frage ich mich, wie zwei Geschwister nur so unterschiedlich sein können. Ha! Ein Wolf und ein Reh.«
Ahrunan drehte sich zu Jandor um, der mit verschränkten Armen an der Wand lehnte, die Fußknöchel in scheinbarer Gelassenheit gekreuzt. Die goldbraunen Augen beobachteten wachsam den Magier, und ein Stirnrunzeln verriet das Aufkeimen von Unmut und Misstrauen. Ahrunan erinnerte sich, dass er sich Jandor und seinen Mannen mit dem Namen Ardan vorgestellt hatte. Was mochte der Grafensohn nun von ihm denken?
»Gut, dass du hier bist«, fuhr Baldor angestrengt fort. »Was immer dich hergeführt hat, ich danke Auron dafür. Jetzt, da ich weiß, dass du dich um meine beiden Kinder kümmern wirst, kann ich in Frieden sterben.« Mit einem erschöpften Seufzer sank er in die Kissen zurück. »Du schuldest mir noch einen Gefallen für dein Leben«, murmelte er so leise, dass Ahrunan ihn beinahe nicht verstand. Verstohlen blickte der Magier zu Jandor hin. Hatte der Junge die Worte seines Vater gehört?
Ahrunan stand auf und trat an den Tisch mit den Salben und Verbänden. Er entdeckte die üblichen Tinkturen und Fieber senkenden Tränke, die auch er bereitet hätte, und ein paar ihm unbekannte Kräutermischungen. Aus einem bereitstehenden Krug goss er Wasser in eine Schüssel. Er tränkte einen weichen Lappen mit dem kühlen Nass und trug beides zu der Schlafstatt, wo er sich auf der Bettkante niederließ.
»Du hast es also bis zum Markgrafen gebracht«, meinte er im Plauderton, während er begann, Baldors Arme mit dem Lappen abzutupfen. Er spürte Jandors prüfenden Blick in seinem Nacken, dennoch riskierte er es, seine Zauberkräfte einzusetzen. Bei jeder federleichten Berührung ließ er ein wenig heilende Magie aus seinen Händen fließen, die Baldor zwar nicht retten, aber zumindest seine letzten Stunden erleichtern würde.
»Ahnte ich es doch, dass du von nobler Geburt bist, obwohl du es immer abgestritten hast«, versuchte er ein Gespräch in Gang zu bringen, um Antworten auf die Fragen zu erhalten, die die Begegnung mit Jandor aufgeworfen hatte. »Aber dich auf dem Thron eines Markgrafen wiederzusehen, hätte ich nicht erwartet.«
Ein leichtes Lächeln entspannte Baldors Züge, doch zu erschöpft für eine lange Rede forderte er seinen Sohn auf: »Erzähl du es ihm.«
»Vater hat sich damals, beim letzten Grenzkrieg mit Synaid, hervorgetan, und daraufhin hat ihn der König als Markgraf bestätigt, als sein älterer Bruder Gonthor von Terredin kinderlos verstarb«, erklärte Jandor mürrisch. Von sich aus hätte er niemals Ahrunans Fragen beantwortet, doch seinem Vater wollte er das anstrengende Reden ersparen.
»Und die Markgräfin?«, erkundigte sich der Magier vorsichtig, da er um Baldors Neigungen wusste.
Der Markgraf griff nach Ahrunans Arm und drückte ihn leicht. »Ich wünschte, ich hätte Illainne geheiratet, bevor sie bei Jandors Geburt starb«, wisperte er erschöpft. »Dann hätte er einen legitimen Anspruch auf das Erbe, das ihm zusteht.«
Der Magier runzelte die Stirn. »Hast du deshalb dem König die Treue gebrochen? Weil er deinen …« Er schluckte das Wort Bastard hinunter und sagte stattdessen: »… deinen unehelichen Sohn nicht als deinen Erben anerkennt?«
»Mein Vater, Keriban und die anderen Markgrafen haben ihr Leben für den König riskiert. Sie haben seine Schlachten geschlagen und ihr Blut für ihn vergossen, doch er will ihnen das Recht verwehren, ihre eigenen Kinder als Erben zu ernennen!«, fuhr Jandor auf. Er machte eine wegwerfende Geste. »Ganz abgesehen davon, dass sich Koroban mehr und mehr von den Rotkitteln gängeln lässt und den Priestern das Reich auf einem goldenen Teller serviert.«
Ahrunan nickte bedächtig. Das war also der Auslöser für diesen unseligen Krieg. Die dynastische Erbfolge war ein Privileg des Hochadels, der Herzöge und Fürsten, aber kein Recht, das den Grafen und Junkern zustand. Und der mal steigende, mal schwindende Einfluss der Auron-Priesterschaft auf den jeweiligen König war ein ständiger Streitpunkt unter den Adelshäusern von Kallidorn.
Er wollte eine weitere Frage stellen, doch Mirias Rückkehr hielt ihn davon ab. Das junge Mädchen wurde von einer älteren Frau mit einer mütterlichen Ausstrahlung begleitet, die sich als die Heilerin Lysanna vorstellte. Wie Ahrunan angenommen hatte, besaß sie ein Fläschchen Wintermohnsamen, die in kleinen Mengen Schmerzen betäubten, und als gewissenhafte Pflegerin wollte sie persönlich die Einnahme dieser zweischneidigen Medizin überwachen.
In dem Wissen, Baldor nicht mehr lebend wiederzusehen, verabschiedete sich Ahrunan von seinem Freund, dann überließ er ihn der Obhut der beiden Frauen, die sich so sorgsam um den Siechenden kümmerten. Er trat zu Jandor und erklärte mit belegter Stimme: »Ich habe für Euren Vater getan, was ich konnte. Aber das Fieber ist zu weit fortgeschritten; er wird die Nacht nicht überleben.«
Der junge Mann nickte knapp. Seine Miene war unbewegt, doch der Magier war sicher, das Herz war dem Jungen so schwer wie ihm selbst. Baldor war starrköpfig und aufbrausend, doch er verfügte über viele gute Eigenschaften, die einst Ahrunans Herz gewonnen hatten. Zweifellos liebten ihn seine Kinder, und sein unabwendbarer Tod war ein schmerzhafter Verlust für sie alle.
»Warte draußen«, wies Jandor den Magier an. Er winkte den Wachen, Ahrunan aus dem Gemach zu führen, und wortlos folgte dieser den Bewaffneten in einen angrenzenden Raum, der mit einigen Holzstühlen und zwei kleinen Tischchen als Empfangszimmer diente.
Ahrunan trat ans Fenster und blickte hinaus auf die sanften Hügel, die sich zwischen dem Hochland im Westen und der Flussebene im Süden erstreckten. Noch waren die Bäume grün belaubt, doch in wenigen Wochen würde der Herbst ihre Blätter färben. Die Felder trugen reiche Frucht, und die Bauern schienen wohlgenährt und zufrieden mit ihrem Lehensherrn – aber das würde sich schon bald ändern, und zwar schneller, als man es in Terredin erwartete.
Bilder aus der Vergangenheit stiegen vor Ahrunans innerem Auge auf. Mit wehem Herzen erinnerte er sich an den jungen Draufgänger Baldor, der mit Witz und Mut die Menschen für sich einnahm. Die Frauen buhlten um seine Gunst, die er ihnen dann und wann gewährte, um die Kälte einsamer Nächte zu vertreiben und um zu verbergen, dass er sein Lager lieber mit einem Kameraden teilte. Denn im Königreich Kallidorn und den angrenzenden Ländern war die Liebe zwischen Männern geächtet und verfemt.
Ahrunan seufzte lautlos. Auch er wirkte auf die holde Weiblichkeit anziehender, als ihm lieb und vor allem erklärlich war. Bis heute wusste er nicht, warum ihm so viele Frauen ihr Herz schenkten, und das, obwohl er nicht mehr der Jüngste war. Er lächelte leise. Sie waren schon zwei rechte Herzensbrecher gewesen, Baldor und er, während sie durch das Hochland von Synaid gezogen waren. An der Grenze zu Kallidorn hatten sich ihre Wege schließlich getrennt; Baldor war weiter in Richtung Terredin geritten, während Ahrunan in einem kleinen Bergdorf geblieben war, das seiner Hilfe bedurfte. Doch anstatt den Bauern das Leben zu erleichtern, hatte er ihnen allen den Tod gebracht.
Der Magier rieb seine narbenbedeckte Brust, die ihn für den Rest seines Lebens an die Schrecken gemahnen würde, die in jenem Dorf geschehen waren. Doch nein, daran wollte er jetzt nicht denken. Jetzt nicht und nie wieder. Er wandte der Landschaft und seinen Erinnerungen den Rücken zu und entdeckte, dass Jandor eingetreten war. Der Markgrafensohn schickte den Diener fort, der ihnen Wein gebracht hatte, und lud Ahrunan mit einer Geste ein, sich einen Becher zu nehmen.
»Du bist also Ahrunan Sturmbrecher.« Er sah den Älteren herausfordernd an. »Vater hat viel von dir erzählt.«
Ahrunan fühlte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte. Wie viel hatte Baldor seinem Sohn erzählt? Wusste der Junge von ihrer Liebschaft – oder schlimmer: von seinen Zauberkräften? Hatte der Markgraf erwähnt, dass Ahrunan schon damals ausgesehen hatte, als zähle er um die fünfzig Jahre? Aufgrund seiner magischen Abstammung alterte Ahrunan nur sehr langsam, und während eine Generation erblühte, reifte und verwelkte, zogen die Jahrzehnte kaum merklich an ihm vorüber. Nur ein Zehntel seiner fünfhundert Lebensjahre sah man ihm an.
»So, hat er das?« Ahrunan versuchte, seine Unruhe zu verbergen. Er schenkte Wein in einen Becher und trank einen Schluck. Unerwartete Süße füllte seinen Mund. »Ich bin sicher, nur ein Bruchteil von dem entspricht der Wahrheit. Je länger ein Abenteuer zurückliegt, desto großartiger wird es geschildert.«
»Vermutlich. Aber der Kern bleibt gleich, egal, wie groß der Apfel wächst.« Jandors Finger trommelten auf den Griff des Dolches, der an seinem Gürtel hing. »Vater hat nie erwähnt, dass du Baumeister bist.«
»War ich damals auch nicht.« Ahrunan sah keinen Grund, Jandor in dieser Sache zu belügen. »Erst später habe ich mich in Asgillimar als Baumeister niedergelassen. Und wie Ihr zu recht angenommen habt, habe ich Markgraf Keriban geholfen, die Stadt zu befestigen.« Um Zeit zu gewinnen, nahm er einen weiteren Schluck Wein, obwohl ihm der Rebensaft schnell zu Kopfe stieg. Irgendwie musste er sich aus seiner Lage herausreden. Baldor war sein Freund, und er schuldete ihm sein Leben, doch dem Sohn fühlte er sich nicht verpflichtet. Jandor war so starrköpfig wie sein Vater und offensichtlich gewillt, den Weg in den Untergang, den Baldor betreten hatte, bis zum bitteren Ende zu beschreiten. »Wenn Ihr erlaubt, werde ich mir morgen die Pläne von Terredin ansehen und schauen, was Ihr verbessern könnt.« Mit einem Ruck stellte er den Becher auf dem Tischchen ab, um seine Entschlossenheit zu betonen. »Aber dann werde ich weiter reiten.«
»Nein.« Jandor trat auf ihn zu. »Wie du gesagt hast, werde ich ab morgen der Markgraf von Terredin sein, und du wirst erst gehen, wenn ich es dir erlaube.« Nur noch eine Handbreit trennte ihre Gesichter. »Du wirst mir alles erzählen, was du über Korobans Hunde weißt, und du wirst meine Wehranlagen befestigen. Und wenn die Meute angreift, wirst du mir helfen, Terredin zu verteidigen.«
»Zirkel, Blei und Lot! Achtet Ihr so die Freundschaft, die mir Euer Vater entgegenbrachte?« Ahrunan starrte den Jungen wütend an. Was fiel diesem törichten Burschen nur ein? Glaubte er, ihn auf diese Weise zum Verbündeten gewinnen zu können? Er blinzelte hastig, um seinen Kopf zu klären. Der Wein war stärker, als er erwartet hatte. »Ein paar Tage, länger kann ich nicht bleiben. Ich will nicht noch so ein Blutbad wie in Asgillimar erleben.«
»Ha! Es wird kein Blutbad auf Terredin geben, höchstens unter unseren Feinden. Sie werden sich an unseren Mauern die Zähne ausbeißen, und wenn der Winter kommt, werden sie mit eingezogenem Schwanz nach Hause zurückkehren.« Die goldbraunen Augen blitzten. »Wir haben ja einen Hexer, der ihre Leitern umstoßen und ihre Geschosse zurückschleudern kann.«
Benommen schüttelte Ahrunan den Kopf. Was sagte Jandor da? Ein Hexer, ein Magier lebte auf Terredin? Seine Freundschaft mit Baldor hatte also bessere Früchte getragen, als er je zu hoffen gewagt … Seine Beine gaben nach, und zittrig ließ er sich auf einen Stuhl sinken. »Wen meint Ihr?«
»Dich natürlich.« Jandor lachte hart. »Wie ich sagte, Vater hat mir viel erzählt.«
»Dann werdet Ihr auch wissen, dass meine Kräfte Grenzen haben.« Er rieb seine schmerzenden Schläfen. Verflixt, er hätte den Wein nicht anrühren sollen. In den letzten Tagen hatte er zu wenig gegessen, sodass ihm der Trank übermäßig zusetzte. »Vielleicht kann ich einen Angriff abwehren, aber Korobans Feldherren werden nicht aufgeben, bis Terredin vernichtet ist. Junger Herr, ich rate Euch, ergebt Euch, solange Ihr noch Zeit habt.«
»Verdammter Feigling!«, entfuhr es dem angehenden Markgrafen. »Aber ob du willst oder nicht, du wirst uns mit all deinen Kräften zur Seite stehen.«
»Wie wollt Ihr das anstellen?« Ahrunan kniff die Augen zusammen. Dieser störrische Bursche zehrte an seiner Geduld. Es war höchste Zeit, dass er den Jungen ein wenig Respekt lehrte. Er wollte zurückweichen, um Platz zwischen Jandor und sich zu schaffen, doch seine Füße gehorchten ihm nicht. Eine Welle der Müdigkeit schwemmte über ihn hinweg. Er bemerkte Jandors Blick, der auf dem Wein ruhte. Bei allen guten Geistern, der Junge hatte ein Schlafmittel hineingemischt! Er wollte den Burschen verfluchten, da raubte undurchdringliche Schwärze seinen Blick. Der Schlaf zog ihn in seine Arme, und kraftlos sank sein Körper zu Boden.
Ein Schwall kalten Wassers weckte Ahrunan. Er prustete, blinzelte und versuchte, die Nässe aus seinem Gesicht zu reiben, doch seine Hände steckten in silbernen Kettenhandschuhen. Eine schwere Kette verschloss diese seltsame Fessel und verband die Hände miteinander.
»Bei allen guten Geistern!« Ruckartig setzte sich Ahrunan auf. Ein schneller Blick in die Runde verriet ihm, er saß in einer düsteren Kerkerzelle, die von drei Fackeln nur notdürftig erhellt wurde. Zwei Wächter flankierten ihn, während Jandor den just geleerten Wassereimer zur Seite stellte.
»Wie kannst du es wagen!«, blaffte Ahrunan den Jungen an. »Weiß dein Vater, wie schmählich du seine Freunde behandelst?!«
»Mein Vater ist tot.« Drohend trat Jandor vor seinen Gefangenen hin, die Miene wie versteinert aus Trauer und Entschlossenheit. »Ich bin jetzt der Markgraf, und du wirst tun, was ich von dir verlange. Du wirst mir helfen, Terredin vor Korobans Hunden zu beschützen.«
»Nein! Niemals!« Heißer Zorn wallte in Ahrunan auf. Die Magie schäumte und wogte in seinem Inneren, doch sie fand keinen Ausweg. Die silbernen Handschuhe bannten seine Zauberkräfte und beraubten ihn seiner Macht. Todesangst beschleunigte seinen Herzschlag. Das letzte Mal, als man ihn in Silberketten geschlagen hatte, hatte man ihn gefoltert und gequält mit dem Tod jener, mit denen er sich verbunden fühlte.
»Haltet ihn«, befahl Jandor den beiden Wachen, die Ahrunan packten und auf die Füße zerrten. Von seinem Gürtel zog der neue Markgraf einen silbernen Halsreif, der auf den ersten Blick wie ein Schmuckstück wirkte und dennoch nur eine weitere Fessel war. Ahrunan bäumte sich auf. Verzweifelt versuchte er, sich von den Wachen loszureißen, doch die kampferprobten Männer waren stärker als er. Jandor legte ihm den Silberreif um den Hals und verschloss diesen auf der Rückseite mit einem kleinen, aber sicheren Schloss. Ahrunan schrie innerlich auf. Sein Widerstand zerbrach. Seine Gegenwehr erlosch, und da ihn die Wachen aus ihrem Griff entließen, sank er kraftlos zu Boden.
»Überleg es dir«, beschied ihm Jandor. »Entweder du schließt dich uns an, oder du magst hier unten verrotten.« Er wandte sich um und verließ den Wachen voran die Zelle. Die Fackeln nahmen sie mit, sodass Ahrunan allein in der Dunkelheit des Kerkers zurückblieb.
Von unendlicher Müdigkeit erfüllt zog der Magier die Beine an und kreuzte sie zum Schneidersitz. Er wiegte den Oberkörper vor und zurück, während er leise eine Totenklage anstimmte. Er trauerte um seinen Freund Baldor, den er nur kurz wiedergesehen hatte, um ihn endgültig zu verlieren. Er beklagte das Leid, das Jandor ihm auferlegte, und er bedauerte die Bewohner von Terredin, die der junge Markgraf dem Tod geweiht hatte.
2. Freund oder Feind
Ranyth steckte im Zwiespalt. Die Kapuze des schwarzen Lederumhangs schränkte seine Sicht gefährlich ein, doch sobald er sie zurückschob, schlug ihm der Herbstregen ins Gesicht und blendete ihn. Einen Tag, nachdem er mit seinen Soldaten die zerstörte Stadt Asgillimar passiert hatte, hatte es zu regnen begonnen und seitdem nicht wieder aufgehört. Die Wege hatten sich in knöcheltiefe Schlammfelder verwandelt, in denen die Wagen stecken blieben und selbst die Pferde nur mühsam vorwärts kamen. Der jüngste Sarlinger seufzte. Von solch lästigen Unbilden war weder in den Erzählungen seiner Brüder noch in den Heldensagen je die Rede gewesen.
Aus dem dichten Regenvorhang schälten sich Stück für Stück die Umrisse niedriger Gebäude. Ranyth schob die lederne Kapuze zurück und schirmte mit der Hand seine Augen ab. Sie hatten ein Dorf erreicht, doch irgendetwas stimmte nicht. Nirgendwo fiel Licht aus den Fenstern. Kein Hund schlug an, keine Gans schnatterte. Die Stille des Todes herrschte über die gedrungenen Häuserschatten.
Wachsam fasste Ranyth die Zügel kürzer und ritt seinem Tross voran in das Dorf. Eine Gänsehaut zog sich über seine Arme. Der Weg sah aus, als habe ihn ein verrückt gewordener Knecht gepflügt. Der Regen prasselte laut in den schrittlangen Furchen und raschelte hohl im verbrannten Ried der Dächer. Verkohlte Stützbalken ragten wie gebrochene Finger in den düsteren Himmel auf.
Ranyth biss sich auf die Lippen. Das Dorf war überfallen worden, und das zweifellos von den königstreuen Truppen, die sein Bruder Wrogomar und dessen Schwertgesellen anführten. Das aufständische Terredin konnte nicht mehr weit sein, und das bedeutete, ab jetzt musste er damit rechnen, auf feindliche Soldaten zu stoßen. Mit der nächsten Rast würde er den schwarzledernen Waffenrock, den nur wenige Eisenringe verstärkten, gegen eine bessere Rüstung tauschen – auch wenn das Verräterpack bei diesem Hundewetter vermutlich lieber daheim am warmen Herd blieb. Nichts anderes war von Kriegern zu erwarten, deren Anführer lieber im Warmen schlief.
Der Fürstensohn verzog das Gesicht. Nun, diese Vorliebe teilte er mit Jandor von Terredin, obwohl es auch eine Art von Frauen gab, nach denen es ihn gelüstete. Doch im Gegensatz zu dem markgräflichen Bastard würde er lieber sterben, als sich offen zu seiner Liebe zu Männern zu bekennen. Niemals würde er ein erfolgreicher und berühmter Feldherr werden, wenn es hieß, er würde seinen Soldaten nachstellen. Zu heiß flammten die Predigten der Priester des Auron, und zu tief wurzelten Verachtung und Vorurteile in den Herzen der Menschen von Kallidorn.
Der schwere Regen ließ langsam nach, als der Sarlinger mit seinem Trupp den Dorfplatz erreichte. Nur flüchtig bemerkte Ranyth die halb verbrannte Linde, die den Mittelpunkt der Siedlung bildete. Seine Aufmerksamkeit galt der Leiche, die von dem vorspringenden Giebel einer Scheune baumelte. Es musste einer der Aufständischen sein, denn nur Verräter und gemeine Verbrecher wurden in Kallidorn gehängt. Neugierig ritt Ranyth näher. Man hatte dem Toten das Hemd heruntergerissen und ein Wappentier in seine Brust geschnitten: den Löwen von Kallidorn.
Ranyth holte scharf Luft. Der Tote war kein Aufständiger, sondern ein Königstreuer. Kein ehrbarer Feldherr würde einem Soldaten solch eine Schmach zufügen, selbst wenn der Mann zu den Truppen des Feindes zählte. Das konnte nur das Werk des Bastards von Terredin sein!
»Auron verbrenne dich!« Er zog sein Schwert, um den Soldaten abzuschneiden.
»Bei diesem Regenwetter wird ihm das schwerfallen!«, rief eine spöttische Stimme. Bewaffnete drängten aus der Scheune, von ledernen Panzern geschützt, die Schwerter blank gezogen. Nur ihr Anführer trug ein glänzendes Kettenhemd, und auf dem Wappenrock prangte kampfeslustig ein schwarzer Wolf, der Stand und Namen seines Trägers verriet: Jandor von Terredin.
»Überfall!«, brüllte Ranyth das Offensichtliche heraus. Er schlug nach dem verräterischen Markgrafen, doch lachend wich dieser zur Seite aus.
»He, du Welpe! Du bist zu jung, um gegen mich zu bestehen.« Jandor hieb nach Ranyths Pferd. Die Schwertklinge schnitt durch Fell und Fleisch, drang tief in die ungeschützte Brust. Blut schlug Jandor ins Gesicht. Der Rappe brach zusammen. Fluchend riss Ranyth den Fuß aus dem Steigbügel. Nur einen Herzschlag, bevor ihn das Pferd unter sich begrub, kam er aus dem Sattel. Er stürzte rücklings in den Schlamm, direkt vor Jandors Füße. Rotes Wasser spritzte auf. Schmerz schoss durch seinen Ellbogen und betäubte seine Hand. Das Schwert entglitt seinen Fingern. Fassungslos starrte er den Krieger an. Was für ein Feigling, ein ungeschütztes Pferd anzugreifen!
»Es wäre wirklich schade um dich, Kleiner«, Jandor fasste seine Waffe mit beiden Händen, die Klinge abwärts gerichtet, und zog sie hoch über seinen Kopf, »wenn du kein verfluchter kallidornischer Hund wärst.« Das Schwert sauste herab. Ranyth zuckte zur Seite. Dicht neben seinem Hals fuhr die Klinge in den Boden. Schlamm spritzte ihm ins Gesicht und über Jandors Beine.
Das war knapp. Ranyths Herz raste. Eisige Kälte bemächtigte sich seiner Glieder und lähmte ihn schier, doch er würde nicht aufgeben. Niemals! Mit der Linken griff er tief in den Schlamm, er packte einen Klumpen Erde und schleuderte ihn gegen seinen Angreifer. Dieser duckte sich. Der Schlammklumpen flog über ihn hinweg und klatschte gegen die Hauswand.
»Elender Verräter!« Ranyth rollte sich herum, zog die Knie unter den Leib und sprang auf die Füße. Mit Links zog er seinen Dolch, während er gleichzeitig den Fuß unter sein Schwert im Schlamm schob. Geschickt trat er das Schwert zurück in seine Hand, gerade noch rechtzeitig, um den nächsten Angriff abzuwehren. Die Klingen kreischten, als Stahl über Stahl schabte. Die Schwerter verhakten sich. Ranyth stach mit dem Dolch nach Jandors rechtem Arm. Die kleine Klinge fand ihren Weg durch das Kettenhemd und biss in das weiche Fleisch. Blut quoll aus der Wunde. Fluchend wich der Krieger zurück.
»Na warte, du Hund!« Jandors goldbraune Augen blitzten und erinnerten Ranyth an jenen Wolf, dem er vor ein paar Jahren gegenüber gestanden hatte. Fast hätte ihn das Tier getötet – und nun drohte der Krieger, das Werk zu vollenden. »Ich zieh dir das Fell über die Ohren!«
Ranyth packte seine Waffen fester. »Das werden wir ja sehen!«
Er warf den Dolch nach seinem Gegner. Mit einem höhnischen Lachen über den leichten Erfolg schlug Jandor die Waffe zur Seite, doch Ranyth nutzte den Augenblick des scheinbaren Triumphes für einen anderen Plan. Er zog den Umhang von seinen Schultern und schlug ihn dem Krieger um die Ohren. Das Leder klatschte gegen Jandors Kopf. Er stolperte rückwärts, bis er mit dem Rücken gegen die Hauswand stieß.
»Höchste Zeit, dass mal ein Mann sein Schwert dahin steckt, wo es hingehört«, fauchte Ranyth. Die Wut vertrieb die klamme Kälte und die Angst, die er eben noch empfunden hatte. Die endlosen Schwertübungen mit seinen Brüdern machten sich nun bezahlt. Er suchte einen sicheren Stand im Schlamm. »In deinen stinkenden Leib!«
»Nur in deinen feuchten Träumen!« Als Ranyth erneut mit dem Umhang zuschlug, fing Jandor das Leder ab und zog heftig daran. Überrascht verlor der Sarlinger den Halt und taumelte vorwärts. Er ließ den Mantel fallen und fing sich an der Hauswand ab, ehe er mit dem Gesicht dagegen schrammte. Stechender Schmerz fuhr in seine rechte Seite. Jandor sprang von ihm fort, in seinen Rücken. Hastig drehte er sich um, die freie Linke auf seine Seite gepresst. Warmes Blut quoll über seine Hand.
»Wickelkind!«, höhnte Jandor. »Du wirst niemals erwachsen werden!«
Sein Schwert wurde zu einem tödlichen Schwirren, und nur mit knapper Not hielt Ranyth ihn auf Abstand. Gedämpft hörte er Waffen klirren. Schreie gellten, doch er wusste nicht, ob es seine eigenen waren oder die seiner Männer. Rasch vergaß er, dass er nicht allein im Kampfe stand. Jandor nahm seine gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch. Nur knapp konnte er den schnellen Angriffen entkommen, und Schritt für Schritt wurde er zurückgedrängt. Die Wunde an seiner Seite schickte Wellen des Schmerzes durch seinen Leib. Bei jeder Parade, jedem gescheiterten Angriff verloren seine Arme kaum merklich, aber unaufhaltsam an Kraft. Seine Füße fanden keinen sicheren Stand mehr. Immer öfter rutschte er im Schlamm aus. Keuchend sog er Luft in seine Lungen, das Herz drohte ihm zu zerspringen. Der Regen floss aus seinen Haaren, rann in seine Augen und nahm ihm die Sicht. Er blinzelte das Wasser fort. Der nächste Hieb kam höher als erwartet. Die Klinge jagte auf seine Kehle zu. Ranyth wich aus und bot dem Schwert die linke Schulter dar. Der Stahl zerschnitt seinen ledernen Waffenrock, seine Haut und sein Fleisch. Der Schmerz raubte Ranyth fast das Bewusstsein. Er stolperte, stürzte und schlug zu Boden. Zum zweiten Mal entglitt die Waffe seiner Hand. Über ihm erschien Jandor, die Klinge hoch erhoben.
»Auron sei dir gnädig!« Er holte Schwung für den Todesstoß.
Eine schattenhafte Gestalt tauchte aus dem Regen auf und warf sich gegen den Krieger. Jandor ging zu Boden, sein Schwert wirbelte davon. Die beiden Gegner wälzten sich im Schlamm und schlugen mit bloßen Fäusten aufeinander ein.
Ranyth biss die Zähne zusammen. Vor Erleichterung wurde ihm beinahe schwarz vor Augen. Auron sei Dank, betete er, während er sich auf die Füße kämpfte. Plötzlich hörte er Hufgetrappel. Zwei, drei Reiter jagten heran. Ein Knüppel flog auf ihn zu, verfehlte ihn jedoch. Ein Reiter brüllte nach Jandor, der von seinem Gegner abließ. Geschickt sprang er hinter dem Mann aufs Pferd, dann preschten die Bewaffneten davon.
Ranyth presste die rechte Hand auf die Schulterwunde. Das Waffengeklirr war verstummt, und nur noch vereinzelt klangen Schmerzensschreie zu ihm hin. Unvermittelt fühlte er sich leicht wie eine Feder. Das Gefühl, überlebt und gewonnen zu haben, rauschte süß durch seine Adern. Die Terrediner waren fort, geflohen. Sie hatten gesiegt.
»Kallidorn!«, brüllte Ranyth erleichtert, und seine Soldaten fielen in den Siegesruf ein. Er streckte die linke Faust in den regenschweren Himmel und bereute es sofort wieder. Ein Folterknecht schien ein glühendes Eisen durch seine Schulter zu stoßen. Von Schmerzen gelähmt fiel seine Hand herab.
»Hexenscheiße«, keuchte er.
Ein trockenes Lachen antwortete ihm. Nur wenige Meter entfernt kämpfte sich sein Lebensretter auf die Knie. Schlamm verdunkelte das braune Haar, das auffallend kurz geschnitten ein kantiges Gesicht einfasste. Der sehnige Körper steckte in der grobgewebten Jacke eines Bauern, doch die Stiefel, die unter der ebenfalls bäuerlichen Hose hervorlugten, waren das Schuhwerk eines Soldaten.
»Du hast mir das Leben gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld.« Ranyth streckte die Hand aus, um dem anderen auf die Füße zu helfen, doch beinahe hätte er ihn auf halber Strecke losgelassen. Sein Retter war gar kein Mann, sondern eine Frau. Zwar trug sie derbe Männerkleidung, doch unter ihrem nassen, zerrissenen Hemd zeichneten sich deutlich Brüste ab.
»Bei allen Schlangenaugen!« Ungläubig starrte Ranyth sie an. »Du bist eine Frau.«
»Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Kundschafter des Königs.« Die Frau zog die Jacke über ihrer Brust zusammen und verschränkte abwehrend die Arme. »Als ich noch ein kleiner Junge war, hat mich ein Pferd zwischen die Beine getreten, und danach sind mir Titten gewachsen.«
Ranyth schüttelte den Kopf. Nein, das war unmöglich. Er hatte noch nie von einem Kastraten gehört, der solch eindeutig weibliche Rundungen entwickelt hatte und dabei so mager und durchtrainiert war wie diese Frau.