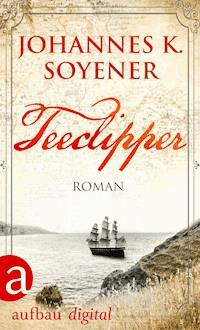8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
21. September 1957. Die deutsche Viermastbark Pamir befindet sich mit geschütteter Gerste, einer gefährlichen Fracht, auf der Heimreise von Buenos Aires nach Hamburg. In den Morgenstunden erhält sie per Funk eine dringende Warnung vor Hurrikan Carrie. Der Sturm befindet sich seit Tagen auf Kollisionskurs und wird die Reiseroute der Pamir kreuzen. Ihr Kapitän unternimmt seltsamerweise nichts, um das drohende Unheil abzuwenden. Zu spät lässt er SOS funken. Und es beginnt ein Kampf mit dem tropischen Sturm - ein Kampf, den Schiff und Seeleute verlieren müssen ...
Der Roman "Sturmlegende" erzählt die Geschichte der Reise und des Untergangs der Pamir packend und lebendig. Der Autor hat die Hintergründe der Tragödie genau recherchiert, neue, unbekannte Dokumente aus jener Zeit ausgewertet und mit Zeitzeugen gesprochen. Dabei ist er auf dramatische Fakten gestoßen, die ein neues Licht auf die Vorgänge an Bord, auf die Motive des Kapitäns und das Schiffsunglück werfen, das Menschen seit Jahrzehnten in seinen Bann zieht.
2022 jährte sich der Untergang der Pamir zum 75. Mal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Johannes K. Soyener
Johannes K. Soyener, geboren 1945 in Altötting, wurde bekannt als Autor historischer Romane, insbesondere durch den Bestseller Der Meister des siebten Siegels (1994). Die Inhalte des Romans dienten auch als Vorlage des Dokumentationsfilmes »Das Imperium schlägt zurück«, gesendet in der Reihe »Mission X / ZDF 2002«. Es folgten u. a. der Teeclipper, die Venus des Velazques, Der Chirurg Napoleons, der Thriller Das Pharmakomplott und der Tatsachenroman Sturmlegende – Die letzte Fahrt der Pamir. Zuletzt erschien der Kriminalroman Toteissee (2016) Soyener interessiert sich seit Jahren für die Geschichte der Seefahrt und ihre historischen Großsegler. Er selbst ist leidenschaftlicher Skipper und hat mehrmals an Transatlantik-Regatten teilgenommen. Bekannt sind auch seine zahlreichen Reportagen zur Vendée Globe, die u.a. auf Zeit-Online veröffentlicht wurden. Fachartikel und Revierreportagen über die Bahamas, Seychellen und British-Virgin-Islands sind in verschiedenen Magazinen erschienen. Johannes K. Soyener lebt heute als freier Schriftsteller in Bremen.
Informationen zum Buch
21. September 1957. Die deutsche Viermastbark Pamir befindet sich mit geschütteter Gerste, einer gefährlichen Fracht, auf der Heimreise von Buenos Aires nach Hamburg. In den Morgenstunden erhält sie per Funk eine dringende Warnung vor Hurrikan Carrie. Der Sturm befindet sich seit Tagen auf Kollisionskurs und wird die Reiseroute der Pamir kreuzen. Ihr Kapitän unternimmt seltsamerweise nichts, um das drohende Unheil abzuwenden. Zu spät lässt er SOS funken. Und so beginnt ein Kampf mit dem tropischen Sturm – ein Kampf, den Schiff und Seeleute verlieren müssen …
Der Roman »Sturmlegende« erzählt die Geschichte der Reise und des Untergangs der Pamir packend und lebendig. Der Autor hat die Hintergründe der Tragödie genau recherchiert, neue, unbekannte Dokumente aus jener Zeit ausgewertet und mit Zeitzeugen gesprochen. Dabei ist er auf dramatische Fakten gestoßen, die ein neues Licht auf die Vorgänge an Bord, auf die Motive des Kapitäns und das Schiffsunglück werfen, das Menschen seit Jahrzehnten in seinen Bann zieht. 2017 jährt sich der Untergang der Pamir zum 60. Mal.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Johannes K. Soyener
Sturmlegende
Die letzte Fahrt der Pamir
Roman
überarbeitete Neuausgabe zum 60. Jahrestages des Untergangs im Herbst 2017
Inhaltsübersicht
Über Johannes K. Soyener
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort zur Neuauflage zum 60. Jahrestag des Untergangs der SS Pamir am 21. September 1957
Widmung
Hurrikan Carrie
Lübeck 1957
Erstes Kapitel: Master next God
Zweites Kapitel: »Fahr wohl, du stolzes Schiff Pamir!«
Drittes Kapitel: Buenos Aires
Viertes Kapitel: Sturmlegende
Danksagung
Quellen
Glossar
Besatzung der Pamir
Impressum
»Dem Bremer Schriftsteller Johannes K. Soyener ist es zu verdanken, dass es zum Untergang der ›Pamir‹ neue, überraschende Antworten gibt. Soyener, 61, ist selbst Hochseesegler, dreimal hat er den Atlantik überquert. Mitte der achtziger Jahre entdeckte er in einer Buchhandlung den Bericht des Seeamts Lübeck, 327 Seiten stark. Von Anfang an hatte er das Gefühl, dass der Bericht mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet, dass irgendetwas nicht stimmt. Soyener fand heraus, dass die Akten der Eignerin, der Stiftung ›Pamir und Passat‹, im Bremer Staatsarchiv lagern, 13 Archivkartons, insgesamt 61 Verzeichnungseinheiten. Durch Zufall waren sie dort gelandet, nachdem der Anwalt der Stiftung gestorben war. Auf Grundlage dieser Dokumente hat Soyener einen Roman geschrieben (›Sturmlegende. Die letzte Fahrt der Pamir‹), und wenn man die Unterlagen sichtet, kann man eine Dokumentation erstellen, die belegt, dass die 80 Männer einen sinnlosen, vermeidbaren Tod starben. Der ›Schicksalsschlag‹ war in Wirklichkeit ein Unglück, das sich leicht hätte verhindern lassen. Das Schiff hätte niemals auslaufen dürfen.«
Zitat aus »SPIEGEL« 25/2007, Seite 86 ff.
Vorwort zur Neuauflage zum 60. Jahrestag des Untergangs der SS Pamir am 21. September 1957
Das vorliegende Buch schildert die Zustände und Vorkommnisse an Bord der PAMIR während ihrer letzten Fahrt von Hamburg nach Buenos Aires und zurück bis zu ihrer Kenterung im Hurrikan Carrie. Protagonisten im Roman sind der damalige Kapitän Johannes Diebitsch, Offiziere der Stammbesatzung und die Kadetten. Charakterisierungen der Personen erfolgte mit Hilfe von Briefen, Dokumenten und zahlreichen Gesprächen, u.a. mit Karl-Otto-Dummer, einer der Überlebenden der PAMIR, sowie durch ehemaligen Besatzungsmitgliedern der PAMIR und PASSAT.
Besonders aufschlussreich und zugleich sensationell war für mich die Sichtung der bis dahin unentdeckten Akten der Pamir-Passat-Stiftung. Während meiner Recherche über Hintergründe und Ursachen, die zur Kenterung der PAMIR am 21. September 1957 führten, stieß ich im Juni 2006 in der Staatsbibliothek Bremen auf Akten (13 Archivkartons, insgesamt 61 Verzeichnungseinheiten), die aus der Anwaltskanzlei der Rechtsvertreter der ehemaligen Korrespondentreederei Zerssen & Co sowie der Stiftung Pamir und Passat, stammen. Protokolle, Kapitänsberichte, Kassenlage und Briefe beweisen, dass die 6. Reise der Pamir unter hohem Risiko für Schiff und Besatzung stattfand.
Reederei und Stiftung hatten bereits vor der letzten Fahrt umfassende Kenntnis über mangelnde Kompetenz der Schiffsführung und über schwerwiegende Mängel am Schiff. Dringend anstehende Reparaturen am Hochdeck und Rumpf wurden aufgrund der schwierigen Finanzlage nicht durchgeführt. Die finanzielle Schieflage wurde 1956 durch Streichung des Zuschusses von DM 65.000.- der Hansestadt Bremen eingeleitet. Begründet wurde die Streichung damit, dass man anlässlich der Leistungskontrolle der Kadetten und Jungmänner den Eindruck gewann, »die Jungens würden auf der Pamir und Passat nur Rostklopfen lernen«! Höhepunkt der finanziellen Krise waren die Kündigungen von insgesamt elf von einundvierzig Stiftungsreedern im Juni 1957. Sie wurden genau zu dem Zeitpunkt von den Reedereien eingereicht, als sich die PAMIR auf den Weg in ihren Untergang befand.
Ursächlich für den Untergang war der marode Zustand des Seglers, insbesondere des Hochdecks (Aufbauten). Dokumentiert sind u. a. gravierende, massive Lecks der Mittschiffs-Aufbauten. Kapitän Eggers berichtet am 21. Februar 1957 aus Montevideo an den Reedereiinspektor Dominik. Dieser informiert den Vorstand der Stiftung über Eggers Bericht und seine Ausführungen zum Zustand der Laderäume und des maroden Hochdecks …
…Das Hochdeck leckt an den verschieden Stellen stark. Teilweise gehen die Decksplanken bei Regen direkt hoch. Grund: Das unter dem Holzdeck liegende Stahldeck ist sehr stark korrodiert, und das Holzdeck selbst ist von unten wegen der stets unter dem Holz stehenden Feuchtigkeit stark angegangen, so dass durch das Einziehen einzelner neuer Planken und durch Kalfatern das Deck nicht mehr dichtzubekommen ist. Wegen der sehr hohen Kosten wurde bei den Klassearbeiten von Erneuerung des Hochdecks Abstand genommen. Wie der Bericht des Kapitäns zeigt, wird diese Arbeit jetzt aber anscheinend akut…
Aus Kostengründen wurde nichts unternommen. Der Wassereinbruch Mittschiffs während des Hurrikans, und der damit einhergehende Verlust des Auftriebs, war, nach Überzeugung des Seeamtes, u. a. für den Untergang verantwortlich. Bilanzen und Schriftstücke über den Finanzstatus der Stiftung, ebenso interne Briefe lassen den Schluss zu, dass die hohen Verbindlichkeiten verhinderten, dass dringend erforderlichen Werftarbeiten vor der schicksalhaften Reise durchgeführt wurden. Die Stiftung war praktisch bankrott. Die Verantwortlichen waren über den maroden Zustand der Pamir informiert, unternahmen nichts um die Mängel zu beseitigen, schwiegen und schickten die PAMIR dennoch auf Reisen.
Dass die Pamir am 21. September 1957 die Zugbahn des Hurrikans Carrie kreuzte, lag an der völligen Unkenntnis an Bord über die Existenz eines tropischen Sturms im betreffenden Seegebiet. Kapitän Diebitsch gab in den entscheidenden Tagen keine Anweisung Wetterkarten zeichnen zu lassen. Sein Funker war durch Verwaltungsaufgaben überlastet. Darüber hinaus muss angenommen werden, dass der übliche Informationsaustausch über Wetterdaten an Bord der Pamir nicht stattfand.
Hurrikan Carrie (Einschätzung nach der Saffir-Simpson-Skala: Kategorie T 1 / ca. 72 Knoten Wind) zog nicht »überraschend« heran und »überfiel« die Pamir auch nicht. Carrie vagabundierte schon seit zwei Wochen auf dem Atlantik umher und der Hurrikan »raste« nicht auf die PAMIR zu, da die Zuggeschwindigkeit des Sturmfeldes rund 15 Knoten betrug. Die Schiffsführung hatte alle Zeit der Welt, um sich gehörig darauf vorzubereiten und ein sicheres Ausweichen nach Südosten einzuleiten. Nichts geschah. Am Ende waren nicht einmal die Segel geborgen, geschweige die Bulleyes verschlossen und eine Eisentür Achtern eingehängt.
Die PAMIR hätte unter diesen Bedingungen diese Reise nie antreten dürfen. Der Rumpf, das Mittschiff der Pamir waren stark von Korrosion befallen. Eine bankrotte Stiftung, unsachgemäß geschüttete Gersten-Fracht, eine mehr als fragliche Auswahl des Kapitäns, unerfahrene nautische Offiziere, eine teilweise Überalterung der Stammbesatzung, der Mangel an Zahl und gut ausgebildeten Matrosen, schafften die Voraussetzungen für das Desaster. Die inkompetente Schiffsführung segelte mit einer unerfahrenen Kadettencrew die PAMIR konsequent in den Hurrikan.
Die Kenterung der PAMIR ist daher der Endpunkt von Fehlern, die allesamt im Vorfeld hätten vermieden werden können. Während der Seeamtsverhandlung führten Gutachter das Wort, die die Schuldfrage nicht zu klären hatten. Als Skandal muss die Tatsache bewertet werden, dass der von zwölf Familien unterzeichnete Strafantrag wg. fahrlässiger Tötung und Körperverletzung von keinem Staatsanwalt verfolgt wurde. Somit unterblieb eine juristische Klärung aller offenen Fragen. Keine Frage, ein zivilgerichtliches Verfahren hätte mehr Licht ins Dunkel getragen. Die Angehörigen der Toten und die Überlebenden hätten ein Anrecht darauf gehabt. Hans Joachim Gerstenberg, Ober-Ramstein, dessen Bruder auf der Pamir fuhr und auf ihr den Tod fand, schrieb zum Artikel: Tod im Orkan (Zeit Nr. 47/2007) von Klaus J. Hennig:
Mein Bruder sank mit der Pamir. Eigentlich hätte nach dem Seeamtsspruch die Staatsanwaltschaft auf den Plan erscheinen müssen. Das wäre der Staat den Opfern schuldig gewesen….«
Alle Dokumente unter: www.pamir-sturmlegende.de
Johannes K. Soyener
Bremen, September 2017
In Gedenken an alle,
die auf See geblieben sind
Hurrikan Carrie
An Bord der Pamir21. September 1957,
Nordatlantik, 13.00 Uhr
»Sie wird kentern!« brüllt Kapitän Johannes Diebitsch. Rolf-Dieter Köhler, sein 1. Offizier, starr wie eine Gliederpuppe, blickt glasig auf dessen Lippen. Orkanböen verwirbeln die Worte seines Kapitäns. Die Prophezeiung bleibt ungehört.
Gegen die Wand gestemmt, blickt Diebitsch auf den Neigungsmesser am Kartenhaus. Er hat das Scheitern vor Augen! Der Zeiger steht längst am Anschlag der Armatur: 40° Neigung. Wahrscheinlich aber beträgt die Schieflage bereits mehr als 45°.
Vier Masten, so hoch wie zwölfgeschossige Gebäude, ragen wie Kreuze in Schräglage aus der brodelnden See, inmitten einer unwirklichen Landschaft aus riesigen Wasserpyramiden, Kuppeln, tiefen Schluchten und Überhängen, die gegen die Steuerbordseite der PAMIR donnern. Die tonnenschweren Wellen kollabieren nicht über dem Deck, sondern an der hoch aufragenden Steuerbordseite. Ein ohrenbetäubendes Knattern entsteht durch die zerfetzten Reste der Mars-, Fock- und Klüversegel, mischt sich in das Kreischen des Orkans. Brecher die über die Leeseite der PAMIR an Deck donnern, häckseln ungesicherte Türen zu Kleinholz. In kurzen Intervallen strömen Wasserfluten durch offene Bullaugen, Gänge und Kammern. In der Dunkelheit unter Deck fließt unaufhörlich die Gerstenfracht nach Backbord. Sie folgt der Schwerkraft. Für die nicht mehr steuerbare PAMIR samt ihrer Besatzung ein unsichtbarer Fingerzeig hinab in die Stille der Ewigkeit …
Joe, Henry, und Manfred sind auf das Hochdeck der PAMIR gekrochen. Die dicken Freunde klammern sich an die gespannten Strecktaue um nicht in die brodelnde See nach Lee abzurutschen, die das Deck an Backbord tosend überflutet. »Wo sind Tom und Jürgen?« Joes Frage vermag auch auf kürzeste Entfernung, das Kreischen des Sturmes nicht zu durchdringen. Die fünf Freunde sind durch Dick und Dünn gegangen, haben sich in schweren Stunden gegenseitig ermutigt, aufgerichtet und verhindert, dass die Tortouren der Reise, das Herz zerfressen. Joe lauscht dem unheimlichen Kreischen. Es ist der Klagegesang des unsichtbaren Todes …
Das Zentrum des Hurrikans Carrie nähert sich indessen unaufhaltsam. Die Bedingungen an Bord haben sich rasant verschlechtert. Die untersten Rahen an den stählernen Masten tauchen schon in die Wellenberge ein. Das Gefühl der Sicherheit weicht der spürbaren tödlichen Gefahr. Riesige Wellenkämme werden abgerissen und wandeln die Meeresoberfläche in eine weiße Masse aus Gischt. Der anschwellende Lärm des Sturms, das Ächzen des Stahlrumpfes, die ungewohnten Vibrationen, das alarmierende Schlingern des Schiffes, leiten das Verhängnis ein. Die vom Rost zerfressenen Eisenplatten des Rumpfes halten den Verwindungskräften nicht stand. Einige reißen unterhalb der Wasserlinie. Auch der Stahl unter den Planken des Hochdecks und der Poop ist stark korrodiert und hat Leckstellen, durch die nun Massen von Wasser in die Aufbauten strömt. Schwere Orkanböen, die durch das Gewirr der Leinen und Drähte heulen, zerren an Ohren und Nerven, machen lethargisch.
Die Viermastbark holt mehrmals extrem nach Lee über, so dass Rettungsboote durch die Wucht der brechenden Seen aus ihren Halterungen gerissen werden. Kurz darauf sind sie zerschlagen.
Dicht gedrängt, aber ohne Zeichen einer Panik, versucht sich die Besatzung auf dem Hochdeck vor der Naturgewalt zu schützen. Doch Wasser dringt unaufhörlich in die Aufbauten und in den Proviantraum, dazu lässt eine gewaltige Windsee die untersten Rahen der PAMIR auf der Backbordseite immer weiter in die Wellenberge eintauchen. Kapitän Diebitsch fühlt das Ende. Die Rückreise von Buenos Aires nach Hamburg wird die letzte Fahrt der PAMIR sein, und das ausgerechnet unter seiner Führung. Er hatte sich das Kommando zugetraut – doch er begreift – er hat versagt. Seine Erfahrung, sein Können, das Vertrauen in ihn… Illusion! Alles löst sich auf, wie eine Sandskulptur in der Brandung.
Er träumte davon, als Kapitän des legendären Windjammers, endlich den versöhnlichen Abschluss seines schillernden Seefahrerlebens gefunden zu haben. Doch statt eines späten Triumphes erlebt er kurz vor dem Ziel seine Todesstunde. »So habe ich immer gelebt!«, gesteht er sich ein, als er sich im Windschatten des Kartenhauses mühsam auf einem eisernen Schäkel eines Brassblocks versucht sein Gleichgewicht zu halten. Ein Leben nahe am Abgrund. Eines, das nach Befehl und Gehorsam ausgerichtet war und ihm – in der Stunde seines Todes – doch wie ein Flickenteppich anmutet: zerrissen und ausgefranst. Dabei hatte er vom inneren Frieden geträumt, von ein wenig Ruhm und davon, den Rest seines Lebens frei von materiellen Sorgen zu sein.
Mit jenen armen Geistern, die weder sonderlich genießen noch sonderlich leiden, ist Diebitsch nicht gleichzustellen. Im grauen Zwielicht hat er nie gelebt. Er hatte sich immer klar entschieden. Für ein dramatisches Leben auf den Meeren als Schiffsoffizier, verbunden mit vielen Jahren der Trennung von seiner geliebten Frau Auguste, für die NSDAP, für den Einsatz im Sudetenland zur Sicherstellung von Beutegut, als Prisenoffizier auf dem Hilfskreuzer Kormoran, und die Verleugnung seines Vaters, der kein Major war wie er angegeben hatte, sondern Schauspieler in seiner Geburtsstadt Magdeburg …
Den Geschmack von Sieg und Niederlage kennt er. Die letzte, die sich nun anbahnt, wird endgültig sein. Sie wiegt aber am schwersten, denn durch Dilettantismus und Ignoranz sind über achtzig Menschenleben gefährdet.
Diebitsch kneift die Augen, und blickt in einige Gesichter. Die jungen Männer zeigen keine Anzeichen von Furcht. Kaum einer von ihnen rechnet offenbar damit, dass das Schiff kentern könnte. Ihrer Unkenntnis über die aussichtslose Lage schützt sie vor Panik. Als einer der Letzten lässt sich Diebitsch auf dem Hochdeck die Korkschwimmweste umbinden. Der Zimmermann und der Kochsmaat Karl-Otto Dummer, genannt Kuddel, sind ihm dabei behilflich. Kuddel wird einer der sechs Männer sein, die den Untergang überleben. Es ist 13.00 Uhr Bordzeit.
Diebitsch ist äußerlich völlig gefasst. In Kuddel’s Augen will er den Anschein erwecken, als habe er noch alles im Griff. In jenem Moment holte die PAMIR zwei-, drei Mal über. Ein Ruck! Die Beatzung beginnt in dieser extremen Situation die tödliche Gefahr endgültig zu begreifen. Das Schiff legt sich auf die Seite, das Deck steht fast senkrecht. Rufe, Schreie… Leiber stürzen in die kochende Leeseite. Andere versuchen sich mit letzter Kraft in der Leeverschanzung des Oberdecks festzukrallen.
Dann hört Kuddel die letzten Befehle aus dem Munde des Kapitäns: »Jetzt! Los, lass Dich fallen!«
Im gleichen Moment donnert eine schwere See gegen die Luvseite. Die brechende Welle drückt die PAMIR in ihren Untergang. Das Deck scheint jeden Moment umzuschlagen. Gruppen von Menschen fallen in die brodelnde Tiefe. Dort bildet sich ein Wirrwarr aus Leinen, Trümmerholz und Köpfen. Diebitsch hängt an der Aussen-Obermars-Gording, Kuddel an der Innen-Gording. Die nächste Monstersee legt den Windjammer vollends auf die Backbordseite. Diebitsch hält sich an der Gording fest. Die Leine ist nass. Er sieht, wie sich sein Kochsmaat am senkrecht stehenden Deck abwärts ins Wasser gleiten lässt. Er will es ihm gleich tun. Doch er kann sich nicht mehr halten und fällt in die brodelnde Tiefe. Neben Kuddel klatscht er ins Wasser und taucht unter. Seine Kapitänsmütze tanzt auf dem Wellen.
Gewaltige Orkanseen bringen die Bark in Sekundenschnelle zu Kippen. Diebitsch kann sich aus Leinen, Trümmern und Menschen, die jetzt in Panik um ihr Leben kämpfen, nicht mehr befreien. Einmal noch taucht er kurz auf. Schnappt nach Luft, schluckt Wasser. Beim Umschlagen des Rumpfes gerät er unter das Deck der PAMIR. Die Planken werden für viele die nicht freikommen zu einem riesigen Sargdeckel. Nach wenigen Augenblicken schwimmt die Viermastbark kieloben …
Die PAMIR kentert auf der Position 35° 57’ N, 40° 20’ W, etwa 600 Seemeilen westsüdwestlich der Azoren im Sturmfeld des Hurrikans Carrie.
Lübeck 1957
20. Dezember 1957, Rathaus Lübeck
Zwei Sachverständige schickten sich an, das »Kommissarenzimmer« zu verlassen. Sie hatten den Herren des Seeamtes Lübeck das Stabilitätsgutachten zum Untergang der PAMIR präsentiert. Als sich die Türen hinter ihnen schlossen, wurde es still und die Stimmung eisig. »Master next god!«, das wäre Johannes Diebitsch, Kapitän der gekenterten PAMIR, wohl gern gewesen. Nun war es raus. Er hatte nie das Zeug dazu gehabt.
Der Vorsitzende spielte fingerfertig mit seinem Füllfederhalter. Dabei fokussierten seine Augen die Holzmaserung des Sitzungstisches, als hätte sich die Lösung seines Problems zwischen den Jahresringen versteckt. Mit ihm starrten seine Beisitzer – drei Kapitäne und ein Seefahrtsoberlehrer – auf die lange Tischplatte. Es hieß, sie wären loyal. Auf den ersten Blick ein verschworenes, auf sich selbst zurückgeworfenes Gremium. Erst auf den zweiten sah man unterschiedliche Reaktionen in ihren Gesichtern. Das Spektrum reichte von fassungslos bis teilnahmslos. Einer der Beisitzer zeigte überhaupt kein Gesicht. Doch gerade dieser Mann saß wie auf glühenden Kohlen. Er fuhr sich über die Stirn und fühlte die Nerven schon, wenn seine Finger das Haar zur Seite strichen. Er sollte Einfluss nehmen. Einfluss auf Geheiß. Doch wie konnte er, nach diesen vernichtenden Tatsachen?
Über Nacht war der Mann wieder zum alten, zuverlässigen Zuträger geworden. Ein Spitzel alten Schlages. Der Gesichtslose war stolz darauf, Fritz, seinem honorigen Kameraden aus alten Zeiten, einen Dienst erweisen zu können.
Traditionen und Interessen schweißen zwar überall auf der Welt die Menschen zusammen, doch im Fall »PAMIR« war der ungebrochene Gehorsam der Nachkriegsseilschaften besonders gefordert, denn Kapitän Fritz Dominik, Scharnier zwischen Reederei ZERSSEN und der PAMIR-PASSAT STIFTUNG, hatte ein hohes Interesse daran, was im Kommissarenzimmer in jenen Stunden entschieden wurde. Schließlich war er für die Auswahl von Diebitsch als Kapitän der PAMIR mitverantwortlich gewesen. Seiner und der Ruf der Reederei standen auf dem Spiel. Die Hinterbliebenen der achtzig Toten, die auf See geblieben waren, konnten zu einem gefährlichen Potential für eine zivilgerichtliche Klage heranreifen. Die Kritik der Presse und der Öffentlichkeit gegenüber der Reederei und den Verantwortlichen wuchs von Tag zu Tag. »Die Pamirmusste nicht kentern!« titelten inzwischen die großen Zeitschriften.
Es galt, auf allen Kanälen Einfluss auf das Seeamt zu nehmen. Fritz zweifelte nicht an der Vasallentreue seines Zuträgers. Sie garantierte ihm, dass er rasch Kenntnis davon bekam, was im Kommissarenzimmer verhandelt und entschieden wurde. Und dieses »Wissen« war äußerst wichtig. Wichtig für ihn, die Reederei, die Stiftung und für ihre Anwälte.
Immerhin war es ihnen gelungen, die sechs Überlebenden von der Presse weitestgehend abzuschirmen. »Wäre doch gelacht,« machte sich Fritz Mut, »wenn man auf die Gutachter des Seeamtes nicht weiteren Einfluss nehmen könnte!«
Doch auch der Vorsitzende wusste, dass es ebenso eine Gruppierung gab, die vehement darauf achten würde, dass der auf See gebliebene Kapitän frei von persönlicher Schuld blieb. Schließlich gab es von Seiten der Anwälte von Stiftung und Reederei Versuche, auf die vom Seeamt bestellte Gutachter im Vorfeld massiv Einfluss zu nehmen. Für beide Gruppierungen war klar: Gutachter würden über den Hergang des Untergangs richten. Hebelarmkurven, Stabilitätsfragen, Funkstörungen, Segelstellung, Wind- und Seegang – darüber würden sie am Ende ihr Papier ausschütten. Das Verhalten der Besatzung während der Reise bis zur Annäherung des Hurrikans fände nur marginal Berücksichtigung. Gutachter dürfen zwar das unausweichliche Ende beglaubigen, doch nach den Regeln des Seeamtes, darf eine Schuldfrage offiziell nicht festgestellt werden …
Der Vorsitzende nahm sich alle Zeit. Die Spannung wurde unerträglich. Der Verräter am Sitzungstisch ahnte nicht, was für ein Bild der Ereignisse sich im Kopf des Vorsitzenden festgesetzt hatte. Jedenfalls schien es so mächtig, dass es kein Abweichen mehr davon gab.
»In diesem Beladungszustand hätte die PAMIR Buenos Aires erst gar nicht verlassen dürfen!«
Dem Spitzel schoss die Röte ins Gesicht. Das Muskelzucken seiner rechten Wange war nicht zu stoppen. »Herr Vorsitzender, das kann man so nicht sagen. Ich mache darauf aufmerksam, dass Kapitän Diebitsch, was den Beladungszustand anbelangt…«
»Sparen Sie sich Ihre Worte!« unterbrach ihn der Vorsitzende barsch und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Der Spitzel fühlte sich geplättet. Das war also die Richtung!
Mit schneidender Stimme nordete der Vorsitzende seine Beisitzer ein für allemal ein: »Meine Herren! Die Unklarheiten sind beseitigt, die Beweislage ist eindeutig. Stellen wir fest: Alle Marssegel und einige mehr der PAMIR standen noch, als das Orkanfeld des Hurrikans mit voller Wucht den Segler traf. Vielleicht sogar auch noch das Großsegel. Der Tieftank konnte nicht geflutet werden. Das bezeugt die mangelnde Vertrautheit des Kapitäns mit den besonderen Segel- und Stabilitätseigenschaften der PAMIR. Die Gerstenfracht ist infolge der Schräglage übergegangen, dazu drang auch noch Wasser in die nicht überall verschlossenen Aufbauten. Die Bark musste unter diesen Umständen kentern! Das Stabilitäts-Gutachten und die Aussagen der Überlebenden schließen jeden Zweifel darüber aus.« Entschlossen blickte er in die Runde. Seine Stimme klang gepresst: »Menschliches Versagen! Kapitän Diebitsch allein, Gott sei seiner Seele gnädig, trägt die Verantwortung dafür!«
Der Zuträger wusste nun, dass es nur ein Urteil am Ende der öffentlichen Sitzung im kommenden Januar geben konnte. Der Untergang der PAMIR wäre – dem Gutachten folgend – vermeidbar gewesen. Höhere Gewalt daher ausgeschlossen. Und das war in den Augen des Vorsitzenden zwingend, denn sonst würde mit dem Untergang der PAMIR auch das Ende der frachttragenden Segelschulschifffahrt in Deutschland gekommen sein …
Bis auf Einen, bekundeten alle durch Nicken ihre Zustimmung. Damit war das Urteil des Seeamtes vor der eigentlichen Verhandlung bereits festgelegt. Eine Ungeheuerlichkeit, doch der Vorsitzende zeigte sich zufrieden. Erleichtert nahm er sich erneut das Wort. »Meine Herren! Niemand darf nach den Grundsätzen unserer Rechtstaatlichkeit schuldig gesprochen werden, wenn er sich nicht gegen Schuldvorwürfe verteidigen kann. Diebitsch ist auf See geblieben. Wir können daher die Schuldfrage nicht in der öffentlichen Verhandlung im Januar erörtern. Die Spruchformel wird davon rein gehalten. Dafür werden wir aber in der Urteilsbegründung klarstellen, wer die Verantwortung für die anderen neunundsiebzig Toten trägt.«
Wiederum bekundeten die Beisitzer durch ihr Nicken ihre Zustimmung. Über das Gesicht des Vorsitzenden huschte ein falsches Lächeln. Er hob die Sitzung auf. Sein Spagat war ihm bewusst. Sorgenvoll wandte er sich an seinen Beisitzer zur Rechten. Er ahnte nicht, dass er seine Beklemmungen einem Verräter anvertraute. »Da wir uns einig sind, frage ich mich: Wie können wir die Sache in der Verhandlung etwas beleben?«
Man trennt sich. Im Rathaus wartet Kapitän Fritz Dominik, verantwortlich für die Auswahl Diebitsch’s, zum Kapitän der PAMIR, auf seinen Gewährsmann. Aus dessen Munde erfährt er, was gerade »verhandelt« wurde …
Erstes Kapitel Master next God
In Gedenken an den Ort ›35 Grad Nord, 40 Grad West‹,
etwa sechshundert Seemeilen südwestlich der Azoren,
wo der Tod alle Schuld, jegliches Versagen bezahlte.
1 Bremen, Mai 1957
Friedrich-Wilhelm-Str. 38, kurz vor neunzehn Uhr. Auguste-Elisabeth bereitet das Abendbrot. Im engen Korridor klingelt das Telefon. Es ist der zweite Anruf an diesem Abend.
»Gehst du ran?«
Ihr Mann sitzt im Wohnzimmer und blättert gedankenverloren im ›Der Weg‹. Eine deutsche Emigrantenzeitschrift in Buenos Aires. Sein Freund Herbert schickt sie ihm regelmäßig aus Argentiniens Hauptstadt. Sie waren 1914 zusammen auf der PAMIR gefahren. Später, zu Beginn des 2. Weltkrieges fuhr Herbert auf der ADMIRAL GRAF SPEE. Als das Kriegsschiff durch Selbstversenkung bei Montevideo sank, baute sich Herbert später in Buenos Aires eine neue Existenz auf.
Johannes legt die Zeitung weg, brummt ein »Ja«, erhebt sich und nimmt den Hörer von der Gabel: »Diebitsch!«
»Guten Abend, Dominik am Apparat!« Die Augen des alten Kapitäns fixieren die weißen Zahlen auf der schwarzen Wählscheibe: Drei – zwei – eins …
Er ahnt, er hofft.
»Die Entscheidung ist gefallen. Sie segeln die PAMIR von Hamburg nach Buenos Aires und zurück!«
Johannes hat Mühe, seine freudige Erregung zu dämpfen. Jetzt ist es offiziell. Er steckt seinen zitternden Zeigefinger in die Wählscheibe, dort wo sich die Null befindet. »Als Kapitän?«
»Aye, aye, Master next God.«
»Ich danke für das Vertrauen, das mir die Stiftung Pamirund Passat und die Reederei Zerssen entgegenbringt.«
»Ja, das Vertrauen …«
Diebitsch holt Luft. Er empfindet Dominiks Bemerkung als Widerworte und schluckt. Auguste kommt aus der Küche. Neugier treibt sie. Ihr Mann verzieht das Gesicht zu einem Grinsen, reckt den Daumen in die Höhe und spricht in die Muschel: »Wann geht es los?«
»Auslauftermin ist der erste Juni. Dr. Wachs, der Präsident der Stiftung, und ich erwarten Sie übermorgen gegen zehn Uhr in Hamburg, Ballindamm 25. Sie kennen ja Herrn Dr. Wachs.«
»Wir sind uns schon begegnet.«
»Also, übermorgen 10 Uhr.«
Johannes lässt den Hörer auf die Gabel fallen.
Die Stiftung kaufte vor etwa zwei Jahren die beiden Viermastbarken, die 1905 und 1911 bei Blohm & Voss auf Kiel gelegt wurden, von der Schleswig-Holsteinischen Landesbank. Diese wiederum hatte sie 1954 aus der Konkursmasse des Reeders Heinz Schliewen erworben. Ein Konsortium von 41 Reedern, unter der Federführung der Reederei Zerssen & Co., tat sich daraufhin in der Stiftung Pamirund Passat zusammen, um die alten Traditionssegler zu erhalten. Damit sollte die finanzielle Basis für die Ausbildung des Nachwuchses auf den beiden frachtfahrenden Segelschulschiffen für die Zukunft gesichert werden. Nach außen hin auch ein einmaliger Schulterschluss der Hafenstädte Bremen, Hamburg und Kiel, der Stabilität versprach …
Mit seinem Kapitänskollegen Dominik, Inspektor der Stiftung Pamirund Passat, pflegt Diebitsch erst seit der Jahreswende Kontakte. Aufgrund seiner Stellung im Verein zur Förderung des seemännischen Nachwuchses e.V. in Bremen, erörterten sie Grundgedanken zur Ausbildung des Nachwuchses auf Fracht- und Segelschulschiffen, diskutierten Einstellungsbedingungen von Bewerbern sowie die Koordination von Ausbildungsplänen.
Johannes klatscht in die Hände, stampft gleichzeitig mit dem Fuß auf den Boden, geht auf seine Frau zu und umfasst sie bei den Schultern. Begeisterung prallt auf Melancholie. »He Auguste! Hast du gehört? Es ist offiziell! Unser Freund hat Wort gehalten. Ich hab das Kommando auf der PAMIR! Als Kapitän!«
Etwa eine Stunde zuvor hatte ihm ein Freund aus der NS-Zeit die Entscheidung bereits mitgeteilt. Er, Diebitsch, würde Eggers auf der Reise nach Buenos Aires und zurück ersetzen, denn der müsse endlich sein Rheuma auskurieren. Aber nun war es offiziell.
Johannes fragte seinen Freund, was mit von Gernet sei. Dominik hatte den doch ursprünglich für das Kommando der PAMIR vorgeschlagen.
»Hat er«, sagte sein Freund, »aber der wird jetzt Kapitän Grubbe während seines Urlaubs vertreten. Von Gernet wird im August die Ausreise der PASSAT von Hamburg nach Buenos Aires übernehmen. Dann muss er wieder zurück zur Marine. Grubbe wird ihn auf dem Luftwege ablösen.«
»Ist Dominik mit allem einverstanden?«
»Sagen wir so, er sieht sich jetzt als mein Erfüllungsgehilfe, denn ich habe deine Berufung durchgesetzt. Übrigens, Grubbe ist nicht dein Freund. Er meint, du seist für das Kommando ungeeignet.«
»Dieser Scheißkerl! Grubbe hat schon immer viel geredet …«
»An anderer Stelle hat er versucht, über dich und deine Vergangenheit auszupacken. Nebenbei spekuliert er auch auf den Posten von Dominik und zieht über ihn her.«
»Ist der noch zu retten?«
»Keine Sorge! Ich habe das alles im Keim erstickt. Wie auch immer. Intern musste ich harte Überzeugungsarbeit leisten, wie du dir denken kannst! Wenn du nach Hamburg kommst, halte dich an Eggers. Er handelt zwar manchmal etwas eigenmächtig, aber er kennt die Besonderheiten der PAMIR am besten. Du musst ihn nur richtig fordern.«
»Ich werde es dir nie vergessen!«
Der Mann an der anderen Seite der Strippe sagte noch etwas von Adressen, die Johannes bekommen werde, sobald die PAMIR Hamburg Richtung La Plata verlassen würde …
Spontan drückt Johannes seine Auguste fest an sich. Sie zeigt keine Regung. Langsam sinkt ihr Kinn auf die Brust. Sie hat viel Zeit in ihrem Leben damit verbracht, über den verschlungenen Lebensweg ihres Mannes nachzudenken. Zu viel Zeit. Johannes gab ihr trotz seiner sechzig Jahre immer wieder Rätsel auf. Sie selbst war sieben Jahre älter. 1920 hatten sie geheiratet. Ein Bund fürs Leben, in der der Vorrat an Gemeinsamkeiten von heute auf morgen verschwand wie das Wasser durch eins Schleusentors. Meist geschah dies durch fremde Hand. Wie jetzt auch. Es gab Jahre, in denen sie sich mehr als Witwe fühlte denn als Ehefrau. Besonders in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, als ihr Mann für das Naziregime schon früh im Sudetenland eingesetzt war und später als Prisenoffizier zur See fuhr. Er war zwar Mitglied in der NSDAP, doch das hatte sich nie ausgezahlt. Im Gegenteil. Die wahren Hintergründe über seine Einsätze, auch auf dem Ostindienfahrer GNEISENAU und später auf dem Hilfskreuzer KORMORAN, erfuhr sie erst Jahre nach dem Krieg.
Seine Parteizugehörigkeit sowie die Kriegseinsätze auf See wurden später eher zum Makel. Schöne gemeinsame Ehejahre mit ihrem Mann waren gezählt. Allein die neun Jahre Trennung durch den Krieg standen auf der Sollseite ihres Lebens. Geprägt von Ungewissheit und Einsamkeit. Davon sieben Jahre Gefangenschaft ihres Mannes. Und das im fernen Australien …
Sie blickt zu ihm auf. Da ist er wieder, denkt Johannes. Dieser Gesichtsausdruck! Voll Bitternis, umrahmt von ergrautem Haar. Schon dem jungen Matrosen Diebitsch war dieser Ausdruck vertraut. Seit seinem ersten Abschied von ihr, damals Ende Juli 1920, als er vier Monate nach ihrer Eheschließung auf der LUCIE WOERMANN angeheuert hatte, war ihm diese Miene im Gedächtnis haften geblieben. Aber diesmal ist ihr Mienenspiel das einer Mater Dolorosa …
Zweifelnd fragt sie: »Fühlst du dich denn dieser Aufgabe gewachsen?«
Johannes stellt sich in Positur: »Schau mich an! Das wird doch eine Kaffeefahrt. Es geht doch nur nach Buenos Aires und wieder zurück. Kap Hoorn werde ich also nicht umrunden!« Seine Worte klingen zwar überzeugend, doch in Wahrheit hat er vor dem Kommando richtig Bammel. Beruhigend legt er seinen Arm um ihre Schultern und versucht sie mit optimistischen Blicken aufzuheitern. Dann wird er plötzlich ernst. »Sieh mal, außerdem kann ich Karl endlich ausfindig machen. Vielleicht ist das die Gelegenheit, unser Auskommen bis an unser Lebensende zu sichern.«
Auguste reagiert ablehnend, indem sie seinen Arm von ihrer Schulter streift: »Davon will ich nichts wissen! Die Zeiten haben sich geändert. Es ist gefährlich, darin rumzustochern, und außerdem brauchen wir das dreckige Geld nicht.«
»Dreckiges Geld!«, ruft er aufgebracht. »Ich hab es mir verdient! Er ist es mir schuldig geblieben!«
»Ich bin zufrieden, wie es ist. Seit du hier in Bremen im Verein zur Förderung des seemännischen Nachwuchses deinen Dienst versiehst, geht es uns doch gut. Du bist den Gefahren des Meeres nicht mehr ausgesetzt, ich brauche mir endlich keine Sorgen mehr um dich zu machen, und wir können die Zeit, die uns der Herrgott hoffentlich noch reichlich schenken wird, endlich gemeinsam verleben.«
Johannes reagiert energisch: »Die Reise dient unserem Vorteil, und für mich ist sie die Krönung meiner Laufbahn.«
Auguste blickt enttäuscht und verschwindet in der Küche. Johannes lässt sich in den Sessel fallen, atmet tief. Er sieht zur Wand. Dorthin, wo zwischen zwei Madonnenbildern ein geschnitzter Christus am Kreuz auf ihn herabblickt. Das Malen von Marienbildern hatte er auf der PAMIR begonnen. Damals, während des 1. Weltkrieges, als sie auf den Kanaren festlagen. Erinnerungen an alte Zeiten. Den Christus schnitzte er, als er auf dem Vergnügungsdampfer GNEISENAU monatelang ausharrte. Er schließt die Augen und erinnert sich an die Pier von Gotenhafen …
2 Gotenhafen, April 1940
Sturmböen trieben tief hängende Regenwolken über Gotenhafen. Das polnische Gdynia gab es nicht mehr, hieß jetzt Gotenhafen. Die Gewalt des Krieges hatte nicht nur Grenzen, sondern auch Namen polnischer Städte gewandelt. Dabei hatte der ›Feldzug‹ längst die normalen Bahnen des friedlichen Lebens gesprengt. Entlang der Küsten löschte der eskalierende Krieg unerbittlich das Feuer der Leuchttürme und in fast allen deutschen Ostseehäfen die Lichter. Dunkles Schweigen lag nachts über den Piers. Gotenhafen dagegen, ein Marinestützpunkt an der Westseite der Danziger Bucht, nahe der Halbinsel Hela, erstrahlte wie im Frieden.
Der Ostasienschnelldampfer GNEISENAU lag seit zwölf Stunden wieder vertäut an der Pier des Beckens fünf, im letzten Zipfel des Hafens. Der Pott trug den gleichen Namen wie das Furcht erregende Schlachtschiff. Man hatte den eleganten Vergnügungsdampfer als Versorgungs- und Truppentransporter umgebaut. Nun fuhr der ehemals friedliche Musikdampfer des Norddeutschen Lloyd Bremen unter Kriegsflagge. Auf Anordnung der Seekriegsleitung wurde die GNEISENAU als Truppentransporter dem Marinegruppenkommando Ost zugewiesen und sollte während der militärischen Aktion ›Unternehmen Weserübung‹, Deckname für die Invasion Norwegens, 3.000 Soldaten von Hamburg nach Stavanger transportieren. Daher hatte man ihr im März einen grauen Tarnanstrich verpasst. Einen Tag vor dem Auslaufen übernahm sie noch ein Dutzend geheimnisvoller Metallkisten. Diebitsch war für die Sicherheit der Kisten an Bord verantwortlich.
Vor vier Tagen hatte der Truppentransporter mit Schlepperhilfe vom Pier abgelegt. Kurz vor Mitternacht, gleich nach dem Passieren von Kap Arkona erhielt das Schiff einen Funkspruch der Admiralität, der die sofortige Rückkehr nach Gotenhafen befahl. Der Kapitän ließ auf Gegenkurs gehen. Einen Tag später, gegen Mittag, erreichte die GNEISENAU wieder Gotenhafen-Reede. Zwei Stunden später lag sie am alten Ankerplatz. War der Admiralität das Risiko eines Verlustes des hochwertigen Schiffes zu groß gewesen? Über die Entscheidung ließ sich nur spekulieren. Jedenfalls musterten überzählige Mannschaftsteile eilig auf Befehl der Admiralität ab.
Johannes Diebitsch, Leutnant zur See, blieb auf Befehl an Bord, denn er hatte als 1. Offizier noch eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Ihm war mulmig zumute. Wie sollte es weitergehen? Der eskalierende Krieg drohte dem schmucken Ostasienfahrer täglich mit der Versenkung durch Seeminen. Und das Risiko, ›erwischt‹ zu werden, wuchs von Tag zu Tag.
Der Wind heulte um die Aufbauten, und dicke Regentropfen prasselten waagerecht an die Scheiben der Kommandobrücke. Diebitsch blickte gedankenverloren hinaus in die stürmische Nacht. Perlenketten von erleuchteten Bullaugen und Deckslampen illuminierten die Reede vor Gotenhafen. Mehr als zwanzig Schiffe lagen dort vor Anker. Meist Schweden, die auf ihre Abfertigung warteten. Man hatte die ganze schlesische Kohleausfuhr von Danzig nach Gotenhafen verlagert. Da die inneren Hafenbecken der Kriegsmarine zugeteilt waren, wurden die Kohlefrachter von der Reede einzeln an die Verladepier geholt. Die Schlepper waren daher Tag und Nacht im Einsatz.
»Idealer Liegeplatz!«, brummelte Diebitsch. Hier war mit keiner Überraschung zu rechnen. In diesem Hafen war es ein Leichtes, für die Geheimhaltung und Bewachung der Fracht zu sorgen. Der Kapitän allerdings wäre sowohl die brisanten Kisten als auch Diebitsch lieber heute als morgen losgeworden, ließ doch sein 1. Offizier bei jeder Gelegenheit durchblicken, dass er eine spezielle Aufgabe an Bord zu erfüllen habe. Und das konnte der Kapitän bei seiner Ehre nicht akzeptieren.
Doch Diebitsch fehlte die wichtigste Information. Es gab etwas, was ihn elektrisierte und worüber er gern mehr wissen wollte. Seine ganze Aufmerksamkeit wurde von einem Spezialtresor im Bauch des Schiffes gefesselt, der von ihm auf Befehl der Führungsdienststelle Nachschubabteilung Ostsee rund um die Uhr bewacht werden musste. Diebitsch hatte zusammen mit Herren der Reichsbank, des Wirtschafts- und Finanzministeriums sowie der Wehrmacht und des Marinegruppenkommandos die Aufsicht geführt, als metallene Kisten darin eingelagert worden waren. Die edlen Behälter trugen die Aufschrift ›Reichskreditkasse-Reichsbank Berlin‹ und waren bestimmt für die zukünftige Militärverwaltung in Norwegen.
Diebitschs Anwesenheit bei der Verladung war kein Zufall.
»Sie können sich auf mich verlassen!«, erwiderte er strammstehend dem B.S.O., Befehlshaber der Sicherung der Ostsee, als dieser ihn in Kiel auf strenge Geheimhaltung verpflichtete. Als verlässliches NSDAP-Mitglied seit der Machtergreifung im Jahre 1933 hatte er seine erste Belehrung über Geheimhaltung militärischer Dinge und Spionageabwehr schon im September 1938, kurz vor seinem Einsatz bei der Besetzung des Sudetenlandes, erhalten. Nun war er für den Sondereinsatz ›Unternehmen Weserübung‹ auf die GNEISENAU befohlen worden und hatte für die Sicherheit und Geheimhaltung der speziellen Fracht an Bord zu sorgen.
»Bald wird man mir mehr Verantwortung übertragen«, murmelte er in Gedanken vor sich hin. Sein ersehntes Ziel war die Beförderung zum Oberleutnant zur See. Doch jegliches Zeichen einer anstehenden Rangerhöhung fehlte. Was ihn obendrein irritierte, war die Wortkargheit der maßgeblichen Zivilisten wie die der hohen Militärs. Sie hüllten sich in Schweigen und ließen seine Fragen über den Inhalt der geheimnisvollen Behälter unbeantwortet.
Der Tresorraum befand sich im C-Deck, drei Stockwerke unter dem oberen Promenadendeck. Wenn Diebitsch nachts aus einer schwer fassbaren Unruhe aufwachte, wanderten seine Gedanken unwillkürlich drei Deck tiefer. Die Fragen marterten sein Gehirn: Was befand sich in diesen Kisten? Gold? Juwelen? Geld? Warum wurden Kapitalien in das zu besetzende Norwegen transportiert? Von dort wurde doch eher etwas ab- als hintransportiert. Dem Ganzen fehlte es an Logik.
Er lauschte auf das Brummen des Generators und es kam ihm vor, als würde unter ihm ein Ungeheuer atmen. Dann warf er einen Blick auf den Decksplan. Seine Augen fixierten das Sonnendeck mit der Kommandobrücke. Dort befand sich im rückwärtigen Teil des Steuerhauses auch der private Salon des Kapitäns. Er wusste, dass kurz vor dem Auslaufen für ihn eine versiegelte Instruktion im Safe des Kapitäns deponiert worden war. Er war sich sicher: Durch sie würde das Geheimnis endlich gelüftet werden. Jedenfalls brandete die Neugier unaufhörlich in seinem Kopf. Als die nächste Wache aufzog, entschloss er sich, einen zusätzlichen Kontrollgang unter Deck vorzunehmen …
3
Diebitsch wurde am anderen Morgen durch ein kräftiges Klopfen aus dem Schlaf gerissen. Als er die Kabinentür öffnete, knallte der Wachoffizier die Hacken zusammen. »Der Kapitän erwartet Sie im Rauchzimmer auf dem Promenadendeck!« Dann hob er die Hand: »Heil Hitler!« Diebitsch schmerzten die Ohren.
Als er sich wieder auf die Bettkante setzte, fühlte er unter dem Gesäß das Vibrieren des Generators. Seine Stimme knarrte: »Der Unterschied zwischen Mensch und Maschine ist unüberbrückbar. Generatoren kennen keine Strapazen.«
Die Morgenmüdigkeit bewirkte, dass er von kurzen Sehstörungen befallen wurde. Er kannte diesen Zustand. Für einen kurzen Augenblick sah er seine Kajüte verschwommen. Sie befand sich auf der Steuerbordseite im oberen Promenadendeck direkt unter dem Steuerhaus. Von dort hatte er freien Blick bis vor zum Bug.
Langsam erhob er sich, kniff die Lider zusammen und blickte durch das Kajütfenster in das fahle Morgenlicht. Im Hafen herrschte erschreckende Betriebsamkeit. Er dachte an all die feindlichen Minen und Torpedos da draußen. Wenigstens sind in unserem Becken keine zu erwarten, ging es ihm durch den Kopf. Dann pellte er sich rasch aus seinem Schlafanzug, klatschte sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht, hängte sich die Kette mit dem Tresorschlüssel um den Hals und schlüpfte in seine Uniform.
Zur Kontrolle blickte er in den Spiegel. Die Gesichtszüge seines längst verstorbenen Vaters traten immer stärker hervor. Fast schien es, als wolle Vater ›Oskar-Arthur-Victor‹ in seinem eigenen Gesicht wieder lebendig werden. Der heranwachsende Johannes wollte nie werden wie Oskar-Arthur-Victor. Sein Vater war Schauspieler in Magdeburg gewesen und stand auch im normalen Leben immer auf der Bühne. In den unterschiedlichsten Rollen: Herrisch aufbrausend, melancholisch mutlos, seelenwund oder lebenssatt, schrecklich oder herzbewegend tränenreich. Dabei immer zu Späßen aufgelegt. Seine tief religiöse Mutter verzweifelte an ihrem Mann, und der kleine Johannes schämte sich vor seinen Mitschülern, da sie ihn wegen des Berufs des Vaters ständig hänselten.
Prägend war für ihn daher nicht der Vater, auch nicht die Offiziere in den riesigen Kasernen entlang der Turmschanzenstraße in Magdeburg-Friedrichstadt, wo er geboren wurde, sondern die Kapitäne der Elbschiffer. Besonders die der Fahrgastschiffe SAXONIA und FREIHERR VOM STEIN. Diese trugen im Gegensatz zu den Kohle- und Holzkapitänen der Schleppdampfer helle, saubere Uniformen und beförderten auf ihren weiß gestrichenen Schiffen die feine Gesellschaft zum Stadtpark. Wenn der kleine Johannes auf einer der vielen Sandbänke der Altelbe stand, schloss er die Augen und träumte davon, von der Kommandobrücke der SAXONIA herab Befehle an seine Matrosen zu geben …
Einen Vater als Schauspieler zu haben war auch während der NS-Herrschaft keine gute Voraussetzung für eine Karriere, weder in der Partei noch bei der Marine. Jenseits der Adoleszenz ließ daher Kadett Johannes Diebitsch den Beruf seines Vaters im Dunkeln und beförderte ihn in seinem Lebenslauf kurzerhand zum Major, wenn es um seinen Vorteil ging.
Schließlich kämmte sich der vierundvierzigjährige Leutnant zur See die Haare. Dann kehrte er seiner Kabine den Rücken.
4
Drei Zivilisten und der Kapitän warteten im Raucherzimmer. Als Diebitsch in den hohen, hellen und behaglichen Raum eintrat, kam es zu einem unerwarteten Intermezzo. Noch bevor der Kapitän seinen 1. Offizier vorstellte, erkannte Diebitsch einen der Männer auf Anhieb wieder. Auch sein Gegenüber war sofort im Bilde. Der Zivilist war ein Hüne von Gestalt. Er schielte mit dem linken Auge. Sie gaben sich die Hand. Der Hüne hieß Karl Wörmann.
Sie waren sich während der Besetzung des Sudetenlandes Anfang Oktober 1938 mehrmals in Aussig begegnet. Diebitsch war mit einer größeren Marineeinheit für die Bewachung und Bewertung möglicher Prisenobjekte an Land und auf dem Elbabschnitt von Tetschen bis Aussig abkommandiert worden. Wörmann dagegen war bei der Militärverwaltung und zuständig für requiriertes Beutegut. Er hatte sich damals, im Herbst 38, wie ein Generalstäbler gebärdet. Es ging um die Besetzung eines Ortes jenseits der Demarkationslinie, einer auf tschechischem Boden gelegenen Ortschaft, auf der sich eine Fabrik befand. Für Wörmann ein lohnendes, sehr verlockendes Beutegut, denn er feuerte die Marinesoldaten mit den Worten an: »Fragt nicht lang! Blickt auf die Landkarte! Finger drauf! Das gehört euch!«
Diebitsch war begeistert vom Willen Wörmanns, die deutsche Reichsgrenze auf eigene Faust nach Osten auszuweiten. Warum nicht gleich bis zur polnischen und ungarischen Staatsgrenze? Tollkühn stimmte er zu: »Besetzen wir den Ort! Das deutsche Volk benötigt die Wirtschaftskraft dieses Raumes!«
Am Abend war man sich einig, die Fabrik samt dem Ort, quasi im Alleingang, am nächsten Tag dem Reich einzugliedern. Im letzten Moment wurde die Plünderung am Rande von ›ganz oben‹ gestoppt.
Wörmann zeigte sich Diebitsch gegenüber trotz der abgeblasenen ›Eroberung‹ großzügig und versorgte ihn und seine Männer mit Delikatessen und Zigaretten. Diese wiederum zollten ihm Respekt, waren dankbar und voller Bewunderung gegenüber dem edlen Spender.
Wenige Tage später beobachtete Diebitsch, wie Wörmann einen Konvoi mit Beutegut in Richtung Dresden befehligte. Diebitsch sicherte mit seiner Marineabteilung die Elbbrücke in Aussig. Als Karl Wörmann die Brücke passierte, brüllte er zynisch einen gängigen Reim der Sudetendeutschen vom LKW herab: ›Wir heben unsre Hände, aus tiefster, bittrer Not: Herrgott, den Führer sende, der unsern Kummer wende, mit mächtigem Gebot!‹ Diebitsch war sich sicher. Der Mann auf dem LKW hatte den lukrativsten Posten, der im Reichsgau Sudetenland zu haben war. Hier flossen Milch und Honig …
Nun standen sie sich wieder gegenüber. Über die jüngste Vergangenheit wurde im Moment des Wiedersehens geschwiegen. Wie sich herausstellte, hatte Wörmann den Auftrag, die metallenen Kisten in Empfang zu nehmen. Dabei erwähnte er beiläufig: »Ich bin mitverantwortlich für die Kontrolle der polnischen Nationalbank!«
Diebitsch nickte respektvoll.
Dem Hünen stand ein Mann zur Seite, der sich mit seiner zernarbten, mageren Hand das Kinn rieb. Seine Persönlichkeit flößte Vertrauen ein. Er war von der Reichskreditkasse in das besetzte Polen abkommandiert. Der dritte, ein kahl geschorener Mann, war vom Devisenschutzkommando, einer Sondereinheit des deutschen Zolls. Er bekam seine Order direkt von der Reichsfinanzverwaltung Berlin.
Man nahm in bequemen Sesseln Platz. Ein Messestewart servierte Kaffee. Der Kapitän überreichte Diebitsch das versiegelte Kuvert, das er seinem Safe zuvor entnommen hatte, trank hastig seinen Kaffee und verließ stumm den Rauchsalon. Als sie unter sich waren, breitete sich im Quartett eine eigenartige Unruhe aus. Diebitsch brach das Siegel und öffnete das braune Kuvert. Der Hüne beobachtete ihn mit wachsamen Augen, während er sich sorgfältig eine Zigarre anzündete. Obwohl Diebitsch das Ziel seiner Aufgabe kannte, waren ihm die detaillierten Pläne des Marinegruppenkommandos unbekannt. Er lehnte sich im Sessel zurück und begann das Anschreiben zu lesen. Unter dem Punkt: ›Verhalten bei Abweichung des Planes‹ erfuhr er, was zu tun war. Aus dem Augenwinkel sah er, dass der Hüne ihn durch den Rauch seiner Zigarre beobachtete.
Diebitsch nahm zur Kenntnis, dass die Instruktionen vertraulich und ausschließlich für ihn allein bestimmt waren. Das Papier sollte danach vom ihm sofort verbrannt werden. Es folgten detaillierte Anweisungen über die Übergabe der Metallkisten, die genauestens befolgt und protokolliert werden sollte. Diebitsch reichte das Protokoll über den Tisch. Der Hüne nahm es an sich. Dann verfolgte er mit Erstaunen, wie Diebitsch sein Sturmfeuerzeug zückte, das Papier mir den Instruktionen über den Aschenbecher hielt und vor allen Augen in Flammen aufgehen ließ.
»Keine Kopie für mich?«, fragte Wörmann überrascht.
Diebitsch selbstbewusst: »Nein! Ist nur für mich bestimmt!« Zu seiner Verwunderung enthielt das Schreiben keinen einzigen Hinweis über den Inhalt der Kisten. Diebitsch machte eine Geste mit der Hand, zum Zeichen, dass man an die Übergabe gehen könne. »Die Prozedur ist Ihnen ja bekannt.«
Sie verließen den Rauchsalon, durchquerten das Schreib- und Lesezimmer des Schnelldampfers, öffneten eine Stahltür und stiegen hinter dem Maschinenschacht hinab bis auf das C-Deck zum Tresorraum. Was folgte, war für Wörmann Routine, für Diebitsch eine Geduldsprobe.
Es gab zwei Tresorschlüssel. Einen hatte Wörmann in Besitz, den anderen Diebitsch. Beide passten. Gemeinsam schwenkten sie die schwere Panzertür zur Seite. Die Metallkisten reflektierten das starke Licht der Lampen. Der Hüne blickte in das Übergabeprotokoll. Dann zählte er die Kisten. Es waren zwölf. Daraufhin gab er dem Kahlgeschorenen vom Devisenschutzkommando Order, die Männer der Transporteinheit an Bord zu befehlen. Im selben Augenblick sprang der Hauptgenerator wieder an. Die Vibrationen im Rumpf nahmen zu. Das Ungeheuer begann wieder zu atmen.
Es gibt keine größere Unruhe als jene, die von Unkenntnis gespeist wird. Diebitsch fühlte sie bis unter seine Haarwurzeln. Der Zwang sie zu dämpfen war unwiderstehlich.
»Was befindet sich in den Kisten?« Seine Stimme klang belegt.
Der Hüne erwiderte ohne zu zögern: »Mit dem Inhalt werden wir die norwegischen Finanzressourcen für unsere kriegswirtschaftlichen Zwecke erschließen!«
Diebitsch verstand kein Wort. »… was soll damit erschlossen werden?«
»In den Kisten befinden sich RKK-Scheine. Reichskreditkassenscheine!«
»Mhm! Ich verstehe …« Diebitsch kannte das Zahlungsmittel, das in besetzten Gebieten Verwendung fand, doch ihm fehlte das Wissen über die tieferen Zusammenhänge.
Der Hüne registrierte Diebitsch Unsicherheit. »Jeder glaubt zu verstehen. Die wenigsten tun es wirklich.«
Diebitsch akzeptierte die Antwort stillschweigend. Während Wörmann das Protokoll stehend ausfüllte, fuhr er fort: »Wissen Sie, die Wehrmacht hält sich strikt an die Haager Landkriegsordnung. Plünderungen gibt es nicht. Was wir uns auch nehmen, wir stellen keine Requisitionsquittungen mehr aus, sondern wir bezahlen mit RKK-Scheinen. Sowohl den Sold für unsere Soldaten als auch Löhne für norwegische oder polnische Arbeiter, die in unseren Diensten stehen. Auch alle Waren, die wir für die Armee einkaufen, sogar die Investitionen für den Unterhalt der Kasernen. Schlichtweg alle Besatzungskosten der Wehrmacht. Alles wird mit diesem Geld bezahlt.«
Diebitsch hielt das Ganze für ein Märchen: »Was ist, wenn sich Norweger oder Polen weigern, die RKK-Scheine als Zahlungsmittel anzunehmen?«
Wörmann darauf süffisant: »Handel und Privatleute hier in Polen akzeptieren die RKK-Scheine, denn die Banken und Sparkassen sind per Dekret gezwungen, die Scheine in polnische Zloty einzutauschen.«
»Und was passiert danach mit den RKK-Scheinen?«, insistierte Diebitsch.
Karl Wörmann wandte sich an seinen Begleiter von der Reichskreditkasse. »Was sagen Sie dazu? Das ist doch hohe Finanzpolitik. Ihr Ressort!«
Der angesprochene erwiderte emotionslos: »Die Scheine werden von den polnischen Banken sofort an uns weitergereicht. Später einmal werden wir alles mit den Polen, Dänen oder Norwegern verrechnen …«
Diebitsch begann zu begreifen, wer in diesem Kreislauf der Zahlmeister sein würde. Treffsicher formulierte er: »Ein Umtauschanspruch, der von unseren Bajonetten durchgesetzt wird?«
»Die Polen oder Dänen sehen kein einziges deutsches Bajonett in ihren Banken. Die sind doch froh, wenn sie uns auf RKK etwas verkaufen können!«, ergötzte sich Wörmann.
Ich diesem Augenblick betraten die Soldaten des Transportkommandos den Tresorraum. Als die letzte Metallkiste aus der Stahlkammer expediert worden war, sagte Wörmann lächelnd: »Dann wollen wir einmal den Empfang bestätigen.« Er unterschrieb Original und Kopie und reichte das Protokoll Otto. Ohne einen Blick darauf zu verschwenden, setzte dieser zügig seine Unterschriften darunter. Der Mann vom Devisenschutzkommando folgte seinem Beispiel. Es fehlten nur noch die Unterschriften von Diebitsch. Schon wollte er seine Unterschrift darauf setzen, als ihm eine dramatische Unregelmäßigkeit ins Auge stach. Er blickte zu Wörmann, als hätte ihm dieser ein versalzenes Omelett zum Frühstück vorgesetzt. Er tippte auf das Protokoll, seine Stimme vibrierte: »Zwölf! Es waren zwölf Metallkisten!«
Wörmann setzte eine überlegene Mine auf, lächelte und fragte seine beiden Begleiter: »Wie viele Kisten haben wir in Empfang genommen?«
»Elf!«, bestätigte Otto.
»Elf!«, erwiderte auch der Kahlgeschorene und behauptete: »Auch das Marinegruppenkommando Kiel avisierte uns nur elf Metallkisten!«
Diebitsch Gesicht wurde wachsweiß. »Das ist eine Lüge!«
»Sie haben sich einfach verzählt.« Wörmann reagierte gelassen, zog seine Ausweiskarte aus der Innentasche seines Sakkos und hielt sie Diebitsch unter die Nase. Dieser las: ›Sicherheitsdienst (SD) der NSDAP, Referat IV D2 (Besetzte polnische Gebiete)‹. Wörmann ergriff die Gelegenheit schnell und scharfsinnig beim Schopfe: »Vergessen Sie nicht Ihre Pflichten gegenüber der politischen Polizeiarbeit.« Daraufhin räusperte er sich. »Außerdem habe ich eine Beurteilung über Ihre politische Zuverlässigkeit abzugeben.«
Diebitsch wusste in diesem Augenblick, welche Folgen das auf seine Offizierslaufbahn haben konnte, sollte er sich querlegen. Bevor er etwas erwidern konnte, tippte der Hüne auf das Protokoll und sagte im Befehlston: »Genosse Leutnant! Ihre Unterschrift!«
Als Gegenleistung glaubte Diebitsch ein Anrecht auf Gehör zu haben. Der hagere Mann von der Reichskreditkasse schien seine Gedanken lesen zu können. »Leutnant Diebitsch! Männer wie Sie werden gebraucht. Sie haben sich gerade um das Vaterland verdient gemacht.«
»Ich warte schon lange auf meine Chance«, erwiderte er.
Wörmann blickte ihn gönnerhaft an. Diebitsch konnte nicht ausmachen, ob ihn das schielende Auge fixierte. »Man wird auf Sie aufmerksam werden. Ich werde Sie für eine weitere Spezialaufgabe vorschlagen.«
Diebitsch salutierte. Sie kehrten an Deck zurück. Sein Auftrag war beendet.
Wörmann und seine beiden Begleiter begaben sich zur Landungsbrücke, die steil vom Deck der GNEISENAU zur Pier hinabführte. Der stark bewaffnete LKW-Konvoi stand längsseits der Steuerbordseite. Eskortiert von Wachsoldaten, stieg Wörmann in einen schwarzen PKW, einen Mercedes. Als sich der Konvoi in Bewegung setzte, stand Diebitsch auf dem Achterdeck. Er ließ seinen Blick über den Hafen schweifen. Es war wie ein Ritual. Er sah sich schon als Kapitän der GNEISENAU. Kurz darauf verschwand der letzte LKW des Konvois zwischen zwei großen Lagerhäusern.
Er konnte nicht ahnen, dass von nun an der Schatten Karl Wörmanns ihn begleitete, der skrupellos sein Schicksal steuern würde.
5 Hamburg, Mai 1957
Johannes sitzt in Hamburg-Altona am Frühstückstisch seines Freundes, Rechtsanwalt Heinrich Dersch. Er ist mitten drin, sich auf seine neue Aufgabe als Kapitän vorzubereiten. Dr. Otto Wachs, Präsident der STIFTUNG PAMIR UND PASSAT, Kapitän Fritz Dominik als Inspektor, und vor allem Hermann Eggers, Stammkapitän auf der PAMIR, sind seine Gesprächspartner.
Die Themen kreisen zunächst um die Erwartungen, die Diebitsch als neuer Kapitän der PAMIR zu erfüllen hat. Schon am ersten Tag ist klar: Die wirtschaftlichen Interessen der Stiftungsmitglieder stehen im Vordergrund. Er bekommt Wind von handfesten Problemen, mit denen sich die Stiftung konfrontiert sieht. Krasser noch, sie steht durch die aufgelaufenen Defizite der PAMIR und PASSAT unter erheblichem finanziellen Druck. Dominik deutet ein Defizit von rund 400.000 DM an, das derzeit nicht gedeckt sei. Negativ wirke sich vor allem auch die Streichung des Zuschusses von 65.000 DM der Hansestadt Bremen vom vergangenen Jahr aus. Man befürchtet, dass Hamburg und auch Schleswig-Holstein diesem bedauerlichen Beispiel folgen könnten. Auch der Bund könnte dann seine Unterstützung versagen. Ein Desaster …
Daran wäre wohl die Stiftung selbst schuld, erwidert Diebitsch ohne Hemmungen. Nach seiner Auffassung liegt die Ursache im unbefriedigenden Leistungsbild der Mannschaften. Die Ausbildung auf den Seglern ließe zu wünschen übrig, wie man liest und hört. Kadetten, Jungmänner, Leichtmatrosen und Matrosen, die nach jeder Fahrt ihr Können während der Abschlussbesichtigung unter Beweis stellen sollten, überzeugten nicht. Das hatte sich herumgesprochen. Kapitäne aus Bremen sahen sich beim letzten Mal zu einem folgenschweren Urteil gezwungen: nicht ausreichend!
Ursache für das vernichtende Urteil war die Abschlussbesichtigung auf der PASSAT nach ihrer 3. Reise am 10. Jensuar desselben Jahres. Grubbe war der verantwortliche Kapitän. Diebitschs gründliches Aktenstudium hatte sich gelohnt. Schriftstücke und Protokolle bekam er von seinem Vorgesetzten, der im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, an Vorstandssitzungen des Stiftung teilnahm. Genüsslich las er Dominiks Aktennotiz an die Herren Dr. Wachs und Schuldt von Zerssen & Co.
Für Diebitsch sind sie das Zeugnis einer völlig unzureichenden seemännischen Ausbildung!
Das stellen beide Herren sofort in Abrede, obwohl sie es besser wissen. Diebitsch, gut präpariert, da er ein Protokoll vom April letzten Jahres im Kopf hat, kontert. Der Geschäftsführer seines Arbeitgebers in Bremen, des Vereins zur Förderung des seemännischen Nachwuchses, nahm damals selbst an der Sitzung teil.
Diebitsch sagt, er habe andere Informationen.
»Raus mit der Sprache!«, fordert Wachs.
»Der Beweis liegt in Ihrer Ablage! Blicken Sie in eines Ihrer Protokolle vom April letzten Jahres. Wenn Sie dort von einer Überwindung von Kinderkrankheiten sprechen, die auf den ersten Reisen der PAMIR und PASSAT im Ausbildungsbereich festzustellen waren, dann hat sich auch nach der vierten und fünften Reise im Grunde nichts geändert.«
Der Präsident sieht ihn verdutzt an und verstummt. Er bittet Diebitsch um einen überarbeiteten Ausbildungsplan und einen Wochenplan zur See, der Aufschluss über Wachzeiten, Arbeitsdienst, Unterricht und Freizeit gibt. Diebitsch öffnet seine Tasche und reicht beides prompt über den Schreibtisch. Er hat es wohl geahnt.
Tage darauf wühlt sich Johannes mithilfe von Eggers durch Kapitäns-Order der Reederei Zerssen, macht sich vertraut mit Schiffsplänen, technischen Daten, Stabilitäts- und Beladungsfragen, dazu studiert er Listen, die Aufschluss über die Ausrüstung der PAMIR geben. Schließlich folgen Personalakten, Logbücher, See- und Hafenkarten. Außerdem grübelt er über nautische Besonderheiten der Reiseroute. Sein Notizbuch füllt sich täglich mit neuen Fragen, die er mit Eggers diskutiert. Darunter ist auch Eggers' Bericht aus Montevideo, den er am 21. Februar an Dominik abgeschickt hatte. Unter Punkt sechs ist aufgeführt, dass die Laderäume der Pamir entrostet und konserviert werden müssen. Diebitsch entschließt sich, den Punkt zu ignorieren und abzuwarten.
Dominik kommentiert Eggers Bericht: ›… der Einsatz einer Firma in Hamburg oder Bremen ist außerordentlich teuer. Es muss überlegt werden, ob nicht vor Übernahme der Ladung die Räume gemacht werden müssen. Falls die Laderäume nicht gemacht werden, laufen wir Gefahr, dass die Behörden in Argentinien das Schiff bei der nächsten Reise ablehnen …‹
Einen weit riskanteren Mangel brachte Eggers unter Punkt sieben zum Ausdruck. Die Brisanz, Bedeutung und Tragweite des maroden Zustandes des Hochdecks, war Diebitsch beim Lesen allerdings nicht bewusst geworden.
Eggers Bericht: ›Das Hochdeck leckt an den verschiedensten Stellen stark. Teilweise gehen die Decksplanken bei Regen direkt hoch. Grund: Das unter dem Holzdeck liegende Stahldeck ist sehr stark korrodiert, und das Holzdeck selbst ist von unten werden der stets unter dem Holz stehenden Feuchtigkeit stark angegangen, so dass durch Einziehen einzelner neuer Planken und durch Kalfatern das Deck nicht mehr dichtzubekommen ist.‹ Dominik kommentierte: ›Wegen der sehr hohen Kosten wurde bei den Klassearbeiten von der Erneuerung des Hochdecks Abstand genommen. Wie der Bericht des Kapitäns zeigt, wird diese Arbeit jetzt anscheinend akut…‹
»Wir werden sehen!«, kommentiert Diebitsch das Gelesene. Kurz darauf erregt Kapitäns-Order Nr. 21 seine besondere Aufmerksamkeit. Betreff: Funkabkürzungen in Sonderfällen …
›Im Klartext gegebene Funkmeldungen in besonderen Fällen bergen stets die Gefahr in sich, dass die Presse ohne unser Wissen Meldungen bringt, die unnötige Unruhe in der Öffentlichkeit stiften. Wir ordnen daher an, dass im Funkverkehr in besonderen Fällen die unten aufgeführten Funkabkürzungen angewandt werden.‹
Beim letzten Satz ballt er seine Hand zur Faust: ›In Fällen von Seenot sind selbstverständlich die internationalen Seenotzeichen usw. sowie jeder offene Text zu verwenden!‹
»Zum Teufel, was sagen Sie dazu?«, macht er Eggers auf den Widerspruch aufmerksam.
»Die Letzten beißen die Hunde! Die Reederei sichert sich auf unsere Kosten ab. Bei dieser widersinnigen Order haben wir als Kapitäne den Schwarzen Peter!«
Am Tag, bevor er zurück nach Bremen reist, um seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln, bittet ihn Wachs in sein Büro.
»Ich habe mit großem Interesse Ihren Wochenplan studiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass Sie den Unterricht an Bord zulasten des Arbeitsdienstes ausweiten wollen.«
»Die Ausbildung der Mannschaft hat in meinen Augen Vorrang. Dem hat sich alles andere unterzuordnen, zumal die Stiftungsreeder, wie Sie wissen, besonderen Wert darauf legen.«
Wachs bringt es mit aller Willenskraft fertig, Diebitsch nicht in die Schranken zu weisen. Die Probleme würden sich in seinen Augen dadurch nur potenzieren. Breit lächelnd erwidert er daher: »Also schön, bringen Sie das mit sich in Einklang. Jedenfalls gelten alle Kapitäns-Order ohne Abstriche. Die Instandhaltung der PAMIR hat für uns als Stiftung und vor allem für die Kassen der Stifter-Reedereien Priorität.«
»Darin sehe ich keinen Widerspruch.«
Wachs schiebt den Stuhl zurück und versucht sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er der falschen Auswahl zugestimmt hat. »Ich kann mir vorstellen, dass das, was ich Ihnen jetzt als zusätzliche Anweisung mit auf die Reise gebe, Sie dazu zwingen wird, Ihren Wochenplan ein wenig zu modifizieren, ohne dass die Qualität der Ausbildung darunter leiden muss.«
»So ist das Leben an Bord, Herr Dr. Wachs. Disponieren, modifizieren: jeden Tag, jede Stunde, jede Minute …«
Wachs rutscht wieder an seinen Schreibtisch heran und knetet seine Finger, bis sie blutleer sind. »Na schön! Der Rost an den Innenbordwänden der Laderäume muss abgeklopft und der gesäuberte Stahl konserviert werden. Sie haben während der Hinreise dafür genügend Zeit einzuplanen. Wenn wir schon ohne Fracht segeln, dann müssen wir die besondere Chance für diese Instandhaltungsarbeiten nutzen.«
Wachs macht eine Pause, während Diebitsch im Stillen die wertvollen Stunden rechnet, die ihm für den Unterricht verloren gehen.
»Denn neben dem romantischen Wert der Reise«, fährt Wachs fort, »haben wir auch die Realität im Auge zu behalten. Wir sparen dadurch erhebliche Summen, die sonst durch Werftliegezeiten anfallen würden. Ein ungemein wertvoller Lehrgegenstand, neben Spleißen und Knoten, Segelnähen, Takelarbeiten, Segelkunde und Bootsmanövern. Außerdem macht harte Arbeit Lust auf Kopfarbeit.«
Diebitsch hätte ihn am liebsten gekielholt. Über seine Kenntnis von der drohenden Ablehnung der PAMIR durch die Behörden in Argentinien schweigt er.
Abends begibt er sich in die Wohnung seines Freundes. Heinrich Dersch besitzt ebenfalls das Patent A6 und war im Krieg Navigationslehrer der Luftwaffe. Sie kennen sich seit 1930. Zusammen segelten sie auf dem SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND. Heinrich als Schiffsjunge, Johannes als 1. Offizier. Damals war es dem ›Ersten‹ gelungen, aus dem halben Kind einen harten, seefesten Jugendlichen zu machen. 1953 trafen sie sich in Hamburg wieder. Johannes zog Heinrich bei seinen Vorbereitungen für den Expeditionstörn auf der Yacht XARIFA mit Hans Hass als Berater heran. Damals fuhr Diebitsch für knapp zwei Jahre als Kapitän auf dem Gaffelschoner.
Nach dem Abendessen bespricht er mit seinem Freund die neuesten Erkenntnisse. »Die finanzielle Situation der Stiftung ist dramatisch. PAMIR und PASSAT sind ein einziges Verlustgeschäft. Dabei haben die Reeder mit Gewinnen gerechnet. Sparmaßnahmen genießen daher oberste Priorität. Ich habe Order, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft bis Buenos Aires die Bordinnenwände der PAMIR vom Rost befreit und konserviert.«
»Das sind doch lupenreine Werftarbeiten!«, stellt Heinrich fest.
»Gestrichen!«
»Eine Schweinearbeit für die gesamte Besatzung.«
»So ist es! Alles unter Deck. Dazu die Hitze in den Mallungen.«
Heinrich ironisch: »Viel Vergnügen!«
»Sie wollen eine gute Ausbildung sicherstellen und ordnen gleichzeitig stupide, zeitraubende Instandsetzungsarbeiten an, die nur eine Werft ordentlich erledigen kann. Beides zusammen ist nicht zu vereinbaren. Aber alle erwarten, dass sich die Qualität der Ausbildung verbessert. Die Wahrheit bleibt sowieso auf der Strecke«, sagt Johannes verbittert.
»Mach dich nicht verrückt. Zieh dein Konzept einfach durch.«
»Das wird unter diesen Bedingungen unmöglich sein. Wie würdest du denn die Sache angehen?«
»Fordere weitere Fachoffiziere an. Wenn du genügend Unterricht geben willst, dann brauchst du mindestens noch einen zusätzlichen nautischen Offizier. Besser zwei. Dann kannst du die Wachen unterteilen und mehr Unterricht zur gleichen Zeit geben.«
»Mensch, Heinrich! Das ist die Idee. Einen ›überzähligen Ersten‹ setzte ich bei Dominik bestimmt durch …«
In der Woche darauf erhält Johannes die Zusage für einen weiteren nautischen Offizier. Die Auswahl gestaltet sich wegen der kurzen Frist schwierig. Hätte Diebitsch gewusst, wer als ›überzähliger Erster‹ an Bord kommt, er hätte gern verzichtet …