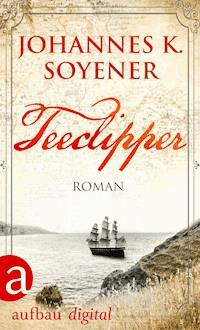13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1970 wird auf dem Grund des Soyensees eine Leiche gefunden. Die Todesumstände sind mysteriös: Das Opfer starb durch einen Harpunenpfeil im Kopf. Der Täter konnte bisher nicht gefunden werden. Und auch die Identität der Leiche ist unklar. Die Ausrüstungsgegenstände lassen darauf schließen, dass der Tote Profitaucher war. Welches Geheimnis verbirgt der See? Der pensionierte Kommissar Maximilian Fangeisen stellt sich genau diese Frage und geht dem Rätsel seines ersten Falls nun erneut auf die Spur. Doch als er der Aufklärung näherkommt, geschieht plötzlich ein zweiter Mord, der Parallelen aufweist. Hat derselbe Täter wieder zugeschlagen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Für meine Heidi, die mich bei allen Recherchen begleitet
und für die pünktliche Fertigstellung dieses Buches so
manche Nacht auf mich verzichtet hat …
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten der Romanfiguren mit lebenden oder toten Personen sind nicht beabsichtigt, ebenso wenig eine Beschreibung der Verhältnisse in tatsächlich existierenden Institutionen, Organisationen oder Vereinigungen.
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2016
© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: © Peter Oberpriller, Soyen
Worum geht es im Buch?
Johannes K. Soyener
Toteissee
Im Jahr 1970 wird auf dem Grund des Soyensees eine Leiche gefunden. Die Todesumstände sind mysteriös: Das Opfer starb durch einen Harpunenpfeil im Kopf. Der Täter konnte bisher nicht gefunden werden. Und auch die Identität der Leiche ist unklar. Die Ausrüstungsgegenstände lassen darauf schließen, dass der Tote Profitaucher war. Welches Geheimnis verbirgt der See? Der pensionierte Kommissar Maximilian Fangeisen stellt sich genau diese Frage und geht dem Rätsel seines ersten Falls nun erneut auf die Spur. Doch als er der Aufklärung näherkommt, geschieht plötzlich ein zweiter Mord, der Parallelen aufweist. Hat derselbe Täter wieder zugeschlagen?
Johannes K. Soyener, geboren in Altötting, hat lange Jahre in der Gemeinde Soyen in Oberbayern gelebt.
Prolog
Zerrissene Wolkenbänke ziehen rasch nach Osten über einen mondhellen Himmel, der dem Soyensee ein wundervoll glitzerndes Aussehen verleiht. In dem Moment erkenne ich durch mein Nachtglas, wie sich drüben am Ostufer eine dunkle Gestalt löst und mit einem Surfbrett auf mich zuhält.
Bill Traser liegt mir seit Tagen wie ein schmerzendes Unbehagen im Magen. Ein junger Engländer, aus Manchester, sagt er. Er kam mir schon am ersten Tag seiner Ankunft, drüben am Campingplatz, verdächtig vor, als er mich am Badestrand über den alten Feldflughafen der Amis ausfragte. Das war bei einem gemeinsamen Bier in seinem Wohnmobil. Ich war gewarnt. Bill reiste an diesen stillen Ort, um mein Revier zu beanspruchen. Warum? Das ist mir kein Rätsel. Dafür ist sein Wissen über das, was da unten auf dem Grund ruht, zu genau. Kann ich zulassen, dass ausgerechnet ein Engländer sich daran vergreift? Niemals!
Angesichts der unendlichen Möglichkeiten der menschlichen Lebenswege ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich zwei Lebensbahnen berühren. Und doch gibt es Kräfte, die diesen Kurs überraschend ändern können. In unserem Fall ist es eine gewaltige Kraft. Wir schießen aufeinander zu wie zwei Projektile, geradlinig, Kollision unvermeidlich!
Noch stört Bill nur meine Kreise, aber taucht er auch heute Nacht wieder im See, lasse ich ihn daraus nicht mehr entkommen. Vielleicht hat er einen anderen Fahrplan, aber seine Endstation heißt Seegrund. Bill ist ein Mensch, den hier niemand kennt. Deshalb wird auch niemand intensiv nach ihm suchen – was mir gut gefällt, denn dann kann ich im See weiter Beute machen. Tauchen ist so alt wie die Menschheit. Fisch unter Fischen sein: ein schönes Hobby, obwohl wir für das Element Wasser nicht geschaffen sind.
Es ist so weit. Jetzt ist nur noch meine mentale Stärke gefragt. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich vorhabe. Das satte Schmatzen, mit dem der Spannungshaken für den Pfeil in den Schlitten meiner Harpune einrastet, ist für mich die reinste Beruhigung. Ich gleite in den See, tauche unter, atme Pressluft. Die Muskeln meiner Oberschenkel geben Druck auf die Flossen. Das Unterwasserareal ist in meinem Kopf kartografiert, das helle Weiß von Bills Tauchlampe ein nicht zu verfehlender Zielpunkt. Ich habe drei Dinge auf die Reihe gebracht: die fabelhafte Chance genutzt, eine ideale Schussposition eingenommen und die Sekunde seines Todes wird allein von mir bestimmt. Ich schalte meine Stirnlampe ein. Bill nimmt mich wahr, blickt erschrocken in meine Richtung. Ich schwebe zwei Meter über seinem Kopf und schieße meinen Pfeil ab. Innerhalb einer Nanosekunde hat Bill sein Leben verwirkt. Seine Tauchlampe verlischt noch schneller als Atemfunktion und Puls. Dass er jemals wieder auftauchen wird, ist so unwahrscheinlich wie eine Auferstehung.
Im Lichtkegel meiner Stirnlampe erfasse ich Bill erneut. Er starrt mich aus einem feinen Blutnebel an mit Augen, die an zwei schwarzverspiegelte Linsen erinnern, flach und leblos. Seine Taucherbrille ist dort angeheftet, wo der Harpunenpfeil sein Stirnbein durchschlagen hat. Mein Herz beginnt zu rasen wie ein Metronom auf Speed. Das innere Notaggregat springt an. Der Horror lässt mich in Panik aus dem See flüchten.
Wenig später reift eine Erkenntnis in mir: Jeder Mensch kann töten, aber nicht jeder hat die Nerven, es auch zu tun.
1
München, Dienstag, 30. September 2014
Als Maximilian Fangeisen am Tag seiner Pensionierung morgens noch einmal sein Büro betritt, findet er eine handgeschriebene Karte mit einem Zitat von Friedrich Schiller darauf: »Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich.«
Wie wahr, denkt er, manch einer empfindet diesen Moment, als würde man ihn häuten. Andere verabschieden sich in dem Gefühl, ausgemustert zu sein, abdanken zu müssen. Klar, es gibt Fälle von Freude und Erleichterung, doch die letzten Stunden sind meist von Wehmut und Erinnerungen gesättigt. Lass es also über dich ergehen. Es ist nur eine Formalität. Alles irgendwo Scheiße!
Er nimmt die Karte und legt sie auf den Tragekorb direkt auf das gerahmte Bild mit den chinesischen Schriftsymbolen »Leben und Tod«. Fangeisen ist nicht frei von Seelenqualen. Diese haben jedoch nichts mit seinem Abschied aus der Abteilung OFA, Operativen Fallanalyse, zu tun. Ihn quält eine ganz andere Art von Schmerz: Wer klärt nun die ungelösten Morde auf? Die Antwort hat er sich zwar längst selbst gegeben, aber das Kreisen dieser unaufhörlichen Frage in seinen Gehirnwindungen lässt sich nicht stoppen. Er wird die Frage also noch einmal stellen, öffentlich, hier und jetzt.
Maximilian misst 1,84 Meter, ist schlank, sieht aus wie ein in die Jahre gekommener Hippie mit Pilzkopf, der dem Anderssein heute noch durch das Tragen langer Haare Ausdruck verleihen möchte. Die sind zwar noch dicht, aber grauweiß: Mittelscheitel, die Strähnen fallen über beide Ohren und verdecken teilweise seine Stirn, deren Falten an die Riffelung eines Kühlergrills erinnern. Ohne Föhnfrisur verlässt er ungern das Haus. Über seiner Oberlippe prangt ein gepflegter Walrossbart. Auch ohne umgeschnallten Geigenkasten wäre er als Musiklehrer glaubhaft. Individualität und Unangepasstheit sind ihm wichtig. Sein Blick ist skeptisch, etwas melancholisch. Er verrät ihn als einen, der zu wissen scheint, dass es draußen nicht gut aussieht, und seine Augen enthüllen, dass sie viel zu oft in menschliche Abgründe geblickt haben. Oft bedeutet: Konfrontation mit mehr als tausend Tötungsdelikten während seiner langjährigen Dienstzeit.
Anschließend wird er von seinem Vorgesetzten Rupert Knecht, dem Chefermittler der Münchener Mordkommission, und dem Innenminister aus seinem Büro abgeholt. Währenddessen drängen immer mehr Mitarbeiter und Kollegen der Mordkommission K11, wie die Abteilung intern genannt wird, in den großen Besprechungsraum, um Fangeisen, der heute aus dem Dienst scheiden wird, die Ehre zu erweisen. Eine Cateringfirma hat den Raum mit Bistrotischen bestückt, Gläser und Getränke bereitgestellt und längs der Fensterseite ein Fingerfood-Büfett aufgebaut.
Gemeinsam betreten Knecht und Fangeisen den Raum zum Stehempfang. Es wird still darin.
Max lächelt fröhlich, als er seine Lebensgefährtin Michaela Dunst, er nennt sie meistens nur Micha, in der ersten Reihe entdeckt. Gleich geht es ihm besser. Sie lebt in Rimsting, ist eine erfolgreiche, freiberuflich arbeitende Journalistin, mit ihrem verwitweten Max seit gut einem Jahr liiert und knapp zwanzig Jahre jünger als er. Nun wird er bald von München weg- und bei ihr in Rimsting einziehen. Sie hat gerade den begehrten Guardian-Price in der Kategorie »Investigative Recherche« für die Aufdeckung krimineller Machenschaften von Schleuserbanden samt Hintermännern im Grenzbezirk Oberbayern bekommen. Er ist dotiert mit 20 000 Euro. Michaela ist etwas hyperaktiv und lebt ihren Ehrgeiz im Beruf aus, wobei sie darauf achtet, davon innerlich nicht aufgefressen zu werden. Dennoch fühlt sie sich durch Abgabetermine bisweilen stranguliert. Doch heute, da eine entscheidende Weiche im Leben ihres Geliebten gestellt wird, will sie an seiner Seite sein. Sie lächelt zurück.
»Die strahlt ihn ja an wie eine Tausend-Watt-Birne«, raunt einer in der dritten Reihe. Er ist nicht der Einzige, der die unglaubliche Präsenz dieser Frau im Raum spürt.
Ein anderer zischelt süffisant: »Leicht krisengefährdet, der gute Max. Alter, Ruhestand und eine jüngere Frau?«
»Ach was, von Schutzmaßnahmen hat der doch eine Menge Ahnung …«, erwidert sein Nebenmann.
Die Blicke der meisten Männer hinter Michaela ruhen auf ihrem pinkfarbenen Blazer mit femininer Silhouette, der ihr dichtes, rabenschwarzes Haar hervorhebt. Eine schwarze Stretchhose ohne auftragende Taschen betont ihre schlanken, langen Beine. Was niemand sieht: Ohne regelmäßiges Fitnesstraining und Disziplin beim Essen wäre diese Figur in ihrem Alter undenkbar.
»Ich hab sie kürzlich kennengelernt. Attraktivität und ein ausgeprägter Riecher begünstigen ihre außerordentlich erfolgreichen Recherchen – das behaupten jedenfalls ihre Journalistenkollegen.«
»Außerdem soll sie ihre eiserne Hand in einem Seidenhandschuh verstecken«, flüstert der Nebenmann zurück.
Der andere nickt zustimmend.
Chefermittler Rupert Knecht geht an das Rednerpult. Das letzte Gemurmel verstummt. Knecht ist kein Mann großer Worte, dafür ist sein Sarkasmus gefürchtet. Ohne ausschweifende Wortgirlanden kommt er auf den Punkt. »Herr Innenminister, lieber Kollege Fangeisen, lieber Max, deine Stunde des Abschiednehmens ist gekommen …« Knecht zeigt ein schiefes Lächeln, »… zumindest was unsere Abteilung K11, vorsätzliche Tötungsdelikte, anbelangt.«
Angesichts der Zweideutigkeit dieses Satzes geht ein Raunen durch die Reihen.
Knecht fährt fort. »Was wird nun kommen, wie wird dein Leben jetzt weitergehen, wenn du dieses Gebäude für immer verlassen haben wirst? Was wird dich interessieren? Wie wird sich der Ruhestand für dich anfühlen? Nie zuvor konnte man so viel über einen Einzelnen in Medien und sozialen Netzwerken in Erfahrung bringen wie heutzutage. Nur die Zukunft ist schwer zu ergründen. Mir ist es aber in einem der letzten Gespräche mit dir gelungen, Hinweise über deinen zukünftigen Weg zu bekommen. Ich komme darauf zurück. Konzentrieren wir uns also auf das, was wir von dir wissen. Daher sei ein kleiner Rückblick gestattet. Du bist 1949 in Soyen geboren und hast dein Abitur in Gars am Inn gemacht. Statt Wehrdienst gehst du zur Bereitschaftspolizei und wirst danach nahtlos in den Polizeidienst übernommen. Ein Kriminalistik-Dozent weckt dein Interesse an der Verbrechensaufklärung, sodass du dann vehement den Einsatz bei der Kriminalpolizei anstrebst. Es folgt die klassische Ausbildung in Traunstein und Rosenheim, du lieferst glänzende Ergebnisse ab, und so kommt es, dass sich ab 1970 in deinem Beruf nahezu alles um Mord und Totschlag, Opfer und Täter dreht. Dazwischen büffelst du und legst rasch alle erforderlichen Prüfungen ab. Mit Beginn des Jahres 1975 arbeitest du im Kommissariat für Todesermittlungen in München. Als Kommissar bist du dann so weit, dass du deinen Kollegen etwas beibringen kannst, und wirst mit gerade einmal 33 Jahren zum Leiter der Mordkommission und stellvertretenden Leiter im Kommissariat für Gewaltverbrechen befördert. Bis 1999 führst du Ermittlungen in mehr als 1000 Tötungsdelikten durch. Wegen deiner hervorragenden Aufklärungsquote hast du dir in unserer Abteilung den Ruf ›Max-100-Prozent‹ redlich verdient.«
Beifall brandet auf.
Knecht wartet ab, bis wieder Stille eingekehrt ist. »2000 gibst du noch einmal richtig Gas. Unser Erfolg basiert ja auf der Innovationsfreudigkeit unserer Beamten. Du bist darin ein echtes Vorbild. Ob Operative Fallanalyse, Profiling, genetischer Fingerabdruck – egal, was die Wissenschaft an neuen Methoden für uns Kriminaler hervorbrachte, du gehörtest immer zu den Ersten, die sie einsetzten. Nicht von ungefähr hast du bis heute die Dienststelle für Operative Fallanalyse der bayerischen Polizei geleitet, eine äußerst erfolgreiche Abteilung, die unsere Soko-Leiter bei ihren Ermittlungen unterstützt. Und wie wir alle mitbekommen, ist die OFA kaum entbehrlich, wenn das Puzzle zur Rekonstruktion eines Verbrechens zusammengefügt werden muss. Mit deiner Hilfe konnte eine Reihe von Serienmorden, vor allem in Verbindung mit Sexualdelikten, aufgeklärt werden. Dein schwierigster, aber auch größter Erfolg war die Aufklärung der »Park-Mörder-Serie«, die weit über Deutschlands Grenzen hinweg in allen Medien Aufsehen erregte und selbst unter den Kollegen in Europa und sogar in den USA große Anerkennung fand. Man kann dein Leben wahrlich nicht als eine Kette von Pleiten erklären, obwohl die, so glaube ich, das Berufsleben eher vermenschlichen. Und wer von uns erinnert sich schon an die Einsamkeit seiner Triumphe? Ich stelle fest, du trägst einen dicken Rucksack an Erfolgen mit dir herum. In meinen Augen ist das mehr als genug für einen Fallanalytiker wie dich – sicher auch in den Augen vieler Kollegen. Doch ich befürchte, die Faszination und das Unerklärbare des Verbrechens, die Abgründe des menschlichen Verhaltens im Verbund mit der Suche nach der Wahrheit bleiben für dich offenkundig auch jetzt noch ein gewaltiger Antrieb. Ich vermute daher, dass du nicht vollständig loslassen wirst.«
Im Raum wird getuschelt, viele sind erstaunt, manche schütteln ihre Köpfe.
»Wie das?«
»Macht er irgendwie weiter?«
»Sondereinsätze oder was?«
Knecht gibt seinem Assistenten ein Zeichen. Dieser reicht ihm eine pralle rostfarbene Akte, darin die Kopie eines alten Falles. Fangeisen weiß, was ihn erwartet. Schließlich ist er konfliktfreudig und provokant, daher handelt Knecht in diesem Punkt auf seinen ausdrücklichen Wunsch.
»Rost« steht für »ungeklärt«.
Knecht wendet sich wieder an Fangeisen. »Eine Pleite gibt es allerdings in deiner Karriere, denn jeder, so sagt man, hat seine Leiche im Keller. Ich habe recherchiert, mein lieber Max, auch du – zwar nicht im Keller, dafür in einem See. Juni 1970 wurde aus dem Soyensee eine der schönsten Wachsleichen Oberbayerns geborgen. Ein bislang unbekannter englischer Camper wurde Mitte Juni 1968 als vermisst gemeldet. Erst zwei Jahre später, 1970, wurde er am Grund des lauschigen Gewässers, einem Toteissee, gefunden, offensichtlich bei einem ominösen Tauchgang ermordet. Deine Heimat, Max, dein erster Mordfall, deine erste Niederlage!« Knecht lächelt süffisant. »Schande, der Fall ist seit 46 Jahren ungelöst. Das Schicksal des Opfers versank langsam im Staub der Akten. Ich bin mir sicher, das wurmt dich bis heute und ist vielleicht ein starkes Motiv, im wahrsten Sinne des Wortes, dem Toteissee noch einmal auf den Grund zu gehen. Danach wirst du hoffentlich von Mord und Totschlag endlich lassen können. Somit ist dein Abschied gleichzeitig die Geburt der Erinnerung.«
Der Chefermittler überreicht Fangeisen feierlich die Akte »Soyen-Toteissee«, als wäre sie ein Verdienstorden.
Der Fall und die Akte »Soyen-Toteissee« wurden nach dem Ursprung des Soyensees benannt, denn nach der Risseiszeit füllte sich eines der schönen Becken durch das Abschmelzen eines »Toteisblockes« mit Wasser.
Diesmal ist der Beifall mäßig, das Gemurmel dafür umso lauter. Wortfetzen sind zu vernehmen.
»Die Akte ist ja der Hammer! Das darf doch nicht wahr sein!«
»Total daneben!«
»Das sieht Knecht ähnlich!«
Inzwischen ist der Innenminister an das Stehpult getreten, greift sich die Ehrenurkunde der Bayerischen Regierung und überreicht sie Fangeisen feierlich mit Worten wie in Blei gegossen. Zugleich werden Blumensträuße, ein offizielles Präsent des BLKA und eines der Kollegen hereingetragen und auf einem Seitentisch sichtbar platziert. Einer der engsten Mitarbeiter Fangeisens hält noch eine kurzweilige und witzige Rede, in der er den Alltag eines Kriminalbeamten pointiert zusammenfasst: Die Arbeitstage: lang. Die Wochenenden: keine. Die Frau: fremd. Die Entscheidungen: tough …
Danach deutet Chefermittler Knecht mit einer Geste an, dass nun Fangeisen das Wort hat. Maximilian tritt zum Rednerpult hin. Loslassen? Was denn eigentlich? Ich will auf der Suche bleiben, ich will nirgends loslassen, sagt er stumm zu sich.
»Sehr geehrter Herr Minister, meine liebe Michaela, lieber Rupert, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Feinde.« Fangeisen spricht langsam und bedächtig. »Unser Chef bestätigt nur eine alte Erkenntnis, aber auch die entscheidende Lehre aus den Dekaden meiner Arbeit als Mordermittler und Fallanalytiker: Ich bin nur so gut wie meine Aufklärungsquote.« Fangeisen hebt die Akte hoch. »Mit der Klärung dieses Falles werde ich sie eventuell noch bessern. Das war der erste Fall meiner Laufbahn, und es ist der einzige ungeklärte – eine Tatsache, die mich wirklich wurmt, denn die erste Leiche vergisst man nie. Natürlich habe ich Hypothesen zum Tathergang und Motiv entwickelt. Auch nach all den Jahren frustriert mich dieser Cold Case noch immer; regelmäßig kehren meine Gedanken an den See zurück, und ich suche nach neuen Erklärungsansätzen. Und gestehen wir es uns ein: Vielen von uns geht es doch ähnlich. Dabei spiegelt der Blick in die Vergangenheit uns manchmal den Weg in die Zukunft. Wie ihr alle wisst, liebe ich es, komplexe Sachverhalte zu entwirren und neue Lösungsansätze zu finden. Soll jetzt damit so Knall auf Fall Schluss sein? Jetzt, wo ich endlich den lang ersehnten Luxus genießen darf, meine Freiräume nutzen und völlig unabhängig bei der Bewertung meiner Recherchen sein zu können? Das kann es noch nicht gewesen sein! Und der Fall von damals erzählt nicht die Geschichte eines menschlichen Irrtums, eines Mangels an Pflichtgefühl oder eine Geschichte über fehlende Fähigkeiten seitens der Ermittler. Nein, der Fall erzählt die Geschichte eines systematischen Scheiterns. Auch wenn sich mir beim Fall ›Soyen-Toteissee‹ die Umstände bis heute noch nicht in ihrer Gänze erschlossen haben, ab heute habe ich endlich die Zeit, dies mit allen modernen Mitteln zu korrigieren. Es ist dies mein erster Mord, den ich als privater Ermittler akribisch nachuntersuchen werde.«
Einzelne Freunde und Mitarbeiter von Fangeisen klatschen, aber die Mehrheit rührt keinen Finger. Micha erstarrt bei seinem letzten Satz. Das hat sie nicht erwartet. 23 Wochenenden war er im letzten Jahr außer Haus. Die Statistik stammt von ihr selbst. Niemand bemerkt ihre tiefe Enttäuschung, denn dass er weitermachen will, hat er ihr gegenüber mit keinem Wort erwähnt. Gemeinsames Bergwandern, lange Kaminabende, gemeinsames Kochen, das war angesagt. Der Satz »Liebling, es ist etwas dazwischengekommen«, so glaubte sie, wäre mit dem Tag seines Abschieds endgültig Vergangenheit.
Fangeisen fährt fort. »Zum Schluss noch eine Antwort auf die häufig gestellte Frage, welche Methoden zu meiner hohen Aufklärungsquote geführt haben. Abgesehen davon, dass wir ein gutes Team waren, gründet sich meine Leistung nicht auf eine einzige überragende Fähigkeit, sondern ist eher bedingt durch die Gesamtheit spezieller Kompetenzen. Aus diesen ergibt sich mein riesiger Erfahrungsschatz. Und am Ende gestatten Sie mir noch einen Appell an alle: Denken Sie daran: Bei Mord gibt es keinen geschlossenen Aktenschrank. Wer klärt also die Altfälle von Morden auf, die sich darin stapeln? Wer bringt diese Mörder, die draußen immer noch frei herumlaufen, hinter Gitter? Ich jedenfalls empfinde es als meine gesellschaftliche und moralische Pflicht, auch im Ruhestand alles dafür zu tun, dass solche Cold Cases irgendwann gelöst werden. Morgen fange ich an, das verspreche ich.«
Seine Worte lassen die Versammlung verstummen. Daraufhin deutet er auf Benedikt Gassner und Thomas Reiter, die in der dritten Reihe stehen, der eine pensioniert, der andere noch im aktiven Dienst und beide erfolgreiche Kollegen aus seiner Dienstzeit in Traunstein und Rosenheim. Sie sind zu seiner Verabschiedung eigens nach München angereist. Ferner weist er auf Johann Förstl, einen lieben alten Kumpel, der in frühen Jahren ein schweres Schicksal hat ertragen müssen, das ihn letztendlich seine Stellung im Polizeidienst gekostet hat. »Liebe Freunde, ich werde euch brauchen. Auf eure Erfahrung, fachliche Kompetenz und eure kriminalistischen Fähigkeiten möchte ich in Zukunft ungern verzichten. Ich weiß heute schon die gute Kommunikation und kurzen Wege zu schätzen. Allen anderen hier im Saal wünsche ich viel Erfolg bei ihren Ermittlungen. Bringt die richtigen Mörder zur Strecke!« Das Wort »richtig« irritiert einige Kollegen im Raum. Fangeisen zeigt ein todernstes Gesicht. »… und holt die Unschuldigen aus den Gefängnissen.«
Am Ende seiner Abschiedsrede drückt Fangeisen seinem ehemaligen Vorgesetzten die Dienstmarke in die Hand, ohne ein weiteres Wort zu verlieren – eine symbolische Handlung, wenn jemand den Dienst quittiert. Beide drücken sich kräftig die Hände und umarmen sich schließlich freundschaftlich.
Die meisten klatschen zu Ehren Maximilians, manch einer auch aus Erleichterung, dass er endlich seinen Hut nimmt.
Micha geht zu ihrem Max und umarmt ihn liebevoll.
»Es ist vollbracht«, summt er ihr ins Ohr.
»Ja, an diesem Ort …«, meint sie doppeldeutig.
Knechts Assistent ruft in die Menge: »Das Büfett ist eröffnet!«
Die vorderen Bistrotische sind für die höheren Ränge und den »Pensionär« Fangeisen mit seinem Anhang reserviert. Man stößt mit Prosecco an, spricht über die Episoden der Vergangenheit und viel über Max’ Zukunftspläne. Michaela an seiner Seite vermeidet es, ihn auf seinen altneuen Fall anzusprechen. Bei nächster Gelegenheit wird sie es aber tun.
Als sich das »Social-Event« auflöst, alle Hände gedrückt und Glückwünsche für die Zukunft entgegengenommen sind, nimmt Max seine Micha bei der Hand. Sie gibt ihm einen Kuss.
Beim Hinausgehen drängt sich Johann an Maximilians Seite. Förstl, ein ehemaliger Kriminalinspektor, ist seit ungefähr dreißig Jahren alkoholkrank. Das Trauma seines Lebens ist der Tod seines kleinen Sohnes, den er alkoholisiert fallen ließ, woraufhin der Säugling verstarb. Ein Jahr später verunglückte obendrein seine Frau tödlich mit ihrem Auto. Johann litt fortan unter Alkoholhalluzinationen. Mehrmals sprachen seine Vorgesetzten die Empfehlung aus, ihn in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen. Als er dann die Stimme seiner verstorbenen Frau aus einer Steckdose oder aus seiner Dusche zu hören glaubte, wurde er für dienstuntauglich erklärt. Inmitten seiner Trugwahrnehmungen entwickelte Förstl aber zur Überraschung aller eine besondere, einzigartige Fähigkeit. Maximilian bemerkte als enger Freund Johanns als Erster die Besonderheit seiner Begabung. Johann begann, Straftaten durch Visualisieren zu verstehen und konnte sich außergewöhnlich stark in die Psyche von Tätern hineindenken. Seine »außerdienstliche« Hilfe hatte Fangeisen in der Vergangenheit bereits wiederholt genutzt.
»Was gibt’s, Johann?«, fragt Max seinen Freund.
Dessen Stimme klingt leise, aber klar. »Ich habe zum Mord im Toteissee neue Hinweise ausgegraben …«
2
Steinhöring, Donnerstag, 13. Januar 1945
Elisabeth Mittermeier, 19 Jahre jung, Krankenschwester, geboren in Teufelsbruck, war während des Zweiten Weltkriegs Untergauführerin »Glaube und Schönheit« des Bundes Deutscher Mädchen (BDM). Eine große, blonde, türkisäugige Frau mit nationalsozialistischer Überzeugung, entsprach sie vollkommen dem Idealbild der germanischen Maid entsprechend der Rassenlehre des Großdeutschen Reiches. Die Mädels beneideten sie, und die Burschen himmelten sie an. Sie war äußerst aktiv, sehr kontaktfreudig, eine geborene Anführerin, keinesfalls zickig, eher unternehmungslustig und mitreißend, aber zugleich fähig, über sich selbst zu lachen, und bereit, Fehler zuzugeben.
Knapp drei Monate vor der Geburt ihres Kindes, als sie ihren dicken Bauch nicht mehr verheimlichen konnte, wurde sie in einer schwarzen Limousine der SS zur Entbindung in das Lebensborn-Heim Steinhöring kutschiert. Elisabeth war ungewollt schwanger. Ihre Eltern, Rosalie und Georg, beide tief katholisch, hätten sie trotz ihrer Meriten als BDM-Untergauführerin wegen ihres Fehltritts aus dem Elternhaus geworfen. Das »Grüß Gott« war im Hause Mittermeier nie durch »Heil Hitler« ersetzt worden, und für Vater Georg war »BDM« nur eine Abkürzung für »Bund deutscher Matratzen«. Auch im Fall seiner Tochter beugte er sich dem Zeitgeist nur bedingt. Für Elisabeth bedeutete die harte Haltung ihres Vaters: Sie war jung, ledig und in Not. Keine akzeptable Situation für sie!
Das »Lebensborn«-Heim in Steinhöring war keine geheime Einrichtung der SS, aber doch geheimnisumwittert, diente es doch den hochrangigen SS- und NS-Parteiführern dazu, ihre schwangeren Geliebten zur Entbindung dorthin abzuschieben, sodass die eigenen Ehefrauen nichts mitbekamen. Schwangerschaft und Geburt wurden so geheim gehalten und in eigenen »Lebensborn«-Standesämtern attestiert. Das war ein großes Glück für Elisabeth – zunächst jedenfalls. Der Preis: Sie war zum Schweigen verdammt.
Was geschieht mit mir? Und was wird aus meinem Kind? Diese Fragen wurden in Lebensborn-Heimen oft gestellt.
Die schicksalhafte Begegnung Elisabeths mit SS-Obersturmbannführer Ortwin Ritter von Hohenstein, dem Vater ihres ungeborenen Kindes, hatte im Reservelazarett Bad Reichenhall stattgefunden, genauer: im Sanatorium der Barmherzigen Brüder. Das Datum würde sie nie vergessen: Es war der 20. April, Hitlers 55. Geburtstag, und Anlass zu zahlreichen Festivitäten, nicht nur in Bad Reichenhall, sondern im ganzen Reich. Schon am Vorabend waren Jungen und Mädchen angetreten, um in die große Gemeinschaft der Hitlerjugend aufgenommen zu werden. Die Zehnjährigen standen mit leuchtenden Augen in Reih und Glied, bereit sich dem Führer zum Geburtstag zu schenken – eine unselige Verbindung von Macht und Unschuld, eine Allegorie, die für die Jugend der NS-Diktatur stand, die in eine vermeintlich glorreiche Zukunft hineinzuwachsen glaubte.
Hohenstein war mit einer Entourage von zwanzig Mann angereist, alles hochrangige SS-Offiziere aus München und Salzburg, die Elite des schwarzen Nazi-Ordens, waren darunter. Der Krankenbesuch von SS-Kameraden gehörte an Führers Geburtstag einfach zum Ritual.
Natürlich war auch das Reservelazarett für die Nazi-Größen eine wichtige Adresse, und das schon am frühen Vormittag. Der Schnee lag dick auf den Bergen, und die meisten Bäume waren noch kahl, aber die Sonne schien.
Im Kasino kam es dann zur ersten Begegnung. Der Obersturmbannführer hatte sofort ein Auge auf Elisabeth geworfen. Vielleicht lag es an ihrem »Ehrenkleid«, der Uniform der BDM-Untergauführerin »Glaube und Schönheit«, die sie für diesen Anlass ausgewählt hatte.
Das Motto dieser nationalsozialistischen Jugendorganisation lautete: Durch die harmonische Ausbildung aller körperlichen, geistigen und seelischen Anlagen wird ein ideales Frauengeschlecht geformt, das allen Anforderungen in Haus und Beruf gewachsen ist. Gesundheit, Anmut, Schönheit und Lebensfreude tragen die Mädel aus den Gymnastik-Arbeitsgemeinschaften des BDM-Werkes »Glaube und Schönheit« in ihren Alltag …
Das war schon eine kernigere Ideologie als die Botschaft einer blassen Schwesterntracht. Elisabeth hatte ihre sandfarbene Uniformjacke auf Taille getrimmt, Schulterpolster eingenäht, die Knopfleiste mit goldenen Zierknöpfen versehen, zwei von vier aufgesetzten Brusttaschen entfernt, dem linken Ärmel neue Rang- und Dienststellungsabzeichen verpasst, eine nagelneue, kunstvoll geflochtene schwarzrote Führerinnenschnur angelegt und den passenden schwarzen Rock enger genäht.
Das lockte den Ritter an ihre Seite. Mit Blick auf ihr Rangabzeichen und ihre sehr ansprechenden Rundungen, schleimte er: »Ich glaube tief und fest an die Schönheit unserer Frauen, an die Ihre ganz besonders.«
Elisabeth reagierte meist recht schlagfertig, doch in diesem Moment rang sie um ihre Fassung. Fast schüchtern erwiderte sie: »Danke.«
Obersturmbannführer von Hohenstein, hochgewachsen, athletisch, mit einem Respekt einflößenden Auftreten, verkörperte perfekt die Attribute nordischer Männlichkeit. Er zeigte ein gewinnendes Lächeln und baute sich als der große Beschützer neben ihr auf. Nachdem der Kreisleiter seine Rede vom bevorstehenden Endsieg über die Zuhörer ausgegossen hatte, wurden Häppchen und Rotwein gereicht. Als am Ende das Horst-Wessel-Lied geschmettert wurde, schien es dem Ritter an der Zeit, den Kontakt mit Elisabeth zu vertiefen. »Kennen Sie Salzburg?«
»Ja, ich war einmal kurz da«, erwiderte Elisabeth.
»Na, dann haben wir ja ein wunderschönes Ziel. Das Juwel an der Salzach, meine liebe Untergauführerin, verdient es, genauer betrachtet zu werden.«
Ortwin von Hohenstein war Elisabeths Einschätzung nach ungefähr doppelt so alt wie sie, doch die Mischung aus Respektsperson und Vaterfigur, dazu die elegante Offiziersuniform, die seine Männlichkeit markant unterstrich, verlieh ihm Autorität und eine kapitale Aura von Macht. Auf diese adelige Führerfigur des Ordens unter dem Totenkopf projizierte Elisabeth schon nach den ersten Sätzen unbefangen ihre Sehnsüchte und Ideale. So wurde in ihrer Vorstellung Obersturmbannführer Ortwin Ritter von Hohenstein für sie der ideale Mann.
»Mein Chauffeur wird Sie zu Hause abholen. Wann passt es Ihnen?«
Ihr Instinkt mahnte sie zur Zurückhaltung, doch das triebhafte Glücksgefühl verdrängte jede Vernunft. Sie konnte ihren Honigmond kaum fassen. Ohne auch nur einen Augenblick nachzudenken erwiderte sie prompt: »Nächstes Wochenende. Am Samstag. Da hab’ ich frei.«
»Schön, mein Fräulein. Um zehn Uhr wird Sie Franz der Rosenheimer abholen.« Der Ritter salutierte, machte auf dem Absatz eine Kehrtwendung und gab seinen Männern das Zeichen zum Aufbruch.
Unter den strahlenden Sternen im Universum ihrer männlichen Verehrer schien Ortwin von Hohenstein die Supernova. Erst war sie heillos verknallt, danach bedingungslos verliebt. Ihr Obersturmbannführer wurde seinem Rang mehr als gerecht: Sturmzeit, Sturmlauf, sturmreif, Sturmnacht, Sturmfluten. Er war einfach ihr Stürmerstar.
In den ersten Wochen und Monaten ihrer erotischen Verbindung erschien es ihr, als verkürze Ortwin die Abstände in Raum und Zeit. Telefon, Fernschreiber, Funksprüche und schnelle Dienstwagen dienten dazu, ihre Treffen zu beschleunigen. Von Ortwins Familienhintergrund und seinen zahllosen Weibergeschichten hatte sie in jenen Tagen noch keinen blassen Schimmer, von seinen mörderischen Aufgaben im berüchtigten Polizeigefangenenhaus Salzburg, das als Drehscheibe für Transporte in die Konzentrationslager fungierte, ebensowenig. Nach jeder Salzburger Frühsommernacht am südlichen Abhang des Mönchberges wurde im Liebesnest der Villa Warsberg, des Ritters »Schloss«, meist all dies von einer aufgehenden Sonne überstrahlt.
Das änderte sich jedoch schlagartig, als Elisabeth Gewissheit gewann, dass eine Frucht in ihrem Leib heranwuchs. Als sie ihrem Ritter die frohe Botschaft verkündete, traf sie das Metallische seines Wesens mit voller Wucht. Ihr Liebhaber nahm die Nachricht auf, als handle es sich um einen beherrschbaren Sturmschaden. Als sie ihn vorsichtig auf Schwangerschaft und Ehe ansprach, eröffnete er ihr barsch und ohne Umschweife, dass er schon verheiratet sei, zwei Kinder habe und eine Scheidung für ihn keinesfalls infrage käme.
Für Elisabeth platzten alle Träume wie Seifenblasen, und sie blickte stattdessen in einen tiefen, hässlichen Abgrund mit Namen »ungesicherte Zukunft«. Was nun?
Wenigstens in puncto Versorgung und Bleibe zeigte ihr Ortwin Charakter. Nach monatelangem Bangen und Unmengen vergossener Tränen hatte der Obersturmbannführer eine für Elisabeth akzeptable Lösung parat.
Das Zauberwort, das über seine Lippen kroch, hieß »Lebensborn«. Stolz verkündete er: »Ich habe alles veranlasst. Du gehst in das Heim Hochland nach Steinhöring. Es ist das Lebensborn-Entbindungsheim der SS. Vor Jahren war es das erste seiner Art. Wir, die Partei, kümmern uns um unsere Kinder, besonders um die unehelichen. Es wird dir und dem Kind an nichts mangeln. Ich werde die Vaterschaft anerkennen. Deine Familie wird nichts mitbekommen, falls du es wünschst.«
Wenn schon keine gemeinsame Zukunft mit Ortwin, dann wenigstens eine gesicherte für das Kind. Verschwiegenheit, Fürsorge und eine »saubere« Identität für ihren Nachwuchs schienen ihr damit gesichert.
Was sie nicht ahnte: Ihre Vorstellungen und Wünsche entsprachen genau der Lebensborn-Philosophie. Die Organisation machte Frauen in schwierigen Lebenssituationen Hilfsangebote, verfolgte aber klar das Ziel, die »arische Rasse« zu vermehren, um eine neue Elite zu schaffen, die die Welt beherrschen sollte. Bloß keine Föten abtreiben, deren Eltern den rassischen Idealvorstellungen der NSDAP entsprachen! Zudem waren der SS-Organisation jene Kinder besonders willkommen, die von ihren Vätern anerkannt wurden und für die mit Unterhaltszahlungen gerechnet werden konnte, was keinesfalls selbstverständlich war.
Am Tag der Geburt, man schrieb den 5. April 1945, umrundete Elisabeth morgens in Begleitung einer Schwester wie gewohnt See und Park. An der übergroßen steinernen Mutter-und-Kind-Skulptur platzte plötzlich ihre Fruchtblase.
»Na, das Kind hat’s ja plötzlich eilig. Will wohl den Endsieg unseres Führers nicht verpassen!«, rief die begleitende Schwester begeistert. Zwei Stunden später war Elisabeth ein gesunder Sohn geboren. Als am gleichen Abend dann der Vater des Kindes aus Salzburg in Steinhöring eintraf, war das kleine Glück am Ende des Tages nahezu perfekt. Gab es doch noch Chancen für eine gemeinsame Zukunft?
Drei Tage später fand unter der Regie des Leiters des Lebensbornheimes, Dr. Gregor Ebner, das feierliche »SS-Taufzeremoniell« in der großen Halle unter Führerbüste, Hakenkreuzfahnen, immergrünen Pflanzen und Kerzen statt. Ritter Ortwin von Hohenstein hatte aus Gründen der Geheimhaltung auf seine Entourage verzichtet.
Die Zeremonie war eine Mischung aus nationalsozialistischen und germanischen Riten. Der Zeremonienmeister stellte ähnlich einem Priester Fragen an Mutter und Vater. Elisabeth blieben nur zwei davon im Gedächtnis. »Deutsche Mutter, verpflichtest du dich, dein Kind getreulich im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen?«
Elisabeth gab unterstützend mit einem Handschlag ihr Jawort.
Die zweite Frage richtete er an den Obersturmbannführer. »Bist du bereit, seine Erziehung im Sinne des Sippengedankens unserer Schutzstaffel stets zu überwachen?«
Wieder ein Handschlag, diesmal ohne Worte.
Der Zeremonienmeister hielt den SS-Dolch über das Kind, berührte es damit und sprach: »Ich nehme dich hiermit in den Schutz unserer Sippengemeinschaft auf und gebe dir den Namen Ortwin. Trage diesen Namen in Ehren.«
In Elisabeth wuchs eine Abneigung gegen diesen Namen. Er stand für Verrat und Demütigung. Ihr Sohn aber war unschuldig. Sie hätte ihm gern den Vornamen »Udo« gegeben. Die Szene mit dem SS-Ehrendolch würde sie nie mehr vergessen.
Ein weiterer Schock traf sie am nächsten Tag, als der Vater des Kindes ihr während des Frühstücks eröffnete, dass er an die Ostfront abkommandiert worden sei.
»Wann?«, fragte sie völlig irritiert.
»Übermorgen!«
Elisabeth beobachtete zum ersten Mal eine Unsicherheit an ihm. Hastig stand er auf, beugte sich über sie und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Einen Moment, ich hab was für dich.« Er ging zu seinem Dienstwagen und kam mit einem kleinen Lederkoffer zurück. »Hier, für dich und unseren Sohn. Ihr werdet es brauchen.«
Überrascht nahm sie den Koffer in Empfang.
»Pass gut darauf auf. Du kannst hier bleiben, solange du willst. Ich habe mit Dr. Ebner alles geregelt.«
Elisabeth sah ihn zum letzten Mal, als er in seinen Wagen stieg und vom Parkplatz fuhr. Als sie auf ihrem Zimmer den ominösen Koffer öffnete, verschlug es ihr schier den Atem. Er war randvoll mit goldenen Uhren und glänzendem Schmuck. Nur Ortwin und der Teufel wussten, woher die Preziosen stammten.
Nur wenige Tage später erhielt sie die Nachricht, dass Ortwin von Hohenstein im heldenhaften Kampf für Volk und Vaterland gefallen sei. Elisabeth sah glasklar, dass sie von nun an in vollem Maße vom »Heim« und der vermeintlichen Fürsorge der Partei abhängig sein würde.
Schon seit Monaten waren immer mehr Mütter mit ihren Kindern aus anderen Lebensborn-Müttergemeinschaften im Reich evakuiert und in das Heim Hochland verlegt worden. Jeder wusste, dass der Krieg längst verloren war, doch kein Wort wurde darüber gesprochen. Zu groß war die Angst vor Dr. Gregor Ebners Repressalien und einem möglichen Rauswurf – von einem Prozess wegen Wehrkraftzersetzung ganz zu schweigen. Das Ende rückte unaufhaltsam näher. Es begann mit Feuer und Rauch. Aktenbestände des Hauses wurden vernichtet. Mütter verließen in Scharen das Heim, die meisten Kinder blieben zurück.
Ende April 1945 näherten sich von Ebersberg kommend Truppen des amerikanischen 47. Panzerbataillons der 14. Division Steinhöring. Elisabeth hatte sich ein Fahrrad mit einem Kinderkorb besorgt, der am Lenker festgemacht werden konnte. Ihre Habseligkeiten und Dokumente passten in einen weiteren kleinen Koffer, den sie zusammen mit dem Schatzkoffer auf dem Gepäckträger festband.
Ihren Weg hatte sie längst gewählt. Die einzigen Menschen, bei denen sie hoffte, sichere Zuflucht zu finden, waren ihre Schwester Jutta und deren Mann, der Landwirt Gustl Heinlein, in Rieden.
Am Samstag, dem 28. April, nach gut fünf Stunden Fahrt mit Rad und Kind, klopfte sie an die Tür des Bauernhauses ihres Schwagers und ihrer Schwester.
Jutta öffnete. Überrascht, verdutzt, perplex blickte sie in die türkisen Augen ihrer Schwester und auf das Gesicht eines schreienden Säuglings.
Elisabeth flehte: »Bitte, Schwester, hilf mir …«
3
Ainring, Soyen, Montag, 25. Juni 1945
Colonel Jack Fraser, amerikanischer Kampfpilot, Fliegerass mit elf Luftsiegen und Geschwaderkommodore, geboren in Vandenberg, Kalifornien, USA, befand sich an diesem Montagnachmittag, bei idealem Flugwetter mit seinem Jagdbomber P-47D-25-RE aus Ainring bei Freilassing kommend, im Anflug auf den Feldflughafen Soyen. Der Flugplatz Ainring hatte NS- und Technikgeschichte geschrieben. 1939, wenige Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, war Außenminister Joachim von Ribbentrop von Ainring aus zur Unterzeichnung des »Nichtangriffspaktes« zwischen Hitler und Stalin nach Moskau geflogen, und bevor die Amerikaner ihn in Besitz genommen hatten, waren auf dem Flugfeld und in den Hangars Neuentwicklungen getestet worden.
Im Juni 1940 war die nach dem legendären Fliegerhelden des Ersten Weltkriegs, Ernst Udet, benannte »Deutsche Forschungsstelle für Segelflug« dorthin gezogen und hatte den damals noch antriebslosen ersten Düsenjäger He 280, den Höhenaufklärer DFS 228, Prototypen der V-1 und diverse Raketenjäger getestet. Ein Windkanal, Triebwerkteststände und physikalische Laboratorien standen zur Verfügung. Lastenabwürfe, Vereisungsforschungen, Huckepackverfahren, Personenabwurfbehälter, Stratosphärenflüge, revolutionäre neue Verfahren für Autopiloten und Fernseh-Blindlandeverfahren wurden damals schon dort erprobt. Und bis zur Kapitulation hatten Hitler und Göring den Flugplatz häufig für ihre Besuche auf dem »Berghof«, Hitlers Landhaus auf dem Obersalzberg, genutzt.
Colonel Jack Fraser war Leader, das heißt, er flog die Führungsmaschine nach Soyen. Sein Wingman, Bob Pepper, flog in einer weiteren Thunderbolt hinter ihm. Der Anflug erfolgte von Süden. Als Orientierung diente ihnen der gut sichtbare, schlanke Nordturm der Kirchreiter Kirche. Fraser befand sich als Erster über dem Soyensee und warf seinen Zusatztank präzise in der Mitte des Sees ab.
Das Verfahren gehörte zur Flugroutine, da Gewicht und Umfang des Tanks bei diesem Flugzeugtyp ein Risiko für eine sichere Landung darstellten. Daher wurde der Abwurf vor dem Aufsetzen von jedem Kampfpiloten der USAAF immer wieder geübt. Diesmal aber war der Tank nicht mit Flugbenzin, sondern mit handlichen Jutesäcken beladen, in denen sich fette Kriegsbeute befand. Sie stammte aus dem NS-Goldschatz, hauptsächlich italienische Feingoldmünzen, die in Kisten und Jutesäcken auf dem Hinterbernbauergut von Ortsbauernführer Alois Ziller in Lämmerbach, Hintersee, Salzburger Land, am 29. April 1945 von den Nazis auf dessen Hof im Erdreich zwischengelagert worden waren. Ausgegraben und abgeholt wurde der Schatz jedoch von den Amerikanern. Die »Goldgräber« waren Colonel Frasers Kameraden, die in der 3rd US-Infanterie Division in Salzburg ihren Dienst versahen. Am 17. Juni hatten sie das Edelmetall wieder aus der Erde gebuddelt: 81 Säcke, die zusammen 4,3 Tonnen wogen. Den Hinweis auf diesen Schatz hatten die Amerikaner von Herbert Herzog bekommen, einem ehemaligen KZ-Häftling, der die Information wiederum von Bernd Gottfriesen erhalten hatte, einem NS-Diplomaten, der sich ihm Ende des Krieges anvertraut hatte. Gottfriesen gehörte zum persönlichen Stab von Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop, und seine Aufgabe war es, den Gold- und Devisenfonds des Auswärtigen Amtes während der Nazi-Zeit zu verwalten. Gemeinsam hatten sie die Amerikaner zum Versteck geführt.
Gottfriesen und Herzog waren mit zwei Offizieren, darunter der CIC-Agent James Devan, vom Counter Intelligence Corps der 3rd US-Infanterie Division nach Lämmerbach gefahren. Ohne Verzögerung war der gewaltige Goldmünzenschatz vom Hinterbernbauergut geborgen, auf US Armee-Lastwagen verladen und nach Salzburg gebracht worden.
Ein beträchtlicher Teil von den Feingoldmünzen freilich verschwand rasch aus dem Depot der »Alten Residenz« in Salzburg, da einige Spezialisten des amerikanischen Militärs nur auf eine Gelegenheit gewartet hatten, sich endlich persönlich etwas von der lukrativen Kriegsbeute unter den Nagel zu reißen. Der korrupte CIC-Agent James Devan hatte die Idee dazu gehabt.
Fraser hatte nicht die geringste Ahnung von diesen Vorgängen. Dass Devan mit dem Finance Officer, ebenfalls von der 3rd US-Infanterie Division, Lt. Colonel Grimes, der die Kontrolle über die eingelagerten Goldmünzen in der Residenz hatte, unter einer Decke steckte, lag außerhalb seiner Vorstellungskraft. Devan, der sich mit Fraser angefreundet hatte, wurde in jenen Wochen häufig mit ihm in Ainring und Salzburg in einschlägigen GIs-Bars gesehen, und als Kampfpilot war er Devan und Grimes beim Abtransport und Verstecken der Beute extrem nützlich. Als CIC-Agent war es für Devan zudem ein Leichtes zu veranlassen, dass die nötigen Befehle für den »Routineflug« nach Soyen ausgestellt wurden.
Devan hatte kein Wort darüber verloren, was er seinem Freund unter den Rumpf seines Jagdbombers hatte hängen lassen, und Fraser hatte keine Fragen gestellt. Nur das relativ hohe Startgewicht hatte ihn irritiert. Außerdem hätte es für den kurzen Flug keines Zusatztanks bedurft. Aber Jack hatte gelernt zu funktionieren. Schließlich waren Fliegen und Töten sein Beruf, nicht seine Berufung. Lediglich Devans Wink, bei präzisem Abwurf über dem Soyensee könne eine zusätzliche Anerkennung winken, sollte ihm als Motivation zur exakten Ausführung der Befehle dienen. Bob Pepper, sein Wingman, ahnte ebenso wenig, was er auf dem kurzen Flug transportierte. Ein Tank, vollgestopft mit Jutesäcken voller Goldmünzen? Darauf wäre auch er nie gekommen. Dementsprechend fand auch er die Zusatztanks auf der kurzen Strecke als völlig überflüssig. Er vertraute aber Fraser, hatte er sich doch das Fliegerass zum Vorbild auserkoren. Dabei hätte ein Blick Peppers auf die Gedenktafeln seines Geschwaders genügt, um ihn davon zu überzeugen, dass die sogenannten Asse kaum weniger oft in den Verlustlisten auftauchten als die »gewöhnlichen« Piloten.
Nachdem er den Turm der Kirchreiter Kirche passiert hatte, setzte Fraser zum Sinkflug an. Kurz bevor er die Position »Seemitte« erreichte, betätigte er den Hebel, mit dem der Zusatztank ausgeklinkt wurde. Der Tank unter dem Bauch des Jagdbombers konnte bei der Landung auf einer unebenen Bahn wie der Soyener Holzbohlenpiste äußerst gefährlich werden. Der Jagdbomber, vom Gewicht befreit, machte einen Satz nach oben, als die edle Fracht in den See plumpste und darin verschwand. Fraser pflegte seinen Kameraden zu erzählen, er spüre die Präzision eines Abwurfs in den Pobacken. Niemand begriff, wie er das meinte. Die Landung kurz darauf war reine Routine.
Als Pepper seine Position »Seemitte« erreichte, betätigte auch er den Hebel, doch der Mechanismus versagte. Bob drehte mit seiner Maschine noch einmal eine Ehrenrunde, überflog Soyen und Kirchreit, bevor er erneut über dem See versuchte, seine »Gold-Zecke« loszuwerden. Der Abwurf klappte wieder nicht, abermals versagte die Mechanik. Pepper übermittelte Fraser über Funk, er habe Schwierigkeit mit dem Abwurf.
»Satanic mechanic!«, hörte Jack seinen Wingman lauthals fluchen.
»Scheiß drauf! Lande mit dem Ding.«
»Das geht in die Hosen«, versuchte Pepper das Unheil abzuwenden.
»Sag ich doch. Aufsetzen und stehen! Danach den Arsch wischen«, befahl ihm sein Führungsoffizier über Funk die Landung.
Die Landebahn, mit Eichenbohlen verstärkt, war mit knapp 400 Metern zwar ausreichend lang, aber der knappe Freiraum zwischen Piste und Zusatztank machte eine solche Landung zu einem unkalkulierbaren Risiko für Mensch und Maschine. Doch Pepper hatte keine Wahl. Befehl war Befehl. Er musste die Landung trotz des enormen Gewichts unter seinem Rumpf wagen. Aufsetzen und stehen! Bob hatte ein mulmiges Gefühl im Magen. Die drei Worte gingen ihm noch mehrmals durch den Kopf, bevor er die Thunderbolt aufsetzte. Kampfpiloten kennen oft ihr Schicksal, und möglicherweise kannte Pepper es auch.
Bobs Landung endete in einem Desaster. Die Maschine setzte zu hart auf, der Zusatztank wurde aufgerissen, das rechte Fahrwerk knickte ab, damit touchierte die Tragfläche die Bohlen der Landebahn, Benzin lief aus, der Jagdbomber fing Feuer und explodierte. Pepper verschmorte in seiner Pilotenkanzel.
Fraser sprintete zur Unglücksstelle. Was er sah, peitschte seinen Blutdruck nach oben, und sein Puls begann zu rasen. Auslöser war eine weitere kleine Explosion in der Pilotenkanzel. Dann sah er, wie die Leiche langsam die Hände hochnahm, als stünde ein Boxkampf bevor. Er hatte so etwas in Frankreich schon einmal bei einem Bomberpiloten erlebt, der wegen eines Feuers an Bord hatte notlanden müssen und sich nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Wrack hatte befreien können. Der Truppenarzt erklärte dazu bei einem Drink an der Bar: »Im Feuer kommt es zu Muskelkontraktionen, die Sehnen der Beine und Arme verkürzen sich, die Gliedmaßen werden zusammengezogen. Es wirkt auf dich, als würde sich die brennende Leiche noch bewegen. Außerdem birst in solcher Hitze dann häufig der Schädel. Das Ganze wirkt wie bei einem verschlossenen Behälter voller Flüssigkeit, wie bei einem Schnellkochtopf. Die Zunahme des Drucks lässt ihn irgendwann explodieren.«
Piloten wie Hilfspersonal des Soyener Feldflughafens konnten nicht viel ausrichten. Das Wichtigste für sie war die Schonung der Landebahn. Rasch befestigte man ein Stahlseil am Spornrad und zog das brennende Wrack von der Piste. Dabei verteilte sich der restliche Inhalt des aufgerissen Zusatztanks auf der Piste. Angesengte Jutesäcke, aus denen Goldmünzen quollen, lagen verstreut zwischen Flugzeugtrümmern, Eichenbohlen, Gras und Acker.
Fraser war der Erste, der die Situation erfasste. Während sich seine Kameraden um die Löschung der Reste des Jagdbombers kümmerten, folgte Fraser der Spur der Goldmünzen. Ihm war mit einem Male klar, was er und Pepper nach Soyen transportiert hatten.
Als sich ein Pilot seiner Staffel näherte, blaffte er ihn geistesgegenwärtig an: »Verschwinde hier. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Befehl vom CIC. Ich brauche zwei Männer, die das Gelände hier absperren und sofort einen Jeep mit zwei leeren Kisten. Beeilung!« Als ranghöchster Offizier hatte Fraser auf der Basis das Kommando.
Die Neugier seiner Kameraden war zwar kaum zu bremsen, aber Frasers Autorität war in der Staffel unstrittig und auch gefürchtet. Bis zum Einbruch der Nacht hatte er bis zur Erschöpfung eigenhändig fast alle Münzen eingesammelt. Fast.
Drei Zivilpersonen aus Soyen, die Handlangerdienste für die Staffel leisteten, wurden für die Bergung der Überreste von Peppers Leiche verpflichtet, darunter Sepp Hofreiter, Gustl Heinlein, Schwager von Elisabeth Mittermeier, und Alois Dachsberger. Sepp und Gustl betrieben kleine Landwirtschaftsbetriebe in Hundsham und Rieden. Dachsberger gehörte der Soyensee, an dessen Ostufer er die äußerst beliebte Seegaststätte »Zur Forelle« führte. Allesamt waren sie fleißige Männer, die während des Krieges ihre Höfe und die Gaststätte weitestgehend allein hatten führen müssen und daher vom Kriegsdienst befreit gewesen waren. Die Bergung der verkohlten Leiche war für Sepp, Gustl und Alois der reinste Horror.
Frasers Münzsicherstellung gelang nicht vollständig. Sepp Hofreiter fand während der Säuberung der Piste, die sich bis zur Dämmerung hinzog, auf und zwischen den Eichenplanken mehr als ein Dutzend Münzen. Es waren alte italienische Goldmünzen. Ohne dass es jemand bemerkte, gelang es ihm, sie in seinen Stiefelschäften verschwinden zu lassen. Die, die im Acker steckten und nicht sofort eingesammelt werden konnten, drückte er mit der Sohle in die Erde. Die Abdrücke sollten gleichzeitig als Markierung dienen, um die Münzen am nächsten Morgen ausgraben zu können.
»Der gerechte Ausgleich für die ganze Scheißarbeit bei den Amis«, murmelte er zufrieden vor sich hin, als er die Stätte des Grauens verließ. Sepp war schlau. Er hatte den Anflug der beiden Thunderbolts beobachtet und durchblickte die Sache mit Frasers erstem gelungenem Abwurf über dem See. Noch in der gleichen Nacht vertraute er sein Geheimnis seiner jungen Frau Franziska an. Eine »goldene« Zukunft, wie es schien, wartete auf die junge Familie. Ihrem einzigen Sohn Franz, im April hatten sie seinen ersten Geburtstag gefeiert, würde es an nichts mangeln. Sepp selbst grübelte über den Schatz und malte sich eine sorgenfreie Zukunft aus. Zwischen Freude und Bangen bekam er kein Auge zu. Am nächsten Morgen wollte er den Rest der Münzen aus dem Acker wühlen. Die Gier hatte ihn gepackt, der Tod würde ihn dann etwas später ereilen.
Am östlichen Horizont lag schon der blasse rote Streifen der aufgehenden Sonne, als Fraser in aller Frühe einen Kontrollgang entlang der Piste machte, wobei er dank der zahlreichen Schuhabdrücke weitere Münzen im Acker entdeckte. Er konnte eins und eins zusammenzählen, zumal ihm die glatten Sohlenabdrücke verrieten, dass sich jemand von den Zivilisten bereichert haben musste. Also legte er sich mit einem Karabiner auf die Lauer. Als Sepp Hofreiter im Morgendunst seine Schuhabdrücke suchte und verräterisch in der Erde wühlte, hatte er sein Leben verwirkt. Fraser zielte und schoss. Für sein Tun durfte es keinen einzigen Zeugen geben, schon gar keinen »Nazi«.
Sepp Hofreiters Leiche wurde in ein leeres Benzinfass gesteckt, mit Sprit übergossen und verbrannt. Der fette Qualm aus dem Fass war nichts Ungewöhnliches, da man mit Ölfeuern oftmals die Start- und Landebahn markiert hatte und Piloten wie Bodenpersonal auf diese Weise schon häufig ein wärmendes Feuer entfacht hatten. Fraser verlor seinen Kameraden gegenüber kein Wort, welches Motiv ihn zu dem Mord getrieben hatte.
»Befehl vom CIC!« Damit waren alle offenen Fragen geklärt. Die Staffel hielt eisern zusammen. Im Krieg galt ein Menschenleben nicht viel. Ein »Nazi« mehr oder weniger? Darauf kam es in diesen Tagen nicht an. Sepp war ihnen nicht einmal ein Wort des Beileids wert.
Ein Unglücksfall beim Reinigungsversuch eines halbvollen Benzinfasses, hieß es. Pech gehabt. Gott sei seiner Seele gnädig. Amen! Seine sterblichen Überreste wurden der jungen Witwe in einem Eimer übergeben.
4
Soyen, Sonntag, 8. Juli 1945
In jenem Jahr mangelte es an allem. Not und Chancen aber haben sich schon immer vertragen. Elisabeth Mittermeier hatte das Startkapital von ihrem »Ritter« bekommen, nutzte damit konsequent ihre Möglichkeiten und startete gleich in den ersten zwei Monaten nach der Kapitulation eine steile Schwarzmarktkarriere rund um Wasserburg. Das war auch nötig. In Rieden, auf dem kleinen Bauernhof ihrer Schwester und des Schwagers, gab es in jener Zeit Kühe, Hühner, Mist, Odel, aber kaum Geld und schon gar keine Freizeit. Stattdessen packte jeder mit an. Eine zähe Sache ohne echte Perspektive! Das war aber nichts für Lisa, jedenfalls nicht auf Dauer.
Fachbegriffe wie »Profitmaximierung« oder gar »Synergismen« wurden zwar erst in ferner Zukunft eingeführt, doch lagen diese Prinzipien schon damals der erfolgreichen Beziehung zwischen Uhren, Schmuck, Butter, Eiern, Fleisch und Ami-Zigaretten samt Dollarscheinen zugrunde, und Elisabeth bewies außerordentliches Talent in diesem nicht sehr legalen »Markt«.
Langbeinig, dabei athletisch wie eine Turnerin, unternehmungslustig und selbstbewusst knüpfte sie ihre Kontakte bis in die lukrative »American-Sea-Alm«, die unweit der Landepiste und des Soyener Dorfkerns von den Amerikanern zur lockeren Freizeitgestaltung errichtet worden war, ein robustes Blockhaus mit Grill und Bar, in der nicht nur die Piloten abhängen konnten – natürlich, wenn’s ging, mit knackigen »German-Country-Frolleins«. Und es ging immer was! Elisabeth bekam problemlos Zutritt zur »Alm«, da sie gut Englisch sprach und in ihrem Sommerkleid, das sie sich aus Fallschirmseide hatte nähen lassen, enorm anziehend auf die GIs wirkte. Sie spielte das Beisammensein bis zu einem bestimmten Punkt mit, ohne auch nur einen Moment ihr Ziel, Profit zu machen, darüber zu vergessen. Amerikaner und Engländer kauften am liebsten Uhren und Schmuck, das war eine bekannte Tatsache, und der Schmuckkoffer ihres Kindsvaters brachte ihr so reichlich Dollars ein.
Über die »Schwarze Börse«, wie die Alm von der Bevölkerung auch genannt wurde, liefen ihre Tauschgeschäfte immer prächtiger, flossen die Gewinne üppiger. Schwester und Schwager waren höchst dankbar für die finanzielle Unterstützung und die verbesserte Verpflegungssituation. Das Gleiche galt für ihren Vater Georg und ihre Mutter Rosalie in Teufelsbruck. Ihr Vater profitierte allerdings nicht mehr viel vom Ende des Mangels, denn der Herztod ereilte ihn bei der Gartenarbeit. Von seinem Enkelsohn hatte er, trotz der geringen Distanz, nie etwas erfahren. Die kränkelnde Mutter wurde immer vergesslicher. Als Tochter Elisabeth eines Tages die Existenz ihres »Lebensbornkindes« gestand, schien es, als hätte sie es am nächsten Tage schon wieder vergessen.
In diesen Monaten kümmerte sich ihre Schwester Jutta rührend um den kleinen »Nazibengel« Hubert, den sie bald nur noch »Hubi« nannten. Der SS-Taufname Ortwin war gelöscht worden, genauso wie der adelige Name seines leiblichen Vaters. Unterdessen mauserte sich Lisas Schwager zum perfekten Papa.
Elisabeths Schlüsselerlebnis auf der »Alm« ließ nicht lange auf sich warten. An einem Sonntagabend im Juli lernte sie in der »American-Sea-Alm« Colonel Jack Fraser kennen. Sein Auftreten wirkte betont jugendlich, Zigarette im Mundwinkel, Baseballmütze flott ins Genick geschoben, Hawaiihemd locker über der Hose, deren Beine in zwei goldbrokatverzierten Cowboystiefeln steckten.
Ein Typ wie Nitroglyzerin, ging es Lisa durch den Kopf, als er an ihr vorbeiging. Jack schenkte ihr ein Lächeln. Was ihr aber sofort auffiel, waren seine feinen Gesichtszüge. Nur sein Geruchscocktail aus Zigarettendunst und Rasierwasser störte sie. Jack orderte zwei Bourbon, kehrte zurück, drückte eines der Gläser Lisa unaufgefordert in ihre Hand, stellte sich kurz vor und richtete sofort die üblichen männlichen Orientierungsfragen an sie. So erfuhr sie schnell, dass Colonel Fraser der »Platzhirsch« außerhalb und in der Alm war, dazu ein Offizier, der gewünschte Waren liefern konnte. Daher beantwortete sie seine Fragen ausweichend vorsichtig charmant.
Was sie aus seinem Gesicht ablas, waren Eigenschaften wie Listigkeit, räuberische Intelligenz und ein egozentrisches Überlegenheitsgefühl, alles Eigenheiten, die mehr Distanz als Nähe signalisierten, wäre da nicht sein versonnenes, sympathisches Lächeln gewesen, das sich hie und da über sein ganzes Gesicht ausbreitete. Dabei war ein gewisses Funkeln in seinen Augen nicht zu übersehen, besonders dann, wenn sich seine Blicke ab und an auf ihre pralle Oberweite senkten.
Lisa nippte an ihrem Whiskey, zog eine angebotene Lucky Strike aus der gereichten Packung und fragte den Colonel: »Wie fühlen Sie sich, wenn Sie so über das schöne Oberbayern donnern?«
Ohne zu zögern kam die Antwort. »Meist angespannt, denn über meinen Flügen schwebt das Damoklesschwert meiner Abhängigkeit von der Laune der Wettergötter und meiner Feinde.«
»Gibt es Letztere überhaupt noch?«
»Und ob! Japaner! Zuhauf!«
»Weit, weit weg von Soyen, soviel ich weiß.«
»Sehr, sehr nah, wenn ich meine mögliche Abkommandierung in Betracht ziehe.«
»Nicht wirklich, oder?«
»Der Krieg im Fernen Osten tobt weiter. Jeder Tag kann hier mein letzter sein.«
Letzter Tag hier? Für Lisa das ideale Stichwort. »Dann sollten Sie das Leben hier bei uns genießen, solange es die Armee zulässt.«
Fraser zeigte wieder sein versonnenes Lächeln. »Gute Idee, meine liebe Liz. Ich glaube, Sie könnten jede Menge dazu beitragen. Zeigen Sie mir doch einfach ein paar unvergessliche Schönheiten Ihrer Heimat.«
Das prickelnde Duell zwischen Mann und Frau, Geist und Hormonen, Anziehung und Vorsicht, Plan und Zufall, endete in einer Verabredung zu einem gemeinsamen Ausflug mit dem Jeep.
5
Rieden, Samstag, 9. März 1946
Das völlig Unbekannte, Geheimnisvolle konzentrierte sich ab jenem Samstag für Liz, wie Jack sie nur noch nannte, nicht im Fernen Osten, sondern Tausende Kilometer westlich von Europa, Richtung USA, eine Verheißung, wie sie meist nur in Träumen vorkam. Elisabeth packte endgültig ihre Sachen.
In den vergangenen acht Monaten hatten Jack und sie nicht nur äußerst erfolgreich Schwarzhandel betrieben, Dollars verdient und Werte angehäuft, sondern sich auch unsterblich ineinander verliebt. Ihre leidenschaftlichen Monate in Soyen vergingen wie im Flug.
Der 2. Weltkrieg war definitiv beendet, Japan kein Thema mehr. Stattdessen wurde Jack Frasers Staffel in die Staaten zurückbeordert. Er eröffnete Liz, dass er sie um jeden Preis über den Atlantik nach Kalifornien mitnehmen wolle. Ihre Hochzeit planten sie in Palmdale, nahe der Edwards Air Force Base im Antelope Valley nahe Lancaster in Kalifornien, rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles, wo Jack demnächst eine neue und anspruchsvolle Aufgabe als Testpilot übernehmen sollte.
Trotz der strahlenden Zukunft gab es dennoch einige rabenschwarze Punkte in beider Leben, die, jeder für sich allein, dem Partner gegenüber konsequent verheimlichte. Während Liz nur eine »Leiche im Keller« hatte, waren es bei Jack gleich drei, und das durchaus im wörtlichen Sinn. Sie verschwieg ihm lediglich ihr »Lebensbornkind« Hubert, um ihre glänzende Zukunft und ihre Liebe nicht zu gefährden, Jack aber die vorsätzliche Tötung von Sepp Hofreiter und einen weiteren Mord an CIC-Agent James Devan, den er während einer ausgelassenen Motorbootfahrt auf dem Soyensee begangen hatte, dazu die »Gold-Zecke« auf dem Grund des Sees.
Elisabeth ließ ihren Sohn bei Schwester und Schwager zurück mit dem Versprechen, ihn so bald wie möglich in die Staaten nachzuholen. Sie tat es jedoch nie, sondern schickte stattdessen Dollars. Eine unbelastete Ehe mit Jack war ihr von Beginn an wichtiger. Und da Schwester Juttas Ehe mit Gustl kinderlos blieb, hatten sie Hubert, im Einvernehmen mit Elisabeths Dollarsegen, noch in den Wirren der Nachkriegszeit als eigenen Sohn ausgegeben und ihn als solchen registrieren und taufen lassen.
Jack konnte im August des Jahres 1945 zwar das brisante Geheimnis im See noch einmal schützen, aber um den Preis eines weiteren Menschenlebens. Er transportierte auf James Devans Befehl einen Großteil der eingesammelten Goldmünzen aus dem Tank von Peppers Maschine nach Salzburg und übergab sie ihm. Erst während eines Barbesuches klärte James seinen Freund darüber auf, dass seine Vorgesetzten, die die Sache eingefädelt hatten, in den letzten Kriegsmonaten nach Okinawa abkommandiert worden waren. Er wüsste nicht, ob sie jemals zurückkehren würden. Die perfekte Konstellation also, um sich die Beute im See zu teilen, meinte er. Den anderen Teil der Story, woher der Goldsegen stammte, ließ er unerwähnt.
Jack ging zunächst darauf ein. Was blieb ihm auch anderes übrig? Devans Plan, die Münzen aus dem Soyensee zu bergen, bestand im Wesentlichen aus vier Punkten: kein gemeinsames Auftreten mit Fraser vor Ort, Lokalisierung des Tanks durch Jacks Berechnungen, Markierung der Stelle durch eine Unterwasserboje, Bergung mit Tauchgerät und Winde in den frühen Morgenstunden. Devon besorgte zur Ausführung ein robustes, schnelles Wehrmachtsboot vom Chiemsee, mit dem die GIs zum Vergnügen in den sommerlichen Abendstunden erstmals Runden auf dem Soyensee drehen durften. Er selbst gab sich nicht zu erkennen und mied, wie vereinbart, die Nähe zu Fraser. Natürlich war die Motorboot-Gaudi auf dem See reine Taktik, die der Ablenkung diente und keine Fragen provozierte.
Als Devan nebenher seinem »Tauchsport« nachging, um an der Abwurfstelle unter Wasser besagte Markierungsboje zu platzieren, drehten Jack und einige andere Piloten unterdessen mit dem Boot unverfängliche, vergnügte Runden auf dem See. Whiskeyflaschen kreisten, im Boot stieg die Stimmung. Jack übernahm irgendwann das Steuer. Niemand außer ihm bemerkte, dass Devan wieder aufgetaucht war. Der See glitzerte in der untergehenden Sonne. Jack hielt mit Vollgas auf einen dunklen Punkt im See zu, James’ Kopf …
Ein folgenreicher Unfall! Niemand konnte offensichtlich etwas dafür. Wer konnte schon ahnen, dass mitten im See plötzlich ein Mensch auftauchen würde, gerade dann, wenn ein Boot mit Speed daherkommt? Verdammt! So ein Blödmann, so ein Pech auch! James Devans Kopf wurde von Bug und Schraube völlig zertrümmert.
Die Leiche mit dem destruierten Schädel wurde von den Männern geborgen und der US Militär-Polizei übergeben. Offenbar handelte es sich um einen GI. Jack fühlte sich wie befreit. Niemand aber konnte die Frage beantworten, wer der entseelte, gesichtslose Leichnam war.
Immerhin sang der Kirchenchor von Soyen dem unbekannten Toten am Sonntag ein Requiem.
6
Rimsting, Dienstag, 30. September 2014
Michaela Dunst, verliebt in Maximilian, erwartet eine Erklärung und am liebsten eine Kehrtwendung um 180 Grad. Kein einziges Wort hat Max vor seiner Verabschiedung aus dem aktiven Dienst als OFA-Leiter bei der Mordkommission München über seine wahren Zukunftspläne verloren. Sie hat voll darauf gesetzt, dass die Zeiten der Trennungen und der unregelmäßigen Tagesabläufe ein Ende haben würden. Sie hat erwartet, von nun an einen Partner zu haben, der nicht nur Liebhaber, Vertrauter, Ratgeber, Gesprächspartner und Lebensinhalt ist, sondern einen, mit dem sie viel Zeit verbringen, gemeinsame Lebensziele verfolgen und idealerweise auch die gleichen Projekte teilen kann. Nun ist sie enttäuscht über seine Wachsleichen-Ambition, die er auch noch öffentlich gemacht hat. Ihre Sehnsucht, die verschiedenen Ebenen und Facetten des zwischenmenschlichen Miteinanders gemeinsam zu realisieren, um damit die Beziehung zu intensivieren, droht nun zu scheitern. Den ganzen Nachmittag über fühlt sie sich verwundet. Das harmonische Wunschkonzert mit Max ist damit wohl vorerst abgeblasen.
Noch am gleichen Abend, nach ihrer Rückkehr aus München, geht sie ihn an. »Mord scheint nun auch nach deiner Pensionierung das Lebenselixier zu werden.«
Max ist völlig überrascht. »Nein, ganz sicher nicht.«
»Du musst doch bis in die Poren gesättigt sein mit Mordfällen. Warum quälst du dich obendrein noch mit einer alten Wasserleiche herum?«
Max versucht, darauf locker zu reagieren. »Ganz einfach, es ist schlicht das beste intellektuelle Spätprogramm für mich.«
Michaela reagiert aufgebracht. »Wie bitte?«
»Sorry, ich will nicht den postmodernen Schwafelphilosophen mimen, aber der Fall ist und bleibt eine Herausforderung für mich. Kannst du das nicht verstehen?«
»Verstehen? Ich möchte, dass du versuchst, mich zu verstehen.«
Max überlegt und zeigt sich einsichtig. »Ich weiß, du ärgerst dich über das, was ich bei meiner Verabschiedung verkündet habe.«
»Soll das eine Entschuldigung sein, oder willst du dein Gewissen erleichtern?«
»Ich will nur, dass du meine Gründe verstehst.«
Michaela legt an Stimmstärke zu. »Deine Gründe sind mir egal! Völlig egal! Es gibt keinen einzigen Grund dafür, deine Ambitionen nicht vorher mit mir zu besprechen, und schon gar keinen einzigen dafür, mich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Es ist unsere Zeit, unser Zusammenleben, das du damit infrage stellst.«
Tränen treten in ihre Augen.
»Du bist Journalistin, viel unterwegs, und auch meine Lebensgefährtin. Wo ist da der Unterschied?«
»Das ist nicht die wahre Reihenfolge. Ich bin zuerst deine Lebensgefährtin, und danach kommt mein Beruf! Bei dir ist es offenbar umgekehrt.«
Max wird plötzlich klar, dass dies kein lauer Konflikt ist, der mit einem wohlmeinenden Gespräch zu befrieden ist. Mit verschrobenen Rechtfertigungen würde er bei Micha außerdem nichts bewirken. Er versucht eine versöhnliche Geste, will sie umarmen. Aber Micha entzieht sich ihm.
Max nimmt nach gut einer Minute des Schweigens einen neuen Anlauf. Dabei legt er seinen Arm behutsam um Michaelas Schulter. »Wir sollten die große Chance unserer Liebe nicht wegwerfen«, flüstert er nah an ihrem Ohr. »Was soll ich deiner Meinung nach ändern?«
Sie dreht sich um und schlingt ihre Arme um seinen Hals. »Es ist nicht viel. Schließe deinen letzten Fall von mir aus ab, aber beginne bitte keinen neuen. Ansonsten freue ich mich auf jedes freie Wochenende mit dir. Ich gehe mit dir in die Berge wandern, und du gehst mit mir an die See. Ich möchte gerne mal wieder auf Sylt sein und dir die Schönheiten der Insel zeigen. Nebenher entspannen wir und machen eine Schlemmertour von List über Kampen bis Hörnum. Einverstanden?«
Max fällt ein Stein vom Herzen. »Einverstanden, meine Maus!«
7
Rimsting, Sonntag, 5. Oktober 2014
Fangeisen wählt nach dem Frühstück auf seinem Smartphone die Nummer seines Kumpels Johann Förstl.
»Max hier. Du wolltest mir brisante Fotos zeigen, die im Jahr 68 von Campern am Ostufer des Soyensees gemacht wurden. Wann?«
»Wann immer du Zeit hast.«
»Dann komm auf einen Kaffee vorbei.«
»Gern.«
»Morgen, 16.00 Uhr?«
»Passt.«
»Super. Bis dann.«
Max schaltet sein Telefon aus, zieht die rostrote Akte aus dem Ablagefach und wirft einen Blick darauf, während er auf seinen Schreibtisch zusteuert. »Cold Case«, murmelt er in einem Ton vor sich hin, den manch einer als Ausdruck von Resignation missverstanden hätte. Weit gefehlt, denn nach so langer Zeit will sich Maximilian ein neues, besseres und vertieftes Fallverständnis zu seinem ersten Mordfall im Jahre 1970 erarbeiten. »Wenn es mir gelingt, neue Fakten auszugraben, um sie mit den vorhandenen zu vereinen – dann würde das Puzzle ein Ganzes ergeben«, murmelt er.
Auch wenn Max die Akte nach einer gefühlten Ewigkeit wieder einmal durchgeht, er kennt die Vorgeschichte von A bis Z, obwohl er 1968 in den Fall noch nicht involviert war. Die Sachverhalte zur damaligen Vermisstenanzeige kann er abspulen:
• Seit Mitte Juni 1968 wird ein männlicher Camper am Soyensee vermisst. Sein mutmaßlicher Name lautet Bill Traser.
• Der Vermisste verbrachte offenbar mit einem angemieteten Campingbus aus Rosenheim einen Urlaub am See.
• Alois Dachsberger, Wirt des Gasthauses »Zur Forelle«, Bedienungen, Bäcker und andere Camper (alle namentlich erfasst) erinnern sich gut an den jungen Gast mit dem englischen Akzent.
• Der Campingbus wirkt nach zwei Tagen plötzlich verlassen. Anderen Campern kommt das seltsam vor, da »Billy«, wie der Vermisste von den Zeugen genannt wird, immer nach einem geregelten Tagesablauf lebte.
• Am dritten Tag verständigt der Campingplatzbetreiber Alois Dachsberger die Polizei, die den Campingbus öffnen lässt.