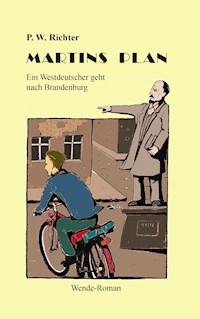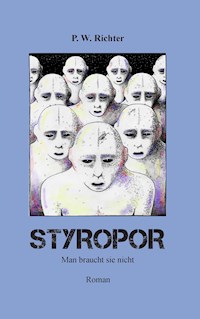
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2072 ist es möglich, das menschliche Leben zu verlängern, im Optimalfall bis zur Unendlichkeit. Doch das können sich nur die Superreichen leisten - die gewöhnlichen Sterblichen werden zunehmend in die Slums abgedrängt, wo sie in ärmlichen Verhältnissen dahinsiechen. Die wohlhabenden „Patrizialen“ grenzen sich von ihnen ab; sie halten die „Prekarier“ für überflüssig und wollen sie abschaffen. Dennoch kommen sich Alexander Lery, Sohn eines der mächtigsten Männer in Deutschland, und Franka Yu Klewe, Studentin an der FU Berlin mit vietnamesischen und deutschen Wurzeln, näher. Trotz ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen Herkunft wird ihnen ihre wesenhafte Verbundenheit bewusst, und sie entwickeln eine tiefe Liebe zueinander. Aber die soziale Kluft zwischen ihnen scheint unüberwindlich und stürzt beide in eine große Krise...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Jahr 2072 ist es möglich, das menschliche Leben zu verlängern, im Optimalfall bis zur Unendlichkeit. Doch das können sich nur die Superreichen leisten – die gewöhnlichen Sterblichen werden zunehmend in die Slums abgedrängt, wo sie in ärmlichen Verhältnissen dahinsiechen. Die wohlhabenden „Patrizialen“ grenzen sich von ihnen ab; sie halten die „Prekarier“ für überflüssig und wollen sie abschaffen.
In diesem Umfeld von Hass und Verachtung kommen sich Alexander Lery, Sohn eines der mächtigsten Männer in Deutschland, und Franka Yu Klewe, Studentin an der FU Berlin mit vietnamesischen und deutschen Wurzeln, näher. Trotz ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen Herkunft wird ihnen ihre wesenhafte Verbundenheit bewusst, und sie entwickeln eine tiefe Liebe zueinander. Doch die Kluft zwischen ihnen scheint unüberwindlich und stürzt beide in eine große Krise.
PETER WERNER RICHTER, geboren 1946 in Schleswig-Holstein, aufgewachsen in Südbaden, siedelte kurz nach der Vereinigung Deutschlands von Karlsruhe nach Eberswalde bei Berlin über, um dort als Stadtplaner zu arbeiten. Die hier erworbenen Erfahrungen, vor allem des Wechselspiels von planerischer Vernunft und demokratischer Interessenaushandlung, führten zwangsläufig zu einer ironischen Sicht auf die Gesellschaft, wie sie sich in Ansätzen schon in seiner mehrjährigen Tätigkeit als politischer Karikaturist für eine Karlsruher Tageszeitung gezeigt hatte. Sein Augenmerk gilt allerdings nicht der Vergangenheit, sondern der näheren Zukunft, die es zu bewältigen gelte. Stetige Erinnerung an die dunklen Phasen der Vergangenheit berge die Gefahr, dass die Zukunft aus dem Blick gerate. Heute, wohnhaft in einem kleinen brandenburgischen Dorf, widmet er sich in diesem Sinne ganz dem Schreiben.
Gerade wenn man soweit ist,
anfangen zu können,
muß man sterben.
Immanuel Kant, Philosoph (1724–1804)
Personenliste S. 255
Erklärung futuristischer Bezeichnungen S. 257
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL I
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
TEIL II
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Kapitel 19.
Kapitel 20.
Kapitel 21.
Kapitel 22.
Kapitel 23.
Kapitel 24.
Kapitel 25.
Kapitel 26.
Kapitel 27.
Kapitel 28.
Kapitel 29.
Kapitel 30.
TEIL III
Kapitel 31.
Kapitel 32.
Kapitel 33.
Kapitel 34.
Kapitel 35.
Kapitel 36.
Kapitel 37.
Kapitel 38.
Kapitel 39.
Kapitel 40.
Kapitel 41.
Kapitel 42.
Kapitel 43.
Kapitel 44.
TEIL IV
Kapitel 45.
Kapitel 46.
Kapitel 47.
Kapitel 48.
Kapitel 49.
Kapitel 50.
Kapitel 51.
Kapitel 52.
Kapitel 53.
Kapitel 54.
Kapitel 55.
Kapitel 56.
Kapitel 57.
TEIL V
Kapitel 58.
Kapitel 59.
Kapitel 60.
Kapitel 61.
Kapitel 62.
Kapitel 63.
Kapitel 64.
Kapitel 65.
NACHWORT
Personenliste
Erklärung futuristischer Bezeichnungen
TEIL I
1.
Der Verkehr im Berlin des Jahres 2072 spielte sich hauptsächlich auf vier Etagen ab: Ganz unten, im Keller der Stadt, lagen das Netz der altbekannten U-Bahn und die beiden Schnellbahnstrecken des neuen Skink-Systems. Die Ebene darüber bot ebenfalls wenig Neues: Autos, Fußgänger, Schienenverkehr, ein Bild wie vor hundertfünfzig Jahren. Dass die meisten Wagen jetzt vollautomatisch fuhren, war von außen nicht zu sehen.
Die Ebenen drei und vier gehörten dem Luftverkehr. Oberhalb der Lichtund Signalmasten verlief auf unsichtbaren, aber fest definierten Trassen der LIBO, der „Luftverkehr in Bodennähe“, wie die amtliche Bezeichnung für diejenigen Fahrzeuge lautete, die mit Hilfe aller möglichen Techniken das Schweben gelernt hatten. Das LIBO-Netz war das bequemste, da es engmaschig und gleichzeitig kreuzungsfrei die ganze Stadt durchzog. Es wurde hauptsächlich von reichen Privatpersonen oder großen Firmen genutzt, die sich die teuren Lizenzen leisten konnten.
In der vierten Ebene tummelten sich Drohnen in allen Formen, Größen und Geschwindigkeiten. Ihre Zahl war in der Vergangenheit so stark angewachsen, dass es an manchen Tagen unmöglich war, den Himmel drohnenfrei zu sehen. Das Schlagwort von der achten Plage der Menschheit fiel – ein Heuschreckenschwarm sei über die Stadt hereingebrochen.
Alexander Lery war mit seinem Baofeng auf der dritten Ebene unterwegs. Er war bester Laune; sein Arbeitstag war zwar anstrengend, aber dafür auch ziemlich erfolgreich gewesen. Er hatte die Verhandlungen mit den Koreanern zu einem positiven Abschluss gebracht, die Lieferung von zweihundertfünfzig Spornets II, ein Riesenauftrag für seine Firma. Glücklicherweise war der sonst übliche Abschlussumtrunk mit der koreanischen Delegation ausgefallen, weil die Koreaner an diesem Tag noch einen anderen Termin hatten. Alexander bedauerte es nicht; er konnte diese obligatorischen Massenbesäufnisse sowieso nicht ausstehen.
Die plötzliche Freizeit schien der beste Anlass, am privaten Wannseeufer die Abendsonne zu genießen, vielleicht auch mit seinen beiden Neffen, falls sie da sein würden, ein wenig herumzubolzen und ansonsten fünfe gerade sein zu lassen. Er mochte die beiden Söhne seines Halbbruders Hans-Tian, den zwölfjährigen Klaus und den zwei Jahre jüngeren Peter; sie waren aufgeschlossen, freundlich und lebhaft – Eigenschaften, die man in diesen Zeiten bei anderen Kindern mit der Lupe suchen konnte.
Fast lautlos schwebte sein Baofeng in Dachtraufenhöhe die Kaiser- Friedrich-Straße entlang. Knapp unter ihm glitten die Baumkronen dahin, links und rechts die oberen Stockwerke der Häuser, deren Fenster stets neugierige Blicke anzogen, was allerdings erst bei Dunkelheit, wenn die Räume erleuchtet waren, zu unstatthaften Einblicken führte. Die Schwebzeuge vor ihm flogen mit exakt derselben Geschwindigkeit auf genau derselben Bahn wie er; hinter ihm lief es ebenso. Wie auf einer Perlenkette aufgereiht bewegten sich die Baofengs, Burane und Erzeugnisse anderer Marken; beim Gegenverkehr auf der gegenüberliegenden Seite bot sich das gleiche Bild. Während sich ganz unten die Autos an der Kreuzung Kaiserdamm stauten, tauchte seine LIBO-Trasse einfach unter dem Querverkehr hindurch.
Es lag in der Natur der Sache, dass einzelne Drohnen sich nicht auf Ebene vier beschränkten, sondern im ganzen Luftraum unterwegs waren. Das waren vor allem Spähdrohnen in amtlichem Auftrag – oder zumindest staatlich autorisiert – und Kleingütertransporter, die Waren auslieferten oder abholten. Diese Fluggeräte stellten für die Nutzer des LIBO-Netzes ein ständiges Ärgernis dar, weil sie die Schwebzeuge immer wieder zu plötzlichen Ausweichmanövern zwangen, wobei die Insassen heftig durchgeschüttelt wurden.
Auch jetzt tauchte wieder so ein Ding auf, direkt vor Alexanders Augen. Sein Baofeng stuckerte, fing sich aber gleich wieder. Alexander erkannte die Maschine sofort: eine Starfly 5.2. Natürlich kannte er sie: Schließlich wurde sie bei Müller-IT produziert, der Firma, in der er selbst Abteilungsleiter für Marketing war. Es war fast wie sein eigenes Baby, dieses Produkt, er hatte es richtig ins Herz geschlossen.
Kein Wunder: Das taubengroßen Fluggerät mit den vier beweglichen Flügeln verkaufte sich wie verrückt; man musste schon fast nicht mehr argumentieren. Aus allen Staaten des EURA-Gebietes lagen Anfragen vor. Auch die Koreaner hatten es in die engere Wahl genommen, sich dann aber doch für die etwas größere Spornet entschieden, wohl wegen der höheren Zuladungsmöglichkeit. Die letzte Starfly-Charge war an die Berliner Polizei herausgegangen, etwa einhundert Maschinen, die zum Teil mit kleinen Laserkanonen zur Personenabwehr, zum Teil auch mit EMP-Shootern ausgerüstet waren. Und anderen Applikationen, deren Funktionsweise selbst er nicht ganz durchschaute. Obwohl er ja von Haus aus selbst Ingenieur war und nicht etwa einer von diesen obskuren Finanzleuten.
Während er dies dachte, beschrieb die Starfly einen eleganten Bogen um seinen Baofeng herum und heftete sich kurz vor dem folgenden Schwebzeug an seinen Kurs.
Die Abendgestaltung kam ihm erneut in den Sinn. Sollte er es vielleicht anders machen und wieder einmal bei Constanze vorbeischauen? Seiner schönen Cousine und ehemaligen Frau, die sich vor zwei Jahren Hals über Kopf von ihm getrennt hatte? Wegen dieses… Er verdrängte den Gedanken an diese obskure Person, es war ja eh vorbei. Jedenfalls hatte er in letzter Zeit den Eindruck gewonnen, dass sich zwischen ihnen wieder etwas entwickelte. Ganz zart und unterschwellig und ganz und gar nicht spruchreif. Natürlich konnte er sich täuschen, aber sie hatten sich ja nie aus den Augen verloren.
Kunststück, wenn man nur zweihundert Meter voneinander entfernt wohnt und sich überdies mehrmals die Woche beim gemeinsamen familiären Abendessen sieht.
Eigenartig, die Starfly flog immer noch hinter ihm. Sie war sogar näher gekommen, er sah es genau im RETRO-Monitor. Er zoomte das Bild heran: Die Maschine trug am Bauch, wo normalerweise die Bewaffnung montiert war, ein seltsames Päckchen, etwas größer als ein Kugelschreiber, aber sicher kein Laser.
Das Ding blitzte kurz auf, dann zerstob das Bild auf seinem Monitor zu einem grauen Grieseln. Auch die Digitalanzeigen produzierten merkwürdige Hieroglyphen, bevor sie ganz erloschen. Eine heftige Schlingerbewegung befiel das Schwebzeug, es kippte vornüber und überschlug sich in der Luft. Alexander, der gar nichts mehr verstand, krallte sich am Haltegriff fest und sah noch, wie der Straßenboden sich rasend schnell näherte.
2.
„Ich bin eine Kämpferin!“
Immer wieder sprach sie es vor sich hin. Auf Vietnamesisch, ihrer Muttersprache. Oder besser gesagt: Sie murmelte es.
Als müsse sie sich selbst überzeugen. Als könne sie es nicht wirklich glauben.
Aber in ihrem Kopf schrie sie es.
Schlaflos wälzte sie sich in ihrem Bett und starrte die Decke an, die unregelmäßig von einer fernen Lichtreklame erhellt wurde. Es waren die Worte ihrer Mutter gewesen. Sie sollten dem weinenden Töchterchen den Trost ersetzen, zu dem die Mutter, selbst zu sehr erschüttert, nicht fähig war. Und eigentlich hatte sie wohl eher sich selbst gemeint.
Es waren die Tage, an denen klar wurde, dass Papa verschwunden war. Verreist – ohne ein Datum seiner Wiederkehr. Frankas Mutter hatte versucht, das Auseinanderbrechen der Familie vor ihren beiden Kindern zu verbergen, doch ihre Tochter, damals vier Jahre alt, ahnte etwas. Die Eltern hatten sich in letzter Zeit viel gestritten, zu oft hatte ihr Vater gebrüllt, dass er aus Berlin weggehen werde, wenn sich nicht grundlegend etwas ändere. Was sich ändern solle, hatte sie nie erfahren. Die Mutter hatte sie und ihren kleinen Bruder in die Arme genommen und ausgesprochen, was sie selbst dachte: Durchhalten! Es gibt Schlimmeres!
Franka – du bist eine Kämpferin.
Sie hatte ihn heiß geliebt, ihren Bó, ihren Papa! Er war groß und blond und sogar blauäugig. Ein helles Licht, ein großer Knuddelriese zwischen den zierlicheren und dunkelhäutigeren Menschen der übrigen Famile! Auch ihre Mutter war jedes Mal ganz verzückt, wenn er kam, und sie glaubte, ihre Familie sehe das ebenso.
Ja, ihre Tochter Franka sah es ebenso, aber sie brannte vor Eifersucht, wenn ihre Mutter ihren Papa umarmte oder gar küsste. Es war ihr Bó, die Mutter liebte ihn völlig falsch. Da war Franka sicher. Die Mutter störte nur.
Seine Stimme klang ihr immer noch im Ohr. „Es wird, es wird“, war sein Spruch, wenn er wieder kleine Fortschritte in ihrer Entwicklung entdeckt hatte.
Und dann war er weg. Verreist. Oder, wie sie später erfuhr, vertrieben vom Clan, dessen Geschäften er immer im Wege gestanden hatte. Vielleicht auch Schlimmeres, keiner sprach darüber.
Seltsam, dass die Worte der Mutter sie so beeindruckt hatten, obwohl sie doch damals so große Vorbehalte gegen die Sprecherin gehabt hatte.
Vom Vater hatte Franka die schlanke Statur geerbt, von der Mutter das asiatische Gesicht. Mehr oder weniger. Und das Haar. Das herrliche, blauschwarze, dichte Haar. Sie war, wie viele Mischlinge, eine schöne junge Frau, wenn auch auf eine aparte, wenig spektakuläre Art. Mehr etwas für denjenigen, der genau hinzusehen bereit war.
Inzwischen war ihre Ruhelosigkeit so weit angewachsen, dass sie in Nervosität überging. Jetzt konnte sie ewig auf Schlaf warten. Aber wenigstens gelang es ihr, nicht mehr die Szenen ihrer Kindheit heraufzubeschwören. Sie dachte an Dinge, die noch kaum vergangen waren.
An die letzte Sitzung von Biofeme.
Biofeme, die revolutionäre Zelle, wie sich die Mitglieder selbst verstanden. Oder die terroristische Vereinigung, wie sie von den Patrizialen genannt wurde. Vielleicht auch die überkandidelte Quasselbude, für die sie von anderen linksextremen Studentengruppen gehalten wurde. Ja, geredet wurde ausgiebig. Das letzte Mal über Gewalt.
Gewalt war eigentlich nicht Frankas Thema, auch wenn sie sich für eine Kämpferin hielt. Physische Auseinandersetzungen verabscheute sie, wie sie überhaupt körperliche Nähe unangenehm fand und nach Möglichkeit mied. Kämpfen war für sie eher eine Sache von Disziplin und Konzentration. Schachspieler, fast unbeweglich am Tisch sitzend, kämpfen auch und können sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben.
Aber wie kämpft man auf geistiger Ebene gegen die Patrizialen, wenn sie die Macht über alle Medien und den Staatsapparat – über die Wirtschaft sowieso - besitzen? Wenn sie die Massen Tag für Tag mit staatstragender Propaganda berieseln können?
„Wir kümmern uns!“
„Wir sorgen für Recht und Ordnung!“
„Es geht euch doch gut. Und es wird euch immer besser gehen!“
Oder auch:
„Seht, wie armselig die Leute bei der WESPAC leben!“
Sie stöhnte. Wie sollte man gegen diese allumfassende Stimmungsmache im geistigen Kampf vorgehen? Manche bei Biofeme und den anderen Gruppen glaubten, dass dies möglich sei. Eines Tages würden die Prekarier, die Angehörigen der Unterschicht, quasi erleuchtet werden und die Fesseln der Unterdrückung abstreifen. Andere - die meisten - glaubten dies nicht und plädierten für materielle Gewalt.
Und sie?
Was wollte sie?
Ehrlich gesagt, sie wusste es nicht.
Und dann die beiden toten Kameraden. Opfer im ungeistigen Kampf. Ihr Puls beschleunigte sich, wenn sie daran dachte. Einen von ihnen, Jonathan, hatte sie richtig gut leiden können, und er war es auch gewesen, der sie zu Biofeme gebracht hatte. Groß war er, wie ihr Bó, doch weder blond noch blauäugig. Sie war sich nie ganz sicher, ob sie sich wegen der Sache oder wegen ihm dieser Gruppe angeschlossen hatte.
Er spielte Orgel, in einer Kirche in irgendeinem Kiez. Auch sonst hatte er einen gewissen Hang zu Höherem und philosophierte gerne über Dinge wie den Sinn im Allgemeinen. Einmal hatte er sie zum Orgelpiel mitgenommen; das hatte großen Eindruck auf sie gemacht. Seine Haltung ihr gegenüber war am Anfang nur kameradschaftlich gewesen. Doch in letzter Zeit hatte sich das grundlegend geändert.
Was wäre gewesen, wenn…
Nun war er tot.
Und sie am Boden zerstört.
Es war auf einer jener Demonstrationen passiert, die in letzter Zeit immer häufiger stattfanden. Ein Mikrowellenschock der Polizei hatte ihn erwischt; er war mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades in die Klinik eingeliefert worden. Eigentlich nicht lebensgefährlich; trotzdem war er überraschend gestorben.
Sie konnte nicht glauben, dass das auf natürliche Weise oder gar auf Geheiß der Patrizialen geschehen war. Dazu war deren Interesse viel zu groß, ihn zu verhören und Informationen über die Cliquen zu erhalten, die sich als Sachwalter der Prekarier verstanden. Und das Interesse von Letzteren bestand darin, das zu verhindern.
Wer also steckte dahinter?
Franka wälzte sich auf die andere Seite, als könne sie die Erklärung, die so offensichtlich war, abschütteln. Aber es funktionierte nicht, irgendwie hatte sich der Gedanke verhakt und kehrte immer wieder zurück.
Die eigenen Leute? Einer von uns?
3.
Jonathans Beerdigung sollte am Sonnabend um elf Uhr auf dem St.-Philippus- Apostel-Friedhof an der Seestraße stattfinden. Das war nicht weit entfernt von Frankas Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen; notfalls könnte sie zu Fuß laufen. Es sollte nur eine kleine Veranstaltung werden; außer seiner Mutter und deren Schwester gab es keine engeren Angehörigen, und von den Mitstreitern bei Biofeme würde wohl keiner kommen.
Nicht aus Desinteresse, sondern aus Sicherheitsgründen. Da Jonathan als Terrorist gefasst worden war, würde das Begräbnis zweifellos geheim überwacht werden, und es war nicht ratsam, in diesem Zusammenhang in die Dateien zu geraten. Das galt natürlich auch für Franka, aber sie scherte sich nicht drum. Nicht in diesem Fall.
Sie stand vor ihrem Spiegel und starrte auf ihre Beine, die in schwarzen Leggins steckten. Sie waren das einzige Schwarze, das sie besaß. Ansonsten hatte sie noch einige dunkle Sachen, die zur Not etwas feierlich aussahen. Egal, wofür sie sich entschied, sie würde immer wie eine Studentin auf dem Weg zur Vorlesung aussehen.
Sollte sie überhaupt hingehen? Sie hatte keine Einladung. Jonathans Mutter kannte sie nur flüchtig; sie würde sich kaum an ihren Namen erinnern. Aber trotzdem, irgendetwas drängte sie. Es schien ihr beinahe wie Verrat, ihrem Freund diesen letzten Dienst zu verweigern. Ordentlich verabschieden war das Wenigste, was sie noch für ihn tun konnte, und das zumindest sollte sie doch packen. Wenn schon sonst keiner der Kameraden kommen würde. Ein leichter Schmerz keimte in ihr auf, wie eine Erinnerung an das, was zwischen ihnen hätte geschehen können. Aber nie geschehen war.
Also huschte sie im letzten Moment, bevor die Orgelmusik verklang und das Pfarrergesicht auf dem großen Monitor über der Urne zu sprechen begann, in die Aussegnungskapelle und nahm gleich neben dem Eingang Platz. Außer ihr waren nur sechs Leute da: Jonathans Mutter, die Frau neben ihr war augenscheinlich seine Tante, dann noch drei weitere Personen und etwas abseits ein Bediensteter des Friedhofes.
Es erschütterte Franka, an Jonathans Stelle nur diese große graue Dose mit seiner Asche aufgebahrt – konnte man das bei einer Urne sagen: aufgebahrt? – zu sehen, da half auch der ganze schüttere Blumenschmuck nichts, den sich die Familie trotz aller Knappheit geleistet hatte.
Der Pfarrerkopf in dem schwarzen Rahmen ließ sich in monotonem Singsang über Jonathans besonderen Wert als Mensch und einzigartigem Individuum aus; die Brüche in der Tonlage offenbarten die rhetorischen Sequenzen, aus denen die Predikt zusammengestoppelt war. Ja, eine persönliche Ansprache von einem Redner aus Fleisch und Blut, die wirklich auf den besonderen Lebenslauf des Verstorbenen einging – die war für einfache Leute nicht zu haben. Aber aller Technik zum Trotz ging ein eigenartiger Reiz von der Inszenierung aus, der schwer zu erklären war.
Als die Stelle mit dem Aufbruch zur großen Reise kam, wie der Darsteller Jonathans Ermordung umschrieb, da sank seine Mutter langsam vornüber und brach in Tränen aus, und seiner Tante, die ihren Arm um sie gelegt hatte, ging es nicht besser. Auch Franka hatte Mühe, Haltung zu bewahren. Sie atmete schwer und starrte in steifer Haltung zur Wand hinüber, vor der niemand saß und die mit einem Fresko der Kreuzigung geschmückt war.
Als das Glöcklein erklang, setzte sich die Urne auf ihrem Untergestell ruckartig in Bewegung, um selbsttätig den Weg zum Urnenfeld einzuschlagen. Dort wartete schon die ausgehobene Grube; daneben stand eine schwarz gewandete Gestalt, die sich beim Näherkommen als echter Pfarrer herausstellte. Das Urnengefährt war etwas breiter als die Grube; es hielt direkt darüber an. Der Pfarrer sprach einige getragene Worte zur Gnade Gottes (er erwähnte tatsächlich das Wort „Gott“!) und zur Vergebung auch Jonathans Sünden.
Nach voreingestellter Zeit (es waren vier Minuten) wurde die Urne automatisch in die Öffnung gesenkt und ausgeklinkt, worauf das Gefährt ein Stück rückwärts fuhr, wendete und sich auf den Heimweg machte.
„Aus der Erde sind wir genommen“, sprach der Pfarrer,
„zur Erde sollen wir wieder werden,
Erde zu Erde,
Asche zu Asche,
Staub zu Staub.“
Jetzt, da aller technischer Kram erledigt, ein allerletzter Blick auf die Überreste des geliebten Freundes möglich war, konnte auch Franka die Tränen nicht mehr halten. Das Bild verschwamm, sie konnte kaum erkennen, wohin die Rose fiel, die sie ihm nachwarf, und hatte Mühe zu sprechen, als sie seiner Mutter die Hand reichte. Sie hätte gerne noch eine Weile am Grab verbracht, doch sie war die Letzte in der Reihe, nach ihr setzte sich der Trupp wieder in Bewegung und stapfte dem Ausgang des Friedhofes zu.
Als sie sich umdrehte und noch einmal einen Blick zurückwarf, sah sie ihn: Den Pentakopter, der ganz ungeniert über dem Grab schwebte, sich nun senkrecht in den Himmel schraubte und in einer großen Kurve davoneilte.
4.
„Wie war es denn auf Jonathans Beerdigung?“, fragte Filip Noy, der Vorsitzende von Biofeme, an Franka gewandt.
Franka zuckte mit den Schultern. „Wie soll‘s gewesen sein? Es lief nach Schema F, wie meistens.“
„Wie wurde er denn bestattet? Im Sarg oder in der Urne?“
Franka reagierte aufgebracht. „Interessiert euch das wirklich? Ich glaube kaum. Warum war denn sonst keiner von euch da?“
Fünfzehn Mitglieder von Biofeme saßen im Hinterzimmer von Janis‘ Computerladen eng zwischen die Geräte gequetscht. Es war der Raum, in dem sie sich regelmäßig trafen, um die Strategie zu diskutieren und die nächsten Aktionen abzusprechen. Sie sahen aus wie Studenten, und die meisten waren es auch. Auf Frankas Vorwurf schwiegen sie betreten.
„Weil die Sache viel zu unsicher war“, konterte Filip. „Du musst bedenken: Jonathan wurde offiziell als Terrorist geführt. Ihr wurdet garantiert beobachtet. Du hättest eigentlich auch nicht hingehen dürfen.“
„Ich habe es auch für euch getan.“
Filip Noy zog die Stirn in Falten. „Hoffentlich nicht, möchte ich fast sagen. Ist dir irgendetwas Verdächtiges aufgefallen?“
Franka grübelte. „Nein, nicht direkt.“
„Aha. Und indirekt?“
Franka musterte die Zimmerdecke. „Nein. Nichts.“ Sollte sie etwa von der Drohne erzählen? Die hätte genauso gut zum Zählen der Rotkehlchennester unterwegs sein können. Die zu erwähnen würde nur unnötige Unruhe erzeugen. Und wenn doch etwas dran war, dann… sollte der Staat eben an seiner Datenflut verrecken.
„Ja was denn nun: Feuer oder Erde?“, kam ihr Bernd Koselitz zu Hilfe. Koselitz, genannt „Kossy“, war sowohl Mitglied bei Biofeme als auch bei Fraktale, einer Hackergruppe, wo er Vorsitzender war.
„Er wurde eingeäschert. Die Beisetzung war auf dem Friedhof an der Seestraße.“
„Und was ist mit Frederik?“, fragte Rodberte, die Rothaarige.
„Darüber weiß ich nichts“, sagte Franka. „War der nicht sofort tot? Ist der denn nicht schon vor Tagen beerdigt worden?“
„Ja, den hatte es noch schlimmer erwischt als Jonathan“, sagte Kossy. Er trug gewöhnlich ein leicht ironisches Grinsen zur Schau, aber jetzt war er richtig wütend. „Die Bullen sagen, es sei ein Unfall gewesen. Ha! Schöner Unfall! Wenn die mit ihren EMP-Kanonen direkt auf Leute halten, die auf sie zulaufen! Das hält keiner aus. Da zerkocht es jeden!“ Er sprach von den Mikrowellenwaffen, die jetzt auf breiter Front von der Polizei gegen Demonstranten eingesetzt wurden. „Dagegen waren die guten alten Wasserwerfer fast harmlos!“, rief er. „Geradezu erfrischend!“
„Ich stelle mir das arg grausam vor“, wandte Rodberte ein. „Wenn man die Menschen nur halb erwischt… Ich habe gehört, dass die Mikrowellen- Impulse die Körperflüssigkeit zum Kochen bringen. Das ist ja genauso, als würde man Krebse in heißes Wasser werfen!“
„Schlimmer! Weil es langsamer geht. Siehe Frederik. Siehe Jonathan“, sagte Filip. „Technisch ist es genau dasselbe, was deine Mikrowelle in der Küche macht. Wenn du die Klappe vorne abmontierst, hast du schon eine richtige EMP-Kanone.“ Er blickte in die Runde und räusperte sich. „Das hier ist keine Frage von Legalität oder Verbrechen“, verkündete er theatralisch. „Leute! Hier geht es um Krieg, um nichts weniger. Und das macht die Sache ganz einfach. Es heißt jetzt nur noch: Prekarier oder Patriziale. Wir oder sie. Und wenn die solch brutale Waffen einsetzen, haben wir jedes Recht der Welt, das auch zu tun. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das ist ein Naturgesetz. Das war schon immer so.“
Niemand sagte etwas, bis sich Victor zu Wort meldete. Victor, der die Mitglieder oft mit seinen umständlichen, dafür aber realistischen Begründungen nervte. „Also du willst jetzt, dass wir auf breiter Front EMPs basteln und gegen die Patrizialen einsetzen“ stellte er in seiner leisen Art zu sprechen fest. „Verstehe ich das richtig? Glaubst du denn, wir kommen gegen die an? Auf die Dauer? Die haben doch viel mehr Ressourcen. Das gibt ein grausames Gemetzel, vor allem bei uns. Das ist doch offensichtlich! Das muss doch jedem klar sein! Entschuldige, aber dein Vorschlag kommt mir bei aller Technik ziemlich steinzeitlich vor!“
Das einsetzende Gemurmel zeigte an, dass viele seine Ansicht teilten.
„Was sollen wir deiner Meinung nach denn sonst tun?“, entgegnete Filip barsch. „Nichts? Und zusehen, wie die Welt noch mehr in Armut und Elend versinkt? Nein, wir haben keine Wahl. Wir müssen mit aller Härte zuschlagen! Angst und Schrecken verbreiten! Die altbewährten Methoden! Das wird sie schon beeindrucken. Sie werden sich untereinander zerstreiten und uns Konzessionen machen, wart‘s nur ab.“
„Steinzeitlich Methoden, ich sag‘s doch! Aber es gibt doch andere Möglichkeiten als diese beschissene Fernsiederei“, rief Victor. „Die heutige Technik ist smart. Intelligent. Vollautomatisch. An diesem Punkt müssen wir ansetzen!“
„Und was heißt das konkret?“, fragte Franka.
„Wir müssen noch smarter und intelligenter sein als sie. Bei EMPs gibt es ja noch einen zweiten Effekt, den wir uns zu Nutze machen können: Ein elektromagnetischer Impuls erhitzt nicht nur organisches Gewebe, er stört oder zerstört auch die elektronischen Systeme, die von ihm getroffen werden. Also man kann damit Autos stoppen, Flugzeuge zum Absturz bringen, Rechenzentren verwirren und vieles andere mehr. Die Möglichkeiten sind faszinierend. Im Grunde kann man damit einen ganzen Staat lahmlegen. Ohne direkt Leben zu gefährden!“
Bernd Koselitz hatte die Diskussion schweigend verfolgt. Jetzt verzog er das Gesicht zu einem breiten Grinsen und warf Filip Noy einen verschwörerischen Blick zu. Der grinste zurück.
Franka, die den Blickwechsel bemerkt hatte, fragte: „Ist etwas? Habt ihr etwas in petto, das wir wissen sollten?“
„Was hältst du davon, wenn wir beide Methoden miteinander verbinden? Das EMP und die Schlauheit?“ Kossy lächelte noch verschmitzter, als er es gewöhnlich schon tat.
„Wenig“, sagte Victor.
„Lass doch erst mal hören!“, rief Franka.
„Also: Victor forderte, wir müssten schlauer sein als der Machtapparat. Das ist gar nicht so schwer, denn dort arbeiten Beamte, die sind nicht viel effektiver als Androiden. Ihr Vortei ist: Sie haben die Staatskasse hinter sich. Aber unser Vorteil liegt darin, dass wir engagiert sind. Engagiert und solidarisch. Geld gegen Herzblut, das alte Spiel.“
Janis Brasauskas, dem der Laden gehörte, wurde ungeduldig.
„Aha. Wie schön für sie. Wie schön für uns. Sonst noch was?“
„Um es kurz zu machen“, fuhr Kossy fort, „wir haben uns ins Polizeinetz gehackt und ein wenig beim Drohnen-Flugpark umgesehen. Dort hat man im letzten halben Jahr einhundert Neuanschaffungen getätigt, darunter zehn, die mit kleinen EMP-Kanonen ausgestattet sind. Bei denen ist uns aufgefallen, dass die Verschlüsselung des Zugangscodes fehlerhaft ist. Das heißt: Wir konnten in die Steuerungen eingreifen und das Kommando über die Fluggeräte übernehmen.“
„Denkst du dir das jetzt so oder habt ihr das schon ausprobiert?“, fragte Franka.
„Tja…“ Kossy sah triumphierend in die Runde. „Wir haben gestern ein Schwebzeug abgeschossen. Einen Baofeng mit Hilfe einer Starfly 5.2, bewaffnet mit einem EMP-Shooter.“
5.
„Wie konnte das passieren?“, fragte Paul Lery unwirsch und stellte geräuschvoll sein Weinglas ab. Als Oberhaupt der Familie präsidierte er am Ende des langen Tisches in der Halle seiner Villa, wo sich jeden Abend die Mitglieder der Lery-Familie zum gemeinsamen Diner zusammenfanden.
Heute war jeder Platz besetzt, denn nach zwei Tagen Abwesenheit nahm auch Alexander, Pauls ältester Sohn, wieder daran teil. Er stand im Mittelpunkt des Interesses; seinen Absturz mit dem Baofeng hatten alle mit Erschrecken aufgenommen. Nun wollte jeder etwas über die genaueren Umstände erfahren. Zum Glück wies Alexander Außer ein paar Hämatomen und einem gestauchten Hals keine Verletzungen auf; die Halskrause hatte man ihm in der Klinik hauptsächlich zur Vorsicht verpasst. Das war zwar relativ harmlos, sah aber übel aus, und alle ahnten: Es hätte viel schlimmer kommen können.
Romana, Pauls Schwester, die kaum verstand, um was es ging, nahm ihren Neffen in Schutz: „Reg dich nicht auf, Paul, er kann doch nichts dafür. Es war doch sicher nur ein Versehen, nicht, Alex?“
„Natürlich.“ Alexander wollte mit dem Kopf nicken, ließ es aber wegen der prompt einsetzenden Stiche im Hals bleiben. „Niemand kann so etwas voraussehen. Was hätte ich denn machen sollen? Man sieht einer Drohne doch nicht an, dass sie einen gleich abschießen wird. Und wenn doch – was kann man dann tun? Außer beten?“
„Man kann zum Beispiel gar nicht erst in so ein Schwebzeug steigen“, stellte sein Vater kategorisch fest. „Ich tue es auch nicht, und auch du kannst mit dem Firmenwagen fahren.“
„Aber selbst das ist nicht ganz sicher“, mischte sich Ian-Dao, Pauls Sohn aus zweiter Ehe, ein. Wie alle am Tisch verfolgte er das Gespräch voller Spannung. „Ihr erinnert euch? Vor ungefähr zwei Wochen ist ein Fahrzeug der Polizei elektronisch gekapert worden und in ein Gebäude gekracht.“
Paul führte sein Weißweinglas zum Mund und nahm einen Schluck. Er zitterte ein wenig, so viel Widerspruch war für ihn ungewohnt. „Die Polizei!“, brummte er. „Was funktioniert schon bei der Polizei?“
Eine Weile herrschte Stille. Alexander stocherte in seiner kross gebratenen Ente, sein Vater Paul starrte auf sein Weinglas, das er ab und an drehte; Oma Romana löffelte ihren Gesundheitsbrei. Die Familie von Hans-Tian (mit seiner Frau Goede und den beiden Söhnen Klaus und Peter, zwölf und zehn Jahre alt) wartete auf den Nachtisch, ebenso sein Bruder Jan-Dao mit seiner Frau Marlies. Constanze, Alexanders schöne Cousine und einstige Ehefrau, nippte an ihrem Prosecco, dem grobschlächtigen Surrogat ihres geliebten und in EURA-Landen nicht mehr verfügbaren Champagners, Kevin, das schwarze Schaf der Familie, fragte sich, ob er noch eine Portion Ente verkraften würde; Betsy, eine weitere Cousine von Alexander, war damit beschäftigt, ihre Pizza wie gewohnt von innen nach außen zu essen und näherte sich bereits dem Rand, den sie wie immer übrig lassen würde. Das war der harte Kern der Lery-Sippschaft. Und alle waren – das unterschied sie gründlich von den meisten Menschen – duriert.
Keiner glaubte, dass es sich bei Alexanders Absturz lediglich um einen Unfall handelte. Dazu war es in letzter Zeit – siehe Polizei – zu oft zu allen möglichen Vorfällen größerer und kleinerer Art gekommen. Drohnen, die aus der Luft fielen, Netzwerke, die sich ins Chaos verabschiedeten, Autos, die plötzlich machten, was sie wollten. Geheime Daten, die an anderer Stelle fröhlich das Licht der Öffentlichkeit erblickten.
„Kann mir mal jemand sagen, was eigentlich genau passiert ist?“, fragte Kevin vom Ende des Tisches. Er war wie immer mit den Gedanken woanders gewesen und merkte erst jetzt so richtig, um was es ging.
„Ja, Alex. Worüber reden wir hier eigentlich?“, stimmte Romana, Pauls Schwester, ein. Wie ihr Bruder hatte sie die Hundert schon längst überschritten, wenn auch geistig nicht ganz so mobil.
Alexander ließ die Gabel mit der Ente sinken. „Na ja… da war eigentlich nicht viel. Ich bin in einem Baofeng nach Hause geflogen. Das sind diese Kabinen mit jeweils drei kleinen Hubschrauber-Rotoren links und rechts vom Dach. In der Kaiser-Friedrich-Straße hat mich dann so eine popelige Drohne verfolgt. Plötzlich hat sie mit einer EMP-Kanone auf mich geschossen.“
„Und dann bist du abgestürzt“, folgerte Peter, der zehnjährige Sohn von Hans-Tiao, mit strahlendem Gesicht.
„Genau!“
„Wow!“ Peter schien das Geschehene für eine herrliche Achterbahnfahrt zu halten.
„Eine… was für eine Kanone?“ Oma Romana sah Alexander entgeistert an.
„Na so ein Strahlengewehr“, platzte Peters Bruder Klaus dazwischen. Für den Zwölfjährigen waren technische Neuerungen olle Kamellen. „Damit kann man die Elektronik von allen möglichen Geräten stören.“
„Ja sowas!“ Oma Romana hatte begriffen.
„Diese EMP-Kanone“, fuhr Alexander fort, „hat jedenfalls die Steuerung des Baofengs außer Gefecht gesetzt. Glücklicherweise hat der Schleudersitz noch funktioniert. Und auch der Airbag.“
„Ein Airbag?“, staunte Constanze. „Am Schleudersitz oder wo?“
„Genau. Er ist in die Sitzschale integriert, die mit dem Fahrer ausgeworfen wird. Er umhüllt alles. Du steckst sozusagen in einem großen Luftballon!“
Alle schwiegen und versuchten, sich das vorzustellen. Ein großer weißer Wattebausch, der auf die Straße fiel.
„Fallschirm geht nicht, dazu ist die Flughöhe zu gering“, ergänzte Alexander.
Peters Augen begannen zu leuchten. „Dann bist du ja wie ein Fußball über die Straße geflitzt!“
„Ja! Genau so! Und dabei sogar mit einem Auto zusammengestoßen!“
„Ui! Was war das denn für eine Schrottmühle!“ Klaus wusste natürlich, dass moderne Autos mit einer AKR, einer Ausweichautomatik ausgestattet waren.
„Das war keine Schrottmühle. Das war ein ziemlich neuer Balcar. Aber was nützt eine AKR, wenn der Wagen gerade langsam fährt? Dann kann er nicht ausweichen.“
Der Balcar – er hieß mit vollem Namen „Balanced Car“ – war ein Auto für zwei Personen, das – ähnlich wie ein Segway-Roller – auf nur einer Achse unterwegs war. Vollautomatisch natürlich.
„Das ist jetzt genug an technischen Details“, fuhr Paul Lery dazwischen. „Wir können feststellen: Es ist im Grunde nichts Schlimmes passiert. Alexanders Halsmanschette ist ja nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und der Fahrer des Balcars ist auch mit dem Schrecken davongekommen. Trinken wir darauf, dass wir weiterhin so viel Glück haben!“
Alle hoben ihr Glas. Doch keiner sah zufrieden aus. Die wichtigsten Fragen schwebten nach wie vor ungeklärt im Raum.
War es ein Unfall? Oder ein Mordversuch?
Wer steckt dahinter?
Wird er es wieder versuchen?
Kann es auch die anderen Mitglieder der Familie treffen?
Also mich?
In das darauf folgende Schweigen hinein erklang das Surren des Service- Androiden, der auf seinen Rollen jeden einzelnen Platz anfuhr und – je nach Wunsch – Reste abräumte oder Speisen nachreichte. Der Roboter in Menschengestalt wurde der Einfachheit halber „Andro“ genannt, was auf die Dauer wenig Sinn ergab, weil der Name allmählich auf alle neu angeschafften Androiden übergegangen war. Zurzeit gab es fünf Andros im Haus.
„Andro“, rief Großvater Paul, als der Roboter seine Runde beendet hatte, „in zehn Minuten kannst du das Dessert servieren.“
Andro hielt im Hinausfahren an, drehte den Kopf um hundertachzig Grad, flackerte mit seinen Dioden und sagte: „Sehr wohl. In zehn Minuten, Herr Lery.“
6.
Als die meisten schon die Tafel verlassen hatten, erhob sich Paul Lery und winkte seinen Sohn heran. „Alex, ich muss mich noch einmal mit dir unterhalten. In einer Viertelstunde? In meinem Arbeitszimmer?“
Alex ahnte, dass dies keine angenehme Unterhaltung werden würde. Nicht nur die ernste Miene des Vaters, allein schon die Erfahrungen seines langjährigen Sohneslebens sprachen dafür. In seiner Halskrause nickte er steif. „Gut. Ich komme. In fünfzehn Minuten.“
Während der Alte den Speisesaal verließ, wandte sich Alexander seiner Cousine Constanze zu. „Deine Mutter – geht es ihr wirklich so schlecht, wie du vorhin angedeutet hast?“
Constanze trug ein hautenges Kleid (wie meistens), ocker-gelb mit weinroten Einsprengseln, das ihre tadellose Figur vorteilhaft zu Geltung brachte. Mit einer lässigen Handbewegung wedelte sie ihr blond gefärbtes, leicht gewelltes Haar über die Schulter zurück.
„Wie soll es jemandem gehen, der eine neue Leber benötigt?“ Sie klang mehr als ironisch.
„Hat sie nicht vor sechs Jahren eine neue bekommen?“, fragte Alexander.
„Ja. Die vierte.“
„Oh! Was meinst du – liegt es denn wirklich an der Leber?“ Trotz seines Mitgefühls für die kranke Mutter hatte Alexander im Augenblick mehr Sinn für die Frau, die vor ihm stand. Sie war etwas kleiner als er, schick und schön, alle Männer würden sich nach ihr umdrehen. Und sie würde immer so schön bleiben, sie war ja duriert. Warum nur hatte er sie vor zwei Jahren gehen lassen? Und wie oft würde er sich das noch fragen?
Constanze lachte affektiert. „Nein, glaube ich nicht. Die Frau hat einfach alle Krankheiten gleichzeitig. Oder irgendetwas zwischen manischdepressiv, Alkoholsucht und Borderline-Syndrom.“
Ihre offen zur Schau getragene Distanz zur leiblichen Mutter irritierte Alexander. Obwohl viel dafür sprach, dass es bei ihm und seinem Vater ähnlich war. Aber dann doch wieder ganz anders. Er verachtete seinen Vater nicht, hatte auch keinen Anlass dazu.
„Das ist das Blöde an der heutigen Medizin“, philosophierte er. „Je besser die Behandlungsmöglichkeiten, desto schludriger gehen die Menschen mit ihrer Gesundheit um.“
Constanzes graue Augen, die heute nur mäßig geschminkt waren, sahen ihn groß an. „Du sagst es. Aber ist das nicht bei allem so?“
Alexander fühlte, wie Constanzes Blick nicht nur in seine Augen, sondern auch in seine Knie gegangen war. Ein plötzliches Begehren keimte in ihm auf, das er auf diese Weise während der beiden Jahre ihrer Trennung nicht gespürt hatte. Warum war ihre Ehe bloß gescheitert? Wegen dieses eigenartigen Monsieur Montseul aus Dingsda? Aber das musste ja nicht bedeuten, dass man sich jetzt, wo der Gute das Zeitliche gesegnet hatte, nicht wieder annähern konnte.
Er fasste sich ein Herz. „Hättest du etwas dagegen, wenn ich morgen Abend kurz bei dir reinschaue? Dann könnten wir ja überlegen, was wir für deine Mutter tun können. Sie braucht eine Psychotherapie, das liegt ja wohl auf der Hand. Sonst geht das ewig so weiter.“
„Sie ist in Psychotherapie. Schon seit Leber nummer zwei“, erwiderte sie kess und schwang Hüfte und Schulter dabei auf eine kokette Weise. „Lass mal überlegen. Morgen? Ja, ich glaube, es geht.“
Bis zum Gespräch mit seinem Vater blieben noch einige Minuten Zeit. Bevor Alexander zu ihm ging, machte er einen Abstecher in seine eigene kleine Wohnung, die ebenso wie Pauls „Herrenzimmer“ im zweiten Obergeschoss der Villa lag. Grübelnd starrte er auf das große Display, das in die Wand eingelassen war und in unregelmäßigem Wechsel berühmte Werke der Malerei darstellte. Heute zeigte es einen Chagall. Schwebende Figuren, scheinbar ohne Zusammenhang…
Was sein Alter wohl von ihm wollte? Würde er mit weiteren Vorhaltungen kommen? Immer, wenn er ihn zu sich rief, hatte Alexander ein mulmiges Gefühl im Bauch. Warum das so war, konnte er sich nicht erklären. Sein Vater hatte ihn als Kind nie geschlagen, nicht einmal an den Haaren gezogen. Aber wenn sie miteinander diskutierten, egal, über welches Thema, verfiel er in einen derart amtlichen Ton und stellte dabei die Dinge so verzerrt dar, dass Alex mit seinen gutgemeinten Erklärungen als vollkommener Trottel dastand. Ohne Rücksicht darauf, wer sonst noch zuhörte. Jedenfalls empfand er es so.
Alexander hatte immer den Eindruck gehabt, es ginge seinem Vater nicht in erster Linie um die Wahrheit, sondern darum, als Sieger aus einem Gespräch hervorzugehen. Und das tat er meistens, seine steile Karriere bewies es. Alexander fand das grundsätzlich auch in Ordnung, nicht aber gegenüber seinen eigenen Kindern. Es brachte einen Hauch von Fremdheit in die Familie, der in keiner Weise förderlich war. Er hatte schon oft darüber nachgedacht, was seinen Vater zu diesem Verhalten trieb; es gab mehrere Möglichkeiten, von denen keine plausibler war als die anderen.
Was blieb, war: Sein Vater war ein unüberwindlicher Block, der drohend vor ihm aufragte. Das war immer so gewesen, seit er denken konnte. Und er war jetzt dreiundsiebzig Jahre alt. In chronologischer Zählung. Biologisch gesehen war er ungefähr fünfunddreißig.
7.
Geboren wurde Alexander im Jahre 1999 im Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Seinen Vater Paul hatte er in den ersten Lebensjahren kaum zu Gesicht bekommen; der war von seiner Firma, einem Chemiekonzern, nach China abgeordnet worden. In der Familie war er hauptsächlich durch den außerordentlichen Wohlstand gegenwärtig, den sein Einkommen bescherte.
Als er zurückkam – Alexander war damals vier Jahre alt –, hatte er eine neue Frau und gleich den Scheidungsantrag im Gepäck. Mit juristischen Finessen schaffte er es, sich das alleinige Sorgerecht für den Sohn zu sichern, worauf seine Frau Bethania alle Brücken zur Familie abbrach und ihrem Liebhaber nach Südamerika folgte. Von ihr hörte Alex nie wieder etwas.
Seine neue Mutter Liu Chan war ein ganz anderer Typ. Sie war Han-Chinesin und sprach fließend Deutsch in einem hohen Sing-Sang, der allein schon Fröhlichkeit verbreitete. Sie war schön und intelligent und passte zu Pauls Leben wie das letzte fehlende Puzzeleteil. Bei seinen gesellschaftlichen Aktivitäten, die gelegentlich auch zu Hause stattfanden, sorgte sie für einen repräsentativen Rahmen; wenn chinesische Partner da waren, war sie das gute Omen für das Gelingen des Geschäftes. Als Mutter war sie streng, aber auch sehr einfühlsam; sie hatte Alexander in ihre Liebe zu ihrem Mann eingeschlossen, und Alexander erwiderte diese Zuneigung. Selbst bekam sie zwei Kinder: Hans-Tian und Jan-Dao, beide inzwischen verheiratet.
Eines konnte sie Alex nicht nehmen – das Unbehagen gegenüber seinem Vater. Niemand wusste, wo es eigentlich herkam, und selbst Paul zeigte sich betroffen vom mangelnden Vertrauen seines Sohnes. Sicher trug dazu bei, dass Paul, der ursprünglich einer Arbeiterfamilie entstammte, in rasantem Tempo den gesellschaftlichen Aufstieg geschafft hatte; in Berlin fiel keine wichtige politische Entscheidung, zu der er nicht als Präsident der Deutsch-Chinesischen Handelskammer gehört worden war. Er war ein Erfolgsmensch und forderte in seinem ganzen Verhalten Respekt.
Dann kam noch der Umzug in die große Villa auf dem Schwanenwerder, der großen Havelinsel, Stammsitz der Reichen und Superreichen von Berlin. Er wurde Zeuge, wie sich sein Vater Zug um Zug das Eigentum an den anderen Grundstücken verschaffte – wobei ihm die große Krise der Zwanzigerjahre zu Gute kam, in der die Wirtschaft europaweit am Boden lag und nur das China-Geschäft brummte. Das war das Jahrzehnt, in dem die Europäische Union und die NATO zerbrachen, um den neuen Machtblöcken WESPAC und EURA Platz zu machen. Die Grenze zwischen beiden verlief ungefähr am Rhein. Um ein Haar schrammte die Welt damals an einem Atomkrieg vorbei.
Alexanders Respekt vor seinem Vater war wiederum nicht so gewaltig, dass sein psychischer Allgemeinzustand darunter litt. Seine Schulnoten waren gut bis sehr gut; das Abitur schloss er mit einem Schnitt von 1,2 ab. Was auffiel, war seine gelegentlich wankelmütige, instabile Art, die er mit einem Übermaß an Humor, manchmal auch Clownerie zu kaschieren suchte. Sie verlieh ihm, der ansonsten jugendlich-forsch auftrat, eine sympathische, gelegentlich aber auch exzentrische Note.
Seinen Job bei Müller-IT, dem Hersteller intelligenter autonomer Flugkörper mit Sitz im BIOBIG (dem ehemaligen Flughafen Tegel), hatte ihm sein Vater vermittelt. Obwohl er nur eine Ausbildung als Logistik-Ingenieur ohne jede Praxiserfahrung hatte, wurde er gleich als Abteilungsleiter Marketing übernommen. Ein Tätigkeitsfeld, das er bisher vor allem mit Argwohn zur Kenntnis genommen hatte, weil es seiner Ansicht nach dabei nur darum ging, anderen Leuten Sachen aufzudrängen, die sie gar nicht brauchten.
Hinzu kam, dass die Flugkörper, die Müller-IT baute, zum Beispiel die Spornets und Starflys, von denen eine ihn ja getroffen hatte, als Waffen eingesetzt werden konnten und dies auch weltweit wurden. Dennoch – die Position bei Müller war verlockend gewesen, was den weiteren Aufstieg in der Welt der Konzerne betraf. Das mussten ja nicht immer gleich Hersteller von Tötungsmaschinen sein.
So hatte er sich bei Müller eingefuchst und war inzwischen recht erfolgreich. Seit sechsundvierzig Jahren auf dem selben Posten.
Der große Einschnitt in seinem Leben kam, als er fünfunddreißig war. Das heißt, das Leben ging eigentlich weiter wie bisher, doch sein Blick darauf wurde ein völlig anderer.
Sein Vater hatte die Sache zuerst ausprobiert, nachdem er von einem gewissen Professor Renemult, seines Zeichens Geschäftsführer der Duratec GmbH, überredet worden war. Als sich so gut wie keine Nebenwirkungen gezeigt hatten, hatte er die Behandlung auch seinem Sohn „verordnet“. Nicht zu vergessen seiner Frau, seiner Schwester und der ganzen übrigen Familie. Es ging um ein Verfahren, über das zahllose Gerüchte im Umlauf waren. Gerüchte, die im Laufe der Jahre immer bizarrere Formen angenommen hatten.
Es hieß Duration. Sein Zweck war nichts weniger als die künstliche Verlängerung des menschlichen Lebens. Wenn alles nach Plan lief, bis zur Unendlichkeit.
Die Situation war ja auch grotesk. Wenn der Süßwasserpolyp in Nachbars Gartenteich, ein kaum sichtbarer Fussel, niemals sterben musste, war es dann nicht ein Skandal, dass die Lebensuhr der Menschen, des höchstentwickelten Wesens auf diesem Planeten, nach maximal einhundertzwanzig Jahren ablief, egal, wie sehr man dagegen antrickste? Die Körperzellen verweigern jegliche weitere Teilungen, der Stoffwechsel gerät ins Stottern und ebnet letztlich den Weg zum letalen Organversagen, auch „natürlicher Tod“ genannt. So viel Weisheit und Können, weggeworfen für nichts.
Von dieser Herausforderung getrieben saßen die Forscher seit Beginn des zweiten Jahrtausends daran, die Fähigkeiten des Polypen und, wie sich herausstellte, zahlreicher weiterer Organismen auf den Menschen zu übertragen. Alle Hoffnungen richteten sich auf die Zauberkünste der Gentechnik.
Und zu Beginn der turbulenten Zwanzigerjahre schaffte man es tatsächlich. In der Berliner Charité hatte man eine Methode entwickelt, bei der dem Organismus von außen Stammzellen zugeführt wurden, wodurch die mangelhafte Selbsterneuerung der Organe kompensiert wurde. Das war natürlich mit regelmäßigen Nachbehandlungen verbunden; im weiteren Verlauf der Forschungen wurde jedoch erreicht, den Körper selbst zur vermehrten Produktion von Stammzellen zu veranlassen und die „Wartungsintervalle“ deutlich zu vergrößern.
Die mit dem Projekt befassten Charité-Forscher gründeten ein eigenes Unternehmen, die Duratec GmbH, und erwarben alle Rechte an der Methode. Doch es dauerte noch zehn Jahre, bis die Sache marktreif war und alle Genehmigungen bis hin zur Erlaubnis des Kartellamtes (Monopol!) eingeholt waren.
Eigentlich wollte der Staat das Verfahren völlig verbieten, weil es sehr teuer war und damit nur für die Superreichen zugänglich; gesellschaftliche Unruhen schienen programmiert. Auch die Sozialsysteme, allen voran die Rentenkasse, wären völlig überfordert gewesen.
Unter dem Druck besagter Superreicher, die sich selbst in Anspielung auf das antike Rom Patriziale nannten, kam es dennoch zur Freigabe mit dem Argument, es betreffe ja nur wenige Personen und werde somit die Gesellschaft nicht sonderlich beeinträchtigen. Was natürlich eine mustergültige Selbsttäuschung war.
Denn von nun an teilte sich die Menschheit in Sterbliche und Unsterbliche. Mit all den gedanklichen und materiellen Folgen, die daran hingen.
Die Duranten waren bestrebt, in dieser Eigenschaft nicht übermäßig in Erscheinung zu treten, um keinen Sozialneid zu wecken. Dies ging auch zirka zehn Jahre gut. Doch es lag in der Natur der Sache, dass jemand – nehmen wir einmal Alexander –, der mit fünfunddreißig duriert wurde und nach weiteren vierzig Jahren immer noch so aussah wie damals, die Leute ins Grübeln brachte.
Anfänglich konnte man die gebildeten Schichten, die natürlich als Erste auf den Trichter gekommen waren, dadurch ruhig stellen, dass man ihnen vereinzelt Hoffnung auf Teilnahme am Durierungsprogramm machte. Doch mit zahlenmäßiger Zunahme der Duranten und fortschreitender Zeit kam die Botschaft auch bei den Massen an, und die bildeten sich ihre eigene Meinung zu der Sache. Sie ließ sich etwa in dem Slogan zusammenfassen:
TOD IST MORD.
Die Mörder in diesem Bild waren die Angehörigen der Oberschicht, die Patrizialen, indem sie es unterließen, vom Tode Bedrohten Hilfe zu leisten. So wurden die politischen Forderungen der Unterschicht, der Prekarier, nach allgemeiner, kostenloser Duration immer wütender, was ihnen jedoch wenig Öffentlichkeitswirkung verschaffte, denn die Medien waren in der Hand der Patrizialen, und diese fanden die Ereignisse kaum berichtenswert. Dies und einige andere Entwicklungen, zum Beispiel der Ersatz menschlicher Arbeitskräfte durch Androiden, führte zum Absturz großer Bevölkerungsteile in bittere Armut und zur Wandlung zahlreicher Stadtteile Berlins in Elendsviertel.
Möglich, dachte Alexander, der immer noch in seinem Zimmer stand und durch den Chagall hindurch in die Ferne starrte, dass dies die Dinge waren, über die sein Vater mit ihm reden wollte. Vielleicht würde es aber auch nur um den Anschlag auf seinen Baofeng gehen. Vielleicht gab es hier neue Erkenntnisse, sein Vater hatte ja zahlreiche Verbindungen und Quellen, selbst bei den diversen Geheimdiensten, die in der Stadt ihr Wesen trieben.
Er gab sich einen Ruck, trat endlich den kurzen Weg zum Arbeitszimmer seines Vaters an; sein Hals in der Krause quittierte es postwendend mit einem stechenden Schmerz. Vor der Türe hielt er an und sah nach oben, als studiere er das Facettenmuster an ihrem oberen Rand. Dann drückte er die Klinke und trat ein.
8.
Paul Lerys Arbeitszimmer war sparsam im Chippendale-Stil eingerichtet. Trotz der dunklen Vorhänge und Möbel wirkte es freundlich, vielleicht wegen der Lichtfülle, die durch die hohen Fenstertüren hereindrang.
Ungewöhnlich war ein großes Standregal an einer Seitenwand, das bis zur Decke reichte und bis oben hin mit Büchern gefüllt war. Papierne Bücher! Die waren Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts aus der Mode gekommen und durch Ebooks ersetzt worden; die letzten Exemplare verstaubten in Dachkammern, Kellern und öffentlichen Bibliotheken. Ob sein Vater tatsächlich darin las oder nur sein Traditionsbewusstsein demonstrieren wollte, war Alexander immer unklar geblieben.
Zwischen Regal und Querwand befand sich eine kleine Nische; darin hatte sich ein „Andro“ postiert und auf Stand by geschaltet.
Paul, ein Cognac-Glas in der Hand, stand am Fenster und sah hinaus. „Kommst du endlich“, sagte er tadelnd. Wortlos wies er zum Couchtisch, wo die Flasche und ein weiteres Glas standen.
Alex schenkte sich ein und prostete seinem Vater flüchtig zu, bevor er trank. Was würde jetzt wohl kommen? Grob betrachtet wirkte sein Vater gelassen, doch Alexander kannte ihn: Das unregelmäßige Zucken seiner Wangenmuskeln verhieß nichts Gutes.
„Wie konntest du nur den Baofeng nehmen?“, polterte der Alte los. „Im Keller bei euch steht die große Firmenlimousine, sogar einen Fahrer habt ihr, wenn ich nicht irre. Und einige Balcars auch! Damit wärst du wenigstens auf am Boden geblieben.“
Alexander nippte am Cognac und zählte in Gedanken bis fünf, bevor er antwortete. „Was ist denn schon passiert? Fast nichts! Hast du das nicht eben selbst gesagt? Nur der Baofeng ist Schrott. Leider. Aber das ist doch wohl eher das Problem von Müller-IT, nicht wahr?“
Paul Lery ließ sich nicht gerne belehren, schon gar nicht von seinem ältesten Sohn. „Natürlich ist etwas passiert!“, schnaubte er. „Soll ich das vielleicht vor der ganzen Familie rausposaunen? Soll ich beim Abendessen Panik schüren? Die haben doch keine Ahnung, die können die Dinge doch gar nicht einordnen. Aber von dir kann ich das verlangen, du bist schließlich vom Fach!“
Alexander entschied, sich nicht einschüchtern zu lassen. „Müller-IT hat diese Schwebzeuge erst vor ein paar Tagen geliefert bekommen“, sagte er ruhig. „Dass die bestellt wurden, daran habe auch ich einen gewissen Anteil. Aber nicht nur ich, die ganze Abteilungsleiter-Ebene hat Druck gemacht. Das war vor einem halben Jahr; damals war in Berlin noch alles ruhig. Nun sieht es natürlich anders aus, ich gebe das zu. Aber es würde ziemlich blöd wirken, wenn jetzt niemand diese Dinger benutzen würde.“
„Und das musstest ausgerechnet du sein?“ Paul schüttelte den Kopf. „Das meiste hast du ja gar nicht mitbekommen, du stecktest ja in deinem Airbag und warst bewusstlos.“
„So? Was gab es denn noch?“
„Nach deinem Zusammenstoß mit dem Balcar ist der Baofeng die Straße entlanggeschrammt, hat noch einen Lichtmast mit Ampel mitgenommen und ist dann auf der Kreuzug Kurfürstendamm mit einem Linienbus kollidiert. Mehrere Krankenwagen waren sofort da, auch die Polizei. Ein Riesenauflauf.“
Alexander fand, dass sein alter Herr die Dinge maßlos aufbauschte. „Hmm…“, brummte er. „Na schön. Der ganze Einsatz. Aber letztlich muss man doch festhalten: Nicht ich habe den Absturz verursacht. Ich hätte ihn vielleicht verhindern können, zugegeben. Trotzdem bin ich das Opfer, nicht der Täter. Ich bin es, der abgeschossen wurde! Auf mich ist ein Anschlag verübt worden! Sollten wir uns nicht darauf konzentrieren? Auf den ursächlichen Vorgang und die mutmaßlichen Täter?“
Draußen war es dämmrig geworden, und auch im Zimmer nahm das Licht ab. Alexander ging zur Stehlampe neben der Couch, knippste sie an und trat wieder neben seinen Vater, der sich erneut dem Fenster zugewandt hatte. Am gegenüberliegenden Ufer blinkten schon die ersten Lichter; letzte Freizeitboote zogen Striche in die glattgebürstete Wasserfläche und strebten ihren Liegeplätzen zu.
„Du hast natürlich Recht“, räumte sein Vater ein, seine Stimme jetzt bedeutend ruhiger. „Der Vorfall wirft eine Menge Fragen auf. Du bist das Opfer, richtig. Ich glaube, die Hypothese, dass es sich um einen Unfall handelte, können wir ausschließen.“
„Das glaube ich auch. Die Starfly hat den Baofeng immer wieder bedrängt, was darauf schließen lässt, dass ihr eigener Ausweichmechanismus ausgeschaltet war. Und sie hat mich zielstrebig verfolgt. Und abgeschossen!“
„Gut! Es ging also um einen geplanten Abschuss! Aber wer war das Ziel?“
„Na, ich…“
„Du persönlich? Oder einfach irgendein Mitglied unserer Familie? Oder der Patrizialen? Oder du als Waffenhändler? Die richtige Antwort engt den Kreis möglicher Täter entscheidend ein.“
Alexander betrachtete sinnend die glitzernde düstere Fläche der Havel. „Oder umgekehrt. Erst wenn wir den Täter kennen, wissen wir, wen er gemeint hat.“
„Hmm… und wer könnten die Täter sein? Eine Revoluzzergruppe der Prekarier? Agenten der WESPAC? Eine Müller-IT feindlich gesonnene Konkurrenzfirma?
Oder einfach eine Verbrecherbande, die dich entführen und uns erpressen will?“
Alexander zuckte mit den Schultern. „Das kann alles sein…“ Plötzlich grinste er seinen Vater an und freute sich wie ein kleines Kind. „Aber einen klaren Hinweis gibt es schon!“
„Aha. Und welchen?“
„Es war eine Polizeidrohne!“, erklärte Alex. „Es war eine Starfly, ausgerüstet mit einer EMP-Kanone. Solche Drohnen hat hier in der Region nur die Berliner Polizei. Ja, wenn ich mich recht erinnere, hat Müller vor einem halben Jahr zehn Stück in dieser Version an die Behörde geliefert.“
Paul sah seinen Sohn ungläubig an, dann hellte sich sein Gesicht auf. „Also fällt der erste Verdacht auf die Polizei selbst.“ Jetzt grinste auch er.
„Genau. Die erste Annahme ist die, dass die Polizei mich aus dem Verkehr gezogen hat. Sie müssen also gegen sich selbst ermitteln.“
„Na dann gute Nacht, Marie. Das heißt auf Deutsch, dass sie alle anderen Spuren mit doppelter Inbrunst verfolgen werden.“ Plötzlich verfinsterte sich seine Miene erneut. „Oder hatten sie etwa einen Grund, dich abzuschießen?“
„Also ich wüsste nicht, welchen. Aber vielleicht stellt das für die Bullen nicht unbedingt ein Problem dar.“
Alexander leerte sein Glas. Plötzlich holte er unvermittelt mit der Hand aus, als wolle er das bisher Gesagte vom Tisch wischen. „Das sind doch alles Spekulationen!“, rief er. „Die Polizei kann es nicht gewesen sein, das wäre doch ein Witz. Die schießen nicht einfach Schwebzeuge vom Himmel – ohne vorherigen Schriftverkehr, ohne Vorwahrnung. Nein, es muss so sein: Jemand hat sich in das Polizeinetz gehackt und von dort aus die Steuerung der Drohne manipuliert. Derjenige – oder diejenigen, die das getan haben, müssen über ausgezeichnete IT-Kenntnisse verfügen.“
„Also… WESPAC oder Untergrund, Prekarier.“
„Oder beide zusammen.“
„Möglich.“ Paul Lery wiegte sein weißhaariges Haupt. „Möchtest du auch noch einen?“
Alexander hielt ihm sein Glas hin, und sein Vater schenkte erst ihm, dann sich selbst ein. Draußen war es jetzt fast ganz dunkel, und in den Scheiben sahen sie hauptsächlich ihr Spiegelbild und das der Stehlampe. Dahinter undeutlich das Postkartenfoto eines nächtlich erleuchteten Sees. Ein Bild des Friedens.
„Es ist schon nicht erfreulich, wie sich die Welt entwickelt hat“, seufzte Paul in einer plötzlichen Anwandlung von Melancholie. „Was waren wir in meiner Jugend doch optimistisch. Alles würde immer besser werden: Emanzipation der Frauen, Schutz der Minderheiten, der Umwelt… und die Einigung Europas! Nie wieder Krieg in Europa! Unsere Eltern, das waren für uns – Pardon! – Idioten, die das Leben nicht begriffen hatten. Aber wir – wir würden es ihnen zeigen. Wir würden es endlich richten. Und was ist daraus geworden?“ Er sah seinen Sohn voller Bitterkeit an, als sei der zum Teil für die Misere verantwortlich.
„Aber Vater – das ist doch über achzig Jahre her!“, sagte Alexander begütigend. Er hatte den Stimmungsumschwung seines alten Herrn wohl wahrgenommen. „Was hilft es, in der Vergangenheit zu kramen. Sie war nicht so golden, wie du gerne glauben möchtest. Wir sollten vielmehr mutig nach vorne schauen!“ Als er sah, dass sich sein Vater erneut einschenkte – zum vierten Mal an diesem Abend –, fügte er hinzu: „Und vielleicht etwas weniger trinken!“
Sein Vater nickte, als stimme er etwas zu, das er gar nicht gehört hatte. „Sie war nicht so golden“, wiederholte er, „da hast du Recht. Aber sie war hoffnungsvoll! Wo, bitteschön, soll heute noch Hoffnung herkommen?“
Alexander hob das Glas ein wenig, als wolle er mit der Hand in eine bessere Zukunft weisen. „Hm! Vielleicht hast du ja teilweise Recht. Aber ich kann dir eines sagen: Die Leute haben Hoffnung! Genau wie damals!“
„Ja, die Jungen vielleicht. Die haben noch Hoffnung, weil sie keinen Vergleich haben. Das ist völlig in Ordnung, das ist ja auch schön so. Aber diejenigen, die schon über ein Jahrhundert leben, die haben keine mehr.
Die Europäische Union existiert nicht mehr, auch nicht die Nato. Deutschland ist Teil der Eurasischen Union