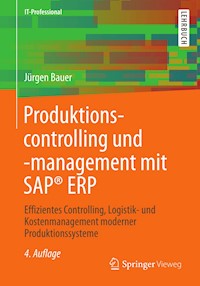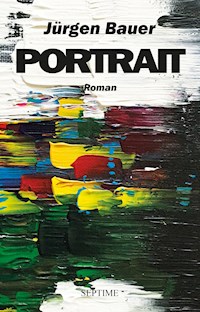15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Zäsur muss her. Eine Generalpause. Der Souffleuse eines großen Wiener Opernhauses reicht es. Als sie während einer Aufführung einer Sängerin ohne erkennbaren Grund den helfenden Einsatz verweigert, gerät ihr berufliches und privates Leben aus der Bahn. Madame Partitur, wie sie von allen nur genannt wird, zieht sich auf ihr Grundstück am Land zurück, in ein paradiesisches Gartenreich mit idyllischem Teich, das ihr verstorbener Mann, einst gefeierter Opernregisseur, mit Hingabe angelegt und gepflegt hatte. Längst jedoch verwildert dieses Vermächtnis, sie sieht sich der Aufgabe nicht gewachsen, es am Leben zu erhalten, und blickt mit Angst auf den bevorstehenden Frühling, wenn der Garten wieder erwachen wird. Nur die Intendantin des Opernhauses dient ihr in dieser Zeit als Stütze, bis ihr ein streunender Hund zuläuft, mit dem sie nun ihre Tage in Abgeschiedenheit verbringt. Als eines Tages ein Gärtner auf dem Grundstück auftaucht und seine Hilfe anbietet, blüht der Garten erneut auf, liebevoll und mit großer Einsicht kümmert er sich um die Pflanzen, bringt jedoch auch schmerzhafte Erinnerungen und verdrängte Schuldgefühle zurück. Was kommt wirklich nach einem Bruch? Welche Welt entsteht, nachdem etwas gestorben ist? Und was geschieht, wenn Dinge und Menschen die Chance auf ein zweites Leben bekommen? Styx ist ein Roman über Verlust, Einsamkeit und Neuanfang, der mit Musikalität und Witz die Verbindungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auslotet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Overtüre
Erster Akt
Zweiter Akt
Dritter Akt
Vierter Akt
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei der Stadt Wien.
Die Arbeit des Autors wurde durch ein Arbeitsstipendium des Landes Burgenland unterstützt.
© 2024, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Stefanie Jaksch
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagbild: © i-stock
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-99120-039-0
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag
ISBN: 978-3-99120-033-8
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.instagram.com/septimeverlag
Jürgen Bauer
geboren 1981, lebt in Wien. Seine journalistischen Texte erscheinen in internationalen Zeitungen und Zeitschriften. Seit 2013 veröffentlichte er im Septime Verlag insgesamt vier Romane. Mit seinem dritten Roman, Ein guter Mensch, schaffte er den Sprung über die österreichischen Grenzen und wurde im gesamten deutsch- sprachigen Raum rezipiert. Der Roman erzählt von einer Welt, in der die Ressource Wasser knapp wird, und wurde von der Kritik als »großartige, fesselnde Social-Fiction« bezeichnet. Mit Portrait, erschienen 2020, gelang der erste Bestseller eines österreichischen Autors im Septime Verlag.
Mareike Fallwickl bezeichnete Bauers Prosa als klug, scharfzüngig, spannend und intelligent, im ORF wurde sein Schreiben mit den Attributen glaubhaft, erschütternd und erhellend bezeichnet.
Klappentext:
Eine Zäsur muss her. Eine Generalpause. Der Souffleuse eines großen Wiener Opernhauses reicht es. Als sie wäh- rend einer Aufführung einer Sängerin ohne erkennbaren Grund den helfenden Einsatz verweigert, gerät ihr berufli- ches und privates Leben aus der Bahn.
Madame Partitur, wie sie von allen nur genannt wird, zieht sich auf ihr Grundstück am Land zurück, in ein para- diesisches Gartenreich mit idyllischem Teich, das ihr ver- storbener Mann, einst gefeierter Opernregisseur, mit Hin- gabe angelegt und gepflegt hatte. Längst jedoch verwildert dieses Vermächtnis, sie sieht sich der Aufgabe nicht ge- wachsen, es am Leben zu erhalten, und blickt mit Angst auf den bevorstehenden Frühling, wenn der Garten wieder erwachen wird.
Nur die Intendantin des Opernhauses dient ihr in dieser Zeit als Stütze, bis ihr ein streunender Hund zuläuft, mit dem sie nun ihre Tage in Abgeschiedenheit verbringt.
Als eines Tages ein Gärtner auf dem Grundstück auf- taucht und seine Hilfe anbietet, blüht der Garten erneut auf, liebevoll und mit großer Einsicht kümmert er sich um die Pflanzen, bringt jedoch auch schmerzhafte Erinnerun- gen und verdrängte Schuldgefühle zurück.
Was kommt wirklich nach einem Bruch? Welche Welt ent- steht, nachdem etwas gestorben ist? Und was geschieht, wenn Dinge und Menschen die Chance auf ein zweites Leben bekommen? Styx ist ein Roman über Verlust, Ein- samkeit und Neuanfang, der mit Musikalität und Witz die Verbindungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auslotet.
Jürgen Bauer
Styx
Roman | Septime Verlag
Sage mir ja kein verschönerndes Wort für den Tod, mein Odysseus! / Strahlender! Lieber wäre ich Knecht auf den Feldern und fronte / Dort einem anderen Mann ohne Land und mit wenig Vermögen; / Lieber tät‘ ichs als herrschen bei allen verstorbenen Toten.
(Od. XI, 11,488-91)
Ouvertüre
Stille.
Kein Wort gebe ich von mir.
Soll sie doch sterben da oben.
Der Klang des Orchesters hinter mir.
Es braucht einen Bruch.
Erster Akt
Winter
Ich sitze in meinem Auto und plappere vor mich hin.
Alsgäbe es kein Morgen.
Vor mir liegen noch dreißig Minuten auf der Autobahn. Hier das Opernhaus, dort mein ...
... nicht Zuhause.
Immer noch nicht.
Nicht einmal unser Zuhause.
Sein Zuhause.
Ich fahre dreißig Minuten, in denen ich das gesamte Libretto der Oper nachplappere, die heute Abend aufgeführt wurde, alle Rollen, ich kann sie auswendig, habe jede Seelenregung in mir abgespeichert. Ich verstehe meinen Job. Ich habe mich nur entschieden, ihn nicht auszuführen. »Lucia di Lammermoor«, eine Nummer zu groß für unser Opernhaus und zwei Nummern zu groß für die Sängerin, die in der Hauptrolle besetzt war.
Ich singe die Melodien laut mit, denke an vieles. Nur nicht an ihn.
In der Ferne die Bergspitze, an der ich mich immer orientiere. Es ist ein kalter Tag, die Luft unendlich klar, die Heizung funktioniert nicht richtig, es ist das Auto meines Mannes, ich kurble das Fenster nach unten. Wenn schon kalt, dann richtig. Meine Nasenspitze fängt an zu kribbeln, meine Fingerspitzen. Meine Augen tränen, doch ich lasse das Fenster geöffnet. Ich kann fühlen, wie die Temperatur fällt, hier draußen auf dem Land. In kleinen Schritten von jeweils einem halben Grad. Immer weiter Richtung Gefrierpunkt und dann darunter. Links die Pfingstkirche, vor etlichen Jahren eröffnet, jedes Jahr vergrößert. Immer noch ein Zubau. Der Parkplatz voller Autos, große Karossen. Pfingsten. Geburtstag der Kirche.
Happy Birthday, etwas Neues entsteht.
Meine Hände auf dem Lenkrad, voller Falten, die Fingernägel gelblich, obwohl ich seit Jahren nicht mehr rauche.
Ich bin alt geworden.
Verdammt, wann ist das passiert?
Der Blick auf die Landschaft. Die Furchen in den Feldern. Die Einfamilienhäuser, die sich hier und da ballen, dann wieder in Felder und Industriebrachen auslaufen. Die kurvenreiche Straße, vorbei am letzten Bahnhof der Gegend, durch den Wald, auf den Feldweg, in Richtung der Hütte. Die Temperatur fällt weiter.
Ich plappere und singe die Oper zu Ende. In nur zwanzig Minuten bin ich am Schluss angekommen, nehme eigene Kürzungen vor. Auf der Bühne brauchen wir beinahe drei Stunden. Wegen dieser langen drei Stunden kommt niemand mehr in die Vorstellungen, sagen die Publikumsbefragungen, die jedes Jahr dem ganzen Opernhaus präsentiert werden, viel zu langfürheutige Menschen, dafür hat niemand mehr Geduld. Was soll ich machen, schneller soufflieren?
Ich hatte eine Freundin, die sagte nach jeder Vorstellung das Selbe: Gut, aber eine halbe Stunde zu lang.
»Götterdämmerung«. Fünfeinhalb Stunden. Gut, aber eine halbe Stunde zu lang.
»Die Zauberflöte«. Drei Stunden. Gut, aber eine halbe Stunde zu lang.
»Herzog Blaubarts Burg«. Fünfzig Minuten. Gut, aber eine halbe Stunde zu lang.
Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr.
Ich schalte das Radio ein, bleibe am Rauschen zwischen den Sendern hängen. White Noise. Keine Musik, aber auch keine Stille. Hin und wieder fängt das Radio einen Sender ein, dann dringen Fetzen von Werbejingles an mein Ohr, verzerrte Worte der Moderatoren. Nur Männer. Als plötzlich der Refrain eines alten Songs durch das Auto plärrt, verreiße ich das Lenkrad, doch nach der nächsten Hügelkuppe ist der Empfang wieder weg und das Rauschen kehrt zurück. Nie wieder Musik, denke ich in diesem Moment, ich habe der Musik mein ganzes Leben gegeben, und was habe ich jetzt davon? Ein Moment des Schweigens, ein Moment der Stille, und schon bin ich aus der Bahn geworfen.
Nie wieder Musik.
Das halte ich nicht durch.
Was, wenn ich muss?
Nichtverlängerung.
Die droht mir nun.
Was für ein Wort.
Als stünde die Intendantin am Beatmungsgerät meiner Karriere. Nicht verlängert. Lebensverlängernd? Ein Leben für die Oper, so haben es die Freundinnen immer gesagt, als ich noch welche hatte: Du lebst nur für die Oper. Immer, wenn ich abends keine Zeit hatte, wenn mein Dienst im Souffleurkasten begann, in meinem kleinen Reich. Immer, wenn ich pünktlich um achtzehn Uhr in die Oper aufbrach und alle gemeinsamen Pläne vorzeitig beendete: Es tut mir leid, ihr wisst ja.
Ja, wir wissen, aber kannst du nicht einmal, ausnahmsweise?
Einmal die Sängerinnen und Sänger allein lassen? Nein, das kann ich nicht.
Können die ihren Text nicht auswendig? Was machen die nur ohne dich, die werden doch auch ohne Einsagerin zurechtkommen, ein einziges Mal. Wie meine Kinder. Ich lasse doch meine Kinder auch mal allein, und deine Sänger, die sind doch längst erwachsen.
Und dann das Gelächter der Freundinnen.
Kinder, Sänger, einerleifürsie.
Darum hast du keine Kinder, sagten sie dann immer, deine Kinder stehen auf der Bühne und brauchen dich. Aber zumindest kannst du ihnen sagen, was sie zu tun haben, und sie müssen gehorchen. Müssen dir nachsprechen. Du hast sie in der Hand, das muss atemberaubend sein.
Mein Mann war gut in Freundschaften, er konnte sie hegen und pflegen.
Ich nicht.
Die Nichtverlängerung kommt bestimmt.
Noch eine Woche, bis sie spätestens ausgesprochen werden muss. Bevor der Vertrag sich automatisch um ein Jahr verlängert. Und ausgerechnet jetzt sage ich der dummen Kuh den Satz nicht ein, den sie immer vergisst, in jeder Vorstellung. Ich höre das Orchester hinter mir und sehe die panischen Augen der Sopranistin vor mir. Und bleibe einfach still, sage gar nichts.
Ich weiß nicht, ob ich sie schlimm finde. Die Nichtverlängerung. Ich sollte sie schlimm finden, finde sie schlimm, finde ich sie wirklich schlimm? Wie wird mein Leben danach aussehen? Was werde ich machen, ohne die Welt, die ich so gut kenne wie sonst nichts?
Zuerst hatte ich nur vergessen, ihr den Satz einzusagen. Ich, die Souffleuse, hatte vergessen, was zu tun war. Und sie hatte mich schreckensstarr angesehen. Dem Vergessen folgte dann die Entscheidung. Die bewusste Entscheidung: Ich lasse dich sterben da oben. Ich sage kein Wort. Die Sängerin auf der Bühne. Ihr Blick, verzweifelt zuerst, dann wütend. Ich habe sie hängen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und plötzlich begriff ich etwas, aber dieses Begreifen war wie ein Blitz, dem kein Donner folgt, es hinterließ keine Spur in mir. Ich wartete. Ihr Hänger war phänomenal, komplette Stille aus ihrem Mund, als hätte man die Stimmbänder entfernt. Kein Verlustfürdie Musikwelt. Sie klingt selbst an guten Abenden wie ein Moskito, den man in einer heißen Nacht erschlagen will, den man aber nicht findet, sobald man das Licht anschaltet. Sie glaubt, gute Töne entstünden durch exzessive Mimik.
Sekunden der Stille.
Gefühlte Stunden.
Ich genoss es.
Ihren Blick.
Als müsse sie nießen und könne nicht.
Noch eine Sekunde, sagte ich mir, und noch eine Sekunde, und noch eine. Und immer war ich kurz davor, das rettende Wort zu sagen, öffnete sanft die Lippen, doch nein. Noch eine Sekunde. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß und einfach nichts sagte, während die Sopranistin auf der Bühne stand und einfach nichts sang. Ich wollte einmal der Grund für das Entsetzen sein, wenn im gewohnten Lauf der Dinge ein Riss entsteht. Eine Generalpause konnte ich nicht erzwingen, nur diese kurze Unterbrechung. Ich wollte die Sopranistin aus ihrem Charakter reißen, aus ihrer Geschichte. Der Zuschauerraum war ja ohnehin leer, nur eine Kamera, die das Schweigen der Sopranistin in die Welt übertrug. Live. Zehntausende Menschen sahen ihr Schweigen, wenn man den offiziellen Zahlen der Intendantin glaubt, was ich normalerweise nicht tue, jetzt aber schon, denn zehntausende Menschen, die mit ausdruckslosen Gesichtern auf ein ebenso ausdrucksloses Gesicht auf ihrem Bildschirm starren, das stelle ich mir witzig vor. Ich lachte, unten in meinem Souffleurkasten, doch ohne einen Laut von mir zu geben. Die Sopranistin auf der Bühne dachte sicher, ich lache sie aus. Dabei hätte sie besser mit mir lachen sollen. Sie sang für einen leeren Zuschauerraum, verschwendete ihre Kraft für ein großes Nichts, das ist doch lachhaft. Und unendlich traurig.
Ich wurde boshaft in meinem Kasten. Formte endlich Worte mit meinem Mund, die nicht in diese Oper gehören. Knödel. Intrige. Aber natürlich, das wusste sie, dass das nicht die richtigen Worte waren. Eine Freude, sie schwitzen zu sehen.
War ich ein Arschloch?
Und was für eines, ein ganz besonders großes.
Machte es mir Freude?
Und wie.
Die Panik in den Rehaugen.
Unbezahlbar.
Ich hatte getrunken. Nicht viel, normalerweise trinke ich gar nicht im Dienst, ich trinke nicht einmal außer Dienst, aber mir war danach gewesen. Den Wein meines verstorbenen Mannes, mitgebracht aus Frankreich, ein Mitbringsel seiner letzten Opernfestspiele. Stell dir vor, es ist Oper und niemand sitzt im Zuschauerraum, ist es dann überhauptDienstzeit, wenn die Souffleuse sich ein Gläschen genehmigt?
Ich wartete lange, die Sängerin spielte ihren Part stumm weiter, die Bühnenpartner irritiert, aber von faszinierender Professionalität.
Ich saß still im Souffleurkasten, Herrin meines Raumes, nicht auf die Seitenbühne verbannt wie an anderen Opernhäusern, noch nicht, nahm mein Glas zur Hand, leerte mir etwas Wein nach und prostete ihr zu. Sie wird mich umbringen, dachte ich. Und dann sang ich mit. Aber nicht »Lucia di Lammermoor«.
Nicht die Oper, in der sie gerade auftrat.
Ich sang die Schlussarie der »Traviata«, eine alte Erinnerung.
Und sah meine Mutter vor mir, in der Blüte ihrer Karriere.
Die Sopranistin fing sich, fand ihre Worte wieder, auch ohne mein Zutun, die Vorstellung ging zu Ende, die Kamera applaudierte nicht.
Stille, als der Vorhang fiel, nur das Geräusch der Musikerinnen und Musiker, die ihre Instrumente packten, ohne ein Wort zu sagen aus dem Graben flüchteten, die Geräusche der Technik, die hinter dem Vorhang schon mit ihrer Arbeit begann. Kein Publikum, Totenstille.
Die Intendantin laut aus ihrer Direktionsloge: Auf ein Wort.
Doch auf dieses Wort wartete ich nicht, verschwand einfach. Packte die vor mir liegende Fassung der Partitur zusammen, stopfte sie in meine Tasche, obwohl sie eigentlich immer im Opernhaus bleiben muss, schaltete meine kleine Lampe aus und schummelte mich aus dem Souffleurkasten durch den schon leeren Orchestergraben, durch unterirdische Gänge, hinaus aus den Katakomben, am Portier vorbei ins Licht.
»Lucia di Lammermoor«: Eine Oper über eine Frau, die aus Gründen der Politik heiraten soll und in den Wahnsinn getrieben wird. Ich hatte die Sopranistin noch im ersten Akt unterbrochen. In jener Szene, in der Lucia ihrer Betreuerin von einer Vision erzählt, in welcher ihr der Geist einer ermordeten Frau erscheint, umgebracht von ihrem Geliebten, an genau diesem Ort. Dem Sirenenbrunnen. Und in genau diesem Brunnen entsorgt. Wunderbar makaber.
Und noch wunderbarer, wenn die Sopranistin keine Worte findet.
Ich lief durch menschenleere Straßen zu meinem Wagen, sah niemanden, auch keine Polizei, nur erleuchtete Fenster, die Menschen alle drinnen zusammengerottet, die Welt draußen ein furchteinflößender Ort.
***
Endlich komme ich bei der Hütte an. Vor mir die Holzbrücke, die über den kleinen Bach führt, das Tor. Ich steige aus dem Auto, hier ist es um fünf Grad kälter als in der Stadt.
Plötzlich ist da ein Hund.
Steht nur da.
Kein Nachbarshund auf Besuch. Ich habe nur einen Nachbar, und der hat nur eine Rinderzucht. Und Bienen.
Ich lehne mich ins Innere des Autos und hupe.
Der Hund verschwindet nicht.
Ich bewege mich ganz langsam.
Der Hund knurrt, aber es ist ein Knurren aus Angst, das spüre ich sofort. Ich weiß, wie man mit Hunden umgeht, habe keine Angst vor ihnen, auch vor diesem hier nicht. Ich gehe langsam an ihm vorbei, öffne das Tor und beobachte ihn dabei genauer. Ein schwarzes Ding, kniehoch, nicht schmutzig, aber kein Halsband. Haare, die aussehen, als bliebe man mit den Fingern in ihnen stecken, wenn man mit der Hand hindurchfährt. Auch er beobachtet mich, legt sich vor der warmen Motorhaube auf den Boden.
Na gut, du kannst gerne liegenbleiben, mich störst du nicht.
Im Inneren der Hütte ist es genauso kalt wie draußen. Ich kann meinen Atem als kleine Wolke sehen. Diese Kälte kennt man in der Stadt nicht mehr. Ich mache Feuer im Kamin, das kann ich. Knülle alte Theaterprogramme zusammen, lege Holzspäne darüber, kleine Scheite, zünde an. Die Flamme schießt hoch, zögert, verschlingt Papier und Holzspäne dann umso schneller. Ich setze mich vor den Kamin, ziehe meine Beine eng um den Körper und halte meine kalten Fingerspitzen vor die Flammen. Im Schlafzimmer gibt es einen kleinen Elektroofen, doch dessen Strahlen wärmen mich nicht richtig.
Ich versuche, an nichts zu denken.
Konzentriere mich auf das Knistern.
Ruhe, sage ich mir.
Völlige Ruhe.
Scheiße, das klappt nicht.
Ich stehe auf.
Schaue aus dem Fenster.
Der Hund ist noch da.
Steht aufrecht vor dem Auto, den Blick zur Hütte gerichtet.
Zu mir.
Was willst du?
Mein Mann hätte nicht gezögert.
Ich selbst habe keine Angst vor Hunden, aber sie glauben mir meine Autorität nicht, gehorchen mir nicht. Mein Mann hatte keine Skrupel, einen Hund auch einmal zu packen, wenn dieser knurrte, mein Mann war stets bereit, sich seine Stellung zu erkämpfen.
Eine Erinnerung, die aufplatzt und nicht mehr verschwindet.
Ich schiebe den Vorhang zur Seite. Der Hund hat sich vom Auto wegbewegt, liegt jetzt im Schnee vor der Eingangstür, ohne sich zu rühren. Der Erdboden draußen ist kalt, aber ich will den Hund nicht in die Hütte lassen. Ich gehe ins Wohnzimmer, wo mein Mann vor einigen Jahren eine Klappe zum Dachboden installiert hat, schleppe die Leiter aus der Abstellkammer, drücke die Holzdecke an der richtigen Stelle nach oben und schiebe die Abdeckung zur Seite. Ich klettere nicht auf den Dachboden, auf dem sich so viele Erinnerungen stapeln. Ich greife ins Dunkle und weiß immer noch, wo das alte Hundebett steht, damals schnell verstaut, ohne es einzupacken, ohne es noch einmal von den Hundehaaren zu befreien. Ich ziehe am Stoff und es fällt an mir vorbei nach unten, Staub wirbelt auf und der Geruch unseres alten Hundes. Ich verschließe die Dachbodenluke, ziehe das Hundebett ins Vorzimmer, hole eine alte Decke aus der Lade unter der Eckbank, öffne die Eingangstürund trete alles mit einer schnellen Bewegung nach draußen. Ich warte einen Moment, dann spähe ich durch das Fenster, das in die Türeingelassen ist. Der Hund betrachtet mein Geschenk mit Argwohn. Langsam, den Bauch auf den Boden gedrückt, kriecht er auf das Bett zu, riecht daran, verzieht sich, kommt zurück und riecht erneut, zieht an der Decke und schleift sie einmal durch den Schnee. Dann legt er sich auf das Hundebett, mit seinem Hinterteil zuerst, die Schnauze und die Vorderbeine noch nach oben gereckt, jederzeit bereit zur Flucht. Ich lasse ihn alleine, ziehe den Vorhang wieder zu und setze mich aufs Sofa.
Schalte den Fernseher ein, zur Ablenkung. Doch die ist nicht zu bekommen. Überall Meldungen von Infizierten, Zahlen von Kranken, auf allen Kanälen. Ich schalte den Fernseher aus, hole kaltes Essen aus dem Kühlschrank.
Als ich das nächste Mal nach draußen schaue, liegt der Hund bereits mit seinem ganzen Körper im Hundebett, die Decke um sich gewickelt, den Blick immer noch zur Tür gerichtet. Ich klopfe an die Fensterscheibe, wir sehen einander an. Ich strecke die Zunge heraus, er reagiert nicht. Ich ziehe Grimassen, doch der Hund sieht mich einfach nur an.
Kein Humor, dieses Vieh.
***
Die Nacht ist die Hölle.
Wie immer, seit damals.
Als wäre in mir eine zweite Version meiner selbst, nur in Schwarz. Diese Version kriecht in jede Extremität, streckt ihre Finger von innen in meine Finger, ihre Zehen in meine Zehen, ihren Kopf in meinen Kopf. Das zweite Ich in mir beugt alle Muskeln, zwingt meinen Körper in dieWaagrechte. Steh wieder auf, sage ich zu mir selbst, koch dir einen Tee und beruhige dich, doch das zweite Ich in mir lacht und verkrampft Arme und Beine.
Ich breche nicht zusammen, etwas in mir bricht mich zusammen.
Etwas, das zu mir gehört und doch nicht.
Nichtverlängerung.
Beruflicher Tod.
Ohne Beruf keine Fahrten mehr in die Stadt, keine Oper, keine Geschichten. Nur mehr diese Hütte. Die wie ein Lebewesen ist. Versorgt werden will, erhalten, die Zuwendung braucht. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Oder ob sie unter meinen Händen stirbt.
Mein Mann hatte sie einst geerbt.
Hatte seine Kindheit darin verbracht, Erinnerungen im Überfluss.
Damals, in seiner Heimat, noch an ihrem alten Ort, dem Ort seiner Eltern. Eine schöne Hütte, fast ein Haus, doch nicht zu groß, aus Holz gebaut, auf einen gemauerten Sockel gestellt, mit grünen Fensterläden und einem Kamin, doch viel zu weit weg von der Stadt, in der er inzwischen arbeitete, fast ein ganzer Tag nur für die Fahrt, das dazugehörige Grundstück so nicht zu bewirtschaften, bei den wenigen Besuchen im Jahr, oft nur während der Theaterferien im Sommer. Die Hütte drohte zu verfallen, dort in der Ferne, das Holz wurde trocken und brüchig, die Schindeln hatten ihre beste Zeit hinter sich. Mein Mann fuhr nicht mehr hin, konnte den Anblick nicht ertragen, den langsamen Tod nicht mitansehen.
Mein Auftritt.
Ich besaß ein Grundstück in der Nähe der Stadt, ein kühles Plätzchen, aber nicht mehr als ein Acker, darauf nur Unkraut und der Dung der Kühe, die der Nachbar ohne zu fragen darauf grasen ließ. Das Haus, das vor langer Zeit einmal hier gestanden war, hatten die Vorbesitzer abreißen lassen, man erkannte noch den Grundriss in der Erde, wenn man wusste, wo man schauen musste. Die Gegend war friedlich, zu nah an der Stadt für Urlaub, zu weit weg für hektische Pendler. Eine Figurine aus Ton hatte man hier einmal gefunden. Fünftausend Jahre alt. Aus der Bronzezeit einige Pläne, Besiedlungen aus früheren Zeiten. Und dann lange nichts. Bis die Landwirtschaft begann, das Erscheinungsbild sich veränderte. Der Fund von Steinkohle. Der Bau einer Bergbahn. Kurze Aufmerksamkeit, bis die Gegend wieder vergessen wurde.
Lass uns dem alten Holz neues Leben einhauchen, sagte mein Mann und machte sich an die Arbeit. Er beauftragte eine Firma mit der Übersiedlung. Wir sahen zu, wie die Hütte an ihrem alten Standort Holzbrett für Holzbrett auseinandergenommen wurde, in alle Einzelteile zerlegt, die Eingeweide feinsäuberlich entfernt, eine Operation ohne Skalpell, mit Kran und vielen Handwerkern. Dann sahen wir zu, wie die tote Hütte auf einen Lastwagen verladen wurde, fuhren dem zerlegten Gebäude auf der Autobahn hinterher. Und erlebten verwundert mit, wie aus den Einzelteilen wieder eine Hütte wurde, zusammengebaut aus Leichenteilen. Wir öffneten die Eingangstür, als die Handwerker gegangen waren, die Übersiedlung vollbracht.
Mein Mann weinte.
Warum weinst du?
Das ist das Zimmer, in dem das Bett stehen wird, in dem ich einmal sterben werde.
Ich lachte seine Worte weg.
Die Hütte ist wie Frankenstein, sagte mein Mann.
Wie Frankenstein?
Es ist noch die alte, aber auch nicht mehr.
Du meinst Frankensteins Monster.
Wir müssen etwas tun, sagte er, Leben zurückbringen, Natur.
Mein Mann grub die Rosenstöcke aus, die auf dem alten Grundstück vor der Hütte gestanden hatten. Er kratzte sich die Arme blutig, die Stirn, weil er auf Knien so tief unter die Äste rutschen musste, um die Wurzeln auszugraben. Er arbeitete stundenlang, mit völliger Hingabe. Ich fand ihn attraktiv, wie er sich das Blut aus dem Gesicht wischte, die Wurzelballen der Rosenstöcke feinsäuberlich einpackte, sein weißes Arbeitsshirt schmutzig von der Erde, die Hände aufgekratzt von den Dornen.
Narben, die ich später mit Salbe bestrich.
Mein Mann übersiedelte die Rosenstöcke mit einem Transporter. Pflanzte sie auf ihrem alten Platz vor der Hütte ein. Ließ eine neue Holzbrücke über den kleinen Bach vor dem Grundstück legen. In einem abgetragenen Krankenhaus fand er Steinfliesen, die er vor der Hütte zu einer wunderschönen Terrasse legte, auf Flohmärkten stöberte er Blumentröge auf, die zum Äußeren passten und neu gestrichen vor die Fenster gehängt werden konnten.
Und dann begann er, den Garten anzulegen.
Begann, aus meinem Acker etwas Schönes zu gestalten.
Alles hier gehört ihm, bis heute.
Ich bin hier nur zu Gast.
Auch wenn der Grund einmal von mir gekauft wurde.
Ohne ihn wäre die Erde bis heute noch tot.
Für das Leben sorgte er.
Fand Samen seltener Pflanzen auf Pflanzenflohmärkten, außerdem dünne Stecken, von denen ich nicht dachte, dass sie jemals wachsen würden, nicht mehr als abgerissene Triebe, Setzlinge. Er bearbeitete die Erde, grub Dinge ein, andere aus. Er war überzeugt, der Garten würde nur dadurch zu einem wirklichen Organismus, indem er die Dinge auch benannte. Also schrieb er alles in ein Buch, legte seine eigene Partitur zu allen Lebewesen an. Das hier wird einmal ein Baum, sagte er, das wächst sich zu einer Staude heraus, hier wird ein Busch stehen.
Ich stand vor dem Acker und sah nur Dreck, er aber irgendetwas mehr.
Schön wird es sein, schon im nächsten Frühjahr. Spätestens im übernächsten.
Ich versuchte, seine Freude nachzuvollziehen.
War überrascht von seinem plötzlichen Wunsch, etwas zum Leben zu bringen.
Ich beobachtete ihn. Und das Grundstück.
Den kleinen Bach, der im Frühjahr unter der Brücke hindurchfloss und auch im Sommer nie ganz austrocknete, die Rehe, die gegenüber dem Grundstück im Unterholz des Waldes auszumachen waren.
Allein ein Wort wie Unterholz.
Wäre mir früher nieüber dieLippen gekommen.
Ich hatte keinen grünen Daumen, konnte nicht einmal Basilikum züchten, auf dem Fensterbrett meiner Wohnung gegenüber dem Opernhaus, mit Blick auf die Schnellbahnstation.
Mein Mann versuchte mir zu erklären, nach welchen Regeln er den Garten bepflanzte. Von Frühjahr bis Herbst sollte überall etwas Lebendiges zu sehen sein, etwas Buntes. Er vergrub Knollen von Frühblühern, Schneeglöckchen und Krokussen, die sich über dasganze Grundstück vermehren sollten, er setzte Salbei und Lavendel an die trockenen Stellen des Gartens, an denen in der Mittagshitze jede Blume verdursten würde, gestaltete den steilen Hang hinter der Hütte mit Bleiwurz zu einer blauen Herbstwelle, fand Disteln, Waldmeister und Kamille, er verschlang jedes Gartenbuch, hielt sich beim Bepflanzen aber an keine der dort beschriebenen Regeln. Wenn er irgendwo eine Pflanze fand, die ihm gefiel, dann lief er so lange mit dem Topf durch den Garten, bis er einen Platz gefunden hatte, der ihm behagte. Dann stellte er den Topf ab, begutachtete die Stelle von der Terrasse aus, sah nach, von welcher Ecke des Gartens man die Farbe am besten erspähen konnte, und erst dann grub er den Wurzelballen ein.
Meine Regeln besagen eben auch, sagte er dann, dass es keine ewig gültigen Regeln gibt. Ich will etwas Mythisches, etwas Verwunschenes. Etwas, das es nirgends sonst mehr gibt, schon gar nicht in unserer vernünftigen Welt. Etwas Zauberhaftes.
Er las nur Bücher, die den Zauber eines Gartens beschrieben, nicht die Drecksarbeit. Hätte ich Bücherüber dieDrecksarbeit gelesen, sagte er dann immer, hätte ich das Mammutprojekt doch nie begonnen.
Warum plötzlich dieser Garten?
Weil er das Gegenteil der Oper ist. In die Oper stecke ich mein Herzblut, aber sie ist für die meisten im Zuschauerraum nicht mehr als eine nette Unterhaltung vor dem Abendessen. Etwas, das sie bei der Vorspeise schon wieder vergessen haben. Und selbst wenn Erinnerungen bleiben. Was ist das denn, eine Erinnerung? Eigentlich ein Nichts. Zumindest nichts Greifbares. Es bleibt nichts von dem ganzen Aufwand, all den Proben und Kämpfen. Vielleicht denkt irgendjemand einmal an eine Operninszenierung zurück, die er vor Jahren gesehen hat, aber die Details verschwinden doch, die Emotionen, die viele Arbeit am Ausdruck. Höchstens eine vage, verzerrte, falsche Erinnerung bleibt. Im Garten hat mein Tun eine Wirkung. Er ist etwas Bleibendes. Etwas, das auch nach meinem Tod noch da sein wird. Weiterwachsen. Wuchern. Leben. Etwas, das ich kontrollieren kann.
Gärtnern ist die Anti-Oper.
Der tatsächliche Grund war ein viel banalerer.
Davon bin ich bis heute überzeugt.
Die Regieaufträge ließen nach, seinen Namen kannten immer noch alle in der Opernwelt, er wurde geschätzt und hofiert, aber engagieren wollte ihn kaum mehr jemand. Die wenigen Regieaufträge ergriff er immer mutloser, dann die Einladung zu den Festspielen in Aix-en-Provence, seine letzte Arbeit. Unterrichten, dafür wurde er über Jahre hinweg immer wiederangefragt. Aber unterrichten wollte er auf keinen Fall. Unterrichten ist etwas für die, die es nicht mehr können oder nie konnten.
Im ersten Jahr des neu angelegten Gartens tat sich nicht viel.
Die frisch gepflanzten Lebewesen zogen sich zurück, entwickelten keine Blüten.
Ich war enttäuscht.
Er wartete zu.
Im zweiten Jahr explodierte der Garten.
Wuchs zu einem chaotischen, bunten Gemälde, das schön anzusehen, aber unmöglich zu pflegen war. Mein Mann ließ Kraut und Unkraut wachsen, schlug nur hier und da Schneisen in die Landschaft, damit man von einem Ort zum anderen kam, ohne etwas niedertreten zu müssen.
Ich verstand, dass es auch so etwas wie zu viel Leben geben kann.
Mein Mann wurde den Pflanzen nicht Herr, die er in unbändigem Enthusiasmus gepflanzt hatte.
Er musste sie wieder ausgraben, verschenken.
Doch niemand wollte sie haben.
Wir haben doch nur einen kleinen Balkon, wo sollen wir da eine Staude?
So redeten sie sich raus.
Er grub die Pflanzen wieder ein, konnte sie nicht sterben lassen.
Schnitt sie zurecht, stutzte sie.
Vieles blieb trotzdem Wildwuchs.
Jetzt ist tiefster Winter, alles tot.