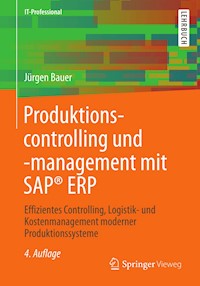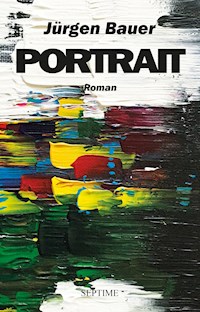12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das erste Mal fühlte ich die Angst, als mein Vater Kornkreise in ein Feld am Ortsrand trat und meine Mutter mich losschickte, um ihn nach Hause zu holen, bevor die Nachbarn etwas bemerken konnten." Georg erzählt aus seinem Leben, das von Unruhe und Angst gezeichnet ist. Die Furcht vor seinem psychisch kranken Vater lässt ihn an allen Versuchen scheitern, Vertrauen und Stabilität zu finden. Erst als Erwachsener gelingt es ihm, die Kontrolle über sein eigenes Leben zu erlangen und sich sicher zu fühlen, bis traumatische Ereignisse die Idylle zerreißen und sein Verfolgungswahn erneut ausbricht. Seine Mutter hält ihn für verrückt, Georgs Frau scheitert daran, ihn zu beschützen, und auch sein bester Freund glaubt nicht an seine Erzählungen. Doch was, wenn Georgs Ängste berechtigt sind und die Menschen in seinem Leben tatsächlich ein Geheimnis verbergen? Was, wenn sich wirklich alles nur um ihn dreht? Im Dialog zwischen Georg und seinem Gegenüber entwickelt sich ein Machtspiel um die Wahrheit und ihre Bedeutung. Doch wer entscheidet, ob eine Geschichte richtig erzählt ist? Vielleicht liegt die Lösung bei jener Person, der er seine Geschichte anvertraut. Schritt für Schritt wird Georgs Leben entblättert, bisherige Antworten werden infrage gestellt und müssen neu überdacht werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Leseproben
Jürgen Bauer - Das Fenster zur Welt
Christoph Flarer - Am achten Tag
Clint Hutzulak - Ein wunderschön tödliches Ende
Tobias Sommer - Dritte Haut
Tobias Sommer - Edens Garten
Tobias Sommer - Jagen 135
Jürgen Bauer, Was wir fürchten
E-Book
ISBN: 978-3-903061-09-5
© 2015, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Alexander Riha
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagfoto: © shutterstock-dubova
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-38-0
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag | www.twitter.com/septimeverlag
Jürgen Bauer
Geboren 1981, lebt in Wien. Im Rahmen des Studiums der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien, Amsterdam und Utrecht spezialisierte er sich auf Jüdisches Theater und veröffentlichte hierzu zahlreiche Artikel und Buchbeiträge. 2008 erschein sein Buch No Escape. Aspekte des Jüdischen im Theater von Barrie Kosky. Seine journalistischen Arbeiten zu Theater, Tanz und Oper erschienen regelmäßig in internationalen Zeitungen und Zeitschriften. Jürgen Bauer nahm mit seinen Theaterstücken zwei Mal am Programm »Neues Schreiben des Wiener Burgtheaters« teil. Das Fenster zur Welt ist sein Debütroman. 2014 wurde ihm das Aufenthaltsstipendium für junge deutschsprachige Autorinnen und Autoren des Literarischen Colloquiums Berlin zugesprochen.
2013 erschien bei Septime sein Debütroman Das Fenster zur Welt. 2015 erscheint mit Was wir fürchten sein zweiter Roman.
Klappentext
»Das erste Mal fühlte ich die Angst, als mein Vater Kornkreise in ein Feld am Ortsrand trat und meine Mutter mich losschickte, um ihn nach Hause zu holen, bevor die Nachbarn etwas bemerken konnten.«
Georg erzählt aus seinem Leben, das von Unruhe und Angst gezeichnet ist. Die Furcht vor seinem psychisch kranken Vater lässt ihn an allen Versuchen scheitern, Vertrauen und Stabilität zu finden. Erst als Erwachsener gelingt es ihm, die Kontrolle über sein Leben zu erlangen und sich sicher zu fühlen, bis traumatische Ereignisse die Idylle zerreißen und sein Verfolgungswahn erneut ausbricht.
Seine Mutter hält ihn für verrückt, Georgs Frau scheitert daran, ihn zu beschützen, und auch sein bester Freund glaubt nicht an seine Erzählungen.
Doch was, wenn Georgs Ängste berechtigt sind und die Menschen in seinem Leben tatsächlich ein Geheimnis verbergen? Was, wenn sich wirklich alles nur um ihn dreht?
Jürgen Bauer
Was wir fürchten
Roman | Septime Verlag
»And I’d sell my soul for
Total control
Oh I’d sell my soul for
Total control over you
Over you
Total control over you.«
The Motels
»Sometimes paranoia’s just having all the facts.«
William S. Burroughs
Setzen Sie sich, ich erzähle Ihnen jetzt meine Geschichte.
*
Alles begann mit dem blutenden Mädchen, das am Naschmarkt zitternd in meine Arme fiel.
Meine Frau meinte zwar bis zuletzt, sie habe schon davor Anzeichen eines Rückfalls bemerkt, doch das sollten Sie ihr nicht glauben. Die Mauerteile in unserer Wohnung, der Vorfall mit unserem Vermieter, das waren nur Warnschüsse gewesen, nicht mehr, vollständig aus der Bahn geworfen hat mich erst das kleine Mädchen am Naschmarkt. Bis zu diesem Vorfall war ich gut darin, meiner Frau ein normaler Ehemann zu sein. Dazu musste ich lügen, musste mich selbst in zwei Personen teilen, aber wenn ich dadurch mein Leben in gewohnten Bahnen weiterleben konnte, war es mir recht. Es ging mir damals schon über so lange Zeit gut wie nie zuvor in meinem Leben. Ich durfte nicht zulassen, dass dieser Zustand so schnell enden würde. Zumindest nicht, ohne alle Beweise zusammenzuhaben, und die würde ich erst einige Wochen später in Händen halten. Erst dann würde ich es schaffen, endlich zu handeln und den Plan in die Tat umzusetzen, der seit geraumer Zeit in mir Form annahm. Doch noch war ich nicht bereit dazu.
Am Tag zuvor hatten wir meinen dreiunddreißigsten Geburtstag gefeiert, und obwohl ich früher nie gedacht hatte, dass ich je so alt werden würde, war ich doch zufrieden mit meinem Leben. In mir brodelte es zwar, aber das war ein Zustand, der mir seit Kindheit an vertraut war und mich nicht mehr überraschen konnte. Meine Frau bekam von all dem nichts mit, und das war das Wichtigste.
Ich dachte:
»Das ist alles nur in deinem Kopf.«
Ich dachte:
»Halt einfach den Mund und sei still.«
Alles, was in dieser Zeit passierte, fiel irgendwie an seinen richtigen Platz, nicht aber der verletzte Körper in meinen Armen, mit dem alles von Neuem begann. An dieser Stelle muss ich Ihnen wahrscheinlich von zwei Dingen erzählen: von dem Vorfall am Naschmarkt und von der Angst, die von da an mein Leben erneut bestimmte. Die Geschichte des kleinen Mädchens erzählt sich allerdings um einiges leichter, auch wenn das für Sie sicher schwer zu glauben ist. Für mich wurde sie zum Neubeginn von etwas, das ich längst in meiner Vergangenheit begraben geglaubt hatte. Nun musste ich von einer Sekunde auf die andere begreifen, dass ich mich selbst belogen hatte. Ich hatte geglaubt, ein ruhiges Leben mit meiner Frau führen zu können, ich hatte mir selbst eingeredet, dass Normalität möglich war. Nun wurde ich eines Besseren belehrt.
Es war ein Samstag. Wir hatten nach dem Aufstehen noch schnell einen Kaffee in der Küche getrunken, bevor ich mich auf den Weg zum Naschmarkt machte, um für ein ausgiebiges Frühstück einzukaufen. Es war Sommer und brütend heiß, also hatte ich nur Jeans und ein weißes T-Shirt angezogen, in der Hand hielt ich eine Tasche für die Einkäufe, die mir meine Frau kurz zuvor in die Hand gedrückt hatte, als sie mich zum Abschied auf den Mund küsste. Ich erinnere mich noch genau an diesen einen Moment in der offenen Tür. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich Sylvia geküsst habe. Wirklich geküsst, nur aus Zuneigung und Liebe, ohne Hintergedanken, ohne den Kuss als Erpressung zu benutzen, als Absicherung oder gar als Druckmittel. Danach war alles irgendwie anders. Aus dem Stiegenhaus strich ein angenehm kühler Windhauch in das Vorzimmer unserer Wohnung, in der die heiße Luft diesen Sommer ohne Bewegung stand und dafür sorgte, dass man selbst nackt Schweißausbrüche bekam. Meine Frau war wunderschön an diesem Tag, vielleicht wollte ich sie auch nur wunderschön finden, weil ich endlich wieder unbeschwert sein mochte. Unbeschwert und sicher. In ihren zerzausten Haaren erkannte ich erste graue Strähnen, ich sah ihr breites Lächeln und vor allem die feinen Linien im Gesicht, die der Kopfpolster hinterlassen hatte, die kleinen Falten um ihre Augen und die etwas größeren, die sich von ihrem Mund zu ihrer Nase zogen. Meine Frau war einige Jahre älter als ich, was mir jene Sicherheit und Stabilität gab, die ich so dringend benötige. Ich erinnere mich heute noch gut an ihr Äußeres, obwohl das Bild des blutenden Mädchens so viel stärker ist. Die Gedanken an das Lächeln meiner Frau an diesem einen Morgen hat es trotzdem nicht völlig ausgelöscht. Ihren Körper betrachtete ich damals nicht mehr, er hatte sich seit unserem ersten Treffen nicht verändert, ich musste ihn nicht mehr ansehen, um ihn mir vorstellen zu können. Ihr Gesicht jedoch erschien mir jeden Tag wie ausgewechselt, weshalb ich es mir immer aufs Neue einprägen musste. Doch ausgerechnet an den Ausdruck in ihren Augen an diesem einen Morgen kann ich mich nicht mehr erinnern, vielleicht weil ich schon damals den Hauch einer Lüge in ihrem Blick zu erahnen meinte. Dabei habe ich meine Frau damals noch geliebt, ganz ohne den Zweifel anderer Gefühle. Ich liebte sie an diesem Morgen endlich wieder, fühlte erneut jenes Gefühl in mir, das ich schon Jahre zuvor bei dem Vorfall mit dem Messer in unserer Küche gefühlt hatte. Deswegen erinnere ich mich noch so gut, deswegen hat sich das Bild des Abschieds, der doch nur einem kurzen Abstecher zum Markt gelten sollte, so sehr in mein Gedächtnis eingeprägt.
Einige Minuten später tauchte ich in das Gewühl des Naschmarktes ein und drückte mich an den Menschenmassen vorbei zu den Ständen, um das Übliche für ein Wochenendfrühstück zu kaufen. Die Hitze, die in den engen Gassen noch unerträglicher war, sorgte dafür, dass die Gerüche aggressiver als sonst in meine Nase drangen. Vor allem der Gestank des rohen Fleisches, der vor den hinteren Ständen bewegungslos in der Luft hing, war ekelerregend. Die Fleischstücke, die hautlosen Hühner und zerhackten Rinderteile attackierten meinen nüchternen Magen. Obwohl ich zunächst die Luft anhielt und dann nur durch den Mund atmete, vermischten sich die Fleischgerüche in meiner Nase mit den Ausdünstungen der Menschenmassen.
Ich erzähle das so detailliert, weil Sie mir sonst nicht glauben, dass es mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gut ging, dass ich meine Krankheit, die von Heerscharen an Ärzten diagnostiziert worden war, endlich hinter mir gelassen hatte, auch wenn meine Frau das bis zu unserem letzten Gespräch abgestritten hat. Sie wissen ja selbst, wie sehr ich mich vor Menschenmassen fürchte, wie groß meine Angst vor Ansammlungen Fremder ist, wie schnell ich in überfüllten Räumen Panikanfälle bekomme, die meinen Hals zuschnüren und mich buchstäblich zu Boden drücken. In anderen Zeiten hätte ich es an einem Samstagvormittag nicht einmal in die Nähe des Naschmarktes geschafft. Ich hätte schon Probleme dabei gehabt, einen Fuß auf die Straße zu setzen, an schlimmen Tagen, wie ich diese Schübe noch heute nenne. Ich wäre in Schweiß ausgebrochen, hätte das Pochen meines Herzens bis in meine Fingerspitzen gefühlt, hätte auf das vertraute Gefühl gewartet, langsam immer kleiner und kleiner zu werden, schließlich ganz zu verschwinden, von den Menschen um mich nicht mehr wahrgenommen zu werden, nicht mehr ich zu sein. Nichts zu sein.
Doch nicht dieses Mal, mein Abstieg stand damals erst bevor. Ich blieb ganz ruhig, ich wartete auf mein Gemüse, mein Fladenbrot, auf meinen Käse. Ich dachte sogar noch daran, wie viel Kraft mich meine Entwicklung hin zu diesem Punkt gekostet hatte. Ich war stolz auf mich, ein neues Gefühl in meinem Leben.
Ich dachte an die Worte meiner Mutter:
»Ich mache mir Sorgen um dich. Wir brauchen einen Arzt.«
Sie hatte doch unrecht behalten. Es hatte lange gedauert, aber jetzt konnte ich ihr endlich zeigen, dass ich anders war als mein Vater, dass ich mich geändert hatte. Ich war ein neuer Mensch geworden. Als ich meine Einkäufe endlich verstaut hatte, war ich bereits auf dem Rückweg, als der Unfall mit dem kleinen Mädchen passierte. Ich fühle mich noch heute verantwortlich für das, was damals geschah.
Ich lief zwischen zwei Ständen hindurch zur Straße, und auch wenn da kein Fußgängerübergang und keine Ampel waren, war es doch der schnellste Weg nach Hause. Ich hörte nicht auf meine Angst, ich lief einfach los. Ich wollte zurück zu Sylvia, ich wollte unsere verletzte Wohnung nicht zu lange aus den Augen lassen, ich wollte die Löcher in der Wand weiter beobachten. Ich sah das Auto nicht kommen, das können Sie mir glauben. Ich kann mir bis heute nicht erklären, aus welcher Seitenstraße es herausgerast sein musste, ohne dass ich etwas gehört habe, das Aufbrausen eines Motors zum Beispiel oder das Quietschen von Reifen auf dem heißen Asphalt. In meiner Erinnerung ist es seltsam still, sind die Geräusche des Marktes gedämpft, bis der Lärm ganz plötzlich und ohne Vorwarnung ausbricht. Die Geschehnisse dieses Tages haben sich in meinen Kopf eingebrannt, doch hier verschwimmen die Eindrücke jedes Mal. Ich höre noch das langgezogene Hupen des Autos, das Abwürgen des Motors und dann den Schrei des Kindes. Diese drei Geräusche haben sich über die Jahre, die seither vergangen sind, in ein Musikstück des Horrors verwandelt. In eine Begleitmusik meines Lebens, das von da an erneut einen komplett anderen Weg einschlug. Einen Weg, von dem ich noch kurz zuvor gehofft hatte, ihn vermeiden zu können, entgegen den Prognosen meiner Ärzte, entgegen den Befürchtungen meiner Mutter. Ich höre die unerträglich lauten Geräusche noch heute in meinem Kopf, viel lauter, als sie in der sogenannten Wirklichkeit gewesen sein konnten. Irgendetwas stimmt an dieser Erinnerung nicht, aber das spielt nicht wirklich eine Rolle. Meine Frau hatte einmal gemeint, für mich sei ohnehin realer, was in meinem Kopf passiert, als das was in der Welt um mich herum vorgeht. Die Geräusche brechen an dieser Stelle plötzlich ab und die Bilder laufen stumm weiter. Das blutende Bein des Mädchens, die klaren Tränen auf ihren Wangen und überall verstreut meine Einkäufe, die die Szene in ein Stillleben verwandelten. Die grünen Paprika, die roten Tomaten, die vielen kleinen Oliven, die die Straße entlangrollten. Ich bemerkte jede Kleinigkeit, verband die drei Eindrücke, genau wie bei den Geräuschen, zu einem seltsamen Dreieck an Sinneseindrücken, das den gerade noch abgewendeten Tod des Mädchens bedeutete.
Und dann, etwas später, die leicht getönte Scheibe des Autos, durch die man nur schwer ins Wageninnere sehen konnte.
Was zuvor geschehen war, erzählte mir die Polizei erst einige Zeit später. Ich selbst hätte aus den Geräuschen und Bildern, die ich noch heute nicht miteinander in Verbindung bringe, keine sinnvolle Geschichte formen können, doch der offiziellen Erzählung konnte ich ebensowenig vertrauen. Angeblich war das Auto auf mich zugerast, ohne dass ich es bemerkt hatte. Das kleine Mädchen auf der anderen Straßenseite hatte mich warnen wollen, sich von der Hand seiner Mutter losgerissen und einen Schritt nach vorne getan. Einen winzigen Schritt, der trotzdem ausreichte. Ich hatte sie noch rechtzeitig gesehen, so erklärte man mir, und war auf sie zugelaufen, aber an das alles kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich muss sie wohl tatsächlich gerettet haben, das war das einzige Detail der Geschichte, das ich glaubte, selbst wenn dazu keine Bilder in meinem Kopf existierten. Bis heute jedoch verstehe ich an dieser Version eines nicht: Wenn ich noch genug Zeit gehabt hatte, sie von der Mitte der Straße wegzureißen, wenn mir noch die Sekunden zur Verfügung gestanden waren, diese Schritte auf sie zuzulaufen, dann war ich nicht wirklich in Gefahr gewesen, dann wäre das Auto auch bei voller Geschwindigkeit an mir vorbeigerast und hätte mir höchstens einen Schrecken eingejagt. Aber wie hätte das kleine Mädchen das wissen sollen, sie war ja kaum sechs Jahre alt? In dem Moment neben der Straße sah sie viel jünger aus, kleiner und zerbrechlicher. Sie hatte mich einfach beschützen wollen und uns beide dadurch in Gefahr gebracht, jetzt lag sie in meinen Armen, hielt die Finger gespreizt auf die aufgerissene Haut ihres Beins und versuchte, tapfer zu bleiben. Wenn ich mir ihr Bild heute in Erinnerung rufe, fallen mir wieder genau drei Dinge ein: ihre karminroten langen Haare, ihr hochgerutschter Rock und die zerrissene weiße Strumpfhose. Wissen Sie, was ich damals als Erstes dachte, als mein Gehirn den Anblick ihres zitternden Körpers verarbeitet hatte? Wer zieht seinem Kind bei dieser Hitze eine so dicke Wollstrumpfhose an. Ein lächerlicher Gedanke, ich weiß, aber trotzdem der erste, der mir durch den Kopf schoss. Es hatte an diesem Tag fast vierzig Grad, aber ihre Mutter musste ihr trotzdem diese heiße Strumpfhose angezogen haben. Das ergab keinen Sinn, das würde niemand seinem Kind antun. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet dieser Gedanke an die Wollstrumpfhose mich noch immer so aufwühlt. Vielleicht, weil die Szene für mich dadurch noch surrealer wurde, noch gespenstischer. Vielleicht, weil ich mir in derselben Sekunde die Frage stellte, wie alt mein Mädchen zu diesem Zeitpunkt geworden wäre. Ob ich ihr auch eine Strumpfhose angezogen hätte, ob sie ebenfalls zu retten gewesen wäre, wenn sie nur etwas länger durchgehalten hätte? Natürlich dachte ich an mein Kind, das ich hätte formen können, ganz allein nach meinen Vorstellungen, und durch diesen Gedanken kam alles zu mir zurück: meine Frau, ihre Freude über die Schwangerschaft, ihre Tränen im Krankenhaus und die endlosen Vorwürfe danach.
Ich dachte:
»Das ist alles nur in deinem Kopf.«
Die Stimme meiner Frau.
Ich dachte:
»Was taugst du, wenn du nicht einmal das schaffst?«
Die Stimme meiner Mutter, begleitet vom Anspringen des Motors, vom Aufheulen des wegrasenden Autos.
Alle Ermittlungen nach diesem Unfall führten zu nichts, trotz der vielen Zeugen. Ungeklärte Fahrerflucht, immerhin war dem Mädchen nicht viel geschehen, dank meiner Hilfe, so versuchte die Polizei mich zu beruhigen. Ein Glück, dass ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen war und schnell gehandelt hatte. Ich begriff: Das waren nur Ausreden, um die einfachste Erklärung glauben zu können. Ich bezweifelte sie von der ersten Sekunde an, schon deswegen, weil einfache Geschichten nie wahr sind. Als ich nämlich von dem Mädchen zum Auto aufsah, da bemerkte ich etwas, das mir sofort seltsam vorkam und das ich wahrscheinlich nicht hätte bemerken sollen. Die Scheiben waren zwar getönt und man konnte nur schwer ins Innere sehen, doch als der Wagen ganz knapp an unseren Körpern vorbeifuhr, da trafen die Sonnenstrahlen in einem Winkel auf das Glas, der es mir erlaubte, den Arm des Fahrers am Lenkrad für eine Sekunde ganz genau zu erkennen. Er hatte nur die linke Hand am Steuer, in der rechten hielt er einen Fotoapparat. Kein kleines Modell für den Urlaub, eine große, professionelle Kamera mit langem Objektiv. Sonst sah ich nichts, doch wie ein Pfeil bohrte sich mein Blick in dieser kurzen Sekunde durch die Scheiben auf die Hände und impfte mir einen Zweifel an all den Worten ein, mit denen mich die Polizei später beruhigen wollte. Dann sprang das Auto nach vorne und raste weg, an die Ziffern des Nummernschildes dachte ich zu spät.
Ich erinnerte mich an die Worte meines Vaters:
»Du bist ja paranoid. Halt einfach den Mund und sei still.«
Ich dachte an meine Frau:
»Das ist alles nur in deinem Kopf.«
Diese Worte hatte sie erst kurz zuvor zu mir gesagt, nach dem Fund der Mauerteile in unserer Wohnung, als erneut das vertraute Gefühl der Angst in mir aufgestiegen war. Ich hatte damals jedoch dafür gesorgt, dass sie von den Umwälzungen nach diesem Vorfall nichts mitbekam, hatte den Wahnsinn, den ich wieder in mir fühlte, gut vor ihr versteckt. Die Ereignisse vor dem Unfall waren eben nur Warnschüsse gewesen, erst jetzt traf mich die Kugel mit voller Wucht. Wegen der Kamera im Inneren des Autos und wegen der Worte des kleinen Mädchens, die mit weit aufgerissenen Augen zu mir hochsah:
»Das Auto wollte mich umbringen.«
Vermutlich hätte ich sie beruhigen sollen, als sie diesen seltsamen Satz zu mir sagte. Ich hätte ihr Worte ins Ohr flüstern müssen, Worte der Ruhe und der Entspannung, nach der Aufregung des Unfalls. Doch ihr Gesicht war mir zu vertraut, der Ausdruck der nackten Panik in ihren riesig geweiteten Pupillen, ihr aufgerissener Mund, der schreien wollte und es gerade noch schaffte, diese Worte zu formen:
»Das Auto wollte mich umbringen.«
Doch von mir kam keine Antwort, die man von einem vernünftigen Menschen erwarten würde, die kam erst von ihrer Mutter, die einige Sekunden später über die Straße sprang. Von mir gab es nur Verständnis für ihre Angst, Spiegelung ihrer Gefühle.
»Ja«, murmelte ich ihr ins Ohr, einige Male.
»Ja, ja, ja.«
Ich verstand nicht, was die Kamera zu bedeuten hatte, warum der Fahrer so schnell wieder weggerast war, wo er das Mädchen doch nur gestreift hatte. Ich war immer noch auf der Suche nach einer logischen Erklärung, einer Geschichte, die meine Angst vertreiben konnte. Doch die Zweifel hatten sich längst in mir festgesetzt. Mein Kopf hatte damals die Rohrbombe in Deutschland noch nicht vergessen, an die niemand sonst mehr einen Gedanken verschwendete. Es war ein Attentat gewesen, das mittlerweile längst wieder aus den Medien war. Ich stellte sofort die Verbindung zu dem Auto auf der Straße her. Erst Jahre später würde ich erfahren, wie viel persönlicher dieser Unfall eigentlich war, wie viel näher an mir selbst, an meinem eigenen kleinen Leben, als ein anonymer Anschlag. In dem Moment auf der Straße, das zitternde Mädchen an meinen Körper gepresst, wusste ich nur, dass etwas nicht stimmte, dass nichts so war, wie es schien, dass ich mich hatte täuschen lassen, zur Ruhe zwingen, wo doch offenbar Schlimmes im Gange war. Ich wusste, dass ich etwas übersehen hatte, dass ich wieder einmal dabei versagt hatte, alle Informationen zu sammeln und richtig zu deuten. Und da bekam ich Angst, da griffen die Gefühle des kleinen Mädchens auf mich über, da spürte ich die bekannte Reaktion meines Körpers, das unregelmäßige Schlagen meines Herzens, das Engwerden meines Halses, den Schweiß auf meinem Rücken.
Ich dachte wieder an die Worte meiner Frau:
»Das ist alles nur in deinem Kopf.«
Wir wollen immer nur unser eigenes Spiegelbild in der Scheibe sehen, doch manchmal reicht ein Sonnenstrahl im richtigen Winkel, um uns unmissverständlich klarzumachen, was sich dahinter versteckt.
Sofort als ich nach Hause kam, wollte Sylvia von mir wissen, wo ich so lange geblieben war, ob mir etwas zugestoßen sei, doch ich wollte ihr nichts erzählen, hatte ihr schon zuvor nie etwas erzählen wollen. Aber sie ließ nicht locker, drohte mir mit meinen Ärzten und, noch schlimmer, mit meiner Mutter. Also nahm ich die Hand meiner Frau, zog sie in unser Badezimmer, drehte die Dusche auf und begann, sie auszuziehen. All diese Vorkehrungen hatte ich auf dem Heimweg längst vorausgeplant. Ich war zu unaufmerksam gewesen, aber nun wollte ich wieder einen Schritt voraus sein, wollte meine nächsten Züge im Kopf parat haben, planen und kontrollieren. Zuerst begriff Sylvia nicht, was ich von ihr wollte, doch dann sah ich die Tränen in ihren Augen. Gemeinsam stiegen wir in die Dusche und unter dem Wasserstrahl, der unsere Stimmen verschluckte, begann ich schließlich zu erzählen. Von dem kleinen Mädchen, von den beschwichtigenden Worten der Polizei und meinen Befürchtungen wegen der Kamera in der Hand des Lenkers. Alles begann von Neuem wegen dieses einen Blickes in ein Auto, der durch die getönten Scheiben eigentlich nicht hätte möglich sein sollen. Dieser Blick, dem der winzige Körper des Mädchens plötzlich völlig egal gewesen war, der sich nur mehr auf die Kamera fixiert hatte. All das erzählte ich meiner Frau, während sich das Wasser auf meiner Haut kälter und kälter anfühlte. Alles begann mit dem blutenden Mädchen, das am Naschmarkt zitternd in meine Arme fiel, mit dem Blick, den es auslöste, mit dem Ausdruck in ihrem Gesicht und den angsterfüllten Worten:
»Das Auto wollte mich umbringen.«
Das kleine Mädchen hatte recht gehabt. Sie hatte recht gehabt, das Schlimmste zu glauben, das Unwahrscheinlichste anzunehmen. Hinter jeder getönten Scheibe verbirgt sich etwas Ungewohntes, etwas, das das eigene Leben sofort aus der Bahn werfen kann. Es verbergen sich Menschen in ihrem Eigensinn, die Handlungen setzen, die einen berühren und verändern, ob man das will oder nicht.
Im Gesicht meiner Frau vermischten sich Tränen mit den Wassertropfen, die über ihren Kopf nach unten liefen, auf die Narben an der Innenseite ihrer Schenkel zu.
»Mach das nicht kaputt, mach uns nicht kaputt. Du zerstörst mich, wenn du wieder wirst wie früher, verstehst du das nicht? Das ist alles nur in deinem Kopf. Bleib bei mir, bleib hier.«
Doch ich war längst woanders. Einige Tage danach stand Simon im Wohnzimmer. Jener Simon, der mich zuvor so oft verraten und wieder gerettet hatte, dessen Mutter ich hatte sterben sehen, der seit unserer Kindheit so konstant in meinem Leben geblieben war wie sonst nur meine Angst.
Ich dachte:
»Das Auto wollte mich umbringen.«
Ich verstand nicht, warum er immer noch hier war, warum er mir wieder helfen wollte. Ich versuchte, meine nächsten Schritte vorauszuplanen, doch ich scheiterte daran, mir sein Motiv zu erklären, und das machte mich wahnsinnig, das zerstörte jede Ruhe, um die ich mit meinen Plänen rang. Ich brüllte ihn an, schlug auf ihn ein, doch er blieb ruhig. Was hatte ausgerechnet Simon mit der ganzen Geschichte zu tun, warum sollte ich mit ihm sprechen? Ich verstand einfach nicht, was das zu bedeuten hatte, wie seine Gefühle für mich aussahen, warum er mich nicht hasste.
»Ich bin hier, um dir zu helfen.«
Das sagte er schließlich, aber ich konnte ihm nicht glauben. Er setzte sich dennoch mit seinem großen, verschwitzten Körper auf unser Sofa, stellte mein altes Schachbrett vor mich und sprach ganz ruhig mit mir, doch zu diesem Zeitpunkt hatte ich längst die Telefonkabel herausgerissen und meinen Stuhl so ans Fenster gerückt, dass ich freie Sicht auf die Straße vor unserem Haus hatte, wo ich hin und wieder das Auto zu erkennen meinte, es aber nie rechtzeitig vor die Tür schaffte, um an die Scheibe zu klopfen, die Motorhaube zu zertrümmern, wie nach dem Tod meines Vaters. Zu diesem Zeitpunkt hatte längst jene Version meines Ichs von mir Besitz ergriffen, die ich kurz zuvor als Sicherheitsvorkehrung von mir abgespalten hatte, sollte ich sie je wieder benötigen. Jene Version, die gezeichnet war von Angst und Panik, von Wahnsinn und Medikamenten. Jene Version, von der ich gedacht hatte, sie mithilfe meiner Frau besiegt zu haben.
Ich dachte:
»Zu Hause ist alles voller Gift.«
Die Worte meines Vaters.
Ich dachte:
»Wenn du wirst wie dein Vater, bringe ich mich um.«
Die Worte meiner Mutter.
Auf sie konnte ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Ich war längst wieder jene Person geworden, deren Vorbild immer mein Vater gewesen war. Jene kranke Person, die wenig später einfach verschwinden würde. Noch spürte ich die Ruhe in unserer Wohnung, die seit dem Vorfall mit den Mauerteilen alle Sicherheit und Geborgenheit für mich verloren hatte. Es war eine Ruhe, die von Sylvia und Simon künstlich hergestellt wurde, um das Chaos und die Angst zu überdecken, die längst wieder hervorkroch.
Noch hörte ich Simons Worte:
»Lass dir helfen.«
Doch mir war nicht zu helfen.
Ich hörte:
»Du musst uns vertrauen.«
Doch an Vertrauen war längst nicht mehr zu denken.
*
Sie wissen, dass ich Ihnen die Zeit hier verrechnen muss.
Selbstverständlich, ich kenne Ihren Stundenlohn. Ich bin nur froh, dass Sie hier bei mir sitzen und ich Ihnen diese Geschichte erzählen kann, über Ihre Bezahlung sprechen wir später. Sie sehen übrigens ganz anders aus als in meiner Erinnerung, kleiner und schmächtiger, wenn Sie mir das nicht übel nehmen, und auch etwas älter. Ich hätte Sie jünger geschätzt. Wie alt sind Sie?
Etwas älter als Sie, fast fünfzig. Es wundert mich, dass Sie sich gar nicht mehr an mich erinnern, immerhin haben wir nicht zum ersten Mal Kontakt. Haben die Medikamente im Krankenhaus mein Gesicht wirklich völlig ausgelöscht?
Ich erinnere mich nur mehr verschwommen, wie durch einen Wasserschleier verdeckt. Ich habe bei unserem ersten Treffen wirklich andere Sorgen gehabt, als mir Gesichter einzuprägen, selbst wenn Sie mir damals geholfen haben und ich Ihnen in gewisser Weise sogar dankbar bin … trotz allem.
Aber auf der Fahrt ins Krankenhaus, da haben Sie mich doch sofort erkannt. Haben Sie mich danach einfach wieder vergessen?
Daran erinnere ich mich nicht mehr.
Gut, es soll hier ja auch nicht um mich gehen. Dafür haben Sie mich sicher nicht kommen lassen, dafür bezahlen Sie mich nicht.
Sie haben recht.
Also, warum haben Sie mich dann hierherbestellt? Meine Zeit ist ja nicht billig, wie Sie wissen.
Meine Erinnerungen müssen aus meinem Gehirn. All diese Gedanken und Erzählungen müssen aufhören, wie Tischtennisbälle von einer Seite meiner Schädeldecke zur anderen zu springen und wieder zurück. Ich bin dankbar, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben. Ich habe ja sonst niemanden, der mir zuhört, seitdem auch Simon nicht mehr mit mir spricht. Haben Sie noch Kontakt zu ihm, sucht er noch Ihre Hilfe?
Nein. Ich würde es Ihnen aber auch nicht sagen, wenn es so wäre.
Sie wirken unruhig, wollen Sie mir überhaupt weiter zuhören? Hier ist es kalt, aber der Balkon auf der Rückseite des Hauses heizt sich am Nachmittag zu sehr auf und ich habe gedacht, der Schatten hier auf der Terrasse wäre angenehm. Ich hoffe, Sie frieren nicht. Wenn wir noch ein bisschen warten, können wir sogar die Sterne sehen.
Ich fühle mich hier nur etwas unwohl.
Sie haben doch nicht etwa Angst vor Bobby. Der tut keiner Menschenseele etwas, und wenn er sie vorhin angeknurrt hat, dann darf Sie das nicht beunruhigen. Ich bekomme hier ja nie Besuch und er ist völlig auf mich fixiert. Er begleitet mich schon einige Zeit und erinnert mich an meine Kindheit. Ohne Sie wäre er ja auch gar nicht mehr hier. Aber das weiß er natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass sich meine Nachbarn ähnlich gut um ihn gekümmert hätten, aber sie wären die einzigen Menschen für ihn gewesen, wenn ich nicht mehr zurückgekommen wäre.
Ich habe nicht den Hund gemeint. Normalerweise finden solche Gespräche zuerst in meinem Büro statt, nicht in Privaträumen. Das hier ist etwas ungewöhnlich, normalerweise bestehe ich auf den herkömmlichen Weg.
Ich kann mit dem Wort herkömmlich nichts mehr anfangen. Nichts an unserem Treffen ist herkömmlich, warum sollte es der Ort sein?
Verstehen Sie mich nicht falsch, Sie haben es wirklich schön hier und ich genieße den Wind, mir ist nicht kalt. Ich bin sogar froh, ein paar Tage aus der Stadt verschwinden zu können, aber es fühlt sich dennoch ungewohnt an, hier zu sitzen. Verboten beinahe, es überschreitet eine Grenze.
Sie wissen ja, dass ich mich von hier nicht mehr fortbewege. Außerdem gibt es keinen Ort, der besser dazu geeignet wäre, meine Geschichte zu erzählen, als diese Terrasse. Sehen Sie sich um. Schauen Sie ganz genau hin, noch ist es nicht zu dunkel dafür. Schauen Sie zwischen den Nachbarhäusern zu den Feldern, zu der kleinen Kapelle in einiger Entfernung und zu dem Waldstück, das da hinten rechts beginnt. Und dann schauen Sie nach links, den kleinen Abhang hinunter, zum Teich, den meine Mutter vor so langer Zeit angelegt hat, zur Betonrotunde, die mein Vater für meine Mutter in einer seiner guten Zeiten gemauert hat, und auf der ich als kleiner Junge so gerne gesessen bin und gelesen habe. Und was sehen Sie? Denken Sie ruhig nach. Richtig, Sie sehen nichts. Weil es rein gar nichts zu sehen gibt. Nichts, das speziell oder außergewöhnlich genug wäre, erwähnt zu werden. Und darum kann ich Ihnen all das erzählen, was ich Ihnen erzählen werde. Weil hier alles gleich ist, weil es kein davor und kein danach gibt, keine Dauer. In meinem Kopf existiert alles gleichzeitig und nebeneinander. Alle meine Erinnerungen sind da, und ich möchte sehen, welche davon nur Fantasien sind. Ich habe hier nichts mehr zu erleben, es ist alles zu Ende, die Gegenwart hat mir nichts mehr zu bieten. Und darum kommt die Vergangenheit zurück, das schon lange Vergessene, das ganze gelebte Leben. Ich möchte Ihnen mein Leben erzählen, weil ich es selbst nicht mehr kenne, weil ich es mir wieder ins Gedächtnis holen will, um meine Erinnerungen und die Erzählungen anderer über mich gegeneinander abzuwägen. Ich will Verdrängtes zurückholen und wieder wissen, warum ich es überhaupt verdrängt habe.
Geben Sie mir noch ein Bier, bevor Sie weitererzählen. Und beantworten Sie mir eine Frage, die ich einfach stellen muss: Wie sind Sie auf mich gekommen?
Sie haben schon einigen Menschen in meiner Familie geholfen: meiner Frau und meiner Mutter, sogar Simon. So, wie es keinen besseren Ort gibt, um meine Geschichte zu erzählen, gibt es keinen anderen Menschen, der besser geeignet wäre, sie zu hören.
Ich hoffe nur, ich kann Ihnen wirklich helfen. Sie haben doch Ihre Medikamente, und ich weiß nicht, ob ich besser wirke als die. Was nicht heißt, dass ich ein kühles Bier und eine gute Geschichte nicht zu schätzen wüsste.
Wissen Sie, ich kann meinen Erinnerungen nicht mehr vertrauen. Meine Gedanken bewegen sich auf dünnem Eis. Mein Gehirn ist wie ein Sieb, durchlöchert von unzähligen Medikamenten. Nach draußen dringt nur, was von den Löchern durchgelassen wird. Darum sind meine Erinnerungen auch so sprunghaft, zersplittert wie mein Gehirn, das durch meine Ängste zu einem Labyrinth wurde. Es reicht eine Kreuzung und ich bin plötzlich ganz woanders, in einer anderen Zeit. Eine Wende und ich bin wieder bei dem kleinen Mädchen am Naschmarkt, ein Schritt und ich bin in meinem Bunker über dem Laufhaus.
Ich bin nicht sicher, ob ich Sie wirklich verstehe.
Das macht nichts, ich will versuchen, einen Weg durch dieses Chaos für Sie zu finden. Ich will das machen, womit Simon mich schon einmal gerettet hat: Ich will kleine Erzählungen aus meinem Leben formen, ich will Ihnen Geschichten erzählen, um den roten Faden in meinem Leben zu finden. Vielleicht hilft mir das auch dieses Mal.
Sind das Notizen, die Sie sich gemacht haben?
Ich will die Dinge, die noch in meinem Kopf sind, nicht vergessen. Ich will sie Ihnen so getreu wie möglich erzählen.
Wie lange möchten Sie mich überhaupt hier bei sich haben? Ich habe Zeit mitgebracht, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Ich weiß nur nicht, worauf ich mich einstellen muss.
Ich auch nicht. Lassen wir uns überraschen.
Und was erwarten Sie am Ende von mir?
Ich erwarte nur von Ihnen, dass Sie mir zuhören. Was Sie am Ende aus meinen Erzählungen machen, ist ganz Ihre Sache. Ich will nur wieder voraussetzungsloser denken, um noch einmal derjenige zu werden, der ich damals war. Vor dem endgültigen Bruch, vor den Medikamenten.
Die Sie hoffentlich weiter nehmen. Wir wissen beide, was passiert, wenn Sie Ihre Paranoia nicht in Schach halten, Sie noch besser als ich.
Hören Sie auf, dieses Wort zu verwenden.
Welches Wort?
Paranoia. Als wäre irgendetwas an meinen Ängsten unverständlich. Sie werden dieses Wort hier nicht verwenden, um mich zu beschreiben. - Es tut mir leid, dass ich laut geworden bin. Schauen Sie, der Hund legt sich schon wieder hin. Sie müssen keine Angst vor ihm haben. Und auch nicht vor mir.
Ich habe keine Angst. Es wundert mich nur, dass dieses Wort solche Aggressionen in Ihnen auslöst.
Ich hasse es und ich werde Ihnen erzählen, weshalb. Ich hoffe, Ihr Bier ist noch kalt genug und Sie können mir folgen. Überlegen Sie sich Ihren nächsten Zug und hören Sie meinen Erzählungen zu.
*
Das Wort Paranoia habe ich zum ersten Mal im August 1980 gehört. Ich erinnere mich so genau, weil es in dem Jahr war, in dem unsere Nachbarin im Erdbeerland vergiftet wurde. Ich verstand das Wort damals zwar noch nicht, ich war erst fünfzehn Jahre alt und wusste durch meine nächtliche Lektüre mehr über den menschlichen Körper als über den Geist, aber ich hatte plötzlich eine Vorstellung von seiner Bedeutung, und diese Vorstellung machte mir viel mehr Angst als der vergiftete Körper zwischen den Stauden. Den Zweifel, der nach diesem Tod blieb, nannte meine Mutter damals Paranoia. Dasselbe Wort, das auch mein Vater mir kurz zuvor nachgebrüllt hatte.
Meine Eltern waren stolz auf die Erdbeerländer in der Umgebung unseres Dorfes. Das waren riesige Felder, auf denen man die Erdbeeren direkt von der Staude pflücken und essen konnte. Man musste nicht einmal dafür bezahlen, die Erdbeeren kosteten nur etwas, wenn man sie in Körben mit nach Hause nahm. Wir haben immer Ananas zu den Erdbeeren gesagt, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall bringt allein das Wort Ananas mich immer zurück auf die Erdbeerfelder und zurück zur toten Nachbarin zwischen den Erdbeersträuchern. Die anderen Kinder in meiner Schule waren immer ganz begeistert, wenn es am Wochenende mit den Eltern dorthin ging, aber mich schauderte schon damals beim bloßen Gedanken daran. Jeder konnte die Erdbeeren anfassen, sie in den schmutzigen Fingern halten und dann doch nicht pflücken, weil sie zu reif waren oder noch nicht reif genug. Und mehr als einmal bemerkte ich, wie Eltern ihren Kindern die Hosen nach unten zogen, sie an den Schultern und Knien nach oben hoben und zwischen die Stauden machen ließen. Öffentliche Toiletten gab es dort natürlich nicht, und so vermischte sich der Urin der Kinder einfach mit dem der Hunde. Tiere waren dort zwar eigentlich verboten, aber daran hielt sich niemand, und so liefen überall große und kleine Hunde hin und her und jagten mir mit ihrem Gebell eine Riesenangst ein, die meine Mutter mit einem Lächeln und einem Klaps auf den Hinterkopf vertreiben wollte.
»Bobby wird auch einmal so groß, gewöhn dich daran!«
Ich wollte ihr nicht glauben, so etwas Großes würde nie aus dem kleinen Ding werden, das nachts vor meiner Kinderzimmertür Wache lag. Welche Tiere sonst noch zwischen den Maschen des Zaunes hindurchschlüpften, wollte ich mir lieber gar nicht vorstellen. Waschen konnte man die Früchte natürlich nicht, die Erde sollte man einfach mit den Fingern abwischen und die Erdbeeren dann direkt in den Mund stecken. Ich fand das zum Erbrechen ekelerregend, den Gedanken an den ganzen Dreck konnte ich einfach nicht aus meinem Kopf streichen. Ich sah die Erdbeeren vor mir, von Tausenden Fingern gedrückt, vom Urin verklebt und von der Erde verkrustet. Wieder drei Eindrücke, die ich nicht aus meinem Kopf bekam. Ich bildete mir ein, den salzigen Geschmack des dreckigen Gemischs auf meiner Zunge zu schmecken, sobald unser Auto auf den immer überfüllten Parkplatz einbog. Ich musste schon beim Gedanken daran würgen und spürte eine Panik in mir aufsteigen, die ich damals noch nicht zuordnen konnte. Eine Angst vor dem, was mich hinter dem kleinen Kassahäuschen erwartete, ein Nachmittag in brütender Hitze, meine Mutter immer hinter mir, auf der Lauer, um mir unvermittelt gerade gepflückte Erdbeeren in den Mund zu stopfen. Ein Unwohlsein, das sich von meinem Magen aus in meinem ganzen Körper verbreitete, eine über mir hängende Drohung, von der ich selbst wusste, dass sie nicht real war, die ich aber dennoch nicht kontrollieren und eindämmen konnte. Und all das ausgelöst von ein paar roten Beeren. Dass die anderen Kinder sich nicht an ihnen störten, irritierte mich schon damals, doch sie wussten wohl einfach nicht, welchen Gefahren sie sich aussetzten. Mir jedoch waren all die möglichen Krankheiten bekannt. Meine Mutter wusste natürlich von meinem Ekel, doch das hielt sie nicht davon ab, immer wieder mit mir hinzufahren. Ich traute mich einfach nicht, ihr das wahre Ausmaß meiner Angst zu verraten. Sie gab mir ein viel zu großes T-Shirt und schmierte meinen Nacken mit Sonnencreme ein, die den Ausschnitt des Shirts verklebte und dafür sorgte, dass ich mich zwar vor den Sonnenstrahlen sicher, aber auch viel unwohler in meiner Haut fühlte, die schon damals seltsam dünn war, als schiene mein Fleisch darunter hervor. Mit übergroßem Hut musste ich dafür sorgen, dass ich auf den weiten Feldern zumindest etwas Schatten bekam. Ich sah aus wie der Idiot, der ich damals noch war.
Ich stand dann jedes Mal regungslos zwischen den Stauden und wartete, bis meine Mutter ihren selbst geflochtenen Weidenkorb vollgepflückt hatte. Das Pochen meines Herzens wurde dabei von Minute zu Minute stärker und ließ mich manchmal unkontrolliert die Trampelwege entlanglaufen, um ein wenig Druck abzulassen. Ich hatte das Gefühl, aus meiner Haut fahren zu müssen, nichts war mit dem Gefühl an diesen Nachmittagen vergleichbar, mit dieser langsam anschwellenden Panik, die kein Ventil fand und über die ich mit niemandem sprechen konnte. Nur im Laufen wurde ich immer ganz leicht, weil meine Füße den Boden nicht mehr zu berühren schienen. Wenn ich stillstand, kam die Furcht zurück. Ich wurde schon damals von Ängsten gequält, noch bevor zum ersten Mal von einem Arzt oder einem Spezialisten die Rede war. Allerdings bewegten sich die sichtbaren Zeichen meiner Angst noch in einem Bereich, den meine Mutter ohne Probleme ignorieren und mein Vater milde belächeln konnte. Ausgerechnet mein Vater, der wissen hätte müssen, auf welchem Weg ich mich befand. Meine Ängste waren damals noch wie kleine Entzündungsherde, deren Ursache nicht zu finden war. Es waren vereinzelte Ereignisse, die sich nicht zu einem großen Ganzen zusammenfügten. Manchmal überwog meine Sorge vor Krankheiten und meine fast panische Angst vor Keimen. Mysophobie, wie ich heute weiß. Ein anderes Mal brach eine ganz kindliche Angst vor Dunkelheit in mir aus, die mir den Schlaf raubte. Achluophobie. In seltenen Momenten konzentrierte sich mein Gehirn schon damals auch auf andere Menschen, von denen ich überzeugt war, sie wollten mir Böses tun. Paranoia. Das böse Wort. Noch konnte niemand hinter meinen Ängsten den roten Faden erkennen, noch waren es einzelne Episoden, die den Menschen in meiner Umgebung Unannehmlichkeiten bereiteten, die aber auch als Spinnereien eines Kindes abgetan werden konnten. Nachdem all diese einzelnen Episoden so willkürlich und unvorhersehbar auftraten und sich keine Angst je vertiefte, zu einer wirklichen und bestimmenden Phobie vor etwas Konkretem wurde, sah meine Mutter wohl keinen akuten Handlungsbedarf, obwohl sie es doch hätte besser wissen müssen, nach all dem, was sie bereits mit meinem Vater durchgemacht hatte. Vielleicht verschloss sie einfach nur ihre Augen, wie ich es später so oft machen würde. Ich wollte sie nicht beunruhigen, ich wollte sie beschützen, also schwieg ich. Erst durch den Vorfall im Erdbeerland erreichten meine Ängste eine neue Ebene und bündelte viel von dem, was bereits in mir angelegt war. Wie bei einem Puzzlespiel hatten sich zuvor die einzelnen Teile meiner Angst auf ein weißes Blatt Papier gelegt. Der Tod unserer Nachbarin fügte dann jenes entscheidende Stück hinzu, das erstmals das ganze Bild erahnen ließ. Und selbst wenn auch danach noch keine Details zu erkennen waren, konnten meine Eltern doch erstmals einen Blick auf das vollständige Werk werfen. Plötzlich war klar, dass alle unzusammenhängenden und einander bekämpfenden Ängste davor nur Vorboten gewesen waren, eine Suchbewegung meines Geistes, bevor er schlussendlich seine wahre Bestimmung fand.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter an diese vielen kleinen Einzelvorfälle dachte, als sie mir hinterherlief, während ich vor meinem Vater flüchtete, noch etwas Erbrochenes in meinen Mundwinkeln. Ich weiß nicht, ob sie genau daran dachte, als wir dann über unsere Nachbarin stolperten, die regungslos mit dem Gesicht im Korb voller Erdbeeren lag. Eine Sekunde sahen wir uns an, bevor ich schließlich losbrüllte:
»Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gewusst. Man darf hier nichts essen. Es ist alles voller Gift, die ganzen Erdbeeren sind vergiftet. Alles Gift!«
Ich war froh, die Erdbeeren ausgespuckt zu haben, die mir mein Vater in den Mund gestopft hatte, obwohl ich mich fragte, wie viele ich wohl unwillkürlich geschluckt hatte.
Ich dachte:
»Zu Hause ist nur Gift, du musst bei mir bleiben.«
Die Worte meines Vaters während des Vorfalls in den Kornkreisen.
Ich schrie:
»Gift, Gift, Gift!«
Während meine Mutter versuchte, mir die Hand auf den Mund zu drücken, musste sie selbst um Fassung ringen, wusste sichtlich nicht, was sie mit dem Körper vor ihr anfangen sollte, der kein Lebenszeichen von sich gab. Und so fanden meine Worte einen Weg in ihren Kopf, bemerkte ich in ihren Augen die gleiche Unsicherheit und Panik, die ich auch in mir fühlte. Ihre Augen waren ein Spiegel, der ein Bild auf mich zurückwarf, in dem ich meine eigene Angst wiedererkannte. Ich hatte also recht mit meiner Furcht, meiner Mutter ging es genau wie mir. Mein Geschrei hatte als bloße Trotzreaktion begonnen, als Befreiungsschlag, weil der leblose Körper ein Beweis dafür war, dass meine Mutter mir Schlimmes antat, wenn sie mich zum Hierbleiben zwang, während ich nur zurück zu unserem Auto laufen wollte, auf den sicheren Rücksitz, wo einige Blätter unserer Medizinmappe auf mich warteten, die ich in meinem Rucksack mit hierher geschmuggelt hatte und die mir eine Erklärung für den toten Körper bieten würden. Ich wollte nur weg, weil ich das Gift nicht sehen konnte, das unsere Nachbarin getötet hatte, weil Erreger in der Luft waren, die mich attackierten, ohne dass ich Gegenwehr leisten konnte.
In mir stieg plötzlich die Erinnerung an jenen Tag auf, als mein Vater Kornkreise in das Feld hinter unserem Haus getreten hatte. Damals war es an mir gewesen, ihn zu beruhigen und nach Hause zu bringen, doch ich war an der Aufgabe gescheitert, seine wirren Erzählungen und Fantasien zu unterbrechen und ein wenig Normalität in seinen Kopf zu pflanzen. Jetzt war ich es, der kaum mehr atmen konnte, der Angst hatte, sein Herz könne den Brustkorb sprengen. Ich sah in die Augen meiner Mutter, sah meine Angst in ihrem Gesicht gespiegelt, und dieses Spiegelbild stieß mich über die Klippe. Plötzlich wurde jeder klare Gedanke unmöglich, lösten sich alle Vorstellungen und Überlegungen in etwas Flüssiges auf. Es gab nun kein Halten mehr, die ganze aufgestaute, unterdrückte und zurückgedrängte Panik brach wie eine große Welle über mir zusammen. Ich fühlte mich wie ein Ertrinkender, der alle Kraft aufwendet und mit den Armen rudert, mit den Beinen strampelt, gegen die Wucht des Wassers aber nicht ankommt. Immer tiefer sank mein Körper, immer kälter fühlte sich die Umgebung an, die rettende Wasseroberfläche rückte weiter und weiter von mir weg. Die Angst war einfach stärker, drückte meinen Körper dem Meeresboden entgegen. Sie ließ einfach nicht locker, egal wie stark ich mich auch wehrte.
Ich konnte nur mehr ein Wort schreien:
»Gift, Gift, Gift!«
Immer wieder dasselbe Wort, bis meine Mutter mir schließlich mit der Hand ins Gesicht schlug und mein Vater mich anbrüllte:
»Du bist ja paranoid. Halt einfach den Mund und sei still.«
Ich hatte ihn gar nicht kommen sehen, doch jetzt stand er über mir, seine Hand um meinen Oberarm geklammert, seine Lippen an mein Ohr gepresst. Ich dachte an jene Worte, die er mir vor nicht allzu langer Zeit im Kornfeld zugeflüstert hatte:
»Zu Hause ist nur Gift.«
Doch jetzt spürte ich nur seinen Griff um meinen Arm.
»Du bist ja paranoid. Halt einfach den Mund und sei still.«
Es war das erste Mal, dass ich diesen Ausdruck hörte, aber er löste sofort etwas in mir aus, er öffnete eine Tür zu einem dunklen Raum, den ich nicht betreten wollte. Und plötzlich war ich still, allein wegen dieses einen Wortes, das in meinem Kopf nachhallte. Meine Mutter sah mich an und ihr liefen Tränen über die Wange. Sie griff nach meinen Schultern und sagte, weil ich die Augen auf den Körper gerichtet hatte, der mittlerweile von anderen Menschen bearbeitet wurde:
»Tote Menschen starrt man nicht an.«
Sie wusste also auch, dass unserer Nachbarin nicht mehr zu helfen war. Meine Mutter drehte mich zur Seite.
»Ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir schon so lange Sorgen um dich. Wir brauchen einen Arzt.«
In dem Moment musste ich endlich loslachen. Sie dachte an einen Arzt für mich, dabei lag hinter ihr noch immer der Körper unserer Nachbarin, den meine Mutter überhaupt nicht mehr beachtete. Dieses Bild fand ich schon als kleiner Junge völlig absurd, und mein Lachen bot mir endlich eine Hand, die mich aus den Wassermassen zog. Endlich konnte ich wieder atmen, strömte wieder Sauerstoff in meine Lungen, fand zurück ins Hier und Jetzt. Ich sah das weiße Werbeschild, auf das eine überlebensgroße Erdbeere gemalt war.
Die fruchtigsten Erdbeeren weit und breit.
Ich ließ meinen Blick nach unten gleiten, die in den Boden gerammten Stahlrohre entlang, und landete direkt bei unserer Nachbarin. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Mein Vater schämte sich für mich, er schob meine Mutter auf mich zu:
»Der Junge spinnt doch, schaff ihn hier weg.«
Doch meine Mutter war immer noch unfähig, irgendetwas zu tun. Sie sagte nur immer und immer wieder:
»Ich mache mir Sorgen um ihn.«
Sie wusste also genau, was in mir vorging, sie hatte nur bisher nie etwas dagegen unternommen, es einfach nur ignoriert. Mir wurde klar, dass ich dabei versagt hatte, mein wahres Wesen vor ihr zu verheimlichen. Einige Zeit zuvor hatte ich etwa begonnen, meinen Körper zu entdecken und meinen Ängsten eine erste Richtung zu geben. Die Angst vor Krankheiten war zu meinem ersten Betätigungsfeld geworden.
Im Wohnzimmerschrank meiner Eltern stand damals eine dicke Medizinmappe, ein Ringbuch der Zeitschrift Medizin privat, für das im Abonnement jede Woche neue Karteikarten zum Einheften mit der Post kamen. Jede Woche neue Blätter mit Informationen zu Tausenden Krankheiten, die ich irgendwann für mich entdeckt hatte. Die Blätter waren zu angsteinflößenden Boten dessen geworden, was mein Körper mir antun konnte. Ich verschlang die Karteikarten heimlich, sobald meine Mutter, die sie selbst nie las, sie in die Mappe eingeordnet hatte. Die Bilder der kaputten Organe, der Hautkrankheiten und Missbildungen waren eine Offenbarung für mich, endlich musste ich nicht mehr nur ganz allgemein Angst vor Krankheiten haben, sondern konnte ihnen konkrete Namen geben und die Symptome bestimmen, vor denen ich mich fürchten konnte. Ich lernte, welche Keime durch Dreck und Schmutz in meinen Körper eindringen konnten, welche Veränderungen in mir möglich waren und welche Unfälle meinen Körper zu deformieren drohten. Jeden Abend schmuggelte ich die Mappe in mein Zimmer und verbrachte ganze Nächte mit ihr unter meiner Bettdecke, meinen Körper befühlend, meine Haut betrachtend und den Versuch wagend, in meine eigenen Innereien zu hören. Sehr viel später wurde das durch das Internet abgelöst, durch unzählige Medizinseiten, die mich von einer möglichen Krankheit zur nächsten führten. Auch meine Arbeit in der Pathologie würde irgendwann zu einem Ersatz für die bunten Blätter werden, aber noch war allein diese Mappe mein Tor in eine fremde und faszinierende Welt. Wo andere Kinder in Märchen eintauchten, eroberte ich mir die Welt der Medizin, deren vielfältige Fachgebiete in der Mappe durch unterschiedliche Farben fein säuberlich voneinander getrennt waren. Natürlich hatte meine Mutter trotz meiner Heimlichtuerei schnell bemerkt, was vor sich ging. Meine Begeisterung für Krankheiten verunsicherte sie, vor allem wegen der Geschichte mit meinem Vater, die damals gerade wieder akut war, doch sie konnte die Zusendung der Blätter nicht einfach einstellen, immerhin hatte ihre beste Freundin ihr das Abonnement als Vertreterin des Verlages verkauft.
Wie aus dem Nichts entwickelte ich zu dieser Zeit Übelkeitsanfälle, die mich von einer Sekunde auf die andere niederstreckten, sodass ich oft nicht einmal mehr sprechen konnte. Ich hatte unendlich Angst, mich sofort zu übergeben, sollte ich meinen Mund auch nur ein klein wenig öffnen. Emetophobie. Aber all diese Fachbegriffe lernte ich erst viel später, Phobien wurden in meiner Mappe nicht behandelt. Zu jeder möglichen und unmöglichen Zeit spürte ich diese Übelkeitsanfälle wie eine Faust in meinem Körper, die meinen Magen umklammerte und so lange zudrückte, bis das letzte bisschen Flüssigkeit durch meine Speiseröhre nach oben gekrochen war. Doch meine Mutter hielt diese Anfälle für Einbildungen, für bloße Spinnereien eines Kindes, die sich legen würden. Sie nahm mir die Mappe weg und meinte, so alle Probleme gelöst zu haben.
»Wir haben schon genug Sorgen, du musst nicht noch welche erfinden.«
Ich beschloss, ihr von nun an nichts mehr zu erzählen. Das mache ich ihr noch heute zum Vorwurf, sie hätte mir viel ersparen können. So jedoch sah ich keinen Arzt, weil sie nicht die Kraft hatte, mir zu glauben, und ich Angst davor hatte, sie zu enttäuschen. Zu den Spezialisten wurde ich erst nach dem Vorfall mit der toten Nachbarin geschleppt, als es längst zu spät war.
»Ich mache mir Sorgen um dich. Wir brauchen einen Arzt.«
Ihre Stimme zitterte, als sie das wieder und wieder murmelte, den vollen Erdbeerkorb noch in der Hand, während mein Vater neben ihr stand, ohne sich um unsere Nachbarin zu kümmern. Seine Anwesenheit an diesem Tag war alles andere als selbstverständlich, erst kurz zuvor war er wieder einmal aus der Klinik entlassen worden, der gemeinsame Ausflug war schon allein deshalb wichtig für meine Mutter gewesen: die ganze Familie vereint. Dabei war der Nachmittag von Anfang an nicht so friedlich verlaufen, wie sie sich das wohl vorgestellt hatte. Es hat keiner toten Frau bedurft, um unsere Familienidylle zu zerstören.
Mein Vater wollte von Beginn an nicht einsehen, dass ich keine Erdbeeren pflücken und essen wollte, immerhin wusste ich durch die Medizinmappe ja mittlerweile ziemlich genau, in welcher Gefahr ich mich befand. Er ließ mich einfach nicht damit in Ruhe, hielt mir die Erdbeeren vors Gesicht, drückte sie an meine Lippen und stopfte sie mir in den Mund, bis ich vor Ekel schließlich vor seine Füße erbrach. Ich hatte meinen Magen nicht länger kontrollieren können, immer wieder waren die Bilder der Karteikarten vor meinem inneren Auge erschienen, hatte ich die Krankheitserreger förmlich auf meinen Lippen gespürt. Doch statt mich zu trösten und mir den Mund abzuwischen, sich vielleicht sogar zu entschuldigen, schlug mir mein Vater die Hand ins Gesicht. Dann brüllte er mich an, schmiss mir die Erdbeeren sogar noch nach, als ich vor ihm davonlief und alles niedertrampelte.
Die roten Punkte, die die Früchte dabei auf der Rückseite meines Shirts hinterließen und die wie Einschusslöcher aussahen, blieben auch nach mehrmaligem Waschen noch sichtbar. Ich hätte das T-Shirt wegschmeißen sollen, stattdessen hob ich es jahrelang unter der Matratze meines Bettes auf, als Erinnerung daran, wie schnell die Stimmung meines Vaters kippen konnte, wie unberechenbar er war. Meine Mutter meinte damals, das läge einfach nur an der Ungenauigkeit seiner Medikamente und hätte nichts mit mir zu tun, aber auch das verstand ich damals nicht.
Es war brütend heiß an diesem Tag im August und nirgendwo auch nur ein bisschen Schatten zu finden. Ich war schweißgebadet, als ich plötzlich der Länge nach zu Boden fiel. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass meine Mutter mir nachgelaufen war, erst als sie neben mir auf den Boden knallte, bemerkte ich sie. Zuerst dachte ich noch, ich wäre über einen Korb gestolpert und blieb einfach liegen, atmete in den harten, verkrusteten Boden und versuchte, wieder etwas zu Atem zu kommen. Doch dann sah ich neben mir den Kopf im Erdbeerkorb liegen. Meine Mutter drehte den leblosen Körper zur Seite, der Kopf unserer Nachbarin fiel nach hinten und ich bemerkte den Schaum vor ihrem Mund. Und bevor die Angst kam, spürte ich Wut in mir aufsteigen, Wut über meinen Vater, der nicht auf mich gehört hatte, der mir die Erdbeeren in den Mund gestopft und mich zum Erbrechen gezwungen hatte. Und da konnte ich nur schreien:
»Ich habe es doch gewusst. Es ist alles voller Gift. Alles Gift!«
Mir war völlig klar, was passiert war. Dann kam die Ohrfeige meiner Mutter, die Worte meines Vaters:
»Du bist ja paranoid.«
Und schließlich Simon, der nichtsahnend auf uns zulief, direkt auf seine tote Mutter zu, während meine Mutter ganz lebendig vor mir stand und immer wieder mit zitternder Stimme sagte:
»Ich mache mir Sorgen um dich. Wir brauchen einen Arzt.«
Simon verstand rein gar nichts, immer wieder blickte er von seiner Mutter zu meiner, von ihr zu mir, schüttelte den Kopf und brachte kein Wort heraus. Ich ließ meinem ganzen Hass auf ihn freien Lauf und rief, während ich ihm in die Augen sah:
»Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot.«
Und dabei dachte ich nur:
»Wir sind quitt.«
Nach all dem, was Simon mir im Sommercamp angetan hatte, wie er meinen Vater verraten und mich erniedrigt hatte, um Oberwasser zu bekommen, befreite mich dieser Gedanke:
»Wir sind endlich quitt.«
In dieser Sekunde verschob sich etwas in meinem Kopf, in dieser Sekunde wurden meine Gehirnwindungen durcheinandergewirbelt, als suchten sie nach ihrem definitiven Platz, ihrer endgültigen Bestimmung. Ich spürte die Veränderung in mir, auch wenn ich damals noch keine Worte dafür hatte. An diesem Tag rastete etwas ein, und all die Ängste, die zuvor nur Teil eines unbestimmten Chaos gewesen waren, formten sich zu dem, was mein Leben von da an bestimmen sollte. Es war das kleine Wort Paranoia, das diese Veränderung auslöste, diesen Durchbruch meiner Ängste, diese Neuformation der Synapsen und elektrischen Impulse in meinem Gehirn. Als entfernte das Wort eine wichtige Sperre, die bis zu diesem Zeitpunkt Schlimmeres verhindert hatte.
Ich dachte:
»Gift, Gift, Gift.«
Ich dachte:
»Zu Hause ist alles voller Gift.«
Diese Gedanken waren wie ein Geruch, der einen Raum vollständig einnimmt, wie Rauch, der sich binnen Sekunden verbreitet. Nichts anderes drang zu mir durch. Wild rasten die Bilder in meinem Kopf durcheinander: die Erdbeeren, die mein Vater mir in den Mund gestopft hatte, der weiße Schaum vor dem Mund von Simons Mutter, mein schmutziges T-Shirt, wieder drei Eindrücke, die mich bearbeiteten. Ich schlug meiner Mutter den Korb voller Erdbeeren wie wild aus der Hand, zerstampfte die Beeren auf dem vertrockneten Boden und lief schließlich auf meinen Vater zu, prügelte auf ihn ein, während Rotz in meine Nase stieg und ich kaum mehr atmen konnte. Mein Vater ertrug meine Schläge, vielleicht als Entschuldigung für die roten Einschusslöcher auf meinem Rücken, für seine Ohrfeige, er ertrug es, dass ich mich auf den Boden warf, weil ich kaum mehr Sauerstoff in meinen Lungen hatte, mich dann aufrappelte und davonrannte. Nur kurz drückte er mir die Hand auf den Mund, während meine Mutter weinte.
Meine Eltern mussten schließlich lange auf das Eintreffen der Polizei und der Rettung warten, wozu sie mich in unser Auto einschlossen, das sich in der Mittagssonne unbarmherzig aufgeheizt hatte. Ich durfte nicht mit den Polizisten sprechen, um ihnen vom Gift zu erzählen, ich durfte auch nicht weglaufen.
Ich dachte:
»Du bist ja paranoid.«
Sich immer und immer wieder abwechselnd:
»Paranoid.«
Und:
»Gift. Alles voller Gift.«
Immerhin hatte Simons Mutter Schaum vor dem Mund gehabt, ihr Gesicht hatte unnatürlich verzerrt ausgesehen, wie eine Fratze. Doch niemand wollte auf mich hören, niemand achtete auf das, was ich zu sagen hatte, was ich wusste. Ich war unwichtig geworden, besaß keinerlei Macht.
Auf der Heimfahrt sprachen meine Eltern kein Wort miteinander, sondern ließen die Wolke aus Vorwürfen, Sorgen und Aggressionen weiter wachsen, die über unseren Köpfen schwebte. Schon aus der Ferne sah ich unser Dorf und am Ende einer Straße schließlich unser Haus. Nach einiger Zeit sprang unser Auto über die Gleise des Bahnübergangs, die vorbeifahrenden Züge konnte man auch nachts in den Zimmern unter dem Dach hören. Als mein Vater in unsere Garageneinfahrt bog, war im Radio noch etwas von einem Sprengstoffattentat in einem Bahnhof in Italien zu hören, doch mehr bekam ich nicht mehr mit, weil meine Mutter sofort an dem Rädchen des Gerätes drehte, den Sprecher zum Schweigen brachte und Musik unser Auto erfüllte.
Ich rief vom Rücksitz nach vorne:
»Ich will wissen, warum Bomben explodieren.«
Bomben und Gift, das waren die beiden Gedanken, die jetzt durch meinen Kopf rasten. Mein Vater aber ignorierte, dass ich mir meine Nase an der Scheibe blutig schlug, und brüllte nur:
»Halt endlich den Mund, sonst explodiere ich!«
Und so begleiteten andere Worte die Bilder in meinem Kopf. It’s A Real Good Feeling - ein furchtbarer Schlager, aber eine der Erinnerungen, die selbst Unmengen an Medikamenten bisher nicht auslöschen konnten. Dabei war die Meldung der Explosion einfach nur der äußere Anlass für eine weitere Drehung der Spirale gewesen, die fest in meinem Inneren verankert saß. Als ahnte sie das, drehte sich meine Mutter zu mir um und sagte, ohne meinen Vater dabei zu beachten:
»Hast du keine Sekunde an Simon gedacht? Als wäre das Ganze nicht schon schlimm genug für ihn. Dazu auch noch dein Geschrei, ich habe mich so geschämt.«
Darauf wusste ich nichts mehr zu antworten, also war ich still und sah aus dem Fenster. Mein Vater stoppte das Auto kurz vor unserem Garagentor und blieb eine Sekunde lang ruhig sitzen, in der meine Mutter ihn ohne Vorwarnung von der Seite her anbrüllte:
»Das ist alles deine Schuld, das weißt du!«
Mein Vater sagte nichts, öffnete nur die Tür und stieg aus, um das Garagentor aufzuschließen. Als er sich wieder zurück in den Fahrersitz fallen ließ, sagte er zuerst ganz leise:
»Wie kann das meine Schuld sein?«
Doch meine Mutter schüttelte nur den Kopf, als verstehe sie die Frage nicht:
»Du bist nie zu Hause, du lässt mich ganz allein mit ihm.«
Mein Vater brüllte ihr seine Antwort ins Gesicht.
»Ich bin krank, verstehst du das nicht?«
Doch meine Mutter hielt seinem Blick stand, ließ sich durch die Lautstärke nicht einschüchtern:
»Und jetzt hast du ihn krank gemacht.«
Mein Vater ließ das Auto langsam in die Garage rollen und sagte nichts mehr. Und doch hatte meine Mutter unrecht. Ich dachte an das, was mein Vater einige Zeit zuvor zu mir gesagt hatte:
»Es wird mir wieder besser gehen. Wegen dir. Zwischendurch wird es schlechter werden, aber am Ende wieder gut.«
Er hatte mich nicht krank gemacht, ich würde ihn wieder gesund machen. Während ich mir das Blut von meiner Nase wischte, bemerkte ich, dass ich vor dieser Aufgabe jämmerlich versagte. Ich schämte mich und war still. Meine Mutter riss mich aus diesen Überlegungen. Als ich aus dem Auto stieg und Bobby an mir hochsprang, um mich zu begrüßen, sagte sie:
»Ich habe mich so geschämt wegen dir. Armer Simon.«
Doch nach all dem, was Simon mir angetan hatte, nach dem, wie er mich im Sommercamp ins offene Messer hatte laufen lassen, wie er meinen Vater in der Schule verraten und lächerlich gemacht und mich ausgestoßen hatte, konnte ich kein Mitleid mit ihm haben. Ich gönnte ihm das Unheil, jeden Schmerz und jede Verletzung.
Meine Mutter begriff nicht:
»Man ist doch still, wenn jemand gestorben ist.«
Ich strich über Bobbys weiches Fell und dachte:
»Du bist ja paranoid. Halt einfach den Mund.«
Andere Worte, gleicher Sinn. Dann sah meine Mutter mir tief in die Augen und sagte die Worte, die ich ihr nie verziehen habe:
»Wenn du wirst wie dein Vater, bringe ich mich um.«
Es dauerte keine Woche, bis wir schließlich im Wartezimmer meines Kinderarztes saßen und darauf warteten, dass mein Name aufgerufen wurde. Meine Mutter hatte mir verboten, die Medizinmappe mitzunehmen.
»Es geht um deinen Kopf«, hatte sie nur gemeint.
Schon auf der kurzen Fahrt zum Arzt hatte sie mir das immer und immer wieder erklärt. Es ginge um meinen Kopf. Nur um meinen Kopf und um sonst nichts.