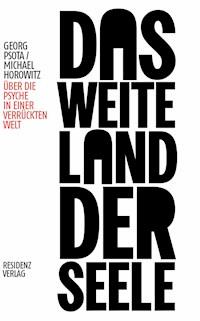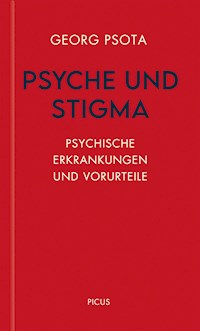Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es ist ein schmaler Grat zwischen Genuss und Sucht. Befreien Sie sich von der Abhängigkeit! Immer mehr beherrschen Süchte unsere Gesellschaft. Auch die Pandemie führte zu einer Zunahme der psychischen Belastung und damit verbunden zu einem erhöhten Risiko für Suchtverhalten. Immer öfter wird ein Augenblick des Wohlbefindens mit dem hohen Preis der Unfreiheit bezahlt. Und immer öfter wird allein die Suche nach diesem Moment zur Sucht. Und süchtig sein kann man nach vielem: Zigaretten, Alkohol, Drogen, Essen, Arbeit, Internet, Einkaufen, Glücksspiel ... Das Buch "Sucht" von Georg Psota und Michael Horowitz zeigt verschiedenste Formen von Suchterkrankungen und deren Ursachen auf und hilft, Abhängigkeiten zu bekämpfen, um wieder ein freieres, ausgeglicheneres Leben zu führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GEORG PSOTAMICHAEL HOROWITZ
SUCHT
ERKENNEN – VERSTEHEN – ÜBERWINDEN
UNTER MITARBEIT VONANGELIKA HOROWITZ
Soweit in diesem Buch personenbezogene Begriffe verwendet werden, gelten diese in derselben Weise für Frauen, Männer und Diverse; zwecks besserer Lesbarkeit wird jedoch ohne Diskriminierungsabsicht meist nur eine geschlechtsspezifische Bezeichnung verwendet.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
© 2022 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Thomas Kussin
Grafische Gestaltung/Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Maria-Christine Leitgeb
ISBN ePub:
978 3 7017 4676 7
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 3501 3
INHALT
TEIL 1 – RÄTSEL DES RAUSCHGLÜCKS
SUCHTSPIRALE IN DER KUNST
VORWORT
TEIL 2 – SUCHT
PROLOG
DIE SUCHT
DER STOFF
ALKOHOL
NIKOTIN
CANNABIS
DIE OPIUM-FAMILIE
KOKAIN
AMPHETAMINE
HALLUZINOGENE & PSYCHEDELIKA
KAFFEE
ESSEN
VON DER SUBSTANZSUCHT ZUR VERHALTENSSUCHT
SUBSTANZUNGEBUNDENE SÜCHTE
AUTOMATEN
INTERNET
SEX- UND PORNOGRAFIESUCHT
ARBEITEN
KAUFEN
SUCHTVERSCHIEBUNG
MEDIKAMENTE
ANGEHÖRIGE VON SUCHTKRANKEN
12 REGELN FÜR ANGEHÖRIGE VON SUCHTKRANKEN
VADEMECUM
BIBLIOGRAFIE
TEIL 1
RÄTSEL DES RAUSCHGLÜCKS
MICHAEL HOROWITZ
SUCHTSPIRALE IN DER KUNST
Man kann nie sicher sein, ob die Geister,die sich durch einen hindurchbewegen,die eigenen oder die der Flasche sind.
TOM WAITS
Das Risiko, süchtig zu werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben der Stabilität von Persönlichkeit und Psyche entscheiden auch die Gene und die Gesellschaft – vor allem das persönliche Umfeld, die soziale Eingebundenheit – darüber, ob ein Mensch abhängig wird. Das Potenzial von Drogen ist vielfältig: So machen sich Alkohol und andere Rauschmittel im Lustzentrum des Gehirns breit und werden dadurch oft wichtig wie Sex.
Wie Michael Musalek, langjähriger Leiter des Anton Proksch Instituts in Wien-Kalksburg, im Vorwort zu diesem Buch schreibt, zeigen wissenschaftliche Studien, dass bei dreißig bis sechzig Prozent aller untersuchten Suchtkranken eine jahrelang dauernde Symptomfreiheit erreicht werden kann. Der Suchtexperte Musalek entwickelte auch innovative Ansätze in der Suchtbehandlung, die zur Neu- und Wiederentdeckung der eigenen Lebenskräfte beitragen sollen und trotz beklemmender Umstände helfen, das Schöne nicht aus den Augen zu verlieren.
Mit diesem Buch – unserem dritten gemeinsamen – haben der Psychiater und Neurologe Georg Psota und ich versucht, das Thema Sucht und Suchtbehandlung zu beschreiben, um möglicherweise auch die Leiden von Suchtkranken lindern zu können sowie den Schmerz der Angehörigen von Betroffenen.
Neben der fundierten Analyse der Sucht und all deren Auswirkungen auf den Menschen zeigt Georg Psota anhand von praktischen Beispielen auch die Suchtspirale von Patientinnen und Patienten auf. Von Alkoholabhängigkeit bis Internet-Sucht, von Drogen- bis Nikotin-Sucht. Er erzählt etwa von Roland, der sich mithilfe der richtigen Behandlung aus seiner jahrzehntelangen Alkoholsucht hat befreien können und abstinent geworden ist, oder auch von Petra, die einen erfolgreichen Amphetaminentzug geschafft hat, und von Josef, der bis zu 120 Zigaretten täglich rauchte und es trotz Entzugsdepression geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören.
Es sind drei Fälle von vielen, die zeigen, dass es Wege aus der Sucht geben kann, beziehungsweise wie wichtig es für jeden gefährdeten Menschen ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wie wenige Menschen sind nicht suchtgefährdet … Das zeigen auch die Lebensgeschichten vieler Künstlerinnen und Künstler. Das gemeinsame Auftreten von Kunst und Sucht zieht sich durch die Jahrhunderte. Das Leben ist dem Exzess verschrieben. Alkohol, Rauschmittel und Medikamente stimulieren die Erlebniswelten. Man will sich mitunter von gesellschaftlichen Normen befreien, erhofft sich Inspiration und Trost, glaubt, durch Drogen dem Leben Halt und einen Sinn geben zu können. Man versucht, Grenzen zu überschreiten, neue Horizonte zu erschließen – meist bis zum körperlichen und seelischen Verfall.
Der sehr persönliche Bericht des Liedermachers und Lyrikers Konstantin Wecker über seine höllischen Qualen während der Zeit, als er – physisch und psychisch – am Ende und drogenabhängig war, manifestiert seine Situation beklemmend und eindringlich.
»Unter Drogen findet man nicht sich selbst, sondern nur seinen Schatten«, bekennt Konstantin Wecker. 1995 wird der Schneemann verhaftet. Wecker hat mehrere Jahre schwerste Kokainabhängigkeit hinter sich. Im autobiografischen Roman Uferlos thematisiert er seine Drogenprobleme. Es ist eine aufwühlende Beschreibung, wie Konstantin Wecker nach anfänglicher Faszination dem Kokain verfällt, wie sich seine traurige Existenz nur mehr um Beschaffung und Konsum der Droge dreht. Im Lied Kokain singt er: »Hol mich raus, ich kann nicht mehr. Alles Leichte wird so schwer. Und was gilt, das geht dahin – Kokain.«
Auf einer Jahrestagung bayerischer Psychiater schildert Konstantin Wecker 1997 seine Jahre im Drogenrausch:
»Als zehn Kriminalbeamte meine Villa in München-Grünwald stürmten, hatte etwas in mir mit dem Leben bereits abgeschlossen. Die Miete des Luxusanwesens war schon seit Monaten nicht mehr bezahlt, und selbst meinen Dealer versuchte ich, mit ungedeckten Schecks zu vertrösten. Wie konnte jemand, der immer die Nähe zu den einfachen Menschen gesucht hatte, sich so hinter den Mauern eines Eispalasts verstecken?
Wie konnte es passieren, dass ein Lebenshungriger seine letzte Hoffnung in den Ausbruch eines Krieges oder in einen Herzinfarkt legte? Oder, um die unausweichliche Frage aller Kranken zu stellen, wie konnte das ausgerechnet mir passieren?
Seit ich mich dem Musikantenberuf verschrieb, habe ich mich damit auch der Ekstase verschrieben. Ekstase ist nun mal die einzige Möglichkeit, der Enge des Körpers kurz zu entwachsen und sich verbunden zu spüren mit allem, was ist. Ich berauschte mich an allem, am Rotwein Brunello di Montalcino ebenso wie an den Liedern eines fahrenden Gesellen; an einem Gramm reinsten bolivianischen Kokains, an Magic Mushrooms, an Fellini und Trotzki, an Frauen. Ein pralles Leben, vielleicht etwas deutlich gelebt, aber von der Idee her nichts Außergewöhnliches. Der liebe Gott hat mir eine kräftige Konstitution mitgegeben, diesen Vorschuss habe ich ausgenützt.
Der Kick des ersten voll durchgezogenen Zuges ist so gigantisch, dass man ihn nie mehr vergisst und sich der sofortige Wunsch, nein, die unbedingte Notwendigkeit, ihn auf der Stelle zu wiederholen, für immer ins Hirn programmiert. Die größte Gemeinheit aller Drogen ist wohl, dass sich das erste gelungene Mal nie mehr wiederholen lässt und man sich anschließend eigentlich nur noch auf der Suche nach diesem verlorenen Glück befindet.
Der nächste Kick, der eine ultimative Zug, der einen mit allem Stress versöhnt, für ein paar Sekunden ins Nirwana katapultiert – mit dieser Droge löst sich jedes Zeitgefühl ins Nichts auf.
Welches Entsetzen, wenn nur noch ein paar Gramm im Haus waren. Wände wurden aufgeschlagen, hinter denen ich Depots vermutete, Möbel zerfetzt in der Hoffnung, Reste zu finden – wie unwürdig, wie sehr ekelte ich mich vor mir selbst. Ich liebte meinen Dealer, der mich sehr fair belieferte, und als ich ihm vor Gericht Anstand bescheinigte, kam das von Herzen.
Ständig schweißüberströmt, aufgeschwemmt aufgrund eines Nierenversagens, weit aufgerissene Augen, wirrer Blick, war ich kaum mehr in der Lage, meine Bewegungen in einem gesellschaftlich akzeptierten Maß zu koordinieren. Die Bühne bot mir einen gewissen Schutz, da ich mich nirgends so zu Hause fühlte wie dort und mich nirgends so selbstverständlich bewegte wie am Klavier. Außerdem hoffte ich, mithilfe der Zauberkraft der Töne mein katastrophales Äußeres etwas vergessen zu machen.
Meistens befand ich mich beim Konzert auf zwei verschiedenen Bewusstseinsebenen gleichzeitig. Ich spielte makellose Soli, manchmal von ungeahnter improvisatorischer Kraft, ein anderer Teil meines Ichs befand sich in einer Art Traumzustand, in dem mich die heftigsten Phantasien bestürmten. Schiller schreibt, man habe im Leben zu wählen zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden. Ersteres habe ich reichlich auszukosten versucht, nun zog ich, noch im Gefängnis, notgedrungen den zweiten Vorschlag in die engere Wahl.«
Aber Konstantin Wecker rechnete auch mit der Gesellschaft ab: »Sie ist noch davon entfernt, Sucht als Krankheit zu sehen.«
Mit den berührend ehrlichen Gedanken von Konstantin Wecker beginnt diese ziemlich triste Betrachtung über Künstlerinnen und Künstler aus mehreren Jahrhunderten, die sich in einer Suchtspirale befunden und ihr Leben – zumindest zeitweise – dem Exzess geopfert haben.
KOKAIN – EIN GESCHENK DER NATUR
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts erlangen zwei Kokain-Pioniere Weltruhm: Sigmund Freud und Sherlock Holmes. Als sein eigenes Versuchsobjekt experimentiert der Psychoanalytiker aus der Berggasse mit Kokain – nach amerikanischen und auch europäischen Forschungsberichten über die Wunderkräfte des Cocablattes: Es solle Alkoholismus und Heuschnupfen kurieren, mache Menschen froh und Soldaten tapfer, wirke anästhetisierend. Erst ab dem Jahr 1903 mischt Coca-Cola seinem Gebräu kein Kokain mehr bei.
Freud widmet sich im Selbstversuch und an Patienten den pharmakologischen Wirkungen von Kokain. Er hofft, sich dadurch als Arzt und Wissenschaftler zu etablieren. Am 30. April 1884 nimmt Sigmund Freud zum ersten Mal Kokain. Bei der Pharmafirma Merck ersteht er für 1,27 Dollar ein Gramm der Substanz. Er ist 28 Jahre alt und arbeitet als Assistenzarzt im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Er verspricht sich anfänglich große Erfolge bei der Behandlung von Herzkrankheiten und nervösen Schwächezuständen, vor allem auch bei den elenden Zuständen des Morphin-Entzugs.
In Nordamerika setzt man bereits Ende der 1870er-Jahre Kokain ein, um Alkoholiker und Morphinisten zu behandeln. Sigmund Freud ist aber nicht der erste Mediziner, der in Europa mit Kokain experimentiert.
Bereits im 18. Jahrhundert ist die Wirkung der Blätter des Cocastrauches bei manchen Gelehrten in Europa bekannt. Die medizinische Anwendung ist in Europa jedoch erst seit dem Jahr 1884 erforscht: Der Ophthalmologe Carl Koller entdeckt die weltweit aufsehenerregende lokalanästhetische Wirkung von Kokain am Auge. Durch Einträufeln einer Kokain-Lösung und die Betäubung der Hornhaut werden erstmals schmerzfreie Augenoperationen wie zum Beispiel von Glaukomen möglich. Der mehrmals für den Nobelpreis nominierte Carl Koller gilt seit damals als Begründer der modernen Lokalanästhesie in der Augenheilkunde.
Coca-Koller nennt ihn sein Freund Sigmund Freud. Als die beiden im Sommer 1884 im Hof des Allgemeinen Krankenhauses im Kreis junger Sekundarärzte plaudern und einer über Zahnschmerzen klagt, reagiert Freud prompt: »Ihnen kann geholfen werden!« Wenige Tropfen der Cocapflanze stillen die Schmerzen im Augenblick.
In jenem Jahr erscheint auch Sigmund Freuds Kokain-Schrift Über Coca. In seiner Untersuchung ist er von der Wirkung des Kokains auf das Gehirn beeindruckt. Voller Enthusiasmus hat er zuvor versucht, durch die Gabe von Kokain – einem »Geschenk der Natur« – einen Kollegen von dessen Morphium-Abhängigkeit zu heilen. Seine Absicht, Kokain als Medikament für seelische Erkrankungen einzuführen, schlägt jedoch fehl.
Der schillernde Meisterdetektiv Sherlock Holmes, unordentlich und drogensüchtig, ist ein Privatier ohne geregeltes Einkommen, aber mit messerscharfem Verstand und den stets leicht arroganten Umgangsformen eines englischen Gentlemans. Er ist ein Geschöpf des Kokainisten Sir Arthur Conan Doyle, der 56 Geschichten und vier Romane über seinen geheimnisvollen Ermittler geschrieben hat. Der exzentrische Detektiv injiziert sich den Saft als überragendes Stimulans und auch zur Klärung des Geistes und verstört damit seinen treuen Freund und Begleiter Dr. Watson.
SCHRILLE, EINBALSAMIERTE VÖGEL
Allein mit der Kokain-Literatur der 1920er- und 1930er-Jahre könnte man ganze Bibliotheken füllen: von Theodor Plieviers Novelle Koka bis zu Max Brods Buch Annerl, einem Roman, in dem Kokain keine unbedeutende Rolle spielt.
Einer der größten Kokainisten des vergangenen Jahrhunderts ist der adelig-mondäne Zyniker und Zeitungskorrespondent, Salonlöwe und Schriftsteller Dino Segre, der unter dem Pseudonym Pitigrilli schreibt. Im Roman Kokain schildert er, wie das Rauschmittel aus Vertretern dekadenter Bourgeoisie und gefährlicher Halbwelt »schrille, einbalsamierte Vögel« macht und durch das Kokain die »Flamme der Sinnlichkeit niedergeschlagen wird«. Die Fama des Frivolen, Berüchtigten und Subversiven erscheint 1921 und wird in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt: »Tolle Phantasien« sorgen im Kokain-Kopf der schillernden Figuren für ein »Karnevalsfest in einem Irrenhaus«.
Schon die Mutter des Dichters Georg Trakl – eines exzessiven Trinkers, der in »Meeren von Wein versinkt« – ist drogenabhängig. Er selbst experimentiert mit Äther und Chloroform, Kokain und Opium, Meskalin und Morphium. 1908 beginnt er, Pharmazie zu studieren, seine Drogenexzesse werden noch ausschweifender.
Nachdem er als Soldat miterleben muss, wie dreizehn Menschen an einem Baum erhängt werden, erleidet er einen Nervenzusammenbruch und versucht, sich später zu erschießen. Im Militärspital von Krakau beobachtet man seinen Geisteszustand. Er stirbt dort an einer Überdosis Kokain.
Knapp zwanzig Jahre später hält Otto Dix, der malende Analytiker menschlicher Abgründe, die triste, devastierte Koksgräfin im Bild fest – kein schöner Anblick.
Charles Baudelaire, der sich selbst als Albatros sieht, der mit majestätisch ausgebreitetem Gefieder hoch über der Allgemeinheit den Himmel beherrscht, empfiehlt als Mittel gegen Schreibhemmungen Schnaps und lässt selbst keinen Rauschzustand aus – von Absinth bis Opium. Und er ist überzeugt davon, dass man sich nur im Rausch frei entfalten kann, gegen den Zwang der Gesellschaft.
BRAUNER SAFT UND GRÜNE FEE
Der Kultautor der Beat-Generation Jack Kerouac versucht sein Bewusstsein durch Halluzinogene zu erweitern. Sein Buch On The Road – das Manuskript schreibt er auf einer knapp vierzig Meter langen Papierrolle – ist Ende der 1950er-Jahre eine Art heilige Schrift der Jugendbewegung. Bereits mehr als 150 Jahre zuvor schwärmt der Dichter und Philosoph Novalis von Opium, in seinen Hymnen an die Nacht huldigt er dem »braunen Safte des Mohns«.
Für den Schriftsteller Klaus Mann ist der morbide Jean Cocteau – Poet, Maler, Komponist und Regisseur – ein »visionärer Clown und clownischer Visionär«. Der als Maître de Plaisir der vergnügungssüchtigen Stadt Paris gefeierte Universalkünstler ist lange Zeit seines Lebens drogenabhängig. Seine Selbstportraits zeigen ihn nachdenklich, mit ins Leere schweifendem Blick. Wegen Opium-Vergiftungen muss er immer wieder medizinisch behandelt werden: 1957 erscheint Opium, ein Tagebuch seiner Entziehungskur.
Sinclair Lewis, Eugene O’Neill, William Faulkner, John Steinbeck und Ernest Hemingway: Diese fünf der sieben US-Literatur-Nobelpreisträger sind schwere Alkoholiker. Faulkner, Preisträger des Jahres 1949, der von vielen Kritikern als der größte amerikanische Romancier bezeichnet wird, kann ohne Whisky keinen seiner langen, labyrinthischen Sätze verfassen.
Brave New World-Autor Aldous Huxley ist ein leidenschaftlicher Konsument und Befürworter bewusstseinserweiternder Drogen, bis zu seinem Ende. Noch auf dem Sterbebett, er hat Kehlkopfkrebs und leidet unter starken Schmerzen, lässt er sich von seiner Frau LSD injizieren. Zuvor gibt er ihr einen Zettel mit der Notiz »LSD 100 (Mikrogramm) intramuskulär«. Dadurch wird Laura Huxley gemeinsam mit ihrem Mann vor fast sechzig Jahren zu einer Pionierin des Einsatzes psychedelischer Substanzen als Sterbebegleitung.
Als Einstimmung auf den Tod lesen die beiden die gerade erschienenen Anweisungen zur Durchführung einer tranceartigen Reise. Verfasst vom umtriebigen Psychologen, Guru der Hippie-Bewegung und LSD-Pionier Timothy Leary. Er ist überzeugt davon, dass die Droge LSD bei richtigem Gebrauch das Bewusstsein in neue Sphären leiten kann. Für seine Fans ist Leary der Galileo des Bewusstseins. Hingegen bezeichnet ihn US-Präsident Richard Nixon einmal als gefährlichsten Mann Amerikas.
Grace Slick, die wilde Jefferson Airplane-Sängerin, versucht am 24. April 1970 im Weißen Haus Präsident Nixon 600 mg LSD in den Tee zu mischen, doch im letzten Moment wird sie von Secret-Service-Beamten daran gehindert. Wie sie in das abgeschirmte Machtzentrum der Vereinigten Staaten gelangen konnte, weiß man bis heute nicht.
Der CIA beginnt – noch bevor die Droge die Popkultur und Partyszene erreicht – mit geheimen Versuchen. Denn man könne ja Staatsfeinde wie Fidel Castro vor Auftritten auf LSD setzen … Soldaten als Probanden, die zur Einnahme von LSD gezwungen sind, erfahren zumeist den atypischen Verlauf des Rausches, den Horrortrip. Alle ihre Ängste und inneren Probleme verfolgen sie stundenlang.
Laura Huxley ist vom positiven Effekt des Halluzinogens während des Sterbeprozesses überzeugt – basierend auf dem tibetischen Totenbuch, das in alter Tradition Sterbenden und Toten vorgelesen wird, um ihre Seelen auf der Reise in oder durch das Jenseits zu leiten. Sie nennt Huxleys Ende »the most beautiful death« – »den schönsten Tod«. Bereits zehn Jahre vor seinem Ende nimmt Huxley unter Aufsicht des Psychiaters Humphry Osmond zum ersten Mal Meskalin, später auch LSD. Gemeinsam prägen sie den Begriff »psychedelisch« – »die Seele offenbarend«.
Der Philosoph Michel Foucault, der die Öffnung psychiatrischer Anstalten propagiert und gegen unmenschliche Zustände in Gefängnissen kämpft, nimmt in Kalifornien LSD, der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger, der vor allem durch seine Kriegstagebücher bekannt ist, schreibt im Essay Annäherungen. Drogen und Rausch über seine eigenen Drogen-Séancen. Unter anderem gemeinsam mit dem Pharmakologen Albert Hofmann, der 1943 – auf der Suche nach einem Kreislaufmittel – LSD im Schweizer Sandoz-Labor entwickelt.
Seinen aufregendsten LSD-Trip beschreibt Ernst Jünger als Adlerflug: »Im Rausch, gleichviel ob er betäubend oder erregend wirkt, wird Zeit vorweggenommen, anders verwaltet, ausgeliehen. Sie wird zurückgefordert; der Flut folgt Ebbe …«
EIN GIGANTISCHER PENIS, DER VON DER ERDE ABHEBT
LSD soll im Jahr 1949 zu einem Wundermittel der Medizin werden, es wird als Delysid zugelassen. Hollywood lernt LSD durch seine Therapeuten kennen. So berichtet der charmante Frauenschwarm Cary Grant, der mehr als hundert Trips unternimmt, begeistert: »Ich wurde wirklich neu geboren.« Einmal meint der soignierte Film-Gentleman nach einer LSD-Reise: »Ich sah mich als gigantischen Penis, der von der Erde abhob wie ein Raumschiff.« Und Grant berichtet, er habe in den 1950er-Jahren – dank Drogen – seine Verklemmtheit abgeworfen: »In einem LSD-Traum kackte ich erst auf einen Teppich und dann über den ganzen Boden.«
Kenneth »Ken« Kesey, der Aktionskünstler und Autor von Einer flog über das Kuckucksnest, zieht Mitte der wilden 1960er-Jahre mit in bunte Tücher gehüllten Hippie-Freunden in einem psychedelisch bemalten, uralten Schulbus durch die USA und veranstaltet Acid Tests. Enthemmte Partys, auf denen die Rockband Grateful Dead spielt und LSD verteilt wird. Ein Dandy im ewig weißen Anzug mit Krawatte, der junge Reporter Tom Wolfe, begleitet den gutgelaunten LSD-Trip und schreibt sein erstes erfolgreiches Buch darüber, den Electric Kool-Aid Acid Test. Die Beatles, die Doors, die Rolling Stones schreiben bald LSD-Songs.
1969 werden die bestialischen Taten des Massenmörders Charles Manson und seiner Hippie-Gang, darunter der Mord an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate, mit LSD in Verbindung gebracht. Timothy Leary erhält eine Gefängnisstrafe, bricht aus und flieht zweieinhalb Jahre durch die halbe Welt, lernt an die vierzig Gefängnisse kennen und ist seit 1978, nach vier Jahren US-Knast, wieder ein freier Mann.
Bereits fünfzehn Jahre zuvor wird er als Psychologiedozent wegen seiner Rauschexperimente von der Harvard University verstoßen. 1984 fordert LSD-Pionier Leary die Auswanderung ins All und veranlasst, dass nach seinem Tod sieben Gramm seiner Asche mit einer Pegasus-XL-Trägerrakete in den Weltraum geschossen werden.
Der tschechische Psychiater Stanislav Grof nennt die Droge LSD ein »Mikroskop und Teleskop der Psychiatrie«, er berichtet von Therapieerfolgen während weniger Wochen, die sonst Jahre gebraucht hätten. Nachdem die Einnahme von LSD in vielen Ländern auch zu Forschungszwecken verboten wird, entwickelt Grof gemeinsam mit seiner Frau als Alternative zum psychedelischen LSD die umstrittene Technik des holotropen Atmens. Dessen Ziel ist es, durch beschleunigtes, vertieftes Atmen einen Zustand zu erreichen, der dem Bewusstsein nicht zugänglich ist: Atmen als Therapie von psychischen und psychosomatischen Störungen – in einem Rauschzustand ohne Drogen.
EKSTASE ALS STÄNDIGER BEGLEITER
Vor allem auch bildende Künstler und Künstlerinnen pflegen schon immer Exerzitien des Rausches als Hilfsmittel ihrer Kreativität – als Treibstoff ihrer Genialität. Man versucht, Bildwelten, die im Unterbewussten verborgen sind, hervorzurufen. Ekstase wird zum ständigen Begleiter.
Lange vor Peter Handke beschimpft Arnulf Rainer das Publikum, der Begründer der informellen Kunst in Österreich, dessen Lebenslinien nicht ganz in das Bild seiner lieblichen Heimatstadt Baden passen. Bereits als Sechsjähriger beginnt der Avantgarde-Künstler wie besessen zu zeichnen.
Mitte der 1960er-Jahre experimentiert er mit Rauschgift, malt entfesselt im Drogenrausch und betreibt Studien in psychiatrischen Anstalten. Mit Überarbeitung von Fotoportraits und Kreuzigungsszenen sorgt er für Skandale. Später malt Rainer einmal so aggressiv, dass ihm der Pinsel zerbricht, worauf er mit den bloßen Händen die Ölfarbe aufs Bild klatscht, bis die Fingerkuppen bluten. Seither ist die Fingermalerei ein Teil seines Repertoires.
Ernst Ludwig Kirchner braucht Morphium, um malen zu können, als Absinth-Trinker sind Édouard Manet, Paul Gauguin und der kleinwüchsige Henri de Toulouse-Lautrec bekannt, der zu trinken beginnt, um sein Selbstvertrauen zu stärken. Auch Vincent van Gogh: Überreizt, überarbeitet, von Gauguin genervt und vom Absinth betrunken soll er sich am Abend des 23. Dezember 1888 ein Stück vom linken Ohr abgeschnitten haben. Und auch der junge Pablo Picasso liebt das Getränk der Bohème.
Absinth, die grüne Fee – so der Name der mystischen Spirituose in Künstlerkreisen – enthält bis zu achtzig Milligramm des Nervengifts Thujon. Literaten wie Baudelaire, Poe und Rimbaud sind dem Absinth ausgeliefert, Maler machen das giftige Gebräu aus Wermut und anderen Kräutern wie Anis und Fenchel berühmt: Vincent van Gogh oder Edgar Degas 1873 mit seinem Bild Absinth – zwei dumpf blickende Figuren ohne Hoffnungsschimmer. Knapp dreißig Jahre danach malt der junge Picasso, für den Absinth und auch Opium treue Begleiter sind, Buveuse assoupie, eine einsame, zusammengeknickte Absinth-Trinkerin mit einem dünnen, ausgemergelten Körper, in einen schwarzblauen Umhang gehüllt. Ein Symbol des körperlichen Verfalls.
Weil er im Verdacht steht, Epilepsie, Blindheit und Wahnsinnszustände auszulösen, wird Absinth schließlich in vielen Ländern verboten. Etwa in Deutschland 1923 nach einer massiven Häufung von Selbsttötungsversuchen. Heute ist eine milde Variante legalisiert, aber nur in wenigen Szenebars erhältlich. In Paris, Berlin und Barcelona.
CLUB 27 DER UNSTERBLICHEN MUSIKER
Die Symbiose von schädlichen Substanzen und dem Rauschzustand des Außer-sich-Seins durchzieht die Musikszene. Auch What a Wonderful World-Botschafter Louis Armstrong ist in seiner Jugend extremer Kiffer. In einem Jazz-Blog mit dem Thema Wieso Drogen? heißt es: »Das Leben der meisten Jazzmusiker war hart: Lebensplanung und finanzielle Versorgung immer nur bis zum nächsten Auftritt, es gab viel mehr gute Musiker als Auftrittsmöglichkeiten. Dann, nach dem Konzert, ist man viel zu aufgedreht, um schlafen gehen zu können …« Drogen werden zu einem kurzfristigen Fluchthelfer aus der tristen Realität.
Lou Reed gründet 1966 im Dunstkreis von Andy Warhol die Underground-Rockband The Velvet Underground. Seinen Song Heroin, der den Ge- und Missbrauch der Droge offen beschreibt, findet man schon auf ihrem Debütalbum. Reed, der Rock-Poet, der sich ein Leben lang auf der wilden Seite des Daseins bewegt, bekennt, »ich habe versucht, meinen Drogenkonsum mit Alkohol zu bekämpfen«. Auch Jim Morrison, Keith Richards, Sid Vicious und viele kaputte Punkrocker haben diesen Versuch unternommen. Ohne Erfolg.
Jimi Hendrix und Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse und Rolling Stones-Gitarrist Brian Jones, der in einem Swimmingpool ertrinkt – werden nur 27 Jahre alt. Ein trauriger Club 27 unsterblicher Musiker, haltloser, hochbegabter Menschen mit einem kurzen, rauschhaften Leben, das von Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll bestimmt ist. Die Devise Live fast, love hard, die young wird zu ihrem Lebensmotto mit tragischem Ende als Drogenopfer.
Heute ist man sich längst der zerstörerischen Kraft von Drogen bewusst – damals sind halluzinogene Drogen das Zauberwort einer Generation. Mit Meskalin, LSD und Alkohol flüchtet man zu neuen Ufern, in einen Rauschzustand, um der prüden Realität der Elterngeneration, ihren rigiden Wertvorstellungen, etwas entgegenzusetzen: Intensität, Exzesse und Ekstase.
POLITIKER DER EROTIK
Vor allem The Doors-Frontmann Jim Morrison fordert mit seinen Texten zum Sturm auf das Spießbürgertum auf. Er sucht, und mit ihm seine Fans, nach neuen Lebensformen. Er sieht sich gerne in einer Pose mit ausgebreiteten Armen, die an Jesus Christus erinnern. Als Politiker der Erotik (Morrison über Morrison) will er Pforten sinnlicher Wahrnehmung, die Türen – daher der Bandname The Doors – zur Freiheit, zum Unbewussten, zum Unbekannten aufstoßen. Da sind halluzinogene Drogen ideale Begleiter.
Gitarrengott Jimi Hendrix begeistert auf seinem Instrument mit einem Klangteppich wie niemand vor und nach ihm. Er bearbeitet bei Live-Auftritten unter dem Jubel der johlenden Fans seine Gitarre mit Fingern, Lippen und Zähnen. Für manche Musikexperten gilt er als begabtester Pop-Instrumentalist aller Zeiten und prägt Generationen von nachfolgenden Musikern. »Jimi, der mich begleitete, stahl mir die Show – ich dachte, die Leute applaudierten mir, aber sie meinten ihn«, erinnert sich Rock-’n’-Roll-Legende Little Richard an einen gemeinsamen Auftritt am 21. Februar 1965 nach Ike & Tina Turner im legendären Rock-Tanzpalast Fillmore Auditorium von San Francisco.
1969 wird die Hendrix-Version der amerikanischen Nationalhymne The Star-Spangled Banner in Woodstock zur Hymne der Antikriegsgeneration, zum Meilenstein der Musikgeschichte. Jimi Hendrix imitiert auf seiner Gitarre Maschinengewehre, Militärflugzeuge und Bombeneinschläge. Der Auftritt der wichtigsten Symbolfigur der Hippie-Bewegung gilt als Protest gegen den Vietnamkrieg.
Der Aufstieg von Jimi Hendrix zum Weltstar hat seinen Preis: Der Ausnahmemusiker konsumiert immer mehr Drogen und zieht sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Seinen letzten Rausch überlebt er nicht: Rotwein und Schlaftabletten. Ein Jahr nach Woodstock stirbt er im Londoner Apartment eines deutschen Groupies, der Eiskunstlauftrainerin Monika Dannemann. Dreißig Jahre später wird bei einer Auktion eine seiner Gitarren um 180 000 Euro versteigert.
Janis Joplin, ein weiteres Mitglied im Club 27, Legende und Symbolfigur der Hippie-Bewegung. Mit ekstatischem Gesang und wilden Gefühlsausbrüchen fasziniert sie die amerikanische Jugend. In einem ihrer berühmtesten Songs träumt sie von einem Mercedes Benz, doch bis zu ihrem Tod ist sie in einem psychedelisch bemalten Porsche 356 1600 SC, Baujahr 1964, unterwegs. Für 1,76 Millionen Dollar wird das Cabrio 45 Jahre später durch ihre Familie in New York bei Sotheby’s versteigert.
Auf vielen Fotos zeigt sich Joplin mit einer Flasche Southern Comfort-Whiskeylikör. Sie fragt bei der Herstellerfirma an, ob sie dafür nicht ein wenig Geld bekommen könne. Man überweist ihr umgehend 6000 Dollar. Die selbstzerstörerische Kultsängerin stirbt 1970 – zwei Wochen nach Jimi Hendrix – an einer Überdosis Heroin. Ihr linker Unterarm weist vierzehn Einstiche auf. Wunschgemäß vertrinken 200 Freunde auf einer Party das hinterlassene Bargeld von 1500 Dollar.
In jenem Jahr 1970 tritt Tom Waits erstmals in einem Club auf, in dem er früher als Türsteher gearbeitet hat. Der melancholische Sänger mit der einzigartigen, rauen Whisky-Stimme hört erst mehr als zwanzig Jahre später, nach der Veröffentlichung seines Albums Bone Machine, zu trinken auf. Bis dahin weiß er, wenn man trinkt, »kann man nie sicher sein, ob die Geister, die sich durch einen hindurchbewegen, die eigenen oder die der Flasche sind«, wie er in einem Interview mit dem Guardian bekennt: Von einem bestimmten Punkt an bekomme man Angst vor der Antwort. Das sei wohl einer der Hauptgründe, die Menschen davon abhalten würden, nüchtern zu werden.
STÖHNEN – DURCHSETZT MIT UNZÜCHTIGER BEGIERDE
Um kaum einen Tod eines Sängers und Säufers ranken sich so viele Legenden wie um den von Jim Morrison. Den Tschick hält er gerne auch auf der Bühne in der Hand, während er seine Rock-Balladen ins Publikum schleudert. Der fescheste Rockstar aller Zeiten ist ein Sexsymbol mehrerer Generationen und ein Poet, der Zeilen wie Before I sink into the big sleep, I want to hear the scream of the butterfly hinterlässt.
Mehr als fünfzig Jahre nach seinem Tod hat der Mythos Morrison nichts von seiner Faszination eingebüßt. Der charismatische The Doors-Frontmann ist auf dem Zenit seiner Karriere der Inbegriff des gefeierten Rockstars. Er schockiert das prüde Amerika und fasziniert als Rebell die Jugend: »Sein Gesicht wie von einem griechischen Gott schien aus schweißtreibenden Träumen zu stammen«, erinnert sich ein Groupie im Summer of love des Jahres 1967, »er sang mit intensivem Baritonstöhnen, durchsetzt mit unzüchtiger Begierde. Ich fiel in Ohnmacht.«
Hinter der Maske des Erfolgs steht ein Mensch, der depressiv, exzessiv und verschlossen ist. Wegen seiner Exzesse mit Marihuana, LSD und Alkohol in rauen Mengen – er torkelt sturzbetrunken über die Bühne, wirft sich schreiend auf den Boden – wird er immer wieder festgenommen, zumeist weil er betrunken randaliert. Der destruktive Musikpoet ist auch Mitglied im Club 27. Er stirbt 1971 an einer Überdosis Heroin in der Badewanne seiner Pariser Wohnung. Noch heute pilgern Scharen von Hippies, Junkies und Doors-Fans auf den Pariser Prominenten-Friedhof Père Lachaise, wo Jim Morrison in der 6. Division, 2. Reihe, im Grab 5 beigesetzt ist. In der Nähe von Édith Piaf und Frédéric Chopin, Oscar Wilde und Marcel Proust.
42 Jahre nach dem frühen Ende von Jim Morrison dokumentiert 2013 ein Forschungsteam der Universität Heidelberg, wie Alkohol und Drogen bei der überdurchschnittlich intelligenten Rock-Legende – in der Highschool wird ihm ein IQ von 149 bescheinigt und er schreibt früh Gedichte – in kurzer Zeit zum Verlust seiner Kreativität führen.
Michael Jackson, der unangefochtene King of Pop der 1980er-Jahre – bis heute haben nur die Beatles und Elvis Presley mehr Platten verkauft als er –, beginnt erst 1993, als er öffentlich der Pädophilie bezichtigt wird, Drogen zu konsumieren. Dann allerdings gewaltige Mengen Kokain und bis zu vierzig Pillen aller Art. Schließlich erliegt er im Alter von fünfzig Jahren einer Überdosis Propofol, einem Narkotikum, das ihm sein Leibarzt Conrad Murray, der wegen fahrlässiger Tötung zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wird, verabreicht hat.
Prince Rogers Nelson, der in High Heels und Rüschenhemden unter seinem ersten Vornamen Prince auftritt – er ist Oscar- und siebenfacher Grammy-Gewinner –, stirbt ausgezehrt und extrem geschwächt nach einem Drogenroulette. Im gigantischen 6038 Quadratmeter großen Wohn- und Arbeitssitz des Kultmusikers, im legendären Anwesen Paisley Park voller Pomp und Pathos mitten im Nirwana von Minnesota, findet man Behälter mit Hunderten Tabletten. Auf vielen ist Watson 853 eingestanzt. Das ist ein starkes Schmerzmittel, das man vor allem aus der TV-Serie mit dem schroffen und schonungslosen Dr. House kennt.
4,16 PROMILLE – DAS ENDE EINES VIEL ZU KURZEN LEBENS
An einer Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille Alkohol im Blut stirbt am 23. Juli 2011 eine phänomenale Soul-Interpretin: Amy Winehouse. Ein Leibwächter entdeckt den leblosen Körper. In ihrem Schlafzimmer im Londoner Stadtteil Camden werden als Beweismittel drei Wodka-Flaschen sichergestellt. Sie sind leer. Die Sängerin mit den geheimnisvollen Katzenaugen schreibt Musikgeschichte: Durch öffentliche Exzesse, Drogeneskapaden und maßlose Alkoholgelage, meist in Feinripp-Leiberln, wird sie früh zu einer trostlosen Figur. Winehouse versucht immer wieder, vom Alkohol loszukommen. Ohne Erfolg.
Ihr letzter Live-Auftritt vor 20 000 Fans in Belgrad, fünf Wochen vor ihrem Tod, wird zu einem Desaster – die geplante Europa-Tournee muss abgesagt werden. Sie ist eine selbstzerstörerische Gigantin der Musik, die wie kaum jemand anderer Liebeskummer in Melodien und Worten ausdrückt. Eine traurige Figur mit einem viel zu kurzen Leben, die sich selbst ruiniert hat. Eine fragile Frau, die schon während ihrer Kindheit Antidepressiva geschluckt und später gesagt hat: »Ich wollte schon mit dreizehn von zu Hause ausziehen, man kann nicht den ganzen Tag kiffen, wenn man noch bei der Mutter wohnt.«
Kaum jemand ist so sichtbar drogenabhängig wie der Geliebte von Amy Winehouse, der Skandal-Rocker Pete Doherty – eine der dunkelsten Figuren der Pop-Kultur. Gemeinsam ziehen sie durch Londons Nachtleben. Er konsumiert nach eigenen Aussagen »alles, was high macht«. Unvergessen bleibt sein Ausraster in einem Interview mit dem Fernsehsender MTV: Er bespritzt den Reporter und den Kameramann mit Blut aus einer gebrauchten Spritze. Ein Jahr nach Amys Tod versteigert Doherty ein Bild seiner Freundin, das sie für ihn mit ihrem eigenen Blut gemalt hat.
GENERATION X – LEIDENSCHAFTLICH AM RANDE DER GESELLSCHAFT
Siebzehn Jahre vor Amys Ende, am 5. April 1994, schießt sich der Sänger und Gitarrist der Kult-Band Nirvana Kurt Cobain in seiner Villa in Seattle unter dem Einfluss von Heroin mit einer Schrotflinte in den Kopf. Auch er ist erst 27 Jahre alt. Seine Drogensucht bringt ihn sogar dazu, Heroin in seiner Gitarre zu verstecken und überallhin mitzunehmen. Cobain ist die Symbolfigur einer desillusionierten Generation junger Menschen der 1980er-Jahre. Der kanadische Schriftsteller Douglas Coupland gibt ihnen mit seinem Roman Generation X den Namen, 1991, als Internet und Smartphones noch weit weg sind.
Das deutsche Magazin Der Spiegel schreibt damals davon, wie sich jene Generation als Subkultur gegen die Falschheit von »Madonna, MTV und Versace« stemmt. Mit zerrissenen Jeans, fettigen langen Haaren – und auch Drogen – seien sie »eine Bewegung aus Aussteigern und Karriereverweigerern, die zynisch und leidenschaftlich am Rande der Gesellschaft nach wirklichen Werten suchen«.
Der Tod eines anderen Megastars der 1980er-Jahre, Whitney Houston, wird auch auf ihren jahrelangen Drogenkonsum zurückgeführt. Lange Zeit gilt sie als skandalfreie Sauberfrau. Doch Gewichtsprobleme nach der Geburt ihrer einzigen Tochter und eine fatale, zutiefst unglückliche Ehe mit dem Rapper Bobby Brown lassen die Sängerin mit ihrer einmaligen Stimme, die über drei Oktaven reicht, in eine tragische Spirale von Medikamentenabhängigkeit, Entziehungskuren und permanenten Rückfällen schlittern. Im Februar 2012 ertrinkt The Voice Whitney Houston in der Badewanne eines Luxus-Hotelzimmers in Beverly Hills.
Mit wienerischer Lässigkeit wird ein provokanter Pop-Poet zum Weltstar. Mit verkokster Exaltiertheit und grenzenlosem Größenwahn erobert er Platz 1 der US-Charts. Seine selbsterfundene Kunstfigur Falco vereinnahmt Hans Hölzel und treibt ihn in einen Konflikt zweier Identitäten: Falco erobert den privat sensiblen, schüchternen Hans und treibt ihn in Alkohol- und Drogenexzesse. Am 6. Februar 1998 wird Hans Hölzels Auto in der Dominikanischen Republik beim Verlassen eines Disco-Parkplatzes mit voller Wucht von einem Bus zerquetscht. Der Vierzigjährige ist sofort tot. Er hat 1,5 Promille Alkohol und große Mengen von Drogen im Blut.
Ein großer deutscher Rocker und Entertainer gesteht in einem Interview, es habe Phasen in seinem Leben gegeben, da habe er »nur noch Restblut im Alkohol gehabt«: Udo Lindenberg. Mit Anfang vierzig hat er einen Herzinfarkt, ab seinem fünfzigsten Lebensjahr wird er immer wieder im Delirium ins Krankenhaus eingeliefert – viermal mit 4,7 Promille Alkohol im Blut. Heute weiß er: »Drogen und Saufen bringen nichts.« 76-jährig betrinke er sich nicht mehr – ein bisschen Eierlikör, das müsse reichen. Der härteste Entzug sei für ihn – wegen Corona – die Bühnenabstinenz.
MÜDE, LEER UND VERLETZT WIE EIN TIER IM WALD
Die Lyrikerin Ingeborg Bachmann: Im Alter von nur 47 Jahren ist ihr Leben als Folge ihrer Entzugserscheinungen zu Ende. Sie bekennt resigniert: »Meine Trunkenheit kann ich nicht abschütteln.«
Die spät gefeierte Literatin ist eine rätselhafte Intellektuelle, eine zerrissene Frau auf ständiger Suche nach Liebe. Mit dem Komponisten Hans Werner Henze durchlebt sie eine exzentrische Künstlerfreundschaft und flüchtet nach einem halben Jahr Zusammenlebens überstürzt – »müde, leer und verletzt wie ein Tier im Wald«.
Der Versuch eines gemeinsamen Lebens in Paris mit Paul Celan, dem Autor der Todesfuge, der sich später in der Seine ertränken wird, wird »strindbergisch« und auch nach wenigen Monaten abgebrochen. Man habe sich »gegenseitig die Luft genommen«, berichtet die sprachgewaltige Poetin ihrem früheren Geliebten Hans Weigel nach Wien.
Das Gefühl der Enge empfindet sie auch später in ihrer Beziehung mit Max Frisch, der wohl größten Liebe ihres Lebens. In ihrem postum – mehr als ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod 1973 – veröffentlichten Gedicht Alkohol heißt es: »ich trinke hinein soviel Schilling / ich trinke meine Arbeit in mich hinein trinke … ich sags nicht weil keiner es sagt / warum es trinkt, sich zu Tod säuft.« Im Vorwort liest man »Die schönen Worte haben dem Entsetzen Platz gemacht«, die Texte beschreiben das »Leiden der Kreatur«.
Entmutigt flieht sie tranceartig in Alkohol und Tablettensucht: »Der Mülleimer ging über von leeren Schachteln. Sie war am ganzen Körper voller Flecken … Als ich sah, wie ihr die Gauloise aus der Hand auf den Arm glitt, wusste ich, es waren Brandwunden von herabfallenden Zigaretten, die vielen Tabletten hatten ihren Körper schmerzunempfindlich gemacht«, zeigt sich Alfred Grisel, ein Freund der letzten Jahre, fassungslos.
BONJOUR TRISTESSE
Eine andere zutiefst unglückliche Schriftstellerin lebt in Paris, Françoise Sagan. Im Alter von achzehn Jahren veröffentlicht sie einen in nur wenigen Wochen geschriebenen autobiografischen Skandalroman, der sofort weltweit zum Bestseller wird. Innerhalb weniger Jahre werden mehr als vier Millionen Exemplare, in 22 Sprachen übersetzt, verkauft. Eine Art Feuchtgebiete des Jahres 1954 macht die junge Autorin sagenhaft reich: Bonjour tristesse. Dennoch bleibt der Buchtitel das Motto ihres Lebens.
Der Spielsucht, ihren Alkohol- und Drogenexzessen versucht sie in rasenden Fahrten mit ihren exklusiven Autos zu entkommen. Mit einem Jaguar XK 140, den sie von ihrem ersten Honorar dem Rennfahrer Roger Loyer abkauft, oder mit einem Aston Martin DB 2/4 Mark 2 – bekannt aus dem Hitchcock-Filmklassiker Die Vögel. Öffentlich bekennt Sagan, Kokain zu konsumieren, wegen Drogenbesitzes und »Überlassung von Kokain an andere Personen« wird sie zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt.
Françoise Sagan sucht das freie Leben, lebt es den Französinnen lange vor dem Feminismus vor, doch sie verliert unter Alkohol- und Drogeneinfluss immer mehr den Boden unter den Füßen. Sie jagt erfolglos der Liebe nach, verspielt ihr Vermögen, überschlägt sich in ihrem stahlblauen Aston Martin Cabrio an einem Apriltag des Jahres 1957 bei einer Geschwindigkeit von knapp 200 Stundenkilometern.
Während eines dreimonatigen Spitalsaufenthalts wird die lebensgefährlich Verletzte morphiumsüchtig: Das neu zugelassene Palfium 875 ist dreimal so stark wie Morphium und macht extrem schnell süchtig. Im Roman Toxique – das Buch erscheint auf Deutsch unter dem Titel Gift – schildert sie die Qualen, die sie während einer Entziehungskur mit dem Morphium ähnlichen Suchtmittel durchlebt: »Ich hatte schon lange nicht mehr mit mir selbst gelebt. Das wirkt sich seltsam aus.«
Sagan gibt sich als Rebellin, doch sie liebt die mondäne Welt, ist auf Yachten und Cocktails der Pariser Hautevolee gern gesehener Gast, bei Pferderennen verliert sie Unmengen von Geld und erfindet St. Tropez als Jetset-Treffpunkt der 1960er-Jahre. Ein Leben lang kann die unglückliche Erfolgsautorin ihre Herkunft aus einer reichen Industriellenfamilie nicht abschütteln.
SORGEN SIND GUTE SCHWIMMER
Thomas Bernhard, der zynische, geliebte Nestbeschmutzer Österreichs, schildert in seinem Debütroman Frost 1963 schaurig-böse die Menschen im Salzburger Pongau: »Man steckt den Säuglingen Schnapsfetzen in den Mund, damit sie nicht schreien … Der Alkohol hat die Milch verdrängt. Alle haben sie hohe heisere Stimmen. Den meisten ist eine Verkrüppelung angeboren. Alle im Rausch gezeugt. Größtenteils kriminelle Naturen.«
»Machen sie sich frei, sagt das Leben. Ganz, fragt der Mensch? Ganz, sagt das Leben«. Als das Leben des Bühnen-Berserkers Werner Schwab im Alter von 35 Jahren endet, ist er der meistgespielte zeitgenössische, deutschsprachige Autor. Der provokante Popstar des Theaters mit fantasievollen Stücktiteln wie Mesalliance. Aber wir ficken uns prächtig und Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos säuft sich zu Tode.
Am Ende seines kurzen Lebens werden die depressiven Schübe immer häufiger. Nach einer exzessiven Silvesternacht, in der er ziellos durch Graz irrt, wacht Werner Schwab am Neujahrsmorgen des Jahres 1994 nicht mehr auf. Er hat 4,1 Promille Alkohol im Blut.
Fast hundert Jahre zuvor meint Robert Musil, ein Dichter, dessen monumentaler Roman Der Mann ohne Eigenschaften mit Werken von James Joyce und Marcel Proust verglichen wird: »Es hat keinen Sinn, Sorgen in Alkohol ertränken zu wollen, denn Sorgen sind gute Schwimmer.«
Musil leidet auch unter seinem unmäßigen Nikotin-Konsum. Um sein Rauchverhalten zu disziplinieren, notiert er während seiner letzten beiden Lebensjahre gewissenhaft die Uhrzeit jeder einzelnen gerauchten Zigarette. Es entstehen lange Listen, die die vergeblichen Versuche der Selbstkontrolle dokumentieren.
In einem parallel zum Zigarettenheftchen geführten Tagebuchheft stellt der Nikotin-Süchtige einen Zusammenhang zwischen Schreiben und Rauchen her: »Man kann sich aus der Langeweile, ebenso aus nervöser Überausgeruhtheit in die Arbeit stürzen, und zwar mit ganz unbelasteten Nerven. Die Ersatzhandlung ist das Rauchen. […] Vorschlag zur Güte: Meide das Rauchen als eine alberne Form des Müßiggangs!«
KOKAIN – DAS ELIXIER DER AVANTGARDE UND BOHÈME
Das sündige Berlin während der 1920er- und am Beginn der 1930er-Jahre: Leichtsinn und Lebensgier. Exzess und Extravaganz. Stil und Schamlosigkeit. Mit dem Treibstoff Kokain, dem Elixier der Avantgarde und Bohème. Das Leben ist unberechenbar in jener Stadt, die jeden Moment über ihre zu hohen Stöckelschuhe stolpern könnte. Das sündige Leben soll Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Konflikte überschatten.
Emanzipation greift um sich. Die neue Frau erregt Aufsehen. Weil sie freche, kurze Haare hat, Auto fährt und in der Öffentlichkeit raucht. Weil sie gleichberechtigt sein will, auch in der Liebe und der Sexualität. In Tanzpalästen wird Frivolität zelebriert. Die Ausdruckstänzerin Anita Berber – sie ist Morphium- und Kokain-süchtig, trinkt pro Tag eine Flasche Cognac – will »das wilde Flackern und Brennen ihrer Generation« verkörpern. In ihrem blutroten Kleid ist sie die Königin des ekstatischen Berliner Nachtlebens.
Mittendrin im Berlin vor hundert Jahren, einem modernen Sodom und Gomorrha, der nervösen Metropole zwischen Glanz und Elend, Dr. med. Gottfried Benn: »Den Ich-Zerfall, den süßen, tiefersehnten, den gibst Du mir«, schreibt er über Kokain. Ein Arzt mit geistiger Nähe zum Nationalsozialismus. Untertags behandelt er Haut- und Geschlechtskrankheiten, nachts trinkt er Unmengen von Kaffee, schläft zwei, drei Tage nicht, fühlt sich »ausgeschöpft«, »leer« und wird immer mehr vom Kokain abhängig.
Der süchtige Dichter im Arztkittel ist ein Freund der Frauen: In einem Brief an eine Angebetete winselt er: »Ich lege mich Ihnen zu Füßen als Ihr treuer Bernhardiner G. B.« Fast zehn Jahre lang bittet er seine ewige Geliebte Elinor Bühler, »Kindchen, lass uns nicht heiraten«, denn die Ehe sei doch nur »eine Institution zur Lähmung des Geschlechtstriebs«.
RÄTSEL DES RAUSCHGLÜCKS
Walter Benjamin, der Bert-Brecht-Freund, Philosoph der Frankfurter Schule und Übersetzer der Werke von Balzac, Baudelaire und Proust, ist überzeugt: »Im Haschisch sind wir genießende Prosawesen höchster Potenz.« Und er versucht den »Rätseln des Rauschglücks« näherzukommen. In seiner Berliner Wohnung in der Kurfürstenstraße: Seine Haschischexperimente, die er von 1927 bis 1934 gemeinsam mit Freunden, darunter der Philosoph Ernst Bloch, nach strengen Ritualen und meistens unter ärztlicher Aufsicht veranstaltet, beschreibt er in seinem Buch Über Haschisch. Benjamin berichtet einseitig fast ausschließlich von der angenehmen Seite des Kiffens, vom Lachen und der Gemütlichkeit.
»Damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt«, schreibt Friedrich Nietzsche Jahrzehnte zuvor, »dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich: der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben, eher kommt es zu keiner Kunst.« Doch es bedarf, so Nietzsche weiter, einer »strengen apollinischen Disziplin, um den dionysischen Taumel individuell zu formen«.
Winselnd vor süchtigem Verlangen stirbt 1939 im Pariser Armenspital ein Greis von 44 Jahren, Joseph Roth. Ein ewig Gehetzter, ein Dichter, der immer am Abgrund balanciert, ein Alkoholiker, zu jenem »langsamen Untergang entschlossen, zu dem Trinker immer bereit sind. Nüchterne werden das nie erfahren … man ist durch ein Feuer gegangen und bleibt gezeichnet für den Rest des Lebens.« Roth ist einsam und schutzbedürftig wie seine Romanfiguren. Sein letztes Prosastück beschreibt sein eigenes Ende: Die Legende vom heiligen Trinker.
Manischer Arbeitseifer und permanente Sexabenteuer können den König der Kolportage, einen Wiener Bestsellerautor, der mehr als 73 Millionen Bücher verkauft hat, lange nicht von seiner Alkoholsucht heilen: Johannes Mario Simmel. Erst nach einer ausgedehnten Schlafkur und intensiver Psychotherapie kommt er vom Alkohol los.
Zuvor versucht der Schundlieferant, der erst spät von der Kritik gefeiert wird, immer wieder, sich das Leben zu nehmen. Ohne Erfolg. Seine Schilderung könnte aus einem seiner Bücher stammen: »Einmal bin ich nachts zu Fuß auf der Autobahn München – Salzburg im Nebel gegangen, um mich totfahren zu lassen. Aber es kam kein Auto.«
Schon immer ist Alkohol im Spiel: Heinrich Heines Champagner-Konsum ist gewaltig, von Friedrich Schiller ist bekannt, dass sein Weinkeller in seiner Todesstunde gut gefüllt ist: 22 Flaschen Champagner, 35 Flaschen Burgunder, 61 Flaschen Malagawein und reichlich schwerer Rotwein. Johann Wolfgang von Goethe soll täglich mindestens drei Flaschen fränkischen Wein getrunken haben, er sagt seinem Vertrauten Eckermann: »Es liegen im Wein produktivmachende Kräfte.«
Wenn man Horaz glaubt, sind Wassertrinker schlechte Dichter. Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway ist ein guter. Er trinkt so viel, dass er massive Leberschäden hat und in schwere Depressionen schlittert. 1961 stellt er den Kolben seiner glatten, braunen Geliebten – eines Jagdgewehrs – auf den Boden und presst seine Stirn auf den Doppellauf. Sein Kopf wird zerschmettert.