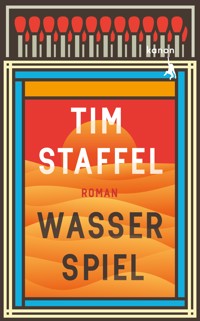Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023Breaking Bad in Berlin: Vanessa liefert Glücksmittel, Deniz fährt Streife. Ihre Begegnung öffnet den Himmel über einer pulsierenden Stadt. Vanessa ist Pharmakologin. Sie liefert Substanzen, die für Erfolg und Glück sorgen. Ihre Kunden sind Sportler, Krankenpflegerinnen und Politiker. Deniz ist Streifenpolizist. Er fährt Doppelschicht und pflegt seinen parkinsonkranken Vater. Jeden Tag suchen Vanessa und Deniz verlorene Menschen auf, doch dann treffen sie sich. Ein zarter, starker Großstadtroman, der danach fragt: Wie halten wir dem Druck stand? Wie wollen wir leben, und wie können wir lieben? »Sein rasendes Gespür für Rhythmus macht süchtig. Auf unsere Stadt, auf die Romantik!« Julia Franck»Tim Staffel hat einen absolut zeitgemäßen halluzinogenen Großstadtroman geschrieben.« Jan Brandt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vielen Dank an:
Lucas Vogelsang, Fabi, Frieda, Karin Graf, Oliver Vogel, Özkan Gümüş
ISBN 978-3-98568-094-8
eISBN 978-3-98568-095-5
1. Auflage 2023
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2023
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Marco Stölk
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Tim Staffel
Südstern
Inhalt
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Teil IV
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Teil V
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
I.
1
Ich heiße Vanessa und bin ein Engel. Alle aus meiner Gemeinde warten darauf, dass noch etwas passiert. Ich dimme das Licht. Ein Paar sitzt am runden Tisch neben dem Durchgang zum Raucherzimmer. Noch sind sie kein Paar, erst morgen werden sie eins sein. Sie trinkt ihren Wodka-Lemon mit dem Strohhalm; er wirft den Strohhalm weg. Sie will Kinder; er denkt nicht mal darüber nach. Fünf sitzen am Ecktisch beim großen Fenster, mit Blick auf die Bierbänke draußen, die habe ich schon um elf angekettet. Nach elf schenken wir draußen nicht mehr aus, weil sonst die ausgesperrten Hunde auf den Balkonen zu heulen beginnen und nicht mehr damit aufhören. Die Fünf sind ein Stammtisch, der steht jedes Mal woanders. Keiner ist von hier, vor zehn Jahren sind sie unabhängig voneinander in die Stadt gekommen, haben sich kennengelernt, sind zusammengezogen. Einmal im Monat feiern sie gemeinsam, dass sie sich noch immer kennen, nur leben sie verschiedene Leben. Sie haben sich viel weiter voneinander entfernt, als sie sich eingestehen möchten, deshalb trinken sie schnell und viel, damit sich Nähe einstellt. Ich fülle den Kühlschrank mit Flaschen auf, er ist größer als ich. Ich zerteile Zitronen und schaufele Crushed Eis in Gläser. Der Junge, der vor mir sitzt, liest Gedichte, am liebsten die von Rimbaud. Er würde gerne nach Hause gehen, noch ein, zwei Folgen The Big Bang Theory gucken und dann einschlafen. Sein Freund ist auf der Toilette, ihm kann er das nicht sagen. Sein Freund möchte feiern, er weiß nicht, wer Rimbaud ist. Sie studieren beide, nur nicht dasselbe. Ich gehe ins Raucherzimmer, leere die Aschenbecher, nur eine Frau sitzt noch da, mit ihrem Freund, seinen Heiratsantrag hat sie abgelehnt, das ist schon ein paar Wochen her. Sie raucht und denkt darüber nach, warum sie nicht mehr singt. Ihr Freund ist Steinmetz, er trägt ein dunkelblaues Seidenhemd, das zieht er nur an, wenn sie mit ihm zusammen ist. Sie möchte Swing tanzen, er hat zwei linke Füße, an ihrem Zigarettenfilter bleibt auberginefarbener Lippenstift haften. Er hört schlecht, sie spricht trotzdem leise. Sie möchte sich verändern, nicht mehr nur vom Geld des Vaters leben, der nicht aufhören kann, sich um sie zu sorgen. Er hat nichts dagegen. Sie möchte helfen, er weiß nicht wie. Er möchte Zigaretten, die Schachtel in ihrer Handtasche ist leer, ich bringe ihm welche, woher weißt du, fragt er. Der Freund von Rimbaud sitzt wieder neben seinem Freund. Wo gehen wir hin, wird er gleich fragen. Die Textiltapete an den Wänden klebt dort schon seit Ewigkeiten. Früher blühten Rosen darauf, jetzt sind sie verblasst, lassen die Köpfe hängen. Ich bin bereit für die letzte Runde, aber noch ist es zu früh. Draußen flackert Blaulicht die Wrangel hinauf und herunter. Die Kerzen im Kronleuchter flackern auch, es sind Attrappen, sie verbrauchen Strom, nur die Kristalle sind echt, sie glitzern und funkeln. Der Kronleuchter ist riesig, unser ganzer Stolz. Die Decke hält ihn, trotz seines Gewichts, nur olivegrüne Farbe blättert von ihr herab, hinterlässt ein zufälliges Muster, die Kartierung einer fremden Welt. In der Nische am Eingang hockt einer und schreibt in sein Notizbuch. Zu Hause wird er versuchen, das Geschriebene zu entziffern. Oft sind es Träume, aus denen formt er dann Geschichten, die zum Tagtraum werden. Abend für Abend trinkt er ein Bier nach dem anderen und schreibt in kleine Hefte mit linierten Seiten. Er hat noch keinem davon erzählt, er stapelt sie zu Hause an einem Ort, an dem niemand diese Stapel je zu sehen bekommt. Die Tür geht auf, einer schlendert herein, möchte Geld wechseln. Er ist nur auf der Durchreise, er kommt aus Polen und weiß nicht, wohin die Reise geht. Draußen wartet seine Freundin, die hat er gerade erst kennengelernt, sie möchte nicht weg. Letzte Runde, sage ich und spiele die Erkennungsmelodie. Die Flaschen in meinem Rücken reihen sich vor einem Spiegel in Regalen aneinander, sie leuchten bunt, reflektieren die Lichter der Lampen, die sich unter einer Leiste über dem Tresen verbergen. Bier schäumt aus den Hähnen, ich schöpfe den Schaum ab. Fritz sieht mir zu, er wackelt mit dem Kopf. Es ist auf jeden Fall ein Fritz. Er sitzt an der Bar auf seinem Hocker, zwischen ihm und Rimbaud bleiben zwei Plätze frei. Fritz taxiert die beiden Jungs, gleich wird er sie ansprechen. Der Stammtisch löst sich auf, eine der Frauen träumt von Indien, doch sie hat Flugangst, eine andere hat ihren Job gekündigt, sie weiß nicht, was nun aus ihr werden soll. Sie zahlt für alle, in zwei Wochen wird sie ein Vorstellungsgespräch bei Amazon haben, das weiß sie nur noch nicht. Die wollen sie unbedingt, werden ihr aber nicht das Gehalt bieten, das sie erwartet. Die beiden Männer der Runde werden sagen, viel mehr bekommt sie woanders auch nicht, trotzdem wird sie ablehnen und ihre Entscheidung schon kurz darauf bereuen. Heute Abend beläuft sich ihre Rechnung auf 150 Euro, sie rechnet, 155 wird sie gleich sagen, ich zähle die Sekunden, 155, sagt sie, ich lächele, bedanke mich, das habe ich geübt. Fritz wackelt weiter mit dem Kopf, folgt den dahinrasenden Zeilen auf einem unsichtbaren Bildschirm. Ich spreche ihn an, Hallo Fritz. Ich kann es nicht lassen, rate ihm, seine Bildschirme ab und zu mal auszuschalten. Sofort hält er still, begreift nicht, woher ich seinen Namen kenne. Erst denke ich, er hat eine Frau und Kinder, ich denke, ja, aber sie leben woanders, doch dann wird mir klar, Fritz lebt nur mit sich selbst, seit neunundvierzig Jahren. Rimbaud und sein Freund kommen nicht weiter, Rimbaud bestellt einen letzten Gin Tonic, sein Freund möchte noch ein Hefeweizen. Ich rolle die Flasche hin und her. Gleich wird Fritz nicht mehr an sich halten können, wird die beiden fragen, ob sie etwas zu rauchen haben. Der Freund von Rimbaud hat Gras dabei, aber das wird er für sich behalten. Fritz gehört zu IBM, er findet keinen Schlaf mehr. Sie aktivieren Kameras in seinem Rechner, die laufen wie eine Stechuhr, überwachen ihn und seine Arbeit, wollen sehen, ob er seine IBM-Gebete spricht. Den ganzen Tag löst Fritz Probleme am Rechner, er kann nicht abschalten, das schafft er ohne Hilfe nicht, deswegen möchte er etwas zu rauchen, damit er runterkommen kann. Rimbaud leert sein Gin Tonic-Glas, Fritz soll es mit Trinken probieren. Rimbaud würde gern mit mir nach Hause, er traut sich nicht, sein Freund möchte wissen, wo es jetzt hingeht. Fritz möchte schlafen. Der in der Nische schreibt noch in sein Notizbuch. Er beobachtet Rimbaud, malt ihn zum Prinzen aus. Ich kann mich nicht entschließen, das Licht hochzudimmen, die Szene aufzulösen, sie hinauszuwerfen. Draußen erwartet sie nur Treibsand, hier drinnen können sie sich noch für einen Augenblick an etwas Unsichtbarem festhalten. Die aus dem Raucherzimmer haben sich auf keinen Tanz geeinigt, morgen wird es ihnen gelingen. Die Musik verstummt, ich stelle den Verstärker aus, bei Fritz geht es nicht so einfach. Rimbaud und sein Freund lassen ihn sitzen. Rimbaud wird seinem Freund folgen, sie werden weiter trinken, Eintritt zahlen. Der Freund wird mit anderen lachen, die er noch nie zuvor gesehen hat, Rimbaud wird schweigen, lächeln, träumen. Ich spüle Gläser, lösche Lichter. Fritz ahnt noch nichts von seinem Glück, warte, sage ich, bleib. Ich habe ein sanftes Indica für ihn, Fritz strahlt. Ich wünsche ihm eine gute Nacht, die wird er haben. Ich schließe die Tür zur Bar ab, ziehe die Vorhänge zu, gehe hinten raus, über den Hof. Am Schlesischen Tor ist es auffällig ruhig, niemand scheint es eilig zu haben, der Verkehr steht still, alle halten inne für eine Gedenkminute, jeder denkt an etwas anderes. Oben an den Gleisen leuchten Neonlichter die Gesichter aus, in allen steht Erschöpfung, niemand gibt es zu. In der Bahn steht mir eine gegenüber, ganz jung noch, ihr Blick streift erst den Boden, dann richtet sie ihn geradeaus, er geht durch alles, durch alle hindurch. Vor ihr verschwimmt die Welt auf einer Leinwand, sie weiß nicht, was sie tun soll. Ein Studium wäre gut, denkt sie, aber welches. Ihre Freunde studieren Musik, Film, Schauspiel, Kulturwissenschaft, das möchte sie auch, aber nur vielleicht, vielleicht auch lieber nicht. Sie erwägt, sich stattdessen für etwas Soziales einzuschreiben, im Bereich der Pflege möglicherweise. Sie könnte sich in einem Praktikum ausprobieren. Viel lieber möchte sie mit den anderen zusammen verreisen, nach Italien, aber sie wohnt noch zu Hause, kann nicht einfach verreisen, ohne zu wissen, was sie irgendwann einmal tun wird. Sie kann nicht ewig für ein Taschengeld zwei Tage die Woche an der Garderobe der Deutschen Oper Mäntel und Taschen entgegennehmen, fürchtet sie, deshalb hat sie sich die Haare gefärbt heute Morgen, damit sich etwas tut, etwas verändert. Ihre Haare sind jetzt schwarz und weißblond, ihre helle Haut hat sie puderweiß überschminkt, der armygrüne Parka ist neu, den hat sie sich bestellt und behalten. Ihre Lippen hat sie in ein dunkles Rot getaucht, schwarz umrandet, aber hier steht sie alleine in der U-Bahn, so wie sie sich immer fühlt. Nur um diese Zeit, mitten in der Nacht, wird dieses Gefühl groß und größer, bis es größer ist als sie selbst. Alle fahren nach Hause, nur sie fährt allein zurück zu ihren Eltern, weiter, nach Charlottenburg. Alle denken, sie ist langweilig, weil sie ständig redet, ohne etwas zu sagen. Ich setze mich, sagt sie, wenn sie sich setzt. Ich glaube, ich esse jetzt mal einen Apfel, sagt sie, bevor sie einen Apfel isst. Sie sagt nur, was sie tut, und das ist nichts. Das, was sie fühlt, kann sie nicht benennen, deshalb ist sie traurig, auch weil heute Abend niemand gesagt hat, wie schön sie aussieht, wie gut ihr der neue Look steht. Ich steige Möckernbrücke aus, im Übergang zur U7 hocken sie zu viert auf zwei Schlafsäcken, einer schält eine Orange, zwei wischen mit geröteten Augen über die Displays ihrer Handys, der Vierte spielt Geige, vor ihm steht ein leerer Pappbecher. Der Tower mit dem Posthorn ragt monolithisch in den Nachthimmel, ist komplett entkernt, die Wohnungen, die dort entstehen sollen, existieren nach wie vor nur auf Papier. Keine Vorstellung steht auf der Schrifttafel über dem Theater. Cüneyts Kiosk mit Spielzimmer im Souterrain bei uns gegenüber in der Großbeeren hat noch geöffnet. Cüneyt spielt mit seinen Freunden, sie müssen nicht dafür bezahlen. Cüneyt fehlt es an Kundschaft. Ich überlege kurz, ob ich mich dazu setzen, ein Bier trinken, auf dem gewölbten Bildschirm ihr Match verfolgen soll, aber ich bleibe, wo ich bin, auf unserer Seite der Straße. Vor der Haustür liegt ein gestrandeter Elektroroller, am Lenker blinkt ein rotes Licht, es ist ein Notruf, den niemand hört. Ich schließe auf, steige die Stufen hoch, das Holz knarrt unter meinen Füßen. In der dritten Etage steht neben einer der beiden Türen ein Schuhregal, nur linke Schuhe ohne Schnürsenkel stehen darauf. Auf dem Treppenpodest zwischen dritter und vierter Etage hat einer vor dem Buntglasfenster, das sich nicht öffnen lässt, geraucht. In der fünften wohnen wir unterm Himmel. Vielleicht schläft er schon, das würde mir gefallen. Ich drücke die Tür auf, die Wohnung liegt im Dunkel. Ich schleiche in mein Zimmer, öffne das Fenster, höre die U-Bahn über dem Kanal, gucke die Sterne, manchmal sieht man sie, wenigstens ein paar von ihnen. Vielleicht lacht Cüneyt unten mit den Jungs vor seinem Laden. Aber ich drehe den Schlüssel im Schloss, drücke die Tür auf und überall brennt Licht. Mein Freund hat auf mich gewartet. Er sperrt die Sterne aus, liegt mit seinem Rechner auf der Couch im Wohnzimmer, alles darin gehört ihm. Eigentlich mag ich es, wenn er auf mich wartet, egal, wie spät es wird. Er ist müde, ich wollte dich sehen, sagt er. Ich weiß. Etwas bedrückt ihn, er darf nicht darüber sprechen, nicht mit mir, ich unterliege keiner Schweigepflicht. Gleich wird er sich entschuldigen, weil er gestresst ist, den Stress verursacht er sich selbst, jedes Mal. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal mit einem Mann zusammenlebe. Ich sehe ihn mir jeden Tag aufs Neue an, überlege, ob er es ist, mit dem ich zusammen sein will. Bis jetzt erhalte ich jeden Tag dieselbe Antwort. Ich mag sein ehrliches Gesicht, die Augen und sein Lachen, obwohl es laut ist, dafür lacht er viel zu selten. Er hat schöne Arme und einen festen Bauch, er wartet auf mich, bis ich mitten in der Nacht nach Hause komme. Du riechst nach Kneipe, sagt er dann. Das liegt daran, dass ich in einer arbeite. Er versteht mich nicht, das wiederholt er gerne. Es ist mir egal, das weiß er nicht. Vielleicht würde ich als Ehefrau anders riechen, aber Olli glaubt nicht an das Ja, deshalb fragt er nicht. Ich frage auch nicht, lieber küsse ich ihn. Ob ich mich nicht doch noch zum Master anmelden will, möchte er wissen, weil er keine Ruhe geben kann. Für mich kam das nie in Frage. Hm, macht Olli. Hm macht mein Freund immer, wenn er unzufrieden ist und trotzdem nichts mehr sagen will. Lass uns vögeln, schlage ich vor. Er zögert kurz. Gehen wir zu dir oder zu mir, wird er gleich fragen, und dann gehen wir zu ihm. Am nächsten Morgen presst mein Freund im Unterhemd Orangen aus. Er leidet, weil er unzufrieden ist, in seinem Kopf dreht sich die gleiche Platte immer weiter. Ich vermisse Zeitungsrascheln. Alle suchen nur nach Anlässen, um anderen zu schaden, glaubt mein Freund, der Abgeordnete Oliver Lompe. Ich frage, ob er Toast möchte, obwohl ich die Antwort kenne. Die Karaffe, aus der er uns den Saft in Gläser eingießt, hat seine Mutter uns geschenkt, die Gläser gehören auch dazu. Die Saftpresse hat Olli sich selbst gekauft. Er mag es, neben mir aufzuwachen. Er findet, ein Schlafzimmer für uns beide ist genug. Er hat ein Zimmer, ich habe eins, wir teilen uns ein Wohnzimmer, eine Küche, in der wir zusammen frühstücken können. Sogar einen Balkon haben wir, der gehört zu Ollis Zimmer. Ich darf ihn auch benutzen, ich finde es gut so, wie es ist. Mein Freund geht sich die Zähne putzen, vier Minuten später küsst er mich zum Abschied. Mach’s gut, mein Engel, sagt er. Ja, du auch.
2
Am Kottbusser Tor wohnen sie unter der Hochbahn, heute haben sie Gäste, die hängen Transparente auf und halten Schilder hoch. Tauben flattern, sehen zu. Am Rand des Kreisels parken vergitterte Mannschaftswagen der Polizei, jeweils zu sechst stehen die Beamten in voller Montur davor, oder sie sitzen darin, gucken herum, durch alles hindurch. Sie lecken an Eiskugeln in Waffeln und warten auf das Ende ihrer Schicht. In der Reichenberger halten zwei Uniformierte in Schusswesten eine alte Dame fest, einer hält sie rechts, der andere links, die Dame zittert und mit ihr ihr Hund, ein Rehpinscher, der an einer Leine hängt. Vielleicht ist ihr nur schwindelig, vielleicht hatte sie eine Tasche dabei, die nun fehlt. Sie erinnert sich an keine Tasche, keinen Namen, sie weiß nicht, wer sie ist, erkennt nur ihren Hund, er ist ihr Alles. Die Polizisten rauchen, versuchen, ihr den Rauch nicht ins Gesicht zu pusten. Sie warten, wissen selbst nicht, worauf, halten sie nur fest, bis sie wieder von alleine stehen kann. Ecke Glogauer bestelle ich mir ein Stück vom New York Cheesecake und einen doppelten Espresso. Der Kuchen sieht heute anders aus als sonst, er schmeckt auch anders. Wir backen ihn nicht mehr selbst, sagt die Frau, die das Café betreibt, es lohnt nicht mehr, sie lassen sich den Kuchen jetzt lieber liefern. Sie hatte eine schwere Nacht, hat kaum geschlafen, ihr Kleiner zahnt, denke ich, jetzt zahnt er in der Krippe. Ich lasse den Cheesecake stehen, gebe ihr Trinkgeld, Bernstein um den Hals soll helfen, sage ich so beiläufig ich kann, sie sieht mich mit großen Augen an. Ich warte vor Andreas’ Haus, nebenan installieren sie gerade eine Überwachungskamera an der Außenwand. Sie filmt Andreas, als er herauskommt, er ist der Erste, den sie aufnimmt. Es ist nur ein Test, der Bär bemerkt sie nicht einmal. Er ist mein Freund und Beschützer, früher war er der Freund meines Vaters, den konnte er nicht beschützen, aufhalten konnte er ihn auch nicht. Mein Vater ist verschollen, ich habe ihn nie kennengelernt. Andreas ist geblieben, war da für mich, solange ich denken kann, ist es noch immer. Er sieht mich winken, strahlt, sein großer Kopf fängt an zu leuchten. Hallo, mein Engel. Hallo, dicker Mann. Was machst du hier, fragt er. Ich weiß es selbst nicht, behaupte ich. Das stimmt nicht ganz, ich taste mich nur langsam vor, habe drei Tage frei, einen Urlaub kann ich mir nicht leisten. Ich umarme ihn, du hast mir freigegeben, da dachte ich, ich bringe dich wenigstens zur Arbeit. Andreas lacht, die Erde bebt, sein Körper ist ein Bassverstärker, ein Leben voller Whiskyfässer steckt in seinem Bauch. Zwei Gorillas auf Elektrorädern steuern zwischen uns hindurch, einer kneift die Lippen zusammen, er hat Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht zu halten. Nebelkrähen beschweren sich lautstark, schwingen in die Luft, rufen nach Verstärkung. Andreas holt sein Rad aus dem Hof, schiebt es neben uns her, gleich fällt es auseinander. Wir wollen durch den Görlitzer Park, ich vermisse die Rufe der Ziegen und Schafe aus dem Streichelzoo. Alle Tiere sind verschwunden, suchen irgendwo Asyl. Im Park suchen Dealer nach Schatten, ihre bunten Hemden und T-Shirts leuchten wie Fahnen zwischen den Bäumen. Zwei streiten sich, es wirkt wie ein Tanz, die Körper schreien mit, ein dritter sitzt daneben, spielt auf einer Mundharmonika. Eine Kita-Gruppe wird zwischen ihnen hindurchgeschleust, die Kinder stecken in gelben Warnwesten, damit sie nicht verloren gehen, sie niemand überfährt. Die Sonne brennt jetzt schon, die Absätze von Andreas’ Cowboystiefeln klappern über den Asphalt, dann knirschen sie im Kies. Der Bär trägt eine braune Lederweste über einem gestreiften Baumwollhemd, es sind immer die gleichen Streifen, es ist immer dieselbe Weste, es sind dieselben Stiefel, egal zu welcher Jahreszeit. Ein Wolt mit himmelblauem Turban klingelt, wir weichen aus. Ein kleines Mädchen lässt vor Schreck die Schnur los, an der ihr mit Helium gefüllter Luftballon schwebt. Er steigt in den Himmel, das Mädchen weint, die Tränen kullern riesig aus erstaunten Augen. Ein Junge rollt auf einem Dreirad auf sie zu, seine Schwester schreit auf dem Arm der Mutter, der Vater rennt dem Dreirad hinterher. Als wäre Sonntag, der Vater verflucht seinen freien Tag. Im Krater bei den alten U-Bahn-Eingängen spielt einer mit roten Zöpfen Golf in einem Kilt, er schlägt die Bälle ziellos Richtung Köpfe, weil keine Löcher in der Nähe sind, nur Hunde, die zu niemandem gehören. Vielleicht trifft er mit einem Ball die Drohne, die über uns sirrt. Die Pilotin trägt eine grüne Latzhose, sie ist vom Naturschutz- und Grünflächenamt, sie spürt mit der Kamera des Quadrokopters Schädlinge an Pflanzen auf, die wird sie später dann besprühen. Andreas schnauft, weil wir bergauf müssen, aus der Kuhle wieder heraus. Was ist los, wird er gleich fragen, weil er nicht dumm ist, er mich länger kennt als ich mich selbst. Ich werde Gründerin, mir fehlt es nur an Kapital, aber das verrate ich noch nicht. Ich muss Andreas langsam darauf vorbereiten. Auf der Görlitzer rast ein Porsche Cayenne einem Audi Q7 hinterher, beide kommen frisch aus der Waschanlage, es ist eindeutig zu viel Testosteron auf den Straßen unterwegs. Auf dem Fahrradweg überholt ein Lieferando einen Uber Eats, ein Amazon-Prime-Transporter versperrt ihnen den Weg. Alle haben Ziele, die Zeit drückt, ich möchte bloß heil über diese Straße kommen, ein anderes Ziel habe ich gerade nicht. Eigentlich fürchte ich mich vor Zielen, das liegt an meinem Freund. Als Abgeordneter verfolgt er eigene, für die geht er ständig Kompromisse ein. Irgendwann wird er vergessen haben, was eigentlich sein Ziel war, er wird enttäuscht sein, weil er sich die ganze Zeit verkauft hat, nur um dorthin zu gelangen, wo er gar nicht mehr sein möchte. Das wird ihn deprimieren, davor fürchte ich mich, weil er den ganzen Rest an Möglichkeiten versäumt, das darf mir nie passieren. Über uns flattert ein Drachen im Wind, der Himmel ist blau, die Wolken sind gelb. Was ist los, Vanessa, fragt Andreas, es gibt jetzt kein Zurück für mich. Ich weiß, wie mein Beschützer zu seiner Bar gekommen ist, was er dafür getan hat, wie er an das Geld gekommen ist, um sich die Bar leisten zu können, für die er lebt und die er liebt. Ich weiß, was er dafür riskiert hat, ich bin bereit, das auch zu tun, so etwas Ähnliches auf jeden Fall, nur viel riskanter, weshalb Andreas garantiert versuchen wird, mich daran zu hindern. Aber ohne ihn wird es nicht gehen. Der Brummbär ist mein Vorbild, ein anderes habe ich nicht, weil ich kein anderes will. In einem Käfig spielen sie Fußball, in Unterhemden die einen, in Hoodies die anderen. Die Mädchen spielen mit, sie machen die Jungs nass, die Schulen haben heute offenbar geschlossen. Andreas schließt sein Rad an und die Tür zu seiner Bar auf. Der Getränkelieferant fährt vor, rollt neue Fässer rein und alte raus, das dauert. Ich schweige, Andreas schweigt auch. Ich habe Geduld, nur nicht so viel wie er. Der Bär hat mal ein ganzes Jahr kein Wort gesagt, hat alles einfach ausgesessen. Es gab keinen einzigen Beweis gegen ihn, keinen Beweis dafür, dass er Koks in Bananenkisten verschiffte. V-Leute vom BKA haben versucht, den Bär zu ködern, ohne Erfolg. Es gab keine Verabredungen, keine Geldübergaben, keine Ware. In der Justizvollzugsanstalt in Tegel haben die Ermittler ein Foto von Andreas herumgezeigt, keiner kannte ihn. Plötzlich war es die Schuld der Staatsanwältin. Alle hielten sie für unfähig, sie hielt den Kopf hin, wurde strafversetzt. Ein Jahr saß Andreas still und ruhig in Untersuchungshaft, dann mussten sie ihn gehen lassen, mit 600.000 Euro Haftentschädigung in seinen Taschen. Er war der Unsichtbare, der den Stoff nie angerührt, nichts gesehen, nichts gehört hat, aber alle haben auf ihn gehört. Damals war das einfacher, es waren Prepaid-Zeiten, es gab Wegwerfhandys, Erde-Mond-Erde-Verbindungen. Andreas wusste alles, das waren seine Pläne, aber er blieb immer unter dem Radar. Er hielt nicht einmal die Fäden in der Hand, hat sie nur gesponnen, für Libanesen, Albaner. Sind einfach seinen Ideen gefolgt, haben sie umgesetzt; Andreas war der Logistiker. Die haben renommierte Unternehmen genutzt, Aldi, Chiquita, Iglu, BoFrost. In einem Hafen wurden Bananenkisten verladen, QR-Codes wurden auf Paletten geklebt, die in einen Container kamen, in den passten vierzig Paletten hinein, vier waren mit ihrem QR-Code versehen, die liefen irgendwie durchs System, waren originalverpackt, wie die anderen sechsunddreißig. Sie kamen am Großmarkt Berlin an, die Zollpapiere waren korrekt, die Gabelstaplerfahrer waren gekauft. Die wussten, wie sie den QR-Code und die vier Paletten erkennen konnten, wo sie mit denen hin mussten. Und wenn am Ende bei Aldi im Logistik-Zentrum vier Paletten fehlten, musste eben auf der langen Reise etwas schiefgegangen sein, bei der Verladung, dachten die bei Aldi. Die sind nicht richtig verpackt, nicht zeitig aufgeladen worden, nicht mehr zu verfolgen, dachten sie, es war ihnen egal. Heute geht das nicht mehr so einfach. In den digitalisierten Häfen wissen sie jede Sekunde, wo sich ein Paket befindet. Und trotzdem rutschen noch Paletten durch, die von Iglu vielleicht, tiefgefrorene Ware, auf der steht nur am Ende wirklich Iglu drauf. Viele Unterfirmen bringen das Produkt zusammen, es ist eine lange Kette, da kann überall etwas passieren, etwas hineinrutschen. Zu Andreas’ Zeiten haben sie alles zum Transport genutzt, Feuerlöscher, Surfboards, das alles ist vorbei, es ist alles verbrannt. Andreas hat von der Ware nie etwas gesehen, der Bär hat nur das Streckennetz entworfen, die Wege abgesteckt. Die Fässer sind längst rausgerollt, die Luke zum Keller ist wieder dicht, es sind noch viele Stunden, bis der Bär seine Bar öffnet. Ich habe frei und bleibe trotzdem, stelle die Stühle von den Tischen. Wir schweigen immer noch. Ich halte es kaum länger aus. Andreas lacht, erklär’s mir, Engelchen. Endlich rücke ich mit meinem Plan heraus.
3
Ich heiße Deniz Aziz. Ich bin Polizist. Meine Kollegin Jovanna Coric und ich haben einen Einsatz in der Bürknerstraße. Ist unser Abschnitt. Abschnitt 52, Kreuzberg-Süd. Jovanna will, dass ich sie ans Steuer lasse. Kann sie vergessen. Ich bin der Streifenführer. Jovanna meint, wenn ich nicht will, muss ich nicht mehr mit ihr fahren. Gibt aber niemanden, der sonst mit ihr fährt. Ich kann mich zu einem anderen Abschnitt versetzen lassen, meint Frau Coric. Dann mach’s doch. So einfach geht das aber nicht, behauptet sie. Ja klar. Ich halte zweite Reihe. Wir klingeln bei Ömür. Müssen die Treppen hoch. Im zweiten Stockwerk fängt Jovanna an zu keuchen. Wir müssen hoch bis zum vierten. Ich komme eine Stunde vor ihr oben an. Keine Ahnung, wie Frau Coric die Eignungsprüfung bestehen konnte. Unsere Leute sind verzweifelt. Wir sind zu wenige. Sie nehmen jeden, der drei Liegestütze schafft. Jovanna klingelt. Ein Mann in Filzpantoffeln öffnet die Tür, nur einen Spalt breit. Seine Pantoffeln sind kariert. Der Mann ist Ende vierzig, vielleicht ein paar Jahre jünger. Er muss gerade beim Friseur gewesen sein, die Kanten seines gestutzten Vollbarts sind wie mit einem Lineal gezogen. Herr Ömür?, fragt Jovanna und stützt sich mit einer Hand an seinem Türrahmen ab. Verstehen Sie mich? Sie spricht viel zu laut. Ja, natürlich, sagt er und sieht mich Hilfe suchend an. Er weiß nicht, was er von der Frage halten soll. Ich kann ihm schlecht die Eigenarten meiner Kollegin erklären. Sie vergewissert sich, ob er es war, der wegen Ruhestörung angerufen hat. Dann erklärt sie ihm, dass wir in die Wohnung müssen, um die Quelle des Lärms lokalisieren zu können. Das versteht Herr Ömür nicht. Er zieht die Tür ein kleines Stück weiter auf, füllt mit seinem schmalen Körper den Spalt aus. Er ist kaum größer als Jovanna, trägt eine graue Strickjacke mit Zopfmuster. Ob wir den Lärm nicht hören. Doch. Klingt nach einer Kreissäge. Und Technomusik. Es ist erst kurz nach acht am Abend. Jovanna will in die Wohnung rein. Damit sie hören kann, woher der Lärm kommt, der ihn belästigt. Herr Ömür möchte wissen, ob das wirklich nötig ist. Ja, sagt Frau Coric, das ist Routine. Herr Ömür bittet sie, sich die Schuhe auszuziehen. Jovanna weigert sich, weil sie im Dienst ist. Herr Ömür wundert sich. Türkmüsun?, fragt er. Ich halte mich raus. Jovanna wird noch lauter, erklärt ihm, dass sie keine Türkin ist. Herr Ömür besteht trotzdem darauf, dass sie ihre Schuhe auszieht. Ist mir nicht möglich, sagt sie, wegen Eigensicherung. Sie betont jede Silbe einzeln, hält ihn für behindert. Eine Frau mit Tragetaschen kommt die Treppe hoch, nickt uns zu. Oder Herrn Ömür. Der ignoriert sie. Sie wohnt gegenüber, verkriecht sich schnell in ihrer Wohnung. Dreht den Schlüssel zweimal um, dann hören wir noch den Bügel eines Sicherheitsschlosses einrasten. Mit Schuhen können Sie nicht in meine Wohnung, sagt Herr Ömür. Dann können wir auch keine Maßnahme gegen die Ruhestörung einleiten. Jovanna. Es klingt wie eine Drohung. Herr Ömür sieht mich fragend an. Iyi akşamlar, Ömür Bey, nasilsiniz, sage ich und ziehe meine Schuhe aus. Jovanna flippt aus. Ich soll gefälligst meine Schuhe wieder anziehen. Herr Ömür gibt den Eingang frei, bittet mich herein, içeri buyrun. Teşekkür ederim, danke. Ich sage Jovanna, dass ich gleich zurück bin. Herr Ömür schließt hinter uns die Tür. Ich höre Jovanna Deniz!, brüllen. Ömür bey ist allein in der Wohnung, nur eine Katze streift um seine Beine. Die Bässe hämmern durch die Wände im Wohnzimmer. Die Säge kreischt erbärmlich. Muss aus dem angrenzenden Seitenflügel kommen. Herr Ömür nimmt die Katze auf den Arm. Ich werde sehen, was ich tun kann, sage ich. Dass ich nichts tun werde, sage ich nicht. Herr Ömür bedankt sich und begleitet mich zur Tür. Jovanna wartet unten und lutscht ein Bonbon. Ich steige in den Wagen. Jovanna schnallt sich an und behauptet, ich hätte mich gefährdet. Es wäre gegen die Vorschrift gewesen, da ohne Schuhe reinzugehen. Ich habe sie lächerlich gemacht, sagt sie. Ja genau. Sie hat kein Problem damit, dass ich Türke bin, behauptet sie. Da bin ich wirklich froh. Ihre Großeltern sind aus Kroatien, die wollten auch nie bleiben. Na dann. Ich bin mit einer Irren unterwegs, fahre mit ihr zusammen die Hobrecht runter. Frau Coric will mit mir nicht über Religion sprechen. Was für ein Glück. Sie toleriert meine Ansichten, aber sie will nicht darüber diskutieren müssen. Was sind denn meine Ansichten?, frage ich sie. Lass uns einfach nicht darüber reden, sagt sie und wickelt das nächste Schokobonbon aus. Stopft es sich in den Mund und lutscht es geräuschvoll. Wirft die Plastikhülle auf die Ablage und beschwert sich, weil alle sie für eine Muslima halten. Sie begreift das nicht. Es geht ihr auf die Nerven. Ich will wissen, ob sie auch mal ihre Klappe hält. Sie versteht nicht, was ich meine. Ich habe genug und rufe Baba an, will hören, wie es ihm geht. Alles ist in bester Ordnung, behauptet er. Seine Stimme klingt halbwegs normal, also glaube ich ihm. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Jovanna meint, private Anrufe sind im Dienst verboten. Ich zwinge mich, ruhig zu bleiben und behalte meine Meinung für mich. Es wird eine lange Schicht. Nachts um zwei müssen wir hoch zum Columbiadamm, die Kollegen bei einer Fahrzeugkontrolle ablösen. Ich melde der Zentrale, dass 2-0-5 jetzt übernimmt. Es nieselt. Jovanna zupft an ihrer Leuchtweste herum, wedelt mit der Kelle. Ist so ein Moment, wo ich mich frage, warum ich den Job noch mache. Weil es der Einzige ist, den ich habe. Weil Baba und ich ohne ihn nicht klarkämen. Weil ich ihn immer machen wollte. Jovanna winkt einen heraus, der verdächtig weit links fuhr. Vielleicht ist er auf Geisterfahrt. Ich lasse sie machen, sie möchte ihn testen. Er will aber nicht. Ist freiwillig, erklärt sie ihm. Er soll einwilligen, den Alkoholtest zu machen, einer Inaugenscheinnahme seiner Pupillen zustimmen, das war’s. Weiter kommt sie nicht. Er will nicht, dass sie ihm in die Augen guckt. Der Regen wird stärker. Jovanna sagt, es war ein gut gemeintes Angebot. Er behauptet, sie hat ihn angehalten, weil er Ausländer ist. Sie konnte nicht sehen, wer im Wagen sitzt. Interessiert ihn nicht. Du kannst mich zu gar nichts zwingen, meint er. Sie erklärt es ihm noch einmal. Ist alles freiwillig. Er soll den Test machen, sie seine Pupillen prüfen lassen, wenn er was genommen hat, wird er’s überleben. Ist eine Ordnungswidrigkeit, mehr nicht. Sie will nur ihren Job machen. Es regnet immer weiter. Wir wollen hier alle weg. Er sagt, er macht den Test. Aber er lässt sich nicht in die Augen gucken, nicht von ihr. Ich höre sie seufzen. Vielleicht sind Sie ja damit einverstanden, wenn mein Kollege in Ihre schönen Augen guckt, sagt sie. Dir ist langweilig, oder?, fragt er. Das war ein Fehler. Jovanna fordert ihn auf, den Kofferraum zu öffnen. Mir ist nicht langweilig, behauptet sie, jetzt nicht mehr. Ihr Ton hat sich verändert, er kapiert’s zu spät. Sie will sein Warndreieck sehen, den Ersatzreifen, einen Verbandskasten. Auf einmal ist er folgsam. Sie sieht in den Verbandskasten. Sind keine Handschuhe drin, stellt sie fest. Was für Handschuhe?, fragt er. Auf dem Mond kennen sie so was nicht. Endlich merkt er, dass hier was schiefläuft, wenn er sich nicht zusammenreißt. Frau Coric fordert ihn auf, sich in seinen Wagen zu setzen. Er soll blinken, erst rechts, dann links. Vom Schirm meiner Mütze tropft mir Wasser auf die Nase. Er will verhandeln, aber er muss blinken, rechts, links, aufblenden, abblenden, Warnblinklicht an, Warnblinklicht aus. Er soll wieder aussteigen. Widerwillig gehorcht er, sieht das Gerät in Jovannas Hand, will wissen, was das ist. Ist ein Apparat, mit dem sie die Profiltiefe seiner Reifen testen wird. Sein ganzer Körper spannt sich an, der Pulsschlag erhöht sich, Jovanna bemerkt es nicht. Es wird Zeit, mich einzumischen. Ich baue mich vor ihm auf und fordere ihn auf, mir in die Augen zu gucken. Keine Ahnung, was er sieht. Vielleicht ein Licht. Ist aber das der Taschenlampe. Kurz vor Schichtende fahren wir den Mehringdamm runter, wollen zu unserer Wache in der Friesenstraße. Der vor uns verhält sich auffällig, meint Jovanna. Ist ein blauer Clio. Die Verkehrskontrolle ist beendet, sage ich und will es gut sein lassen. Frau Coric besteht darauf, ihn anzuhalten. Vielleicht hat sie kein Zuhause. Oder keins, in das sie gern zurückkommt. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Wir sind im Dienst, sagt sie. Ja klar. Amına koyuyum. Sie sind zu dritt, riechen nach Sprit. Der Fahrer verweigert den Test. Wir haben keine Wahl, verfrachten ihn nach Tempelhof in die Gefangenensammelstelle. Ist aber kein Arzt in der GeSa, also warten wir. Dauert alles ewig. Als ich endlich nach Hause komme, ist es schon nach acht. Ich schließe die Tür auf, Baba müsste längst wach sein. Baba? Die Tür zu seinem Zimmer steht offen. Im Wohnzimmer, in dem ich schlafe und in dem sich auch die Küche befindet, ist Baba auch nicht. Baba? Bist du im Bad? Ich drücke gegen die Tür. Sie geht nicht auf. Baba! Er ist gestürzt, blockiert die Tür. Endlich bewegt er sich, zieht sich von der Tür weg. Ich schiebe. Er hat sich eingeschissen. Fängt an zu weinen. Tut mir leid, Baba. Ich erzähle ihm von der Trunkenheitsfahrt kurz vor Schichtende und hieve ihn in die Badewanne. Setze ihn auf den Hocker, dusche ihn. Ist eh große Wäsche heute, sagt er. Ja. Er will sich rasieren. Das kann Katrin nachher machen. So wie er heute zittert, schneidet er sich glatt den Hals durch. Kommt Katrin nicht?, fragt er. Doch, Baba. Ich trockne ihn ab, muss ihn zum Laufen bringen. Rechtes Bein hoch! Linkes Bein hoch! Wir schaffen es bis in sein Zimmer. Ich will ihm eine Windel anziehen. Er scheucht mich weg. Ich lasse ihn allein, mache ihm Frühstück, damit er seine Pillen nehmen kann. Sonst kommt der Motor nicht ins Rollen. Baba schlurft rein. Vorsicht Teppichkante! Rechtes Bein hoch! Linkes Bein hoch! Ich soll ihm das Hemd in die Hose stecken. Er hat die Windel vergessen. Was für eine Windel?, fragt er und setzt sich an den Esstisch. Ich stelle ihm seinen Tee hin. Er kann den Becher kaum halten. Nimm erst die Pillen, sage ich. Der Tee schwappt über den Rand, läuft sein Kinn hinunter. Es dauert, bis das Madopar wirkt. Ich schmiere ihm Butter und Honig auf einen Sesamring. Er will nicht, dass ich so viele Überstunden mache. Kann ich mir nicht aussuchen, Baba. Selda hätte das nicht gewollt, sagt er. Ich weiß, Baba. Aber Mama lebt nicht mehr. Er nickt. Als hätte er’s vergessen. Du musst schlafen, Junge. Er steht auf, nimmt seinen Teller, schafft es ohne Unfall in sein Zimmer. Ich schaff’s nicht mehr, das Sofa auszuklappen, falle drauf und bin schon weg, ehe ich gelandet bin.
Ich wache auf und höre das Klackern. Baba hockt wieder am Esstisch und würfelt Pillen ins 7-Tage-Kästchen. Ich habe keine zwei Stunden geschlafen. Baba zählt mit. Montag. Morgens. Einmal Requip. Einmal Motilium. Einmal Madopar. Einmal Blutdruck hoch. Oder einmal Blutdruck runter. Montag. Abend. Eine halbe Motilium. Einmal Madopar. Einmal Blutdruck runter. Montag Mittag und Montag Nachmittag hat er vergessen. Seine Hände zittern, aber nicht so doll wie vorhin. Trotzdem fallen Tabletten daneben. Dauert, bis er sie wieder eingesammelt hat. Ich frage, warum er das nicht Katrin überlässt, sie kommt eh gleich. Ich will keine Fremden im Haus, sagt er und wünscht mir einen guten Morgen. Er wollte mich nicht wecken. Du kennst Katrin, Baba. Sie kommt jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag. Einmal Motilium. Einmal Madopar. Einmal Blutdruck hoch. Die Tabletten klackern in das Döschen. Du brauchst ein eigenes Zimmer, Junge. Ja. Baba hat frischen Tee gemacht, vielleicht wird es ein guter Tag für ihn. Ich gehe mich duschen. Als es klingelt, komme ich gerade aus dem Bad. Baba geht ganz normal zur Tür, als wäre nichts. Na, Herr Stummer, uns geht’s ja prächtig heute. Katrin. Wir begrüßen uns, ich sage ihr, dass wir die große Wäsche schon hinter uns haben. Sie können ruhig Markus zu mir sagen. Baba. Katrin lacht. Er will raus vor die Tür. Na, erst mal wollen wir uns rasieren, meint Katrin und schiebt ihn ins Bad. Sind alle weggezogen hier, sagt er, Kaiser’s ist auch weg. Das heißt jetzt Rewe, meint Katrin. Ich suche in der Kammer meine Sachen zusammen. Die Selda ist hier geboren, kommt hinten vom Leuschnerdamm, ich komm vom Südstern, sagt Baba. Wir sind beide von zu Hause ausgebüchst, die Selda und ich. Weil wir’s mit den Eltern nicht mehr ausgehalten haben. Mit Ihnen ist auch schwer auszuhalten, sagt er. Katrin lacht, Baba dann auch. Ist schwer, nicht mitzulachen, wenn sie lacht. Die Medikamente wirken. Baba erzählt Geschichten, immer dieselben. Katrin schäumt ihm das Gesicht ein, rasiert ihn. Trockenrasur mag er nicht. Der Apparat ist eh kaputt. Meine Selda, die wollte Kinderärztin werden, sagt er, aber für Abitur haben ihre Noten nicht gereicht. Waren ihre Eltern dran schuld, die haben sie nicht in die Schule gelassen. Musste sich um alles andere kümmern, die Selda, nur nicht um die Schule. Da ist sie dann Erzieherin geworden. Katrin tut so, als höre sie das zum ersten Mal. Sie warnt ihn, weil sie ihm mit der Pinzette Nasenhaare ausziehen will. Das ziept gleich, sagt sie. Selda konnte immer gut mit Kindern. Ist dann später zur Abendschule, das Abitur nachmachen. Wollte sich was beweisen. Da haben wir den Deniz schon gehabt, sagt Baba. Da war sie ganz stolz, die Selda. Guck, Markus, ich hab’s geschafft, hat sie gesagt. Ist Deniz noch da? Ich bin hier, Baba! Das Verfallsdatum vom letzten Joghurt im Kühlschrank ist abgelaufen, was anderes ist nicht mehr da. Ich schneide mir einen Apfel rein. Wir sind ja beide von zu Hause weg, die Selda und ich, sonst wären wir uns nie begegnet. Vorsicht, Teppichkante, warnt Katrin. Beim betreuten Wohnen sind wir uns begegnet, draußen in Spandau, war eine Jugend-WG. In Spandau fehlt mir die Wärme, meinte Selda, die hatte Heimweh nach Kreuzberg. Baba landet wieder am Esstisch, hat vergessen, dass er schon gefrühstückt hat. Katrin guckt in den Kühlschrank, fragt, ob sie schnell für uns was einkaufen soll. Ich schüttele den Kopf, kann ich nicht annehmen. Als der Deniz in die Schule sollte, hat Selda gesagt, hier soll unser Junge nicht zur Schule. Hast ’nen schlechten Ruf, wenn du in Kreuzberg aufwächst. Deniz soll auf ’ne Schule mit weniger Ausländern, meinte Selda. Gab überall Ausländer hier, Polen, Russen, Türken, Libanesen, konnste dir aussuchen. Katrin will Babas Bett frisch beziehen. Du musst das nicht machen, sage ich. Lass mal, meint sie und kümmert sich. Baba redet trotzdem weiter. Hat sich Sorgen um den Deniz gemacht, meine Selda, und ich sag, Selda, guck mal, Selda, ich bin doch auch nur mit türkischen und arabischen Freunden aufgewachsen. Muss doch nicht heißen, wir gehen alle den Bach runter. Ich hab eine türkische Frau, Selda, du bist doch meine Frau, du hast doch trotzdem deinen Namen behalten, das war dir wichtig, dass der Deniz auch so heißt, das war mir doch egal. Du sagst doch immer, ist meine Heimat hier, sagst du immer. Aus uns ist doch auch was geworden. Katrin hat das Bett bezogen und kontrolliert, ob Baba seine Pillen richtig einsortiert hat. Ich packe meinen Rucksack. Ich dachte, du hattest Nachtschicht, sagt Katrin. Sie streicht mir über den Arm. Ihr braucht neue Medikamente, erinnert sie mich, ob ich das Rezept schon besorgen konnte. Ich kümmere mich, sage ich. Was flüstert ihr denn da, will Baba wissen. Wir flüstern doch nicht, Herr Stummer. Na sehen Sie, jetzt haben wir uns schon wieder verplaudert. Babas Zeit ist abgelaufen, Katrin muss los. Bis Freitag dann, Herr Stummer, tschüss, Deniz, sagt sie. Tür zu!, ruft Baba ihr hinterher. Er steht problemlos auf, will raus auf den Balkon. Ich zeige ihm sein Mittagessen. Bin nicht dazu gekommen, zu kochen. Hab’s aus dem Eis geholt. Ich sage ihm, er soll die Mikro benutzen, auf keinen Fall den Herd. Warum soll ich nicht den Herd benutzen?, fragt er. Ich schreibe Mikro auf einen Zettel und klebe ihn an den Teller. Damit er es nicht vergisst. Ich hab noch nie was vergessen, behauptet er. Ich muss los. Bist doch gerade erst gekommen. Hab trotzdem jetzt die nächste Schicht, Baba. Mach dir um mich mal keine Sorgen, Junge. Ja klar.
4
Ich habe einen großen Bruder, Felix, er ist zwei Jähre älter als ich, mit sechzehn fing er an, zu dienen, unser Land zu verteidigen, wie sie es nennen. Ich war da schon auf einem Gymnasium, hatte Biologie als Leistungskurs. Was mich wirklich interessierte, war Ökotrophologie, da kommen Elemente der Botanik, der Physiologie, der Biochemie vor, das sprach mich an. Ich bin diesem Pfad gefolgt, habe mich fortgebildet und studiert. Jetzt bin ich Pharmakologin, es bedeutet mir nichts. Ich interessiere mich für die Wechselwirkung zwischen Stoffen und Menschen, mehr ist da nicht. Heute bin ich zum ersten Mal wieder an der Freien Universität, aber nur als Besucherin. Ich sehe die Studierenden und vermisse nichts. Ich sehe sie mit ihren Taschen und Rucksäcken durch die Ein-und Ausgänge fluten, hoffnungs- und erwartungsvoll, blass, müde, gelangweilt, überdreht, ehrgeizig, selbstverloren, zufrieden, ängstlich, überfordert. All das war ich nie. Vor dem Chemie-Institut wartet Connor auf mich, Hallo Vanessa!, ruft er und winkt. Ich habe ihn in meinen Plan eingeweiht, er ist ein Teil davon, jetzt setzen wir ihn um. Connor kann es kaum erwarten, er war mein Tutor, hat sich damals gleich in mich verliebt. Ich umarme ihn, er riecht gut, hat Sommersprossen, sein Lächeln verrät mir, er hat noch immer keine feste Freundin, selbst etwas Loses läuft bei ihm nicht. Connor möchte mit mir zusammen sein, er möchte Kinder mit mir haben, mit mir seine Apotheken führen, er würde es nie zugeben. Noch gehören die Apotheken seinem Vater, aber Connor ist geduldig. Sein Vater mochte mich, ich durfte ein Praktikum bei ihm absolvieren, er vertraute mir sogar die Schlüssel zu den Mülltonnen an, das bedeutete eine große Verantwortung. Es gibt Abhängige, die darauf warten, dass man vergisst, die Tonnen abzuschließen. Sie durchsuchen sie dann nach Schmerzpflastern, die sind getränkt mit Fentanyl, einem synthetischen Opioid, das fünfzig Mal stärker wirkt als Heroin. Sie saugen die Pflaster aus, kochen sie auf, setzen sich Spritzen, aber wer einmal falsch dosiert, dosiert nie wieder. Connor grinst und strahlt, er macht sich immer noch Hoffnungen. Obwohl er weiß, es ist umsonst. Ob ich mir wirklich sicher bin, fragt er besorgt. Ja, sonst wären wir nicht hier. Wir wollen zu Bruno, ein Studienfreund von Connor, jetzt ist er Angestellter der FU. Bruno forscht auch in seiner freien Zeit, erfindet Nebentätigkeiten, weil er sich in Laboren wohler als in Kneipen oder Kinosälen fühlt. Connor schleust uns durch die Flure. Die Cafeteria wurde schon vor Wochen geschlossen, unter Neonröhren bilden sich vor den Kaffee- und Sandwichautomaten lange Schlangen. Wir erreichen den Labortrakt, Connor klingelt an einer der Türen, über ihr hängt eine Überwachungskamera, das hatte ich nicht bedacht. Connor beruhigt mich, die Bänder werden jeden Tag gelöscht, wir sind nur Freunde, Freunde gehen bei Bruno ständig ein und aus. Die Tür summt, Bruno hat uns schon erwartet. Er kommt mit einem Drehstuhl auf mich zugerollt, er sieht mich an, dann sieht er knapp an mir vorbei, und hofft, dass ich es nicht bemerke. Bruno hält meinem Blick nicht stand, das bin ich schon von anderen gewohnt. Er begrüßt Connor, ist herzlich, hat eine warme, weiche Stimme. Sein Atem geht schwer, Bruno bekommt zu wenig Luft. Ich bin sicher, er war schon bei einem Arzt, einer Ärztin vielleicht, ich sehe es ihm an, Bruno fürchtet immer gleich, es könnte etwas Schlimmes sein. Wahrscheinlich reist Bruno schon bald an die Nordsee, fünf Tage wird er es dort aushalten, sich in einem Strandkorb verstecken, die Hosen hochkrempeln, mit seinen bleichen Füßen im Sand wühlen. Bruno wischt sich seine Hände an der grünen Cordhose ab, holt mich zurück. Sein Händedruck ist kräftig, die Haut chronisch trocken, beinahe rissig, er benutzt regelmäßig eine Salbe, sie lindert die Beschwerden nur, er wird sie nicht mehr los. Schön, dich kennenzulernen, wird er gleich sagen. Wir sind uns nie begegnet. Connor stellt uns vor, klopft seinem Freund wieder und wieder auf die Schulter. Schön, dich kennenzulernen, sagt Bruno. Er zeigt mir glücklich seine kleine Speed-Fabrik, Connor kennt sie schon, er hat mir davon erzählt. Bruno lagert sein Produkt in einem der Kühlschränke, zu dem haben nur Bruno und der Reinigungsdienst Zugang, für die Reinigungskräfte sieht alles, was darin ist, gleich aus. Bruno verkauft Minimum fünfzig Gramm, sonst lohnt es nicht für ihn, erklärt er mir. Ich denke an Andreas, der Bär hat mich gewarnt, zu viele in diesem Geschäft leiden an psychischen Problemen, sie verschwinden irgendwann für immer. Andreas wollte mich abschrecken, es ist ihm nicht gelungen. Also hat er mir die goldenen Regeln aufgezählt: kein persönlicher Kontakt zu Kunden, nicht gierig werden, niemals selbst konsumieren, kein Kredit für niemanden. Er hat nicht aufgehört zu brummen, zwischen uns stand nur sein dicker Bauch, als wäre ihm etwas verloren gegangen, so hat er mich angesehen. Ich nehme alle in die Arme, so war es schon immer, niemand bemerkt etwas, ich falle niemals auf. Ich blättere Bruno meine Scheine hin, ich wünsche ihm schöne Tage an der Nordsee. Seine Augen reißen auf, woher weißt du? Er läuft rot an, ich wollte ihn nicht beschämen. Draußen sinkt die Sonne und entflammt den Grunewald. Felix, mein großer Bruder, hat mir eine Nachricht hinterlassen. Er hat wieder schlecht geschlafen, möchte meine Stimme hören, hofft mich bald zu sehen, er muss gleich los zu seinen Häftlingen nach Tegel. Mein großer Bruder arbeitet dort in der Strafanstalt, als Justizvollzugsobersekretär. Heute werden wir uns nicht mehr sehen können, sofort werde ich unruhig. Connor möchte mich mitnehmen, egal, wohin ich will. Ich begleite ihn nach Wedding, dort leitet Connor im Gesundbrunnen-Center eine der Apotheken seines Vaters. Connor erzählt mir von der Kundschaft, er mag sie nicht, viele kommen aus dem Fitnessstudio unter Kaufland, wollen nur Spritzen für ihr Testosteron oder verlangen nach Pseudoephedrin. Connor verkauft ihnen schachtelweise Grippemittel. Andere schieben ihm schwitzend selbstausgedruckte Rezepte hin, von Ärzten unterschrieben, die niemals existierten. Connor verliert sich, erzählt mir von früher, als er noch Handball spielte, schon in der B-Jugend haben sie hohe Dosen Ibuprofen und Paracetamol geschluckt, der Handballsport war hart, zu hart für Connor, das weiß ich, viel härter wäre die Strafe seines Vaters gewesen, wenn Connor es nicht ins Team geschafft hätte. Connor lacht es weg, ist noch immer dieser Junge, der sich vor seinem Vater fürchtet, obwohl er ihm längst überlegen ist. Ob ich für ihren Lieferservice fahren will, fragt er. Ein zweiter Job neben dem in der Bar wäre gut für mich, niemand würde fragen, warum ich plötzlich Geld habe. Auch unser persönlicher Warenaustausch wäre viel einfacher. Du brauchst nur einen Führerschein, sagt Connor. Den habe ich. Ja!, ruft er, ich wusste es. Er schlägt aufs Lenkrad, freut sich, weil wir uns nun öfter sehen werden. Wir hören Musik, um uns herum kommt der Verkehr zum Erliegen, nur wir fahren weiter. Connor möchte feiern, ich vertröste ihn, er bemüht sich, seine Enttäuschung zu verbergen. Er lässt mich Bad Ecke Behm raus, ich drücke ihm einen Kuss auf die Wange, sein Strahlen kehrt zurück. Ich sehe ihm hinterher, dann steige ich die endlose Treppe zur U8 hinunter. Die grünen Kacheln an den Wänden sind verblasst und rissig, ausgespucktes Kaugummi pflastert die Stufen, in den Ecken trocknen Urinlachen. Eine Spur von Abfällen führt zu Behältern, die niemand mehr leert. Am Bahnsteig pressen alle die Lippen aufeinander, ein Alter läuft barfuß auf und ab. Seine Füße sind schwarz, er droht, wir werden ihm alle in die Hölle folgen. Sein Gesicht ist braun gebrannt, ein grauer Bart klebt auf der nackten Brust, die Knöpfe von seinem Hemd hat er verloren. Niemand hilft ihm, sie zu suchen, alle versuchen nur, der Hölle auszuweichen, die er mit sich trägt. Sein kahler Schädel ist verschorft, wir haben Krieg!, brüllt er. Ich berühre ihn vorsichtig an der Schulter, er zuckt zurück, bleibt stehen und verstummt. Ein Waffenstillstand wurde ausgehandelt, er soll das nutzen, schlage ich behutsam vor, oben, über Tage geht die Sonne langsam unter, vielleicht möchte er den Abendhimmel sehen. Er blinzelt mich an, zweifelt. Am Flakturm im Humboldthain haben sie die Geschütze abmontiert, verspreche ich, er lächelt. Mal sehen, sagt er und beginnt den Aufstieg an die Oberfläche. Kottbusser Tor steige ich aus, im Neonlicht warten sie mit Hunden auf Lieferanten, hoffen, zwischen all den anderen Verzweifelten am Bahnsteig ihre eigene Verzweiflung zu vergessen. Ich rolle mit der Treppe zur U1 hoch, fahre bis Möckernbrücke, zwei Surfer springen vom Dach eines Waggons ins schwarze Wasser des Landwehrkanals. So wie mein Bruder früher, Felix. Ich muss dringend zu ihm, aber vor morgen macht es keinen Sinn. Wasserpolizisten fischen die Wagemutigen aus dem Kanal, hieven sie in ihre Patrouillenboote und halten sich die Nasen zu. Mein Freund ist nicht zu Hause, nicht um diese Zeit, trotzdem schließe ich meine Tür, bevor ich Brunos Päckchen in der Vitrine verstaue, die Mama mir vermacht hat, als sie auf ihre Insel ausgeflogen ist, um Heilerin zu werden. Plötzlich höre ich es rumoren, Olli ist im Homeoffice, ich habe ihn nicht bemerkt. Ich umarme meinen Freund, ich habe Lust auf ihn, er möchte lieber erst spazieren gehen, war noch nicht draußen heute, er sehnt sich nach frischer Luft. Wir spazieren im Gleisdreieck-Park, ich werde Kurierin, sage ich. Hm, macht Olli. Vor der Bude am Spielplatz stehen sie Schlange, Olli möchte sich einreihen und den Kindern zuschauen. Ich brauche keinen Karriereplaner, einen Familienplaner brauche ich auch nicht. Ich habe doch gar nichts gesagt, empört sich mein Freund, der Abgeordnete Lompe. Nein, aber ich weiß, was du gedacht hast, Olli. In der Nacht, als wir uns kennenlernten, strandeten wir im Adlon. Es war gerade da, wo wir waren, zumindest in der Nähe. Wir haben bis zum Morgengrauen gevögelt, ich habe nicht nachgedacht, war gleich verliebt, also haben wir unsere Nummern ausgetauscht. Ich bin ihm zuvorgekommen, habe ihn angerufen, er hat mir seine Wohnung gezeigt, ein Zimmer war frei. Ich weiß, gleich wird er sich bei mir entschuldigen. Zwei Mädchen rollen auf Skateboards an uns vorüber, sie haben bunte Helme auf den Köpfen, ein breites Grinsen im Gesicht, eine Graswolke zieht hinter ihnen her. Tut mir leid, sagt Olli, er legt einen Arm um mich. Zwei Jungs stehen auf einem Elektroroller, sie befinden sich auf Kollisionskurs mit den beiden Rollbrettmädchen. Der hinten hält sich an dem vorne fest, sie lachen beide, die Mädchen weichen aus und landen unverletzt auf einer Wiese. Ollis Telefon klingelt, vibriert, er ist im Homeoffice, muss das Gespräch annehmen. Die Jungs an den Tischtennisplatten ziehen ihre T-Shirts aus, sie trinken Bier, ich wünschte, wir hätten unsere Schläger mitgenommen. Ich texte meinem großen Bruder, gleich morgen früh komme ich dich besuchen, versprochen. Olli fragt, ob wir nach Hause wollen. Wir müssen noch einkaufen, wird er gleich feststellen, das ist seine Aufgabe, das haben wir verabredet. Ich kann mich im LPG in keine Schlange stellen, ich würde keine Luft bekommen und vermutlich um mich schlagen, niemand wäre sicher. Wir können etwas bestellen, schlägt mein Freund vor, weil er sich vor dem Einkauf drücken will.
5
Im U-Bahnhof Möckernbrücke campieren nach wie vor die vier mit den zwei Schlafsäcken beim Übergang zur U7, vielleicht ist es ihr neuer Wohnsitz. Der mit der Geige sitzt vor seinem leeren Pappbecher, er macht gerade eine Pause, isst einen Apfel zum Frühstück, den hat ihm jemand zugeworfen. Station Haselhorst in Spandau