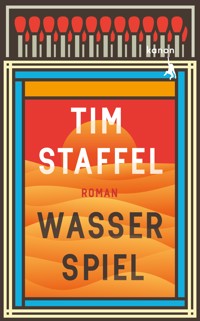
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Tim Staffels rasendes Gespür für Rhythmus macht süchtig.« Julia Franck Roberto Böger hat Angst vor Wasser. Dennoch ist es sein Element. Als rastloser Zeuge bereist er die Welt, um Wasserverbrechen zu dokumentieren. Dann wird ausgerechnet in seiner Heimatstadt Lüren das Wasser knapp. Roberto kehrt an den Urquell seiner Angst zurück. Er trifft auf Gleichgesinnte und sein jüngeres Ich. Kann er sich freischwimmen? Tim Staffel hat einen großen Roman über ein drängendes Thema unserer Zeit geschrieben. Ebenso visionär wie unterhaltsam erzählt er vom gewaltigen Kampf ums Wasser. In einer Sprache, die fließt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wer in aller Welt kann sich Wasser noch leisten? Roberto Böger bereist als Wasserexperte die Welt und dokumentiert Unrecht: Die Flutung jahrtausendealter Orte, dass in Athen einer jungen Familie das Wasser abgedreht wird, wie ein Armenviertel in Detroit ohne Kanalisation überlebt. Als ausgerechnet in seiner Heimatstadt Lüren die Wasserversorgung bedroht ist, muss Roberto zurück in eine schmerzliche Vergangenheit reisen. Dort trifft er sein jüngeres Ich, Humphrey. Können sie gemeinsam den Untergang Lürens verhindern?
»Der Gedanke an Wasser treibt mich an. Ich fürchte mich vor etwas, das existenziell ist, aus dem ich mehrheitlich bestehe, vor etwas, das allen selbstverständlich ist. Dabei ist Wasser genau das nicht: selbstverständlich.«
TIM STAFFEL hat vier Romane veröffentlicht. Sein Debüt »Terrordrom« wurde 1998 von Frank Castorf für die Volksbühne dramatisiert. Daneben schrieb Staffel zahlreiche Hörspiele. Er wurde u. a. mit dem Alfred-Döblin-Stipendium und mehrmals mit dem Literatur-Stipendium des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet. Sein Roman »Südstern« stand 2023 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. 2024 erhielt er das London-Stipendium des Deutschen Literaturfonds.
Die Arbeit des Autors am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert.
ISBN 978-3-98568-177-8 e-ISBN 978-3-98568-178-5
1. Auflage 2025
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2025
Belziger Straße 35, 10823 Berlin
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Cover: zero-media.net
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Ingo Neumann / boldfish
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Tim Staffel
Wasserspiel
Inhalt
PROLOG SEEPFERDCHEN
TEIL I DIE QUELLE
FRÜHLING
ATHEN
LIFE
LÜREN-INSIDE
SOMMER
GROSSE HEIDE
RÜCKKEHR
WATER-GAME
HOCHZEIT
HERBST
LAAR-WIESEN
POOL-PARTY
STURM
WINTER
DETROIT
TEIL II DER FLUSS
FRÜHLING
DEAD WATER
JO'BURG
SPIDER
DAKAR
WALLENSTEIN
SOMMER
COSTA DEL SOL
ERDFALL
TEIL III WOLKEN
HERBST
TAUFALLEN
BRACHE
REGENMACHEN
REGEN
FLUT
EPILOG DER AQUIFER
PROLOGSEEPFERDCHEN
ROBERTO
Wir waren uns so nahe, es hätten gerade einmal acht Gramm Papier zwischen uns gepasst. Jetzt sind es Länder, Kontinente, vielleicht ein Ozean. »Spring«, sagst du, aber ich kann nicht, nicht einmal für dich, das weiß ich nur noch nicht.
Ich habe einen ganzen Sommer lang geübt, bin zwei Jahre älter und etliche Zentimeter größer als alle anderen im Kurs. Im Wasser fällt es nicht auf, unter Wasser erst recht nicht. Unter Wasser mache ich die Augen zu und bemühe mich, nicht zu atmen. Unter Wasser ist Teil der Übungen. Am Boden des Beckens liegt ein roter Gummiring, den müssen wir bergen und an die Oberfläche bringen. Ich stehe im Wasser, mein Kopf ragt heraus, dann soll ich kopfüber untertauchen und den Ring herausholen, ohne dabei zu ertrinken. Meine Schwimmlehrerin behauptet gegenüber meiner Mutter, ich sei bereit. Sie hat recht. Ich bin bereit, es hinter mich zu bringen. Meine Mutter will mich zur Prüfung begleiten. Sie freut sich auf das Seepferd, auf einen Sohn, der schwimmen kann.
Am Morgen des großen Tages wache ich schweißgebadet auf. Mein Vater ist schon aus dem Haus, unterwegs zu Papier Böger, unserer Firma. In Lüren, in ganz Ostwestfalen schreiben sie in unsere Schulhefte; auf jedem Klassenarbeitsheft steht der Schriftzug Böger drauf. Jede schlechte Note wird mit meinem Namen in Verbindung gebracht. Meine Mutter lächelt und drückt mir am Frühstückstisch ein Päckchen in die Hand. Ich wickele gelb-rot gestreifte Badeshorts aus dem Geschenkpapier der Marke Böger. Mir ist es egal, in welchen Shorts ich baden gehe. Draußen ist es sommerwarm, obwohl es regnet. Die Regentropfen platschen auf die Wasseroberfläche des Pools und kräuseln sie. Ich sehe den Beckenboden nicht, weil da keiner mehr ist. Meine Mutter steht mit anderen Eltern zusammen unter einem großen Sonnenschirm und winkt mir zu. Ich stehe in gelb-rot gestreiften Badeshorts am Beckenrand. Ich bin der Zweite von links. Es regnet. Der Regen wühlt das Wasser auf. Da ist kein Grund mehr. Ich zittere. Meine Zähne klappern aufeinander. Mein Kopf tut höllisch weh. Wir stehen in einer Reihe neben und zwischen den Startblöcken. Ich bin der Einzige, der zittert. Wir sollen näher an den Beckenrand herantreten, so nah, dass unsere Zehen knapp über den Rand hinausragen. Das Trillern der Pfeife unserer Lehrerin schrillt aus weiter Ferne in meine Ohren, in meinen Kopf hinein. Sie steht beinahe neben mir, direkt neben dem Ersten von links, aber ich bin unendlich weit weg. Ich bleibe als Einziger stehen. Alle anderen springen, schwimmen im Regen, unter ihnen die Tiefe. Ich zittere heftiger, spüre eine Hand auf meiner Schulter; sie gehört der Lehrerin. Mir wird schwindelig. Meine Mutter kniet vor mir. Sie befühlt meine Stirn. Ich bibbere. Die Lehrerin zieht sich zurück. Meine Mutter legt ein Handtuch um meine Schultern. Wir bekommen nicht mit, wie die anderen ihr Ziel erreichen.
»Schließ deine Augen, Robert«, sagt meine Mutter. »Denk an etwas anderes.« Ich weiß nicht, woran. Meine Mutter dreht mich vom Wasser weg. »Du kannst deine Augen wieder öffnen«, sagt sie. Ich glaube ihr. Ich sehe Menschen unter einem Sonnenschirm, auf den der Regen prasselt. Alle starren mich an. Meine Mutter hält ihren Arm um mich. Ganz langsam gehen wir an den anderen vorbei. »Beachte sie nicht«, flüstert meine Mutter. Doch dann höre ich sie an all die anderen gewandt laut »Fieber« und »Schüttelfrost« sagen. Sie schämt sich. Es hört auf zu regnen. Im Auto summt meine Mutter, um sich zu beruhigen. Ich trage noch immer die neuen Badeshorts, auf denen kein Seepferd ist, niemals eins sein wird.
Mein Vater sagt nichts zu dem Vorfall. Seine fünfhundert Meter jeden Samstagmorgen im Lürener Stadtbad wird er auch in Zukunft ohne mich zurücklegen müssen. Er ist Brustschwimmer mit Badehaube. Bei jedem Zug verschwindet sein Kopf unter Wasser. Meine Mutter organisiert ein Attest, das eine Allergie auf Chlorwasser nachweist und mich vom Schulschwimmen befreit. Sie liebt nach wie vor das Meer; wir fahren nur noch in die Berge. Für meinen Vater ist das kein Problem; er mag Skifahren, Wandern und Biergärten. Wir reisen immer in denselben Ort. Dort nennen alle, die uns bewirten, meinen Vater »Herr Doktor«. Es gefällt ihm, weil er keiner ist. Bergseen müssen wir umfahren. »Memme«, nennt mich mein Vater und handelt sich dafür Ärger mit meiner Mutter ein.
Einmal ist das Herz meines Vaters groß genug, da beschließt er, seinem besten Freund zu helfen. Der betreibt in Lüren eine Holzmanufaktur, die Innentüren mit Blei als Dampfsperre zwischen den Holzdeckplatten herstellt. Die Manufaktur ist nicht mehr zu retten, das verrät der Freund meinem Vater aber nicht. Mein Vater bürgt für ihn und verliert alles, vor allem unsere Firma. Meine Mutter weiß das nicht. Mein Vater schweigt und verreist zum Stubaier Gletscher, wie jedes Jahr, wenn da außerhalb der Schulferien die Skisaison eröffnet wird. Sein Koffer ist ungewöhnlich groß, als er ihn in seinem bmw verstaut. Tage später benötigt die Lürener Sparkasse eine Unterschrift, den Schriftzug Böger im Original. Mein Vater fährt Ski. Die von der Sparkasse teilen meiner ahnungslosen Mutter mit, dass es ohne meinen Vater nicht geht, nicht einen Tag länger. Dann erzählen die von der Sparkasse und unser Anwalt meiner Mutter von der Bürgschaft. Meine Mutter verliert jegliche Sicherheit. Mein Vater bleibt unerreichbar. Meine Mutter bläut mir ein, mir nichts anmerken zu lassen und niemandem ein Wort davon zu sagen.
Mein Vater kommt vom Gletscher nicht zurück. Meine Mutter wird deshalb mit anderen Augen angesehen. Uns bleibt nur das Haus, ein Bungalow, zumindest vorerst. Meine Mutter meldet sich arbeitssuchend; meinen Vater meldet sie als vermisst. Das macht keinen guten Eindruck auf die Lürener; es ist zu außerordentlich. Gewisse Kreise meiden meine Mutter. Es sind die Kreise, in denen sie gern verkehrt, in die sie sich als Zugezogene hineinarbeiten musste. Gebürtig ist sie aus Korbach in Hessen. Für mich spielt Herkunft keine Rolle. Für mich sind alle, die in Lüren leben, Lürener. Aber meine Mutter ist anders als zum Beispiel mein Vater. Sie mag Romane und Opern. Mein Vater liest den Lürener Tagesanzeiger. Er mag Musicals. Unsere Welt geht unter, und er verschwindet. Meine Mutter versucht verzweifelt, ihr Ansehen wiederherzustellen. Sie meldet mich beim SV Lüren zum Tennis an. Wir können uns noch immer etwas leisten, soll das heißen. Meine Großeltern kommen für die Beiträge auf. Die Einladungen zu Geburtstagsfeiern, Abendessen oder Bridgerunden bleiben trotzdem aus. Ich müsste es wenigstens in die erste Mannschaft meiner Altersklasse schaffen, bleibe aber im Mittelmaß der zweiten stecken. Meine Mutter ist überzeugt, sich nirgends mehr blicken lassen zu können.
Johannes Güthoff herrscht über ein Getränke- und Immobilienimperium; ihm gehört auch die Güthoff-Quelle, ein Wahrzeichen Lürens. Johannes Güthoff erwirbt unser Firmengelände. Der Schriftzug Papier Böger wird vom Dach entfernt und entsorgt. Dank des Verkaufs der Immobilie kann meine Mutter sich von den Schulden befreien. Sie beschließt trotzdem, Lüren hinter sich zu lassen und meinen Vater endgültig aufzugeben. Ich bin vierzehn. Meine Mutter zieht mit mir aus dem Ostwestfälischen ins Nordhessische, nach Korbach, zu ihren Eltern, meinen Großeltern. Sie gewähren uns Unterkunft in dem Haus, in dem meine Mutter aufgewachsen ist.
Als Achtjähriger habe ich dort ein einziges Mal die Sommerferien verbracht. Kaum angekommen, beauftragte mich meine Großmutter mit der Himbeerernte in ihrem Obstgarten. Ich verschwand in den dornigen Sträuchern, die mir beinahe bis zum Kopf ragten, und pflückte einen ganzen Putzeimer voll. Stolz lieferte ich die Ware mit zerkratzten Armen und Beinen bei der Großmutter ab. Wir aßen draußen auf der Veranda zu Mittag. Für meinen Großvater und meine Großmutter gab es zum Nachtisch gezuckerte Himbeeren. Ich bekam Rote Grütze, wahrscheinlich vom Vorvorvortag. Eine säuerlich schmeckende Haube Schlagsahne überdeckte eine pelzige weiß-grüne Fläche am Rand des Schälchens.
Sechs Jahre später werde ich gezwungen, bei diesen Großeltern einzuziehen. Meine Mutter und ich bekommen Zimmer in der oberen Etage zugeteilt. Manchmal wird meine Mutter ohne ersichtlichen Grund wütend, dann muss sie ihre Wut an jemandem auslassen. »Ich habe Angst vor deiner Mutter«, flüstert mir meine Großmutter ins Ohr. Mein Großvater verzieht sich in die Räume seiner allgemeinmedizinischen Praxis im Seitenflügel des Hauses. Er praktiziert seit Jahren nicht mehr, aber alle Geräte und Möbel sind noch da. Meine Mutter wurde in dieser Praxis gegen ihren Willen als Assistentin ausgebildet. Jetzt braucht sie eine Arbeit, aber alles, was sie kann, ist etwas, das sie auf keinen Fall jemals wieder tun möchte. »Mir wird speiübel von den Gerüchen«, klagt sie.
Wir haben Glück; sie findet Anstellung in einer Mode-Boutique. Meine Mutter besitzt ein Talent dafür, Leute einzukleiden. Nur manchmal verliert sie die Geduld mit ihren Kundinnen, wenn die auf Größen beharren, in die ihre Körper kaum hineinpassen.
Nach einem halben Jahr ziehen wir zwei Straßen weiter in die oberste Etage eines Mehrfamilienhauses. Wir bleiben in Reichweite meiner Großeltern, sind aber weniger abhängig von ihnen. Diese Lösung stimmt alle Beteiligten froh. Jeden Samstag essen wir bei ihnen zu Mittag. Es gibt immer Kassler, dazu Salzkartoffeln und einen Erbsen-Möhren-Mix. Zwischen den Schüsseln hüpft auf dem Tisch ein Sperling herum, dem hat meine Großmutter das Leben gerettet. Ein Kanarienvogel singt dazu, der darf seinen Käfig nicht verlassen. Zum Nachtisch gibt es Rote Grütze; die lasse ich jedes Mal stehen.
In der neuen Wohnung hört meine Mutter abends Musik von Elton John, Lauryn Hill oder Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Manchmal auch CDs, die sie früher mit meinem Vater zusammen gehört hat: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Glenn Miller. Ich frage mich, ob mein Vater feige oder mutig war. Meine Antwort wechselt ständig, bis ich aufhöre, mir diese Frage zu stellen. Ich habe zwei Fotos von ihm und weiß nicht, wohin damit. Aufstellen oder aufhängen kann ich sie nicht; meine Mutter würde es nicht dulden. Ich verstecke sie, kann mich bis heute nicht erinnern, wo.
Korbach ist halb so groß wie Lüren. Ich bekomme einen Schlüssel um den Hals gehängt. Die Abende verbringt meine Mutter meist summend allein zu Hause. Ich bleibe in meinem Zimmer oder gehe raus, um nach einer anderen Welt zu suchen. Sie bemerkt es nie. Einmal hört sie all ihre Fitzgerald-, Miller-, und Armstrong-Alben hintereinander weg, zusammen mit einer Flasche Hennessy, ihrem Lieblingsweinbrand. Am nächsten Morgen liegen die CDs draußen neben dem Mülleimer, und die leere Flasche befindet sich im Altglasbehälter. Ich versuche die CDs in der Schule zu verkaufen. Ich besuche den Gymnasialzweig einer Gesamtschule, halte mich von tiefen Wassern fern und bekomme, ohne mich anzustrengen, gute Noten. Mit sechzehn entscheide ich, mich anzustrengen. Drei Jahre später erhalte ich einen Studienplatz für Europäische Studien und Geografie in Berlin. Meine Mutter schenkt mir einen nachtblauen Anzug, ein weißes Hemd mit Haifischkragen und eine Flasche Prosecco. Sie summt. Meine Großeltern überweisen halbjährlich die Studiengebühren. Ich gewinne ein Stipendium, und nach vier Semestern werde ich studentische Hilfskraft. Ich kaufe mir eine Videokamera und beginne zu filmen, lerne, die Bilder zu schneiden und Töne anzulegen. Ich veröffentliche meinen ersten Video-Blog und wundere mich über die Resonanz. Meine Bachelorarbeit schreibe ich über die Kraft des Wassers, aber mich interessieren vor allem Bilder. Ich richte einen Kanal ein, beginne regelmäßig zu vloggen und studiere im Master Globalgeschichte. Immer mehr Menschen sehen sich meine Clips an und abonnieren den Kanal. Ich finde Sponsoren und gewinne den Jackpot, als World Water Ltd. mir eine Zusammenarbeit vorschlägt, eine NGO, die weltweit lokale Lösungen im Wassermanagement anbietet, in Wasserbetriebe investiert, um sie zu sanieren, zu erhalten und auf Nachhaltigkeit auszurichten.
Der Gedanke an Wasser treibt mich an. Ich interessiere mich nicht für meine Angst oder ihre Ursache, sondern für das Element, um das sie kreist, das uns alle und alles bestimmt. Ich fürchte mich vor etwas, das existenziell ist, aus dem ich mehrheitlich bestehe, vor etwas, das allen selbstverständlich ist. Das erscheint mir bedeutsam, denn ich habe herausgefunden, dass Wasser genau das nicht ist: selbstverständlich. Wasser frisst meine Zeit, vereinnahmt mich ganz und gar. Du verstehst das, lässt es zu. Von dir habe ich das zweite O in meinem Namen. Robert passt nicht zu mir, Roberto schon, findest du. Egal, was passiert, dieses O gebe ich nie wieder her. Meine Mutter versteht das nicht. Sie fragt sich bis heute, wer dieser Roberto sein soll. Nicht mein Problem.
TEIL IDIE QUELLE
FRÜHLING
ATHEN
ROBERTO
Ich will nicht, dass du aufwachst. Ich will nicht gehen, rede ich mir ein und gehe trotzdem, jedes Mal. Ich lasse das Licht aus und stolpere im Flur über den kleinen Rollkoffer. Du wachst trotzdem nicht auf. Ich ziehe mich im Wohnzimmer an, wo alles bereitliegt, T-Shirt, Socken, Hoodie, Jeans, Rucksack. Ich habe die Boxershorts vergessen, muss zurück ins Schlafzimmer, eine Schublade aufziehen, die Shorts rausholen. Du schläfst. Ich tappe auf Zehenspitzen wieder ins Wohnzimmer, ziehe mich endlich an, schleiche in den Flur, öffne die Wohnungstür.
»Komm zurück, Roberto.«
Du hast mich doch gehört. Einen Moment lang bin ich versucht, wieder zu dir ins Bett zu kriechen, mit dir auf den Morgen zu warten und auf den nächsten und dann den übernächsten, aber ich kann nicht. Plötzlich stehst du vor mir, nackt, verschlafen, schlingst deine Arme um meinen Hals.
»Halt dich fern von tiefen Gewässern«, flüsterst du mir ins Ohr.
»Versprochen, Sascha.«
Das genügt dir; du verschwindest wieder im Dunkel des Schlafzimmers. Ich ziehe die Tür ins Schloss, laufe sechs Stockwerke die Treppen hinunter, weil ich dem Lift nicht traue. Draußen wartet ein Taxi. Es ist vier Uhr morgens, Wochenende; wir haben freie Fahrt durch eine Stadt, die zugleich einschläft und erwacht. Ich kenne die Strecke auswendig; sie führt weit hinunter in den Süden, über die Randgebiete hinaus. Ich sitze auf der Rückbank, den Kopf an die Scheibe gelehnt, denke darüber nach, was mich erwartet, bin angespannt, voller Energie; so geht es mir jedes Mal, sobald ich unterwegs bin, um zu filmen. Der Taxifahrer fragt, ob es mich stört, wenn er telefoniert. Es stört mich nicht; er spricht trotzdem leise. Ich kann kein Arabisch, verstehe nur ein paar Worte; ich bin sicher, er spricht mit seiner Frau. Es klingt, als würde er sie trösten, sie beruhigen. Vielleicht ist sie es auch, die ihn beruhigt oder wach hält. Hinter Adlershof lenkt er auf die Autobahn, im Lichtkegel der Scheinwerfer nur noch Asphalt, sonst nichts, bis irgendwann die kaltweißen Lichter des BER-Areals auftauchen.
»Meine Tochter hat gestern ihre Seepferdchenprüfung bestanden«, erzählt mir der Taxifahrer stolz. »Ist ins Wasser gesprungen, geschwommen, sogar getaucht ist sie, und ich war nicht dabei, kannst du dir das vorstellen?«
Nein, kann ich nicht, will ich nicht. Ich halte mich fern von tiefen Gewässern. Ich checke ein, laufe zum Gate. Sobald ich sitze, greife ich unter den Sitz, taste nach der Schwimmweste. Ich schlafe ein und denke an dich, fühle deine Hand in meiner. Sofort ist klar, ich träume; du magst kein Händchenhalten. Ich wache auf und sehe aus dem Fenster; da ist nur Himmel. Irgendwo unter uns muss verstreut Athen liegen. Das Bodenpersonal streikt, heißt es. Aus dem Bus, der uns von der Maschine zum Terminal bringt, sieht man in offene Hangars, in denen sich Abertausende Koffer stapeln. Ich habe nur Handgepäck, einen Rucksack und den Rollkoffer. Ich leihe einen Wagen, gebe die Adresse ins Navi ein. Du fehlst. Alles fiele leichter, wärst du dabei; das denke ich jedes Mal.
Die Gasse ist zu schmal, um mit dem Auto vorzufahren. Ich finde eine Lücke auf dem Boulevard, fange sofort an zu filmen. Alle zweihundert Meter eine Mülltonne, die überläuft. Die Rollgitter vor den Geschäften sind heruntergelassen. Zeitungen wehen mit Straßenstaub Richtung Süden, dann dreht der Wind, und das ganze Elend fliegt zurück. Überall die Schilder: »Geschlossen«, in den Fenstern der Bäckereien, Fleischereien, selbst die grünen Rollläden der Kioske sind heruntergelassen. Ein Streik vielleicht, ein Feiertag. »Zu verkaufen« steht auf den Schildern. Natalia wartet schon auf mich; sie ist Psychologin, arbeitet für die Stadtverwaltung. Wir sind verabredet; sie kennt meine Vlogs. Natalia schwingt eine zerfranste Tasche über ihre Schulter und stellt mir Giorgios vor. Erst mustert er mich, ist misstrauisch wegen der Kamera, aber dann gibt er mir mit der Hand das Zeichen, ihnen zu folgen. Giorgios trägt Uniform; an seinem Gürtel hängt ein Halfter mit Handfeuerwaffe. Er ist Polizist, muss uns begleiten, nur falls es Schwierigkeiten geben sollte.
»Es gibt immer Schwierigkeiten«, sagt Natalia.
Giorgios sagt nichts. Natalias Hände zittern, trotz der Routine. Vielleicht möchte sie rauchen. Zwischen einigen wenigen Häusern sind Wäscheleinen gespannt, wie Girlanden bei einem Kindergeburtstag. Giorgios klingelt. Das Namensschild ist ordentlich beschriftet, die Abdeckung fest verschraubt. Im Treppenhaus ist es kühl. Wir steigen die Stufen hinauf ins dritte Stockwerk; Giorgios geht voran. Giorgios ist zweiundvierzig Jahre alt, seit fünfundzwanzig Jahren ist er Polizist. Sein kurz geschnittenes Haar ist grau meliert; bestimmt hat seine Frau es geschnitten; bestimmt besitzt sie keinen Rasierer zum Ausrasieren des Nackens. Giorgios Schultern sind breit, sein Bauch ist flach, die Hände kräftig, auf seiner Hose sind Flecken.
Der Name »Manolas« steht auf einem Messingschild mitten an der hölzernen Tür. Natalia klopft. Niemand öffnet. Giorgios hämmert gegen die Tür.
»Dimitris Manolas! Aufmachen!«
Ein grauhäutiger Mann öffnet, Dimitris Manolas, Ende zwanzig, schwarze Haare, Dreitagebart, athletische Figur. Er ist zwei Köpfe kleiner als Giorgios. Sie kennen sich, natürlich. Natalia reicht ihm die Hand; er schlägt sie aus, hat dunkle Ringe unter den Augen.
»Hallo.« Natalia.
Dimitris Blick weicht aus. »Hallo«, sagt er leise, resigniert, trotzdem aufgewühlt. »Da lang, bitte.«
Natalia begrüßt Eleni. Ihre Augen sind rot verweint, die Wangen hohl; sie ist wütend, aber unterdrückt ihre Wut. »Hallo.«
Ich nicke.
»Wo ist Christina?«, fragt Natalia.
»Sie schläft«, sagt Eleni, ohne Natalia anzugucken. Eleni lehnt an einer geschlossenen Tür, hat die Arme vor der Brust verschränkt. Neben Eleni hängt eine ungerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie, darauf ein Haus, in der Ferne Meer, Strand, Stromkabel im Himmel.
»Kann ich sie sehen?« Natalia ist die Frage unangenehm, aber sie muss sie stellen, mit freundlicher Stimme. Eleni drückt die Klinke, stößt die Tür auf. Christina schläft hinter einem weißen Gitter aus Holz, über ihr schwingen gelbe Enten mit orangenen Schnäbeln, ein Mobile. »Danke«, sagt Natalia.
Dimitris schließt leise die Tür.
»Wo können wir uns setzen und reden?« Natalia. Im zweiten Zimmer hocken sie sich auf Sofa- und Sesselkanten. Giorgios bleibt stehen. Dimitris sitzt neben Eleni, beinahe berühren sich ihre Knie. Ich darf filmen, das haben wir im Vorfeld verabredet, als ich ihnen versprochen habe, in einem Vlog ihre Geschichte zu erzählen. »Hat sich seit meinem letzten Besuch irgendetwas an Ihrer Lebenssituation geändert?« Natalia kennt die Antwort auf ihre Frage im Voraus.
»Nein.« Dimitris faltet die Hände, die Fingerknöchel werden weiß; das ist kein Gebet.
»Das heißt, Sie haben nach wie vor keinen Zugang mehr zu fließendem Wasser?«
»Óchi.« Nein.
An einer Wand klebt der Abdruck eines Flachbildschirms. Kennengelernt haben sich Eleni und Dimitris bei einem Hochschulfest. Dimitris lief mit einem Bauchladen herum, verkaufte Gebäck aus der Konditorei seines Vaters. Patsavouropita zum Beispiel, kleine Kuchenstücke aus den Resten von Pitateig, mit Zitronencreme gefüllt. Eleni lachte, als Dimitris ihr anbot, zu kosten.
»Ich habe kein Geld dabei«, meinte Eleni.
»Aber kosten kannst du trotzdem.« Dimitris bestand darauf, packte ihr drei Stücke in eine kleine Papiertüte, und auf die Tüte schrieb er seine Telefonnummer.
Drei Tage später rief Eleni Dimitris an. »Hallo?«
»Eleni?«
»Ja.«
So fängt es an – sie sitzen in einer Taverne unter einem Dach aus Wein, mit rot karierten Tüchern aus Wachspapier auf den Tischen. Meist treffen sich dort nur Touristen.
»Ich kenne den Koch.« Dimitris strahlt.
Eleni studiert Griechisch, Sport und Mathematik; sie möchte Lehrerin werden. Dimitris studiert Maschinenbau. Eleni trinkt Weißwein, und Dimitris trinkt Bier; der Koch schreibt an. »Lass uns woanders hingehen.« Eleni.
Sie flanieren durch die Gassen. Der Abend ist kühl, trotzdem, alle sind draußen, Hunde und Katzen, Bettler, Sperlinge, Krähen. Eine schwarze Limousine verschwindet in einer von privatem Sicherheitspersonal bewachten Tiefgarage. Lichtverschmutzung erhellt die Akropolis. Dimitris bringt Eleni nach Hause; sie teilt sich mit einer Kommilitonin in einem Studentenwohnheim ein fünfzehn Quadratmeter großes Zimmer. Das Geld für die Rückfahrt spart Dimitris sich und läuft. Als er nach Hause kommt, brennt in der Backstube seines Vaters Licht. Dimitris fragt, ob er helfen soll.
»Geh schlafen«, sagt sein Vater.
Das erste Mal zusammen schlafen Eleni und Dimitris, als Elenis Kommilitonin an einem Wochenende zu ihren Eltern fährt. Die Zimmernachbarinnen können sie hören. Beim dritten Mal trommelt die erste gegen die Wand. Eleni ist es egal, Dimitris dann auch. In den Ferien soll Dimitris mit Eleni nach Limnos, zu ihren Eltern. Dimitris fragt seine Eltern nach einem Zuschuss für die Reise. Dimitris soll in den Ferien selbst etwas dazuverdienen, aber er findet keinen Job, und sein Vater kann seine Hilfe nicht gebrauchen, weil es zu wenig zu tun gibt in der Konditorei. Ein Flug ist billiger als die Fähre, auch wenn man kein Auto hat. Dimitris Mutter leiht ihm das Geld. Der Vater soll es nicht wissen, auch wenn beide wissen, dass er es weiß. Dimitris ist noch nie geflogen. Eleni freut sich auf zu Hause. Zu Hause ist für sie ein Haus, in dem viele Menschen wohnen, wenn die Geschäfte gut laufen. Ihre Eltern betreiben die Pension seit siebenundzwanzig Jahren. Ein Foto von früher hängt in Elenis Zimmerhälfte in Athen an der Wand, Schwarz-Weiß, Stromleitungen im Himmel, im Hintergrund das Meer. Eleni ist unter Fremden aufgewachsen, Gäste, einige davon kamen immer wieder, die waren wie Jahreszeiten. Manchmal musste Eleni ihr Zimmer räumen und bei den Eltern campieren, damit alle Gäste unterkamen. Elenis Mutter umarmt Dimitris ohne Argwohn, aber er bekommt ein Gästezimmer im Erdgeschoss zugewiesen. Elenis Zimmer liegt in der ersten Etage. Die meisten Zimmer stehen leer.
»Ist früh in der Saison«, meint Elenis Vater. Dimitris repariert mit ihm unter den Aprikosenbäumen im Garten die Pumpe des Brunnens.
Heute, zwei Jahre später, haben Eleni und Dimitris in ihrer Athener Wohnung keinen Zugang zu fließendem Wasser.
»Was ist mit Strom?«, fragt Natalia.
»Strom haben sie auch abgestellt.« Dimitris.
Wieder springen wir in der Erzählung zurück. Dimitris macht seinen Abschluss noch vor Eleni. Er ist jetzt offiziell Maschinenbauingenieur. Die städtischen Wasserbetriebe stellen ihn ein. Dimitris zieht mit Eleni zusammen, zwei Zimmer, Küche, Bad. Zum ersten Mal schlafen sie in den eigenen vier Wänden miteinander. Eleni besteht ihre Prüfungen; sie wird Lehrerin für sechste bis neunte Klasse. Dimitris kauft einen Fernseher und hängt ihn an die Wand. Eleni verdient zusätzlich mit Nachhilfestunden. Dimitris geht jeden Morgen pünktlich zur Arbeit. Am Abend kocht er für beide, und sie essen auf dem schmalen Balkon. Samstags gehen sie mit Freunden aus; Eleni trinkt Weißwein, Dimitris Bier. Manchmal tanzen sie, auch zu Hause, auf dem Balkon, im Wohnzimmer, der Küche, im Schlafzimmer. Immer weniger Menschen kommen in den Laden von Dimitris Vater. Sein Süßgebäck ist zu teuer geworden, obwohl er seit Jahren die Preise nicht erhöht hat. Stille. Eleni und Dimitris blicken schweigend in meine Kamera. Noch immer hocken sie auf der Sofagarnitur. Die Straße lärmt; Wind weht den Vorhang herein. Eleni schämt sich. Kein Wasser, um Tee zu kochen, kein Wasser, um sich zu waschen. Nein, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Óchi.
»Ich war einer der Ersten, den die neuen Betreiber der Wasserwerke entlassen haben, aber nur einer von vielen«, sagt Dimitris. »Dell'Aqua heißen die. Sie haben die Leute entlassen, und dann haben sie die Preise erhöht. Um dreihundert Prozent.«
»Da hatte ich meine Stelle in der Schule noch. Also haben wir bezahlt. Dreimal so viel wie vorher.« Eleni.
Dimitris soll Englisch oder Deutsch lernen, haben sie ihm auf dem Amt gesagt. Damit er ins Ausland kann. Da suchen sie Ingenieure. So habe ich die beiden kennengelernt. Mein Hauptsponsor World Water Ltd. hat versucht, Dimitris eine Stelle zu vermitteln. Vor achtzehn Monaten war das.
Dimitris und Eleni liegen auf der Couch. Das Licht ist aus; an den Wänden flirren Lichter und Schatten von den Scheinwerfern der Autos, die den Boulevard entlangfahren.
»Dimitris?«
»Hm?«
Eleni ist schwanger. Dimitris kann es nicht glauben. Eleni ist sich sicher. Dimitris hat sich nie zuvor so über etwas gefreut. Er findet keine Arbeit; World Water Ltd. kann nicht helfen. Ihm fehlen Sprachkenntnisse. Ein Freund bietet Dimitris einen Job in seiner Autowerkstatt an, vier Euro die Stunde plus Trinkgeld, schwarz. Dimitris lernt eine Menge über Motoren und Getriebe. Eleni unterrichtet noch fünf Monate lang, dann geht sie in Mutterschutz. Sie leihen sich ein Kinderzimmer zusammen und richten es ein. Die Geburt verläuft gut; sie sind glücklich. Christina weiß noch nichts von ihrem Glück, dafür ist sie zu jung. Eleni und Dimitris reisen mit Christina nach Limnos. Alle Zimmer sind frei. Am Strand campieren Geflüchtete; die Touristen buchen um. Elenis Mama weint, mit Christina auf dem Arm. Dimitris versucht mit seinem Schwiegervater ein Ersatzteil für die Wasserpumpe zu organisieren. Am Abend sehen sie sich Fotos von der Hochzeit an. Eleni hatte schon einen dicken Bauch. Elenis Mama weint, weil so viele ihrer Verwandten nicht kommen konnten. Elenis Vater will ihr Geld zustecken. Sie kann es nicht annehmen, also steckt er es in ihre Reisetasche und bringt sie zum Flughafen. Als sie nach Hause kommen, finden sie einen einzelnen Brief in ihrem Briefkasten. Elenis Stelle wird gestrichen. Falls sie noch Sachen in der Schule hat, soll Eleni sie dort abholen.
Ich gucke aufs Display meines Handys, das mir als Kamera dient. Der Akku läuft leer; ich suche das Ladegerät. Dimitris und Eleni spielen mit etwas Unsichtbarem auf dem Couchtisch.
»Ich will, dass meine Tochter in ihrer Heimat aufwächst. Das geht doch nicht, dass alle jungen Leute einfach gehen. Was soll denn so aus unserem Land werden?« Eleni sieht mich an, als wüsste ich die Antwort.
Natalia wird unruhig. Sie hat hier einen Job zu erledigen; alle wissen das. Giorgios rührt sich nicht von der Stelle, aber ist jederzeit bereit, einzugreifen. Dimitris tut sich schwer mit Englisch, noch schwerer mit Deutsch, sagt er. World Water Ltd. ist bereit, ihm einen Kurs zu finanzieren, er weiß nicht, woher er die Zeit nehmen soll, versucht es sich selbst beizubringen.
»Mein Vater, also die Konditorei, die Leute sind nicht mehr gekommen. Die können sich hier im Viertel vielleicht noch Brot, aber kein Süßgebäck mehr leisten. Sie mussten die Konditorei aufgeben, konnten ein paar Sachen verkaufen und bekommen eine Rente, aber die reicht kaum für sie selbst. Meine Mama, es geht nicht darum, also es geht ihr nicht um sich und Papa, aber dass sie ihren Kindern nicht helfen kann, das macht sie krank.«
»Eleni, Dimitris, ihr werdet auch nächste Woche kein Wasser haben, oder?« Natalia sieht auf ihre Uhr. Sie kennt die Geschichten; sie hat noch andere Kunden. Eleni ist das egal. Sie glaubt daran, dass es etwas ändert, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen. Ich habe es ihnen versprochen.
»Sauberes Trinkwasser und Sanitätsversorgung wurden von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen als Menschenrecht deklariert, wissen Sie das? Alle Mitgliedsstaaten haben das anerkannt. Griechenland ist auch ein Mitgliedsstaat. Es bedeutet, dass die Regierung sich verpflichtet, die Wasserversorgung nicht einzustellen, auch wenn man nicht mehr bezahlen kann, so wie wir. Machen die das bei Ihnen auch? Leuten das Wasser abstellen? Die bestimmen nur, dass das bei uns gemacht wird, richtig? Wie lässt sich denn ein Menschenrecht mit einem Tarifsystem vereinbaren?« Eleni funkelt mich an. Sie versteht nicht, warum man ein Menschenrecht nicht einklagen kann.
Aus dem Schlafzimmer hört man Christina. Sie ist aufgewacht und weint. Eleni blickt zur Tür. Sie steht auf, verlässt den Raum, kommt mit Christina auf dem Arm zurück, die noch verschlafen in die Welt guckt und sich über die Fremden wundert. Eleni bleibt mit Christina auf dem Arm in der Tür stehen; für sie ist das Gespräch beendet. Natalia steht auf. Sie versucht ihre Stimme sanft und ruhig klingen zu lassen.
»Eleni, Sie wissen, worüber wir gesprochen haben.«
»Sie können mir meine Tochter nicht wegnehmen!« Eleni wiegt Christina, drückt sie an sich.
»Eleni, bitte. Ohne fließend Wasser ist eine ordnungsgemäße Versorgung Ihrer Tochter nicht mehr möglich«, sagt Natalia und geht einen Schritt auf Eleni und Christina zu.
Dimitris springt auf. »Unserer Tochter geht es gut!«
Giorgios rührt sich. Dimitris stellt sich zwischen Natalia und Eleni, legt seinen Arm schützend um seine Frau und seine Tochter. Giorgios stellt sich breitbeinig neben Natalia, die eine Hand auf seinen Arm legt, um ihn zurückzuhalten.
»Ich sehe, dass es Ihrer Tochter gut geht. Aber wir haben Sie rechtzeitig auf die Verordnung hingewiesen. Sie hatten Zeit, etwas an Ihren Lebensumständen zu ändern. Es tut mir ehrlich leid, glauben Sie mir, aber wir müssen reagieren«, sagt Natalia.
Christina weint; Eleni versucht sie zu beruhigen. Sie selbst weint auch, doch sie weint vor Wut.
»Haben Sie ein paar Sachen für Christina zusammengepackt?«, fragt Natalia.
Eleni fleht. »Dimitris, bitte.«
Dimitris kann nichts machen.
»Bitte, Eleni, geben Sie mir Ihre Tochter; es ist zu Ihrem Besten.« Natalia streckt ihre Arme nach Christina aus; Eleni dreht sich von Natalia weg und schreit:
»Das können Sie nicht machen!«
»Eleni, bitte.« Natalia. »Sie finden bestimmt eine Lösung, aber ich muss Christina jetzt mitnehmen.«
Dimitris schiebt sich kraftlos vor Natalia. Christina weint immer weiter. Plötzlich verstummt sie vor lauter Aufregung für einen Moment. Eleni ruft:
»Dimitris!« Sie will, dass ihr Mann endlich etwas unternimmt. Natalia gibt Giorgios ein Zeichen.
»Wie können Sie das tun!«, ruft Dimitris.
Giorgios schiebt Dimitris zur Seite. »Übergeben Sie uns jetzt bitte Ihre Tochter.«
Natalia greift nach Christina, nimmt sie Eleni ab, die keine Kraft mehr hat, sie festzuhalten. Dimitris will es verhindern; Giorgios hält ihn mühelos zurück.
»Óchi!« Elenis Ruf lässt die Luft vibrieren. Aus Dimitris Lippen schwindet jegliche Farbe. Er geht Giorgios an, der ihn, davon unbeeindruckt, mit einem Arm wegdrückt und Natalia abschirmt, die mit Christina schon beinahe die Wohnungstür erreicht hat. Elenis Wehklagen erfüllt das ganze Haus, weht durchs Fenster und das Treppenhaus hinaus auf die schmale Gasse und den Boulevard. Eleni sinkt auf die Knie; Dimitris umschlingt sie, weint. Ich stelle die Kamera aus, schließe die Tür. Vielleicht werde ich die beiden nie wiedersehen.
Natalia wartet draußen mit Giorgios und Christina auf mich. Christina schluchzt, aber es scheint, als könne Natalia sie beruhigen. Giorgios hat sich eine Zigarette angezündet. Ich filme. Natalia beginnt, auf mich einzureden. In ihrer Stimme schwingt Zorn; sie muss sich Luft verschaffen.
»Es ist das dritte Mal in diesem Monat, dass ich so etwas machen muss! Was für eine Logik steckt dahinter? Sie können ihnen das Wasser nicht zahlen, aber Geld für die Unterbringung der Kinder in einem Heim haben sie, und da kommen die Kinder hin, weil sie zu Hause kein fließendes Wasser haben? Zum Kotzen ist das! Das ist ihr Europa, verstehst du? Das machen sie mit uns! Und du? Du mit deinen Vlogs, du tust doch auch nichts!«
Es ist kein Gespräch.
»Alles in Ordnung, Natalia?«, fragt Giorgios. Er fixiert mich, und tritt seine Kippe aus.
»Nichts ist in Ordnung!« Natalia dreht sich um und eilt ohne Abschied mit Christina im Arm davon. Niemand kümmert sich darum, nur ein paar verstohlene Blicke folgen ihr.
»Ich habe nie verstanden, wie Menschen derart verantwortungslos handeln können«, blafft Giorgios mich an und geht mit der rechten Hand auf seiner Waffe Natalia hinterher.
Ich bleibe stehen, bin ein Hindernis für die Passanten. Sie weichen mir aus; ich treibe mit ihnen, keine Ahnung, wohin. »Ich habe nie verstanden, wie Menschen derart verantwortungslos handeln können.« Ich weiß nicht, auf wen ich das beziehen soll. Auf dem Syntagma-Platz, in der U-Bahn zum Flughafen, der Abflughalle, überall sind Menschen in Bewegung, deren Geschichte ich nicht kenne, die die Geschichte von Eleni und Dimitris nicht kennen, vielleicht nie von ihr erfahren werden, trotz meines Video-Blogs. Ich komme jedes Mal zu spät, denke ich. Dell'Aqua ist schon da. Dell'Aqua ist überall.
LIFE
ROBERTO
Ich checke ein, fliege nach Lagos. In Nigerias Hauptstadt stellt der CEO Ken Brabeck Dell'Aquas neuestes Projekt persönlich vor: Life. Ein Wasser für alle; die ganze Welt erkennt es am Geschmack, der überall derselbe ist. Ken Brabeck und Dell'Aqua sind die Windmühlen, ich bin Don Quichote, zumindest behauptest du das. Ich lande, rufe dich an; du meldest dich nicht. Ich hinterlasse eine Nachricht: »Ich bin jetzt in Lagos.« Mein Display leuchtet auf: »Ich kann gerade nicht sprechen«. Das steht da jedes Mal, wenn du nicht sprechen kannst. Oft vergesse ich, dass auch du Dinge tust, die ein Gespräch, eine direkte Verbindung unmöglich machen. Fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Ich verlasse den Flughafen, dringe in einem Fluss zerdehnter Zeit in Richtung Zentrum vor, ringe nach Luft, halte die Kamera vors Auge. Ein Schlachthof so groß wie riesengroß inmitten einer endlosen Stadt. Im Zentrum beginnt das Ghetto, zwischen den Towern die Slums. Der Verkehr steht still. Es gibt kein Vor und kein Zurück, und trotzdem wächst die Stadt. Man kann ihr dabei zusehen; niemand vermag hier etwas aufzuhalten. Es wird Tage dauern, bis ich wieder herausfinde. Ken Brabeck fliegt, weicht in einem Helikopter dem Verkehr aus, dem ich nicht entkomme, der mich direkt zu diesem Schlachthof führt. Kein Wasser überall. Das Fleisch hängt über brennenden Autoreifen, wird geröstet und geräuchert. Sie wenden es mit Eisenhaken, fangen das Blut in Zinkwannen auf, kochen es. Der schwarze Rauch hinterlässt eine ölige, rußige Spur auf meiner Haut, auf meiner Kamera. Die Reifen der Lastwagen brennen, auf dem Boden Kot, Knochen, Rinnsale von Blut, nirgends fließt Wasser. Wir tauchen in schwarzen Wolken, hören die Tiere schreien; es gibt kein Eis für die Ware, die sie ungekühlt verladen. Niemand ahnt, dass aller Tod hier nur dem Überleben dient. Ich sehne mich nach Athen zurück. Ich sehne mich zu dir und bleibe hier. »Weil du nicht anders kannst«, wirst du später sagen. Manchmal legst du eine Hand auf mein Gesicht, berührst mich, als wärst du blind. Um dich erinnern zu können, um sicherzugehen, dass ich noch derselbe bin, bilde ich mir ein. Aber du tust Dinge einfach so, ohne Absicht, ohne davor oder danach darüber nachzudenken.
Ich erreiche das Messezentrum. Ken Brabeck hat mir ein Interview versprochen, zum hundertsten Mal. Meine 700.000 Follower erwarten es beinahe ebenso sehnsüchtig wie ich. Vielleicht hält er diesmal Wort, nur deshalb bin ich hier. Dell'Aqua-Flaggen wehen neben den Nationalfarben Grün und Weiß. Die Security durchleuchtet mich, tastet mich ab; sie scannen meinen Ausweis, lassen mich durch, lenken mich zum Pressebereich nahe der Bühne.
Ken Brabeck tritt auf. Das Mikrofon des Headsets berührt beinahe seine Lippen: »Wasser ist ein soziales Gut«, sagt er. »Wir müssen den Blick auf sein ökonomisches Potential richten, auf eine gemeinsame Wertschöpfung. Wir sorgen dafür, dass wir weiter wachsen können, und das können wir, weil wir der andauernden Verfügbarkeit von Wasser die oberste Priorität einräumen. Wasser garantiert uns und unseren Aktionären eine Zukunft, die uns befähigt, die Bedürfnisse der Konsumenten überall auf der Welt zu befriedigen.« Er lächelt, nennt es »Life«.
Für einen Tageslohn bekommt man in Lagos eine Literflasche Life an jedem Kiosk. Das internationale Fachpublikum klatscht erst höflich, dann begeistert. Brabecks Bilder und Worte rauschen durch mich hindurch. Ich versuche seine Pressesprecherin auf mich aufmerksam zu machen. Sie hat mich längst entdeckt, schüttelt ihren Kopf. Offenbar kann sie nicht glauben, dass ich hier bin. Sie weiß nichts von einem Interview, leidet unter spontanem Gedächtnisverlust. War klar. Sie tippt an ihr Ohr, spricht ins Headset, verständigt die Security. Personenschützer führen Ken Brabeck in Richtung Ausgang. Ich dränge mich vor. Er soll wissen, dass ich hier bin, dass ich nie aufgeben werde. Unsere Blicke treffen sich, er erkennt mich, natürlich. Er zögert, dann lächelt er in meine Kamera, kommt auf mich zu. Er hat keine Angst, ist unantastbar, glaubt er. Er nimmt meine Hand, schüttelt sie; mit der anderen filme ich.
»Sie habe ich hier nicht erwartet, Böger.«
»Wir sind verabredet. Sie wollten mit mir reden. Zwei Stunden waren vereinbart.«
»Das hatten wir doch abgesagt. Warum sind Sie trotzdem gekommen?«
Weil ich von einer Absage nichts weiß, ich wieder auf ihn reingefallen bin.
»Sie können es nicht lassen, richtig, Böger? Das bewundere ich, ehrlich. Also, wie finden Sie es? Ein großartiges Projekt, Life, das müssen Sie zugeben.«
Ja. Der Personenschutz zieht ihn weiter. Ken hebt entschuldigend die Schultern. Das war's. Mehr bekomme ich nicht von ihm; ich muss ihn ziehen lassen. Die Personenschützer umringen ihn, führen ihn ab. Security steuert auf mich zu. Ich bin draußen, ehe sie mich erreichen. Ich verlasse das Messegelände, die Stadt, den Kontinent. Sie werden uns fertigmachen mit ihrem Life.
»Wann kommst du?«, fragst du.
Ich bin schon unterwegs, schlafe ein, im Flughafen, in einem Uber. Ich bin schon fast da, nehme den Lift. Du hast auf mich gewartet, liebst mich noch; das überrascht mich immer wieder. Es riecht nach Essen. Du hast gekocht, in meiner Wohnung, in der du nur lebst, weil ich nie da bin.
»Es könnte unsere sein, Sascha.«
»Lass es, Roberto.«
Wir kommen über die Vorspeise nicht hinaus, sind beide auf Entzug. Deine Haut ist rau vom Chlor. Ich rieche Avocado-Lotion, schmecke dich durch sie hindurch, kann mich nicht länger zurückhalten.
»Komm schon«, sagst du und grinst. Bestimmt habe ich mir dieses Grinsen nur eingebildet. Du siehst mich an, als wäre ich dir etwas schuldig geblieben. »Was ist?«, fragst du. Ja, genau, was ist? Vielleicht bin ich schon wieder woanders. Es stört dich nicht, dass ich ständig unterwegs bin, unruhig werde, sobald ich länger bleibe. Wenn es anders wäre, würdest du es sagen, weil du nie etwas zurückhältst, mir nie etwas vormachst. Das wäre viel zu anstrengend, findest du. Wir liegen nebeneinander. Über uns dreht sich der Deckenventilator; die Flügel sind aus dunklem Holz. Du magst es nicht, nach dem Sex berührt zu werden. Daran werde ich mich nie gewöhnen, aber ich respektiere es, sehe dich nur an. Selbst das hältst du kaum aus, schließt deine Augen. »Du willst immer, dass es wie beim ersten Mal ist, Roberto.«
»Ja, kann sein.«
Als ich dich das erste Mal sah, ahnte ich nicht, dass auch du ein besonderes Verhältnis zu Wasser hast. Ich sah nur dich, wir gingen beide in die Knie, lasen die Scherben auf. Du hattest mich angestoßen, bei Luigi. In seinem zwölf Quadratmeter großen Kaffeehaus stießt du gegen meinen Ellenbogen; meine Espressotasse fiel zu Boden. »Tut mir leid«, hast du gesagt. Ich wusste sofort, ich will dich wiedersehen, egal wo. »Ich hab's eilig«, hast du behauptet. Angeblich warst du unterwegs; ich hatte keine Ahnung, wohin, wollte, dass du bleibst. Du wolltest den Kaffee bezahlen. »Wir sehen uns wieder«, hast du versprochen.
»Ja, aber wann?«
Du hast gelacht, ich konnte unmöglich nachgeben. Ob ich das Seepferdchen kenne, wolltest du wissen. Keine Ahnung, nein, Seepferdchen, ausgerechnet, nein, natürlich kannte ich das nicht. Ich sollte dich dort treffen, in acht oder neun Stunden. So lange konnte ich auf keinen Fall warten. Ich suchte im Netz nach Seepferdchen, stieß auf eine Gaststätte im Kombibad Seestraße. Na gut, dachte ich, ich kann da rein. Es ist nicht das Schwimmbad; es ist die Gaststätte. Ich setzte mich an einen Tisch mit senfgelbem Tischtuch. Durch eine kinoleinwandgroße Glasscheibe guckte ich in die Schwimmhalle. Ich fing an zu schwitzen. Es roch nach Filterkaffee und Frittierfett, Pommes und Buletten, Bier und Fanta. Du standst am Beckenrand, in roten Shorts, obenrum ein navyblaues T-Shirt. Ich konzentrierte mich auf die Tätowierung an deinem rechten Arm, Rosen vielleicht, dachte ich. Um deinen Hals hing ein Band mit Trillerpfeife. Ich hielt mir die Ohren zu; da hast du mich entdeckt. Deine Gesten waren eindeutig. Du wolltest, dass ich zu dir in die Halle komme. Im Kombibad Seestraße kann man alles leihen, Badehose, Seife, Handtuch, Latschen. Es gibt drei Becken, eins mit Fünfzig-Meter-Bahnen, eins mit Sprungturm und eins für Kinder. Selbst das Kinderbecken kam für mich nicht in Frage. Ich strich das Tischtuch glatt, pulte am weichen Wachs der Kerze, die vor mir flackerte. Ich versuchte zu lächeln und meinen Kopf ganz langsam von rechts nach links und wieder zurückzudrehen. »Nein«, sollte das heißen. »Okay«, hast du gesagt oder gedacht, zumindest sah es so aus. Du musstest deiner Arbeit nachgehen. Ich klebte am abgeriebenen Polster meines Stuhls fest. Ein paar Jungs, kaum älter als vierzehn, sprangen vom Rand ins Wasser. Das ist nicht erlaubt. Dein Pfiff entging niemandem. Kleinlaut zogen sie sich aus dem Becken. Mittendrin standen ältere Damen, dazwischen zwei alte Herren. Alle trugen Hauben auf ihren Köpfen; ihre fahle Haut warf Falten. Sie hielten bunte Rollen in den Händen; ihre Füße tanzten unter Wasser. Drei Finger deiner rechten Hand streckten sich in die Höhe. Drei Minuten oder drei Stunden oder aller guten Dinge sind drei, sollte das bedeuten. Ich konnte unmöglich noch drei Stunden im Seepferdchen bleiben. Trotzdem wartete ich auf dich. Dreißig Minuten später standst du vor mir oder neben mir. Du hast dich zu mir gesetzt, deine Haare waren noch nass.
»Willst du gar nicht wissen, wie ich heiße?«, hast du gefragt.
»Robert Böger«, habe ich mich vorgestellt. So hat es angefangen. So fängt es immer wieder an. Ich sehe dich an und sage deinen Namen. »Sascha.«
Du öffnest deine Augen, der Ventilator kreist über uns, wirft Schattenbilder an die unverputzten Wände. »Spielen wir das erste Mal?«, fragst du, und dann schlafen wir noch einmal miteinander, und es ist jedes Mal anders. »Das ist der Grund, warum ich immer noch mit dir zusammen bin, Roberto.«
Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Mir wird heiß; mein Herz klopft.
»Nimm nicht immer alles so ernst«, lachst du und legst eine Hand auf mein Gesicht.
Die Austernpilze in Weißwein sind längst kalt; die Gemüselasagne schrumpelt im Ofen vor sich hin. Wir sitzen nebeneinander auf der Couch, blicken aus dem Panoramafenster über den Antennenwald, das Meer der Satellitenschüsseln hinweg. Du nimmst mein Handy, siehst dir die unbearbeiteten Bilder aus Athen und Lagos an. Was mit dem Mädchen wird, Christina, wann sie zurück zu Dimitris und Eleni kann, willst du wissen. Ich weiß es nicht. Du nickst, hast genug gesehen. Du möchtest raus, möchtest Hokey-Pokey-Eis. Wir laufen Richtung Pappelallee. Ich hole einen Sechser-Träger aus Tamers Spätkauf. Wir setzen uns auf eine Bank, sehen uns die Menschen an. Es geht mir gut; du bist meine Familie. Familie sucht man sich aus, nur bei den Blutsverwandten geht das nicht.
Mein Handy klingelt. »World Water Ltd.« erscheint auf dem Display. Ich habe Feierabend, nehme das Gespräch trotzdem an, ist immerhin mein wichtigster Sponsor. Die CEO persönlich ist dran. »Roberto? Hast du einen Moment?«
»Ja.«
»Du kommst doch aus Lüren, oder?«
»Ja. Wieso?«
Ob ich mich an die Güthoff-Quelle erinnere, fragt sie mich. Natürlich erinnere ich mich an die Güthoff-Quelle. Güthoff Still, Güthoff Medium, Güthoff Classic. Stand in jedem Lokal auf der Karte, in jedem Supermarkt und Kiosk im Regal. Die Güthoffs lebten in einem riesigen, weißen Haus; das war doppelt so groß wie unser Bungalow und hatte ein wellenförmiges schwarzes Dach. Eine Mauer führte um das Anwesen herum; hinter der Mauer waren Hunde. Johannes Güthoff hat sich damals als unser Lebensretter aufgespielt, uns von unserer Schuldenlast befreit. Vielleicht ist das der Grund, warum er als Ehrenbürger im Festsaal des Rathauses an der Wand hängt. Vor einiger Zeit ist ein Flugzeug über dem Indischen Ozean abgestürzt; Johannes Güthoff und seine Frau zählten zu den Passagieren. Das ist das Problem beim Fliegen: die Meere und die Ozeane unter einem und an Land die Seen und Flüsse. Ich erinnere mich vor allem auch an seinen Sohn, Jakob Güthoff. Wir gingen beide aufs Döblin-Gymnasium, waren Freunde. Bis er mich verraten hat.
»Roberto? Bist du noch dran?«
»Ja.«
»Wir verfügen über gesicherte Informationen, dass Dell'Aqua Waterhunter nach Lüren geschickt hat.«
Okay.
»Es geht vermutlich um die Mineralwasserquelle, Roberto.«
Ja. Ist klar, worum es geht. Brabeck. Ich spüre ein Kribbeln in meinen Händen und unter den Armen, Vorboten des Fiebers.
»Wir hatten gehofft, du könntest versuchen, eine mögliche Übernahme der Quelle durch Dell'Aqua zu verhindern und dafür uns ins Spiel zu bringen.«
»Ihr wollt, dass ich nach Lüren gehe?«
»Ja.«
»Ich bin da seit fast fünfundzwanzig Jahren nicht mehr gewesen.«
»Es könnte ein guter Moment sein, um das zu ändern.«
Auf keinen Fall. Dafür gibt es keinen guten Moment, niemals.
»Es wäre ein Heimspiel. Du wärst im Vorteil, meinst du nicht?«
»Nein.«
»Ohne dich macht ein Engagement in Lüren für uns wenig Sinn, Roberto. Denk an deinen Vlog. Es ist eine tolle Geschichte; sie wäre persönlich.«
Es ist immer persönlich.
»Roberto?«
»Ja?«
»Überleg es dir. Viel Zeit bleibt nicht.«
Das kann sie vergessen, den Köder schlucke ich nicht. Du kratzt deinen Eisbecher aus, schiebst dir einen letzten Löffel Crunchy Peanut in den Mund. Du hast Lust auf Pizza, behauptest du, kannst immer essen. Man sieht es dir nicht an, weil du ständig in Bewegung bist, jede Kalorie verbrennst, egal wie viele du dir zuführst, aber die Zia hat schon zu. Du fragst nicht nach dem Gespräch. »Bist du müde?«, fragst du,
Ja. Egal. »Nein.«
Du lachst, möchtest ausgehen, tanzen, hast dich verabredet. Ich soll mitkommen, von mir aus. Die meisten deiner Freunde und Freundinnen kenne ich; sie arbeiten mit dir zusammen. Wir begrüßen uns; gleich ist zu viel Wasser um mich herum. Ich sehe dich mit ihnen und tauche unter. Ihr schwimmt und treibt im Meer, in Seen, in Flüssen, überall da, wo ich verlorengehe. Ich flüchte mich zur Bar, blicke in mein Gin Tonic-Glas, könnte sein, dass selbst das irgendwann zu tief wird. Du lässt mich nicht entkommen, nimmst meine Hand, ziehst mich auf die Tanzfläche, wo du glücklich bist, denke ich, weil du loslässt und tanzt und lachst und flirtest. Ich mache mit, das freut dich. Als ich sage, ich muss gehen, findest du es schade. »Bleib, solange du willst«, sage ich. Das tust du sowieso, deshalb lachst du auch, lachst schon mit den Freunden, Freundinnen, Schwimmern und Strömungsretterinnen.
Ich laufe durch die Stadt, die fröhlich, aber völlig ausgetrocknet ist. Man sieht es nachts nicht. Nachts freuen sich alle, weil es warm ist, wir draußen leben können. Zu Hause setze ich mich auf den Balkon. Du hast die Kräuter und Blumen vertrocknen lassen. Vielleicht waren sie auch einfach nicht zu retten. Ich öffne den Rechner, surfe im Netz, lande bei einem Blog, der sich Lüren-Inside nennt und über dreitausend Follower hat. Alle Einträge stammen von einem Humphry Güthoff. Der nächste Güthoff also, Jakobs Sohn. Auf seinem Profilfoto sieht er aus, als wäre er höchstens vierzehn. Schwer vorstellbar, dass ein 14-Jähriger solche Texte schreibt. Die Welt zieht sich zusammen, zumindest meine. Du tauchst hinter mir auf; ich rieche deinen Party-Atem, möchte ihn trotzdem schmecken. Du setzt dich neben mich, holst deinen Vaporizer raus, rauchst Haschischöl, reichst mir den Verdampfer.
»Nein, lieber nicht.«
»Was gibt es Neues in Lüren?«
Ich hätte es wissen müssen; so leicht lässt du mich nicht entkommen. Ich klappe das Notebook zu.
»Angst vor Dämonen?«
»Was für Dämonen?«
»Dein Vater?«
»Der ist Geschichte, Sascha.«
»Ach ja?«
»Ja.«
»Dann kannst du ja hin.«
»Können wir das Thema wechseln, bitte.«
Du wechselst das Thema; ich wünschte, ich hätte nicht gefragt. Sie haben dir heute Abend angeboten, den Sommer über in St. Peter-Ording zu arbeiten. »Als Rettungsschwimmerin«, sagst du, und ich fange an zu zittern.
»St. Peter-Ording ist am Meer, Sascha.«
»Ja.«
»Dann kann ich dich da nicht besuchen.«
»Stimmt, das wird wohl leider nicht gehen.«
»Keine Sorge, ich werde dich nicht bitten, abzulehnen.«
»Aber du würdest gerne.«
»Ja, vielleicht.«
»Du bist auch eher selten zu Hause, Roberto.«
»Zu Hause ist da, wo du bist.«
»Das sage ich ja. Da bist du eher selten, und ich liebe dich trotzdem, oder?«
Ich schätze, das stimmt.
»Ich werde zusagen«, entscheidest du. »Ist nur für drei Monate.«
Drei Monate am Meer, das halte ich nicht aus.
LÜREN-INSIDE
HUMPHRY
Ich bin Humphry, der letzte Güthoff. Noch einen braucht die Welt meiner Ansicht nach nicht. Papa sieht das sicher anders, Jakob Güthoff, der vorletzte oder besser drittletzte Güthoff. Er ist unter mir im Treppenhaus. Ich kann ihn hören, weil ich auf der Suche nach meinen Sneakers bin. Papa lädt jemanden ein, noch mit hochzukommen. Keine Ahnung, wer gemeint ist. Da ist nur die Stimme einer Frau, die sich entschuldigt. Sie hat Mama zwar versprochen vorbeizuschauen, sagt sie, aber Papa soll ihr ausrichten, dass sie es heute doch nicht mehr schafft. Ich höre sie »Ciao!« rufen, dann schließt die Lifttür.
»Ciao«, sagt Papa und verschwindet wieder in seiner Büroetage.
Ich ziehe die Sauerstoffflasche auf dem Rollgestell hinter mir her, bis in mein Zimmer, weil ich noch bloggen will. Auf meinem Blog Lüren-Inside schreibe ich über Sachen, über die ich schlecht reden kann, Humphry-Inside, sozusagen. Die Flasche ziehe ich hinter mir her, weil ich ständig zu wenig Sauerstoff im Blut habe. Das Gewebe und die Bläschen in meiner Lunge haben sich irgendwann entzündet. Das war eine allergische Reaktion, da sind dann Narben daraus geworden, die sehen aus wie Pocken. Man kann es nicht rückgängig machen, aber schlimmer wird es in meinem Fall auch nicht mehr. Ist so etwas wie Stillstand, also habe ich enormes Glück gehabt; das ist das Gute daran. Sonst würde ich nämlich irgendwann ersticken, weil immer mehr Narben dazukämen, und irgendwann wäre die komplette Lunge dicht, und dann wäre Schicht im Schacht. Ich bekomme trotzdem schlecht Luft, bin ständig müde und habe nie Hunger, deswegen ist Sauerstoff mein ständiger Begleiter. Ich habe große Flaschen, kleine Flaschen, und zu Hause gibt es eine Tankstelle zum Auffüllen. Also, ich habe zwar eine Sauerstoffbrille in meiner Nase klemmen und ständig O2 im Gepäck, aber es gibt keinen Grund, mich zu beklagen. Mir geht es gut, und ich will unbedingt noch etwas schreiben, das ich posten kann, bevor Mama mit dem Hund nach Hause kommt. Dem haben sie heute ein Geschwulst am Rücken wegoperiert. Wir wissen noch nicht, ob es gutartig war oder nicht. Ich höre den Aufzug in der Wohnung landen; das müssen sie sein. Bei uns landet ein Aufzug nämlich direkt in der Wohnung. Den können nur wir benutzen. Oder Gäste. Manchmal kommen nämlich Gäste in unseren Palast unterm Himmel. War doch nicht Mama mit dem Hund, sondern Papa. Er geht nicht mal zwei Treppen zu Fuß, aber im Gegensatz zu Mama kommt er wenigstens nicht gleich zu mir ins Zimmer gerannt, sondern lässt mich in Ruhe, wenn meine Tür zu ist. Deswegen sitze ich jetzt in aller Ruhe am Schreibtisch und gucke mir einen fliederfarbenen Himmel über tannengrünen Tannenwipfeln an. Kann sein, dass ich zwei Minuten so sitze und gucke, können aber auch zwanzig sein. Manchmal verliere ich die Zeit. Da ist dann ein Loch, und ich hocke davor, vor diesem Loch und weiß nicht, was drin ist. Jedenfalls ist Mama jetzt im Car-Lift auf dem Weg nach oben. Wir haben nämlich auch einen Lift fürs Auto. Keine zwei Minuten später geht meine Tür auf. Mama.
»Ich habe Abendessen mitgebracht, Humphry, kommst du bitte.«
»Ja, gleich.«
Dass ich arbeite, ist ihr egal. Ich soll mir die Hände waschen, sagt sie noch, weil sie das immer sagt. Den Blog kann ich vergessen. Ich stöpsele mich aus und lasse die Flasche in meinem Zimmer. Ich habe auch ein eigenes Bad, so wie Mama und Papa. Die schlafen in der Etage über mir. Wir haben nämlich zwei Etagen, eine direkt unterm Himmel und eine darunter, wo die Dachterrasse ist. Was irgendwie komisch oder unlogisch ist oder aber eine architektonische Meisterleistung. Papa hat die Güthoff-Höfe mit entworfen, obwohl er kein Architekt ist. Er ist trotzdem enorm stolz auf seine Höfe. Er hat keinen richtigen Beruf, deshalb kann er alles machen, aber ihm macht das voll zu schaffen, glaube ich, so ein Leben als Privatier.
Der Hund liegt auf seinem Schaffell und schnarcht. Es scheint ihm soweit ganz gut zu gehen. Aber auf seinem Rücken ist eine kahle rosa Stelle, über der verläuft eine schwarze Naht, die man nur sieht, weil der Verband verrutscht ist. Wo ich meinen Sauerstoff gelassen habe, fragt Mama. Sie küsst mich auf die Backe und hinterlässt einen Spucketropfen. Sie will, dass Papa sich um den Verband vom Hund kümmert.
»Ich war schon vierzehn Stunden angeschlossen«, erkläre ich ihr. »Die restlichen zwei erledige ich nachher, versprochen.«
Mama traut mir nicht, das sehe ich ihr an, aber sie sagt nichts. Als sie wegguckt, wische ich mir mit der Hand über die Backe, und dann wische ich die Hand an meinem Hosenbein ab. Es gibt Sushi und Verpackungsmüll. Papa soll die Misosuppe in die Mikrowelle stellen und einen Weißen aufmachen. Ich muss den Tisch decken und alles auf Teller legen, damit niemand den Müll angucken muss. Unser Esstisch steht in der Küche, die ist in unserem Wohnzimmer, das ist ungefähr so groß wie die Sporthalle in unserer Schule. Mama fragt, ob Chiara Mendez sich gemeldet hat.
»Nein«, sagt Papa.
Den Namen Chiara Mendez kenne ich; das ist eine Waterhunterin von Dell'Aqua. Voll bedenklich, dass eine Waterhunterin bei uns in Lüren auftaucht.
»Wir haben zwei Semester lang zusammen studiert«, erklärt mir Mama, und dass sie sich leider aus den Augen verloren haben.
»Du hast bei ihr gewohnt. Ihr standet euch damals ziemlich nahe.«
»Das stimmt.«
»Hat sie dich nicht auch bei deiner Dissertation unterstützt?«
»Nein.«
»Ich dachte …«
»Jakob, bitte. Das sind alte Geschichten. Ich möchte nicht mehr darüber reden.«
Mama will, dass ich mir von den Avocado-Maki nehme und legt sechs Stück auf meinen Teller. Onkel Aaron hat Frau Mendez auch schon kennengelernt, sagt Mama. Sie hat die Güthoff-Quelle besichtigt. Papa möchte, dass ich ihm den eingelegten Ingwer reiche. Sobald er den Namen seines Bruders hört, schaltet er auf Durchzug. Onkel Aaron ist der vorletzte Güthoff, obwohl er nur ein halber ist. Deshalb ist er Papas Ansicht nach gar keiner. Er kennt seinen Bruder auch erst, seitdem er achtzehn ist, bis dahin war Onkel Aaron Opapas Geheimnis.





























