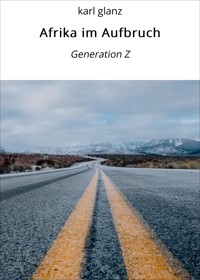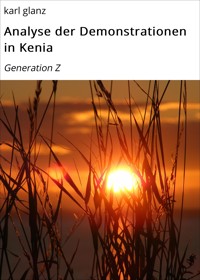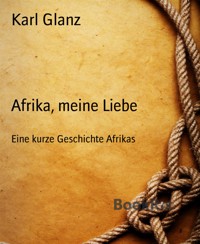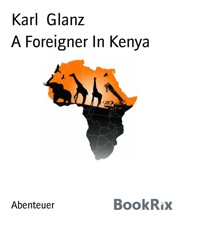2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Hereros hatten große Landflächen an die deutschen Siedler verkauft. Die Hereros nutzten aber immer noch die Weiden für ihre Rinder. Die Siedler wehrten sich, indem sie die Rinder der Hereros erschossen. Es kam immer öfters zu Schießereien zwischen den Siedlern und den Hereros. Es kam schließlich zu Übergriffen an den Siedlern, dass kostete 150 Einwanderer das Leben. Am 12. Jänner 1904 brach der Hereroaufstand aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
karl glanz
Südwest
Der Völkermord an den Hereros
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Südwest
Impressum neobooks
Südwest
Südwest
Von
Karl Glanz
1
Es ist immer schwierig den Anfang zu finden. Ich weiß auch nicht, was an meiner Geschichte interessant ist und was nicht.
Ich könnte jetzt von Anfang an erzählen, aber diese Geschichte, die ich hier erzählen soll, wird dann furchtbar lang.
Alles wird sich um Afrika drehen. Meine Geschichte, ist die Geschichte von Südwest Afrika. Was dort geschehen ist, dass werde ich hier erzählen, denn ich war dabei. Ich habe alles miterlebt, mitgemacht und durchgemacht. Vieles was ich hier erzählen werde, ist nicht bekannt, da es kaum jemanden gibt, der darauf stolz ist. Was ich dort gemacht habe, was meine Kameraden dort gemacht haben, dass werde ich hier erzählen, auch wenn es mir schwer fällt über dies Ereignisse zu reden.
Was ich erlebt habe, dass ist in meinem Kopf verborgen. Ich wollte es vergessen, aber es geht nicht. Immer wieder werde ich daran erinnert. Es sind Tantalus Qualen die mich innerlich zerfressen.
Ich fange einmal an zu erzählen.
Mein Vater war ein Metzger, meine Mutter half ihm in seinen Laden. Viel zu tun war nicht, denn wir lebten in einen kleinen Dorf, das von Bauern bewohnt war und die waren meist Selbstversorger.
Reich waren wir nicht, wir kamen einigermaßen über die Runden.
Ich hatte auch noch zwei kleinere Schwestern.
Die Schule war für mich nicht so berauschend. Ich liebte es mehr in der Natur zu sein, als in einem Schulzimmer zu sitzen.
Die Schule ging so recht und schlecht vorbei, und ich war froh, dass sie vorbei war. Ich wollte Briefträger werden, manchmal auch Kutscher, Fahrer, dass gefiel meinen Eltern sehr. Mein Vater, der Metzger war, sagte immer, dass mein Berufswunsch Zukunft haben würde, denn die Metzgerei brachte nur wenig Geld ein und er hatte doch viel Arbeit damit.
Lange hielt dieser Berufswunsch nicht, nur einige Wochen später wollte ich Seemann werden und nach Amerika segeln. Das regte meine Mutter sehr auf und sie weinte bitterlich.
Endlich würde ich aus der Schule entlassen. Es war wie Weihnachten und Neujahr zusammen, so froh war ich.
Ich begann eine Lehre als Schmied. Das war zwar kein Berufswunsch von mir gewesen, aber ein Zufall wollte es so. Die Zeit war für Schmiede genau richtig, die Auftragsbücher waren voll und es wurde nach Schmieden gesucht. Das war eine harte Arbeit, aber sie gefiel mir und so blieb ich bis zu meinem Berufsabschluss.
Ich überspringe nun etwas, dass ist nicht so wichtig.
Dann kam das Militär. Zufällig erfuhr ich vom Seebataillon und es erschien mir Recht interessant zu sein in diesem Bataillon zu dienen. Damals hatten wir noch Überseekolonien, sollte dort eine Aufstand ausbrechen, dann würde das Seebataillon als erster zum Einsatz kommen. Und so entschied ich mich bei den Fünfundachtzigern zu dienen, da dieses Seebataillon Dreijährig-Freiwillige annahm.
Meine Entscheidung musste ich meinen Vater beibringen. Ich hatte schon etwas Muffensausen als ich zu ihm ging. Er hatte es bis zum Unteroffizier gebracht, dass hatte ihm stolz gemacht. Meine Entscheidung gefiel ihm, dass konnte ich gleich an seinem Gesicht erkennen.
Er meinte nur: "Sag es deiner Mutter, die wird nicht glücklich sein, aber was soll's! Wir müssen unseren Weg gehen. Sie wird dich vermissen!"
"Sie hat doch noch die beiden Mädchen!", meinte ich.
"Du gehörst auch zur Familie und du bist der Älteste, du musst unseren Namen weitergeben."
Das hatte ich verstanden was er meinte.
Meine Mutter war nicht froh über meinen Entschluss, aber schließlich fügte sie sich, allerdings unter viel Tränen. Sie wusch meine Wäsche, einiges war neu, die hatte sie zum Abschied gekauft. Ich war gut ausgestattet und so fuhr ich nach Kiel, denn dort war das Lager der
Fünfundachtzigsten Seebataillon der Dreijährig-Freiwillige.
Ich diente inzwischen zwei Jahre. Der Dienst war nicht schwer, es war, mehr angenehm als schwierig. Der Leutnant, der uns befehligte war ganz passabel, er verhielt sich wie ein Mensch, er versuchte uns beizubringen, wie wir, in einem möglichen Kampf, überleben können.
Es war im Februar 1904, da erfuhren wir, dass die Schwarzen die Weißen in Südwestafrika überfallen hatten.
Die Nachricht wurde mir von einen guten Kameraden überbracht.
"Was ist geschen?", fragte ich fassungslos.
"Die Schwarzen haben unsere Leute in Südwest-Afrika überfallen und viele niedergemetzelt. Frauen und Kinder!"
"Alles Weiße?"
"Alles deutsche Siedler. Aus ganz Deutschland!"
Ich muss gestehen, dass ich im ersten Moment nicht wusste wo Südwest-Afrika ist, aber ein kurzer Blick auf die Landkarte brachte die Erinnerung wieder.
"Was denkst du, was wird geschehen?", fragte er mich.
Lange brauchte ich nicht nachzudenken. "wir müssen da hin!"
"Genau!", sagte er.
Und wirklich, einige Tage später war es dann soweit. Am Appellplatz kam der Mayor und hielt eine Rede. Sinn der Rede war, Freiwillige für den Einsatz in Südwest-Afrika zu rekrutieren. Da hätte der Mayor ein leichtes Spiel mit uns, wir traten fast geschlossen vor und meldeten uns freiwillig.
Wir wurden für den Einsatz ausgerüstet, dass machte uns stolz und wir, dass heißt, ich und meine Kameraden flanierten durch die Stadt, wo uns die Menschen bewunderten und zunickten.
Dann kam der Abschied. Der war etwas schwierig. Die Eltern, Geschwister kamen um von uns Freiwilligen Abschied zu nehmen. Dieser Abschied hatte etwas von einem Volksfest, da spielte Musik, es wurde getanzt, gelacht, kaum jemand der daran dachte, dass einige von uns in Afrika bleiben könnten.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit der Bahn nach Wilhelmshaven, dort wartete das Schiff auf uns.
Es war ein trüber Tag, nass und kalt. Es versprach kein schöner Tag zu werden. Möwen kreisten über den Hafen. Ein Hafen schläft nie, kommt nie zur Ruhe, auch wenn das von Besuchern oft so empfunden wird. Schiffe kommen und gehen, werden entladen und beladen, kommen von der See oder fahren hinaus. Schlepper und Lotsen müssen bereit sein. Von weit hörten wir Soldaten eine Schiffssirene. Matrosen gingen gemächlich den Kai entlang. Niemand schien es wirklich eilig zu haben. Die Dockarbeiter luden und entluden die Schiffe. Der Reif war an den Schiffen gefroren, er lag wie Puderzucker auf den eisigen Blanken. Ein ruhiger Tag im Hafen von Wilhelmshafen.
Da lag sie, die "Lucie Ermanne"! Ein wunderschönes Schiff! In Reih und Glied traten die Soldaten an. Noch einmal wurden wir gemustert, dann wurde durchgezählt. Als alles erledigt war, gingen wir auf das Schiff.
400 Soldaten und 25 Offiziere gingen auf das Schiff. Die Mannschaft war frohgemut und guter Dinge, dass konnte ein jeder an den fröhlichen Gesichter der Seeleute erkennen. Viele Soldaten hielten es für ein Abenteuer, dem sie zueilten. Einige wollten ihr Vaterland verteidigen, andere ihren bedrängten Kameraden zu Hilfe kommen. Die Stimmung unter den Soldaten, wie unter den Offizieren, war kriegerisch. Sie freuten sich auf den ersten Kontakt mit dem Feind. Der Feind war weit entfernt. Drüben, in der Kolonie Südwest-Afrika, war ein blutiger Aufstand ausgebrochen. Den Soldaten wurde mitgeteilt, dass mitten im Frieden deutsche Siedler, Farmer und wehrlose Frauen von einem großen Eingeborenenstamm, den Hereros, ermordet wurden. Das musste gerächt werden! Es war ein schuldloses Blut, das da vergossen worden war; die von einer Übermacht bedrängten Schutztruppen verlangten nach Ersatz und Hilfe!
Deutsch-Südwestafrika war weit entfernt. Die Schiffsreise sollte 24 Tage dauern und das war nicht immer angenehm.
Die "Lucie" lag tief im Wasser. Sie hatte viel geladen: Signalgeräte, tausende von Kisten mit Konserven, Früchten, Backobst, Milch, Wein, Tee; Säcke mit Reis, Hafer, Kaffee; Ballen mit Zelten, Uniformen, Decken, Wäsche, Feldflaschen, Kochgeschirren,; Kanonen, Maschinengewehre, Lafetten, Pompoms, Schrapnells, hunderttausende von Patronen; es gab da noch ganze acht völlig fertige Lokomotiven mit Tendern. Es darf auch nicht auf die 14 Pferde vergessen werden, die sich im Frachtraum befanden.
Wir wurden in einem Frachtraum untergebracht. In den Mannschaftskojen, die sich im vorderen Teil des Schiffes befanden, herrschte kein Wohlgeruch. Wir mussten zwei kurze Treppen hinunter steigen, kamen in einen ziemlich großen, niedrigen Raum, der so dicht mit Bettstellen belegt war, dass sie sich wunderten. In zwei Stockwerken standen sie über- und unter- und dicht beieinander. Sehr schmale Gänge liefen zwischen ihnen hin und an den Wänden entlang. Da stellten und legten eir über unseren Bett alles hin, was wir hatten: Gewehr, Tornister und Kleidersack. Oft standen wir an den Bullaugen und sahen aufs Meer, und waren sehr lebhaft und guter Dinge, wie immer in einem neuen Quartier; und wurden nur fortwährend durch das Zittern, das vom Gang der Maschine her durch das ganze Schiff ging, erinnert, dass dies uns in die weite Ferne trug.
Alles war sehr eng und ein jeder von uns suchte sich sein Bett aus. Kurz gesagt, wir richteten uns ein, so gut es eben ging.
Noch einmal ging ich an Deck um frische Luft zu atmen und um den Hafen zu betrachten. Ich dachte nicht daran, dass es eine Möglichkeit geben könnte nicht zurückzukehren, keiner von uns dürfte diesen Gedanken gehabt haben. Wir haben ihn vielleicht verdrängt oder wir waren zu jung um daran zu denken.
"An was denkst du?" fragte mich ein Kamerad, der unbemerkt von hinten an mich herangetreten war.
"Ich sehe mir noch einmal den Hafen an."
"Ist dein Herz schwer?"
"Irgendwie schon. Südwest-Afrika ist weit weg. Wir werden vierzehn Tage auf See verbringen."
"Das kann ungemütlich werden."
"Es wird ganz sicher ungemütlich werden. Es ist Winter und da gibt es viele Stürme."
"Es wird schon gut gehen " sagte er und verschwand.
Trotzdem "Lucie" so schwer beladen war, machte ihr doch der Atlantik und der Sturm zu schaffen. Sie schlingerte und stampfte schwer. Kaum ein Passagier blieb dabei ungerührt. Die Soldaten wälzten sich auf ihren Kojen herum, stöhnten und fluchten was das Zeug hielt. "Lucie" kannte keine Gnade mit diesen wehrlosen Geschöpfen, sie bewegte sich nach vorne herunter, der Bug stieß tief in das Wellental hinein, dann ein Dröhnen, wie als würde das Schiff stöhnen, dann ein Poltern, die Schiffsschraube quirlte in der Luft, "Lucie" drehte sich nach rechts, dann nach links, die Schiffsschraube war wieder im Wasser, dann noch ein kleiner Stoß, die Fahrt ging weiter.
Die Offiziere hatten es etwas besser. Ihre Kabinen lagen Mittschiffs, da waren die Schwankungen nicht so stark zu spüren, wie bei den Soldaten. Aber auch sie mussten leiden! Bei Tisch ließen sich die Herren Offiziere nichts anmerken, wie schlecht es ihnen ging, so mancher stand vom Tisch auf, kreidebleich, er versicherte ernsthaft, dass ihm nicht schlecht sei, dass er nur etwas vergessen hatte um dann mit raschem Schritt sich zum Ausgang zu bewegen.
Für manchen von uns war die Fahrt eine richtige Tortur! Solange das Meer ruhig war, ging es einigermaßen, aber kaum bewegte dich das Schiff, begann zu rollen, da kamen viele von uns zur Reeling und fütterten die Fische.
Das Meer kann so friedlich sein, so schön, wenn es von der "Lucie" durchkämmt wird. Es ist so schön, wenn die Sonne scheint und die Sonnenstrahlen vom Meer reflektiert werden. Besonders schön sind die Sonnenaufgänge und Untergangs, das Meer verfärbt sich dann rot.
Am Beginn unserer Reise hatten wir noch Mitfahrer, Seemöven, die sich an dem Mast ausrasten bevor sie weiter flogen oder zurück ans Land zurückkehrten. Einige von uns dürften diese Seemöven beneidet haben, denn viele hatten, von der Seefahrt, schon nach kurzer Zeit, die Nase voll.
Die Fahrt wurde bald stürmisch. Der Sturm wurde immer stärker und nichts blieb an seinem Platz, alles was nicht festgeschraubt war rutschte, flog herum. Ganz plötzlich hob und schob sich ganz plötzlich der Boden schräg unter unseren Füßen, während im gleichen Augenblick ein mächtiges Krachen, Klirren, Fallen und Schreien von überall her kam und wir übereinander und über das Bett fielen, mit Armen und Beinen nach allen Richtungen Hilfe und Stützen suchten. Mühsam kamen wir wieder hoch und griffen nach den eisernen Stangen, welche die Bettstellen trugen, und torkelten, indem nun die andere Seite des Schiffes gewaltig hoch fuhr, gegen die andere Bettreihe, strebten aus den Bettreihen heraus, als wenn da Rettung wäre. Ein Druck lag schwer auf den Köpfen, und ihr Mägen stiegen und stiegen zum Hals hinauf. Unser ganzer Mut und all unsere Lebenslust war weg, und Angstschweiß tropfte uns von der Stirn. Da ging wir taumelnd und kläglich den Gang wieder zurück und warfen uns auf die Betten. Zwei Offiziere verletzten sich. Das Wetter war kalt, hell und windig. Sie sahen kleinere Schiffe auf den Wogen auf- und niedergehen; aber unser großes Schiff rührte sich viel, und es waren nur mehr seekrank. Wir konnten es nicht ertragen, das lange, lange Deck entlang zu sehen, wie es sich langsam ein wenig hob und dann wieder hinunterging. Es erschien uns so unvernünftig und unglaublich, und es legte sich ein Druck auf den Vorderkopf und auf den Leib. Aber als wir aus dem Englischen Kanal heraus und in das Gebiet der Biscaya kamen, da wurde es plötzlich schlimm.
Alles ist Gewohnheit, so auch die Seefahrt, und nach einigen Tagen des Sturms legte sich die erste Verzweiflung und eine gewisse Ratlosigkeit stellte sich ein, 'da kann man halt nichts machen'. Das war eine gute Einstellung! Sie half uns diesen Sturm zu überleben.
Einige Soldaten standen des öfteren im Windschutz der ersten Kajüte an der Reling und sah nach der Küste hinüber. Sie sahen aber im Dunkeln nichts weiter, als von den Lichtern des Schiffes einen gelblichen, wirren Schein in schwarzen, schwer rauschenden Wellen, in der Ferne einige stillstehende Lichter, wohl von Leuchttürmen oder Feuerschiffen, am Himmel die Sterne. Da wurden sie von dem Gedanken bedrückt, dass sie fortgebracht wurden und sich nicht dagegen wehren konnten, in der Fremde vielleicht Furchtbares erleben mussten.
Einige wurden krank und der Stabsarzt musste nach ihnen sehen. Es war nicht so schlimm, die Kranken waren bald wieder gesund.
2
Wir führen nach Süden, dass hatte den Vorteil, dass es wärmer wurde und wir es vorzogen an Deck zu sein, als uns unter Deck vor der kälte zu verkriechen.
Die Offiziere hatten den Einfall mit uns zu trainieren. Dazu wurde an Deck ein Balken angebracht, darauf eine Zielscheibe befestigt, auf die wir schossen.
Am Abend saßen wir auf Deck herum, unterhielten uns, reinigen unsere Gewehre, wuschen unsere Kleider, erzählten Geschichten von unserer Heimat, kurz gesagt, wir hatten genügend Zeit. Einige fingen an kleine Theaterstücke zu spielen, die wir ganz gern hatten.
Ich, für meinen Teil, ich habe es genossen am Bug des Schiffes zu stehen um den Sonnenuntergang zu bewundern. Ob wir wollen oder nicht, immer rast ein Gedanke durch unser Gehirn, selbst dann, wenn wir versuchen nicht zu denken oder wenn wir schlafen. Wir denken immer, ob wir wollen oder nicht! Was immer noch im Dunkeln ist, wie entsteht ein Gedanke? Bei mir, am Bug der "Lucie". Wir vergessen wieder viel, denn alles was wir aufnehmen in unser Gehirn, braucht nicht abgespeichert werden, weil es keine Bedeutung hat.
Jetzt bin ich von meiner Erzählung etwas angeschweift. Das macht nichts, jetzt werde ich von unseren Hauptmann erzählen, dass ist wichtig, denn er hat eine entscheidende Rolle in Südwest-Afrika gespielt.
Sein Name war Maximilian Bayer. Seine Eltern waren der aus einer alten Offiziersfamilie stammende Generalmajor Stephan Bayer und dessen zweite Frau Julie Heinrich.
Bayer wurde als erstes Kind geboren und hatte eine Schwester. Zwischen 1873 und 1875 befand sich die Familie in Italien, danach wohnte sie in Baden-Baden, in Gotha am Wohnort von Julie Heinrichs Mutter und dann erneut in Baden-Baden, wo Maximilian an einer schweren Augendiphtherie erkrankte. Danach lebte die Familie wieder in Italien. Zunächst auf Capri und anschließend in Venedig, wo Maximilian das Marco-Polo-Gymnasium besuchte. Hier wurde er auch mit der italienischen Kultur und Sprache vertraut. Mit 14 Jahren, der militärischen Familientradition folgend, sein Vater war ja Generalmajor, in die Haupt-Kadetten-Anstalt Groß-Lichterfelde, trat er in Berlin ein. Einige Jahre später starb seine Mutter. Er verließ als Sekonde-Lieutenant mit 18 Jahren die Anstalt. Im Anschluss diente Bayer beim 1. Oberrheinischen Infanterie-Regiment Nr. 97 in Saarburg, danach wurde er zur Kriegsakademie in Berlin abkommandiert. 1901 wurde er zum Generalstab versetzt und 1903 in den Großen Generalstab berufen.
Als in Deutsch-Südwestafrika der Herero-Aufstand ausbrach, meldete Bayer sich freiwillig.
Südwest Afrika ist geprägt durch ständige Auseinandersetzungen und gegenseitige Raubzüge zwischen Herero einerseits und den Nama und Orlam andererseits. Diese kriegerische Entwicklung wird maßgeblich gefördert durch die mit Unterstützung der Missionare ins Land kommenden Händler: sie verkauften neben Alkohol vor allem Schusswaffen und nehmen dafür Rinder in Zahlung. Extreme Handelsspannen und hohe Kreditzinsen lassen die Stämme schnell verarmen und lösen zahlreiche Raubzüge zwischen den Stämmen aus, damit die Häuptlinge ihre Schulden bezahlen können.
Dann kommen die ersten, eine dauerhafte Besiedlung anstrebenden Europäer ins Land. Im Damaraland sowie auch im zentralen Hochland um die Stadt Windhuk herum erwerben deutsche Siedler von den Herero Land für den Aufbau von Farmen. Trotz des zunächst guten Einvernehmens zwischen der deutschen Kolonialverwaltung und den Herero kommt es bald zu Konflikten zwischen den deutschen Kolonialisten und den Herero-Hirten. Dabei geht es häufig um Land- und Wasserrechte, aber auch um die Diskriminierung, ungeahndete sexuelle Übergriffe auf Herero-Frauen, Missionierung, Unterdrückung und Ausbeutung der Einheimischen durch die Weißen. Insbesondere das Jahr 1897 wirkt sich besonders verheerend aus: die von Südafrika kommende Rinderpest und eine große Heuschreckenplage führen dazu, dass fast der gesamte Viehbestandes der Herero verloren gehen. Dies und die von den Händlern forcierten Kreditverkäufe führen zu einer nachhaltigen Verarmung der Herero und zwingen diese zu weiteren Landverkäufen sowie zur Lohnarbeit bei deutschen Farmern.
Diese Konflikte münden im Januar 1904, ausgelöst durch die Ungeschicklichkeit des deutschen Distriktaufseher in Okahandja, Oberleutnant Zürn, in den Hereroaufstand, der unter Führung des Häuptlings Samuel Maharero mit der Plünderung der Stadt Okahandja seinen Anfang nimmt. Nach seinem Ausscheiden aus dem Heer am 31. Januar 1904 wurde er am 1. Februar desselben Jahres im Stab des Führers des Marine-Expeditionskorps für Deutsch-Südwestafrika im 2. Seebataillon eingesetzt.
Und jetzt muss ich doch noch etwas zu diesem Krieg sagen. Dieser Krieg war keineswegs eine geplante Erhebung gegen den Kolonialstaat. Vielmehr ergab sich der Krieg aus einer Reihe von Missverständnissen, die vor allem aufseiten der Verwaltung zu panischen Reaktionen führten. Eine auf die Möglichkeit eines Aufstandes fixierte Paranoia der Siedler sowie eine auf Krieg orientierte Verwaltungsspitze schufen den Boden für massive militärische Aktionen. Konflikte innerhalb des deutschen Militärs führten zudem dazu, dass mehrfach Verhandlungsmöglichkeiten mit den Aufständischen ignoriert wurden, um einen genozidalen Krieg gegen vermeintliche und echte Aufständische fortzusetzen. Zweifelsohne führte das raumgreifende Wachstum der deutschen Siedlergemeinschaft um 1900 zu grundlegenden Spannungen zwischen Siedlern, Verwaltung und indigener Bevölkerung und sicherlich müssen in den Strukturen der kolonialen Expansion die tieferen Ursachen des Krieges gesucht werden. Individuelle Ängste und Schuldgefühle sowie der unbedingte Wille von Einzelpersonen, den Konflikt gewaltsam auszutragen, waren aber schließlich für den Ausbruch des Krieges verantwortlich.