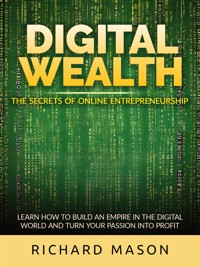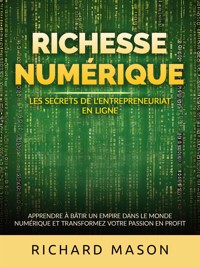4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gelangweilt vom Dünkel seiner englischen Landsleute, bezieht der Maler Robert Lomax ein Zimmer in einem chinesischen Hotel direkt am Hafenkai Hongkongs. Ganz nah am Puls dieser exotischen Metropole will er sein. Hier ist er der Einzige, der für sein Zimmer eine Monatsmiete statt einen Stundentarif bezahlt. Den Barmädchen ist er kein Kunde, sondern schon bald ein Freund und Vertrauter. Für die temperamentvolle Suzie Wong empfindet Robert mehr. Doch es sind nicht nur gesellschaftliche Hürden, die er überwinden muss, bis er das Herz eines Mädchens erobern kann, das sich mit käuflicher Liebe seinen Lebensunterhalt verdient.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Der junge Maler Robert Lomax lebt im Hafenviertel von Hongkong, wo ihm die Barmädchen und ihre Gäste als unerschöpfliche Studienobjekte für seine Bilder dienen. Suzie Wong strahlt mit ihrem erstaunlichen Temperament eine Unschuld des Herzens aus, die Robert schon bald gefangen nimmt. Doch die Gegensätze zwischen beiden scheinen unüberbrückbar …
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Richard Mason (1919–1997) arbeitete bei einem Film-Magazin und später beim British Council. Im Zweiten Weltkrieg wurde er in Birma und Malaya eingesetzt. 1957 entstand sein Roman The World of Suzie Wong.
Zur Webseite von Richard Mason.
Edmund Theodor Kauer (1899–1973) war Übersetzer und Journalist, u. a. viele Jahre als Kulturredakteur bei der Wiener Volksstimme.
Zur Webseite von Edmund Theodor Kauer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Richard Mason
Suzie Wong
Roman
Aus dem Englischen von Edmund Th. Kauer
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1957 unter dem Titel The World of Suzie Wong bei The World Publishing Company, Cleveland.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1958 im Verlag Paul Zsolnay, Wien.
Originaltitel: The World of Suzie Wong (1957)
© by Richard Mason 1957
Für die deutsche Übersetzung:
© by Paul Zsolnay Verlag Wien 1958 und 1986
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Szenenbild aus The World of Suzie Wong (1960)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30660-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.05.2024, 21:16h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SUZIE WONG
Erstes Buch — Die Mädchen1 – Sie wand sich durch das Drehkreuz und mischte …2 – Es war George Wheeler, er war schuld …3 – Ich hatte, als ich zum ersten Mal darauf …4 – Dieser Lunch mit Doris trug sich etwa zehn …5 – Und von nun an liebte Suzie es …6 – Suzie, es ist drei Uhr«, sagte ich. »Und …Zweites Buch — Die Männer1 – Suzie lernte Ben Jeffcoat im Nam Kok kennen …2 – Wenn sie indessen geglaubt hatte, dass Ben seine …3 – Als ich Ben im Kit Kat versicherte …4 – Und von da an hielt Suzie sich streng …5 – Zwei Tage später kam Suzie zu ungewohnter Stunde …6 – Ich wachte am Morgen um neun auf …7 – In der Tat war Ah Tong im Irrtum …8 – Betty Lau gehörte zu jenem Frauentypus, der wohl …Drittes Buch — Die Liebenden1 – Sie wartete an der Straßenecke. Sie stand auf …2 – Die Tage, die nun folgten, waren wundersam glücklich …3 – Diese Polizisten, weißt du, die haben mir arg …4 – Suzie, du siehst, wie gut wir uns als …5 – Das einzige Mädchen im Nam Kok, das schon …6 – Suzie war in den nächsten Tagen sehr glücklich …7 – Suzie, du bist so schön.«8 – Suzie, der Arzt sagt, dass wir, wenn du …Mehr über dieses Buch
Über Richard Mason
Über Edmund Theodor Kauer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Asien
Zum Thema Hongkong
Zum Thema Frau
Zum Thema Schmöker
Zum Thema Großstadt
Zum Thema Liebe
Erstes Buch
Die Mädchen
1
Sie wand sich durch das Drehkreuz und mischte sich unter die Menge, die auf das Fährboot wartete: die Frauen in Baumwollpyjamas, die Männer mit Filzpantoffeln und Goldzähnen. Das Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, und sie trug Jeans, grüne, knapp überknielange Jeans.
Komisch, dachte ich. Ein chinesisches Mädchen in Jeans. Wie sollte man sich das erklären?
Ich beobachtete sie, wie sie einem am Boden hockenden Straßenverkäufer eine Münze in den verbeulten alten Filzhut warf. Der Straßenverkäufer drehte ein Stück Zeitungspapier zu einer Tüte, schüttete Melonenkerne hinein und reichte sie dem Mädchen für seine zehn Cent. Geistesabwesend grub sie die rot bemalten Fingernägel in die Melonenkerne, wandte sich ab und blieb knapp einen Meter vor mir stehen.
Vermutlich die Tochter eines reichen Taipan, dachte ich. Oder eine Studentin. Sie konnte aber auch ein Ladenmädchen sein – so genau weiß man das nie bei den Chinesinnen.
Sie knackte einen Kern zwischen den Zähnen auf, löste ihn aus der Hülse, zerkaute ihn. Neben ihr stand ein alter Mann in einem hochgeschlossenen Chinesenmantel, auf einen Ebenholzstock gestützt, und strich sich seinen weißen schmalen, fußlangen Besenbart. Ein Baby guckte neugierig aus dem Schlingtuch am Rücken einer Frau hervor, seine schwarzen Augen blinkten in kindlicher Selbstgewissheit. Ein junger Mensch mit Hornbrille und einem fadenscheinigen offenen Hemd hielt ein Buch dicht an die Nase. Aufmerksam studierte er ein Diagramm. Das Buch trug den Titel »Aerodynamik«.
Das Mädchen schob einen zweiten Melonenkern zwischen die regelmäßigen weißen Zähne. In diesem Augenblick begegneten ihre Augen den meinen. Da ihr Blick nicht sofort wieder abglitt, sagte ich: »Das möchte ich auch können.«
»Eh?«
»Melonenkerne so aufknacken. Ich hab das nie gelernt.«
»Ich wünsche kein Gespräch.«
Hochmütig wandte sie das Gesicht ab, blickte über die Barriere hinüber, hinter der die Zehn-Cent-Passagiere auf das untere Deck strömten: Kulis in blauen Hosen und zerfetzten Überresten von Hemden, kantonesische Fischerfrauen mit kegelförmigen Strohhüten, in weißleuchtenden Jacken. Sie kaute voll Hingabe.
Ich gab mir Mühe, mich nicht abgewiesen zu fühlen. Nun ja, beim Ansprechen hatte ich mich immer hilflos benommen. Hatte nie die rechte Art.
Dann aber hatte ich den Eindruck, dass sie … tatsächlich, ihre Züge hellten sich auf. Ich bekam einen flüchtigen Seitenblick. Sie überlegte wohl, ob sie mich falsch eingeschätzt hatte.
Jetzt sah sie wieder weg. Noch ein Seitenblick. Dann fragte sie vorsichtig: »Sind Sie Matrose?«
»Ich, ein Matrose? Du lieber Gott, nein.«
Sie schien ein wenig aufzuatmen. »Bestimmt nicht?«
»Keine Spur.«
»Schön, dann können wir reden, wenn Sie wollen.«
»Na, das ist ja großartig«, lachte ich. »Was haben Sie bloß gegen Seeleute?«
»Ich nicht – mein Vater.«
»Ihr Vater hat etwas gegen Matrosen?«
»Ja. Er sagt, die Matrosen sind immer hinter den Mädchen her, richten Unheil an.«
»Und so will er nicht, dass Sie mit Matrosen sprechen?«
»Nein. Er sagt: ›Redest du mit einem Matrosen, so kriegst du Hiebe.‹«
»Nun ja, vermutlich hat er viel Erfahrung.«
»Ja. Sehr viel.«
Das Fährboot legte an, und die Menge drängte vorwärts. Zusammen schoben wir uns über die Laufplanke, wählten Sitze auf einer der Holzleistenbänke auf dem überdachten Oberdeck: Die Fährboote gehörten Chinesen und wurden von Chinesen betrieben, sie arbeiteten schnell: Wir saßen kaum, da rauschte das Wasser schon auf, der Motor pochte, das Boot geriet in leises Schwanken, und wir glitten davon, an der Kowloon-Lände vorbei, vorbei an Frachtschiffen und zusammengedrängten Dschunken, die vor Anker lagen. Vor uns, auf der Insel jenseits des Kanals, lag Hongkong, in einen kaum ein paar hundert Meter tiefen Küstenstreifen gezwängt, mit seinen Miniaturwolkenkratzern im Zentrum; und zu seinen beiden Seiten erstreckte sich meilenweit die Küste, vor der Sampans und Dschunken verankert lagen; dahinter erhob sich steil der Abhang des Peak, der das Volk und die niederen sozialen Ränge allmählich abschüttelte, bis auf den hochgelegenen Terrassen nur mehr ein Gesprenkel weißer Bungalows und Luxusvillen der Elite übrig blieb.
Wir umfuhren die Spitze der Kowloon-Halbinsel, hielten schräg über den Kanal auf Wanchai, den bevölkerungsreichsten Distrikt an der Ostseite von Hongkong, zu. Ich wandte meinen Blick nach dem Mädchen an meiner Seite. Das Gesicht war rundlich und glatt, die Augen bildeten lange schwarze Ellipsen; die Brauen waren so vollendet in ihrer Bogenform, dass sie gezeichnet wirkten – in der Tat waren sie nur flüchtig nachgezogen. Die breiten Backenknochen deuteten auf mongolische Herkunft.
»Sie sind aus dem Norden?«, fragte ich.
»Ja. Shanghai.«
»Aber jetzt leben Sie in Hongkong?«
»North Point.«
»Gute Gegend.« Das erklärte, wieso sie auf dieses Fährboot kam, denn North Point lag hinter Wanchai, ein luxuriöser Vorort gleich hinter den Slums, und der Pier von Wanchai lag North Point am nächsten.
»Schon, aber mir ist Repulse Bay lieber. Das Haus dort ist hübscher.«
»Wollen Sie damit sagen, dass Sie zwei Häuser haben?«
»Vier.«
»Vier?« Ich wusste, dass diese chinesischen Taipans, neben denen die reichsten Europäer wie Bettler wirkten, oft zwei oder drei Wohnhäuser hatten, aber vier waren doch ein Rekord. »Alle in Hongkong?«
»Ja, in Hongkong. Mein Vater ist sehr reich, verstehen Sie.« Sie sah selbstgefällig drein, prahlte in kindlicher Naivität.
»Nun ja, das sehe ich wohl. Und wo sind die anderen beiden Häuser?«
Sie zählte an ihren Fingern, kam auf den dritten: »Nummer drei, Conduit Road. Nummer vier, Peak. Nummer fünf …«
»Doch nicht fünf!«
»Doch, das hätte ich beinahe vergessen, Nummer fünf: Happy Valley. Aber das ist nur sehr klein, verstehen Sie – bloß zehn Zimmer.«
»Aha, kaum der Rede wert.« Ich lachte. »Und wie viele Wagen haben Sie?« Diese Chinesen sammelten Wagen noch eifriger als Häuser.
»Wagen? Lassen Sie mich nachdenken.« Sie zog die Brauen hoch, begann wieder, an den Fingern zu zählen, gab es kichernd auf. »Oh, ich hab vergessen, wie viele Wagen.«
»Ich nehme an, Sie haben doch wohl einen eigenen?«
»Nein, ich bin zu unsicher, um selbst zu fahren. Zu scheu. Aber vor Straßenbahnen hab ich keine Scheu, sehen Sie – mit der Straßenbahn fahre ich gern.« Sie hielt mir die Zeitungspapiertüte mit den Melonenkernen hin. »Möchten Sie einen?«
»Ja, aber ich bringe sie nicht auf. Sie müssten es mich lehren.«
»Versuchen Sie es erst.«
Ich probierte ein paar Kerne, aber sie zerbrachen zwischen meinen Zähnen, wurden hoffnungslos zerquetscht. Meine Ungeschicklichkeit brachte das Mädchen zum Lachen. Sie verbarg das Gesicht hinter der Hand, ihr Pferdeschwanz hüpfte und tanzte, dann beruhigte sie sich wieder, immer noch kichernd, und führte mir vor, wie man es machen musste. Sie knackte einen Kern am Rand auf, schob die Hülse zurück, reichte mir den unbeschädigten Kern.
»Habs genauso gemacht«, sagte ich. »Der Ihre war eben leichter zu knacken.«
»Nein, die sind alle gleich.«
»Dann gebe ichs auf. Wie heißen Sie?«
»Wong Mee-ling.«
»Mee-ling – das ist bezaubernd.«
»Und Sie?«
»Robert Lomax – oder Lomax Robert, wie man hier sagt.«
»Lobert.«
»Nein, Robert mit R.«
»Robert. Und wo wohnen Sie?«
»Nun ja, augenblicklich …«
»Auf dem Peak?«
»Ja … so halbwegs. In einem Boardinghouse. Sunset Lodge.« Das war annähernd wahr – bis vor ein paar Tagen hatte ich in Sunset Lodge gewohnt, dann war ich nach Wanchai gezogen. Vom Nam Kok konnte ich nicht gut sprechen … zumindest nicht, bevor ich sie besser kannte.
»Sie arbeiten bei der Regierung? In einer Bank?«
»Weder noch. Ich war Gummipflanzer, habs aber vor ein paar Monaten aufgegeben, um mich ganz der Malerei zu widmen.«
»Malerei?«
»Bilder.« Schon tastete ich nach meinem Skizzenbuch, um es ihr zu zeigen, dann aber fiel mir ein, dass es Skizzen aus dem Nam Kok waren. Lieber nicht.
»Ich verstehe – Künstler.«
»Nun, so möchte ich mich wohl nicht nennen.« Und da alles so gut vorwärts ging, fragte ich sie, ob ich sie zum Dinner einladen dürfe; doch sie lehnte glatt ab.
»Dann wenigstens zum Lunch?«
»Nein.« So energisch schüttelte sie den Kopf, dass der Pferdeschwanz hüpfte.
»Aber ich würde Sie gern wieder sehen, Mee-ling. Können wir uns nicht einmal treffen?«
»Nein.«
»Aber warum denn nicht?«
»Ich heirate bald.« Die Heirat, so setzte sie mir auseinander, war, wie das so chinesische Sitte ist, von den Eltern abgemacht worden, und sie war ihrem künftigen Gatten noch nicht begegnet, aber sein Foto hatte sie gezeigt bekommen, und sie fand ihn sehr gut aussehend. Und er hatte auch Geld, viel Geld. Aber auch wenn sie nicht demnächst heiraten sollte, hätte sie mich nicht wieder sehen können, denn junge Chinesinnen dürfen nicht tun, was englischen Mädchen erlaubt ist. Die, das wusste Mee-ling, durften Freunde haben, durften ihren Freunden sogar gestatten, die Rolle des Ehemanns vorwegzunehmen, ohne dass dadurch die Heiratschancen ernsthaft gefährdet waren. Man hatte ihr sogar von einem englischen Mädchen aus einem der vornehmsten Wohnviertel auf dem Peak erzählt, das hatte vier Freunde in ebenso viel Jahren verbraucht, und dann hatte es einen Regierungsbeamten von hohem Rang geheiratet, in der Kathedrale von Hongkong. Für ein chinesisches Mädchen war solches Betragen undenkbar – Unberührtheit war die unumgängliche Voraussetzung für die Ehe, und die Verwandten des Gatten hatten das traditionelle Recht, sich am Hochzeitstag von dem Tatbestand zu überzeugen. Wurde das Mädchen unzulänglich befunden, so annullierte man den Kontrakt, und ihr blieb dann nichts offen als die Straße.
»Sie sehen, ich hab nie einen Freund gehabt«, erklärte Mee-ling feierlich. »Hab das noch nie gemacht.«
»Nicht?«, fragte ich, über solchen Freimut verwundert.
»Nein, kein einziges Mal.«
»Na, dazu bleibt Ihnen ja noch reichlich Zeit.« Ich fragte mich allerdings, ob ein solches Gespräch bei der ersten Begegnung typisch chinesisch war.
Sie sah mich unschuldig an. »Wie nennen Sie das auf Englisch?«
»Wie ich was nenne?«
»Ich meine, wenn eine das noch nicht gemacht hat – mit gar keinem.«
»Nun, das nennt man bei uns eine Jungfrau.«
»Jungfrau? Genauso?«
»Ja.«
»Ja, Jungfrau – so was bin ich.«
Das sagte sie und wies dabei mit dem rotlackierten Finger auf sich. Ich lachte hellauf. »Mee-ling, Sie sind großartig. Aber da wir in diesem Punkt Klarheit geschaffen haben, könnten Sie ja nun doch mit mir dinieren? Ich meine, wenn ich verspreche, Ihren Lebenswandel nicht zu verderben, nicht einmal versuchsweise?«
Sie schüttelte hartnäckig den Kopf. »Nein.«
»Ich hätte Sie so gern gemalt.«
»Nein. Wir sagen uns in einer Minute Adieu.«
Das ganze Boot erbebte, als die Maschine reversierte. Dann legten wir am Pier von Wanchai an. Das Laufbrett wurde heruntergeklappt, und ich folgte Mee-ling ins Gedränge der Passagiere. Am Kai, bei einer Gruppe Rikscha-Kulis, die zwischen den Deichseln ihrer Rikschas träg herumhockten, blieben wir stehen. Keine hundert Meter von hier lag das Nam Kok, deutlich konnte ich das blaue Neonzeichen über dem Eingang sehen, sogar meinen Eckbalkon im obersten Stock; meine Staffelei stand, mit weißer Leinwand bezogen, auf dem Balkon. Ein Porträt Gwennys, mit dem ich heute Morgen begonnen hatte.
Mee-ling folgte meinem Blick.
»Was ist das für ein Haus?«
»Welches …?«, fragte ich abwehrend. Und um ihre Aufmerksamkeit auf ein anderes Ziel zu lenken, fragte ich: »Wohin gehen Sie jetzt?«
»Hennessy Road.«
»Zur Straßenbahn?«
»Nein. Ein Wagen wartet auf mich.«
»Darf ich Sie bis zu dem Wagen begleiten?«
»Nein. Der Chauffeur würde es meinem Vater sagen.«
»Und dann gäbe es wohl Hiebe?«
»Ja – vielleicht.«
»Und Sie wollen nichts riskieren, wollen nicht etwa doch mit mir zum Dinner kommen?«
»Nein, ich geh jetzt.«
Sie bot mir die Hand zu einem förmlichen Abschied, ließ dann ein leises Kichern hören, als ich sie nahm, offenbar von der Gefährlichkeit unserer Begegnung belustigt, dann wandte sie sich um und bog in die Seitenstraße zur Hennessy Road ein; ihre Absätze klapperten, ihr Pferdeschwanz hüpfte. Einmal wandte sie sich um, hob winkend eine Hand, dann war sie zwischen den Fußgängern und Rikschas verschwunden.
Vorbei, dachte ich, dahin. Partir c’est mourir un peu … Ich wandte mich meinerseits um und überquerte den Kai in der Richtung zum Nam Kok. Und kaum war ich auf meinem Balkon, da stellte ich meinen Zeichenblock auf die Staffelei, über das begonnene Bildnis Gwennys, fand einen Kohlenstift auf dem mit allerlei Zeug überladenen Tisch und entwarf eine Skizze, solange die Erinnerung an Mee-ling noch frisch war. Ich zeichnete sie mit diesem halb unschuldigen, halb spöttischen Blick, eine Hand in der Melonenkerntüte, die andere auf sich selbst deutend, und darunter schrieb ich: »Ja, Jungfrau – so was bin ich.«
Sehr gut gelang die Zeichnung nicht, aber ich fand sie lustig, und so behielt ich sie. Eben erst habe ich sie wieder einmal angesehen. Sie ist sehr verknittert und sogar durchgerissen, Mee-ling selbst hat es getan, sie mag die Zeichnung nicht. Ich habe sie dann mit Klebestreifen repariert. Mich amüsiert sie noch, denn es war meine erste Skizze von ihr. Und ich frage mich, wie oft ich sie seither gezeichnet und gemalt habe. Unzählige Male. Vermutlich öfter, als Melonenkerne in der Tüte sind – ja, öfter, als Haare in diesem Pferdeschwanz sind.
2
Es war George Wheeler, er war schuld, dass ich mich aufs Zeichnen verlegte. Wheeler, der Manager der Bukit Merah Gummiplantage in Malaya, führte ein einschichtiges Leben in seinem dunklen, im Ozean der Gummibäume untergetauchten Bungalow. Er war ein unglücklicher, ein falsch verbrauchter Mensch. An dem Tag, an dem ich aus England eintraf, um als sein Gehilfe zu arbeiten, sagte er:
»Sie werden in mir im Großen und Ganzen einen bequemen Chef finden – nur eines gibts, was ich auf dieser Farm nicht dulde: miscegenation.«
Etwas unsicher antwortete ich: »Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet.«
»Es mit den einheimischen Weibern treiben.«
Ich blickte in diesem dunklen, mit Moskitonetzen verhangenen Käfig, der seinen Wohnraum darstellte, um mich. Die Regale waren mit Büchern über Bergbesteigungen vollgestopft, an den Wänden hingen Bilder von touristischen Unternehmungen, aus Magazinen gerissen. Offenbar verschaffte Wheeler sich ein Ventil für seine unterdrückte Vitalität, indem er von der Bezwingung eisglitzernder Gipfel träumte. Wie aber kamen, so fragte ich mich, die anderen mit seinem Verbot zurecht?
Bald fand ich es heraus: Es hatte seine Gehilfen auf verschiedene Weise betroffen. Meinen Vorgänger, einen Polen, hatte es dazu gebracht, dass er postalisch einem Mädchen in Glasgow, das er nie gesehen hatte, mit dem er aber in Briefwechsel stand, einen Heiratsantrag machte. Das Mädchen war hierhergekommen, sie hatten geheiratet, und jetzt lebten sie drüben in Kuantan, benahmen sich immer noch wie verliebte Vögelchen und erwarteten schon das dritte Kind. Weniger gut war es Ted Willis, einem meiner Kollegen, ergangen: Schon von Haus aus introvertiert, hatte er sich nur noch mehr in sich zurückgezogen und war mit vierundzwanzig Jahren ein Einsiedler, vermutlich fürs ganze Leben gefühlsmäßig verkrüppelt. Was dagegen Tubby Penfold, meinen anderen Kollegen, betraf, so hatte das Verbot ihn nur bewogen, sein Repertoire an schmutzigen Anekdoten zu erweitern und mit neuen Details auszustatten. Gelegentlich schaffte er sich auch auf extravagantere Art Entspannung, so zum Beispiel, wenn er mit breitem, triumphierendem Grinsen zu mir kam, um mir eine Begegnung mit einer Tamilin zu beschreiben, die er aufgegabelt hatte, als sie sich beim Röstschuppen herumtrieb: »Schwarz wie Ihr Hut, verstehen Sie, und mit diesen großen Tingeltangelringen in der Nase, aber geradezu wild danach! Du lieber Gott, wenn man es wieder einmal treibt, dass einem die Knie scheppern, das macht einen flott!« Ich wusste, es war nur Fantasie, aber ich tat so, als ob ich ihm glaubte, und das machte ihn fast so glücklich, als wäre es wahr gewesen.
Das erste Mal, dass ich die Wirkung des Verbots am eigenen Leibe erprobte, war, als ich mich einen Monat nach meiner Ankunft in ein malaiisches Mädchen verguckte.
Sie war nicht auf der Plantage beschäftigt, schlenderte aber mehrmals am Tage an meinem Bungalow vorbei und immer zur Essenszeit, wenn ich auf der Veranda saß. War das bloß Zufall? Ich vermutete es anders, denn sie hatte so lustig freche Augen und solch provozierendes Schwingen der Hüften, wenn sie meinen Blick auf sich fühlte. Ihre Haut hatte einen warmen Honigton. Bald wurde sie bei mir eine Besessenheit, den ganzen Tag über, auf der Plantage, lechzte ich nach dem nächsten Blick, den ich auf sie werfen konnte, und zergrübelte meinen Kopf, wie ich an sie herankommen könnte, ohne dass Wheeler davon erfuhr. Ein dutzend Mal war ich nahe daran, zu ihr hinauszulaufen; dann gewann wieder die Angst, meinen Posten zu verlieren, die Oberhand. Ein Glück, dass sie es aufgab, zu kommen. Ich hatte nicht einmal ein Wort mit ihr gewechselt, aber als sie fortblieb, war ich verzweifelt bis in die Tiefen meiner Seele.
In der Folge wurden die Tage wieder zäh, die Abende endlos: nichts, sie zu füllen, als Tubby Penfolds Schmutzgeschichten. Ach, diese Finsternis nach einem frühen tropischen Sonnenuntergang, wie in einer Höhle! Ich begann, um die Stunden auszufüllen, mehr zu trinken, als mir gut tat. Schon sah ich die roten Lichter. »Wenn ich so weitermache, gehe ich in einem Jahr auf Fetzen«, sagte ich mir. »Ich muss irgendetwas anfangen, muss mir ein Steckenpferd suchen.« Ich holte ein altes Notizbuch hervor, einen Kugelschreiber, und ich begann zu zeichnen.
Ich hatte in meinem Leben weder gemalt noch gezeichnet, von der Schule abgesehen, und auch da nur gezwungenermaßen, in der Zeichenstunde, und ohne mich hervorzutun. Die »Künstlertypen« hatte ich für eine besondere Gattung gehalten, abwegig und beklagenswert. An Feiertagen hatte ich meine kulturelle Pflicht erfüllt, hatte die großen Londoner Galerien besucht und hatte mich gelangweilt. Wenn ich mich an irgendetwas erinnerte, so waren es nicht die Bilder, sondern die Leute, die sich Bilder ansahen – die hatten mehr Eindruck auf mich gemacht. Und einmal, in der Königlichen Akademie, war mir ein kritischer Gedanke gekommen. Warum, du lieber Himmel, waren all diese Porträts so steif, so plump? Warum waren die Leute so aufgeplustert, warum standen oder saßen sie so hölzern da? Warum hatte man sie nicht in einem lebendigen Moment gepackt? Ich fand mehr Charakter, mehr Ausdruck, mehr Sinn im ratlosen Gesicht eines Betrachters als auf einem Dutzend eingerahmter Porträts.
Während des Krieges hatte ich die Schule verlassen und war direkt zur Armee gegangen. Binnen Jahresfrist befand ich mich in Indien. Als der Krieg zu Ende ging, war ich irgendwo droben in Burma; und eines Tages hatte ich einer burmesischen Frau zugesehen, die Wäsche waschend im Irawadi stand, über das Wasser gebeugt, die hell-rote Longyi straff über den Lenden zusammengezogen. Ein Dakota-Flugzeug kam surrend über den Fluss. Die Frau achtete nicht darauf, bis es dicht über ihr war. Dann hob sie, immer noch ihre Wäsche klopfend, das Gesicht, gab dem Flugzeug einen kurzen, gleichmütigen, fast verächtlichen Blick – den Blick einer burmesischen Dörflerin, die vier Jahre lang zugesehen hatte, wie ausländische Armeen auf dem Schaukelbrett des Krieges tanzten, vorgingen und zurück mit ihren lärmenden Zerstörungsmaschinen, einander in eine scheußliche Massenschlächterei verstrickend – sie aber stand immer noch Wäsche waschend im Irawadi, wie sie es seit ihren Kindertagen getan, nicht besser und nicht schlimmer dran als zuvor. Und plötzlich war ein unsagbares Gefühl der Erhabenheit über mich gekommen; denn dieser Blick, diese Kopfhaltung, während die Hände weiterarbeiteten, all dies schien mir plötzlich über die Maßen schön und bedeutungsvoll, als Ausdruck einer Wahrheit. Wenn ich doch diesen Moment festhalten, aufbewahren hätte können! Wie viel hätte er gesagt über Burma, über den Krieg, über die Menschen, über das Leben! Aber schon verebbte das Rattern der Dakota. Die Frau hatte sich wieder über ihre Wäsche gebeugt. Der Moment war vorbei.
Kurz nachher hatte ich mir von einem Kameraden in der Offiziersmesse eine Kamera gekauft; denn wieder hatte es solche Augenblicke gegeben, solche Szenen, und mir hatte es geschienen, dass in ihnen weit mehr von der wirklichen Schönheit Burmas zu finden war als in der Shwe Dagon Pagode oder in den zerbröckelnden Denkmälern von Pagan, der wirkliche Sinn im Leben dieses Landes, und ich war entschlossen, ihn festzuhalten. Fotos hatte ich aufgenommen in Mengen. Aber von all diesen Schnappschüssen hatte kaum ein Dutzend den Blick, die Gebärde, die entscheidende Sekunde eingefangen, nach denen ich zielte; und gerade die Fotos, die es taten, waren am meisten enttäuschend, denn nichts, was ich erwartet hatte, war auf ihnen zu finden. Leer waren sie, platt, ohne Sinn. Warum nur, warum? Sie hielten doch die Augenblicke getreulich fest, die mich ergriffen hatten, warum also rührten sie mich jetzt nicht?
Und da hatte ich zu verstehen begonnen. Ein Moment selber, in sich, konnte nie komplett sein, denn er gehörte in einen Zusammenhang der Bewegung und des Gefühls, und nur in diesem Zusammenhang hatte er Sinn; Hauptpartner aber in diesem Zusammenhang war der Schauende selbst, der jenen Moment im Licht seiner Gefühlseinstellung interpretierte, seiner Persönlichkeit, seines Wissens von der Welt. Als ich diese burmesische Frau im Irawadi stehen sah, war es nicht die flüchtige Gebärde, die mich rührte, sondern was diese Gebärde in mir wachrief, als sie wie durch einen Filter in meine Wahrnehmung einging: verschmolzen mit meinem Erlebnis, mit meinem Hass gegen Zerstörung und Krieg. Auf einen anderen Menschen, der just neben mir gestanden hätte, würde dieser Moment einen ganz anderen Eindruck gemacht haben. Und auf ein Dutzend Menschen ein Dutzend verschiedene Eindrücke.
So habe ich sehr spät – denn den meisten Leuten ist dies wohl von Kindheit an selbstverständlich – diese erste und mutmaßlich einzige Wahrheit über Kunst entdeckt: dass es nicht ihre Aufgabe ist, auszusagen: »so hat X in einem bestimmten Augenblick ausgesehen«, sondern: »so habe ich X gesehen«.
Kurz nachher erhielt ich meine Entlassungspapiere und kehrte nach England heim. Ich hatte Ostasien lieben gelernt, und als ich jetzt, in meinem neuen Anzug fröstelnd, durch London lief, fühlte ich mich elend und verloren. Meine Eltern waren tot; eine spezifische Berufsausbildung hatte ich nicht genossen; ich spürte keine Wurzeln, fühlte mich nirgends zugehörig. Dann nahm mein Onkel mich in seine Immobilienagentur in der Sloane Street auf, eröffnete mir sogar eine vage Möglichkeit, sein Sozius zu werden, wenn ich dazu taugte. Ich biss die Zähne zusammen, besuchte Abendkurse, hockte zu Hause über den Büchern und begann nach einiger Zeit im Büro mit einiger Vertrautheit Worte wie Mietkontrakt, Zehnteil, kellerloser Bau, Nebeneingang, Parkettböden, Maisonette zu gebrauchen. Dies Leben ist mir verhasst, aber ich muss beweisen, dass ich es schaffe, dachte ich. Ich hab mir nun einmal in den Kopf gesetzt, dieses Examen zu bestehen. Kaum aber hatte ich es getan, so gab ich alles auf und fuhr auf die Plantage nach Malaya; und obwohl mein freundlicher Onkel enttäuscht sagte: »Du wirst das, fürchte ich, bereuen«, wusste ich, als ich das erste Mal wieder die Luft des Ostens roch, dass er geirrt hatte. In London, wenn ich auf dem Sloane Square auf den Bus wartete, war ich zu drei Viertel tot gewesen; jetzt war ich wieder ganz lebendig, alle meine Sinne waren gespannt. Und wieder erlebte ich dieses Gefühl köstlicher Erhabenheit in flüchtigen Momenten, in denen sich mir die Schönheit darbot: in Gebärden, Mienen, in kleinen Alltagsszenen. Wenn ich doch ein Künstler gewesen wäre! Und so kam es, dass ich in meinem dritten Monat in Bukit Merah, nachdem ein malaiisches Mädchen aufgehört hatte, mich mit seinem Anblick im Vorbeigehen zu quälen, Zeichenblock und Kugelschreiber hervorholte und zu zeichnen begann.
Und fast sogleich, obwohl ich mich über die Unbeholfenheit meiner ersten Kritzeleien keiner Illusion hingab, hatte ich ein Gefühl, dass mir das Zeichnen leichtfiel. Es war eine seltsame, nicht ganz geheure Empfindung. Es war, als hätte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben an die Schreibmaschine gesetzt und hätte gefunden, dass meine Finger mit den Tasten vertraut waren. Es war wie das Gefühl »hier bin ich schon einmal gewesen«. Und gleichzeitig war es ungeheuer erregend. Immer hatte ich gedacht: Ich bin zwar kein schlechter Allrounder, aber es gibt nichts, das ich wirklich gut kann, und ich hatte die Leute beneidet, die einen bestimmten Drang hatten, ein Talent, irgendeinen Beruf, in dem sie sich hervortun konnten. Und da hatte ich nun schließlich einen Beruf für mich gefunden. Es war, als hätte ich zufällig eine Schublade aufgezogen, von der ich immer gemeint hatte, sie wäre leer, und hätte darin den Schatz entdeckt, der nun mein ganzes Leben in eine andere Bahn werfen konnte.
Bald war das Zeichnen meine einzige Leidenschaft, all mein Sinnen und Trachten. Tag und Nacht dachte ich an nichts anderes. Auch wenn ich auf der Plantage herumging, hatte ich immer das Skizzenbuch bei mir, hielt Ausschau nach Momenten, die ich festhalten konnte, und zählte die Stunden bis zur Mittagspause oder bis zum Abend, da ich mich meiner Passion hemmungslos ausliefern konnte. Jeder freie Augenblick war mir unsäglich kostbar geworden. Ich hungerte nach Einsicht und nach Belehrung. Ich marterte mein Gehirn nach allen Spuren, die etwa von meinen vergeudeten Zeichenstunden in der Schule zurückgeblieben waren. Ich bestellte Kunstbücher aller Art aus Singapur und London. Gierig verschlang ich sie; fand mich bewegt, verzaubert, hingerissen von den Reproduktionen von Originalen, die mich zwölf Jahre vorher in den Londoner Galerien kaltgelassen hatten. Sogar Zeichnungen in Zeitungen, selbst Briefköpfe mit bildlichen Darstellungen hatten jetzt ein neues Interesse für mich, denn ich studierte sie, um herauszubringen, wie ihre Wirkung zustande kam. Über das Mädchen, das an meinem Bungalow vorbeigegangen war, machte ich mir keine Gedanken mehr. Meine gestauten Gefühle waren in einen Kanal gelenkt. Ich ließ all die Energie, die ich ohne George Wheelers Sittenstrenge in Liebschaften vertan hätte, in mein Zeichenbuch strömen.
Zeichenstile, die mir nicht lagen, vermied ich, und so hatte ich binnen Jahresfrist einen eigenen Stil entwickelt. Ich hatte auch begonnen, in Farben zu zeichnen, zuerst mit Farbstiften, wie sie der örtliche chinesische Kramladen für Kinder bereithielt, dann mit Pastellstiften, die ich aus England kommen ließ. Und nun begann ein neues Abenteuer, mein Einbruch in die Welt der Ölfarben.
Wheeler hatte mich wohl unzählige Male dabei ertappt, wie ich in der Arbeitszeit über mein Skizzenbuch gebeugt war, aber er war meinem Steckenpferd eher wohlgesinnt, mochte es sauber finden; in der Tat war ich sein bevorzugter Gehilfe, denn mit Tubby Penfold, dessen unsaubere Gedanken immer um die Weiber schweiften, war nicht viel anzufangen. Er bat mich sogar, ihm ein Bild zu malen. Dies war das Jahr der Krönung von Elizabeth II. und der Erstbesteigung des Mount Everest. Da wollte er nun, ich sollte den triumphalen Augenblick der Ersteigung auf einem Ölbild festhalten. Aus Magazinen hatte er Fotos von Hillary und Tensing entnommen, die mir als Modelle dienen sollten. Ich fand weder Geschmack an dieser Aufgabe, noch war ich zu ihr im Geringsten befähigt, aber ich war bestrebt, mein Bestes zu tun; und es konnte nicht anders kommen, ein Werk von überwältigender Unechtheit kam zustande, aber Wheeler entzückte es. Er hängte es in seinem Schlafzimmer auf, damit er das Himalaya-Epos im Bett miterleben konnte.
Eine Woche später, immer noch meine Bemühungen um den Everest nachkostend, zeigte er mir einen Artikel in einer Londoner Zeitung: das Interview eines Gesellschaftsklatsch-Reporters mit einer Malerin, deren erste Ausstellung soeben in einer Kunsthandlung in West End, Ullman, eröffnet worden war. Ganz Mayfair war aus dem Häuschen, denn diese Frau, die mitten in den Dreißigern stand, hatte erst im Vorjahr zu malen begonnen.
»Sie geben sich schon länger damit ab«, sagte Wheeler. »Warum senden Sie nicht ein paar von Ihren Arbeiten dahin?«
»Ich bin noch nicht gut genug«, sagte ich. Wenn ich aber meine Gedanken richtig wiedergeben soll, so waren sie so: Ich selber halte mich wohl für gut genug, aber ich bin nicht überzeugt, dass die anderen meine Meinung teilen, und ich hab einfach nicht die Courage, das Schicksal auf die Probe zu stellen.
»Nun, versuchen Sie es doch – zu verlieren haben Sie dabei doch nichts.«
Mehr Zuredens bedurfte es nicht, prompt schickte ich ein Paket Pastellzeichnungen und zwei Ölbilder mit enormen Spesen per Flugpost ab. Aber ich bekam nicht einmal, eine Empfangsbestätigung. Acht Monate lang sah und hörte ich nichts von meinen Bildern.
Also hatte ich doch etwas zu verlieren gehabt – meine Selbstgewissheit. Das Blut stieg mir in die Wangen, wenn ich an die Vermessenheit dachte, mit der ich meine Bilder nach London geschickt hatte – nur zu gut konnte ich mir das Gelächter vorstellen, mit dem man sie aufgenommen hatte. Ich wagte nicht einmal, brieflich um Rücksendung zu bitten. Mein Selbstvertrauen war erschüttert. Und es war folglich kein Zufall – das Bedürfnis nach Wiederherstellung des Selbstgefühls treibt Männer oft Frauen in die Arme –, dass ich mich zu jener Zeit an Stella hängte.
Stella Plowden war vierundzwanzig Jahre alt und einigermaßen hübsch, was hier, tief im malaiischen Landesinnern bedeutete: sie war hinreißend. Als sie mit ihrer Mutter auf die Nachbarplantage kam, zog sie im Umkreis von hundert Meilen alle Junggesellen an. Ich beteiligte mich an dem Wettlauf, mit dem Vorteil, in unmittelbarer Nachbarschaft zu wohnen: Die Banditen kamen mir zupass, denn nachdem ein Bewerber, der unvorsichtigerweise nachts zu Stella fuhr, in einen Hinterhalt geraten und erschossen worden war, erfuhr die Begeisterung der weiter abseits wohnenden Mitbewerber eine fühlbare Abkühlung. Am Weihnachtstag machte ich ihr meinen Heiratsantrag, am ersten Wochentag nach Weihnachten wurde er angenommen; kurz nach Neujahr war ich bereits die Beute quälenden Zweifels. Doch erst im April fasste ich mir ein Herz und löste die Verlobung.
Hauptursache unseres Bruches war meine Malerei. Es verletzte Stella, dass ich fortfuhr, die einheimischen Mädchen lieber zu zeichnen und zu malen als sie. Das konnte sie nicht verstehen. Wie konnte ich jetzt, da ich ein williges, untadelig weißhäutiges und nicht reizloses Modell zur Verfügung hatte, mein Talent auf Eingeborene vergeuden? Eine Weile lang gestand sie nicht, wie ihr ums Herz war, aber merken musste ich es doch, denn sooft ich ihr eine meiner Arbeiten zeigte, wurde sie mürrisch und machte ärgerliche Bemerkungen. Alle meine Fehler deckte sie auf – alle außer dem einzigen, den sie mir wirklich übel nahm. Eines Tages aber kam sie dann doch damit heraus. Es ging nicht darum, erklärte sie mir, dass sie gemalt sein wollte, in Wirklichkeit konnte sie sich nichts Langweiligeres vorstellen, als Modell zu sitzen, aber mein offenkundiger Mangel an Interesse war für sie demütigend. Erst an diesem Morgen wieder hatte ihre Mutter sie gefragt, ob ich jetzt an ihrem Porträt arbeite, und wieder hatte sie antworten müssen: »Nein, er malt irgendein malaiisches Mädchen.« Vergehen hätte sie mögen vor Scham.
Wir begannen, uns bei jeder Begegnung zu zanken; immer waren es dieselben Argumente, dieselben Anschuldigungen, aber jedes Mal ein wenig bitterer. Endlich, eines Tages bei einem Picknick, kam der Krach, nachdem ich mir herausgenommen hatte, drei Frauen zu skizzieren, die mit Yakfrüchten an uns vorbeigingen.
»Was ist eigentlich mit mir los?«, fragte Stella. »Bin ich so hässlich oder fehlt mir sonst etwas?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Aber das ist so beleidigend … und so wider die Natur …«
»Malaien zu zeichnen?«
»Ja, besonders, wenn es bei neun von zehn Malen Malaiinnen sind. Das ist abscheulich.«
»Aber sie sind so schön … so voller Grazie.«
»Da soll dir einer zuhören! Und du behauptest noch, dass nichts dahinter steckt.«
»Natürlich steckt nichts dahinter.« Zehn Minuten trommelten wir aufeinander los, sie der Hammer, ich der Amboss, suchten einander weh zu tun, so gut wir nur konnten, dann wurden wir still. Ich fühlte mich beschämt, wollte Buße tun und sagte: »So, und jetzt möchte ich dich zeichnen.«
»Schön, warte eine Minute.« Sie griff nach ihrer Handtasche.
»Nein, nicht rühren! Gerade so – das ist großartig.«
»Sei doch nicht verrückt.«
Und als sie dann Kamm, Stift und Puderquaste in Bewegung setzte, explodierte alles in mir. »Du blöde Gans«, hätte ich rufen mögen, »du läppisches, eitles, ichbezogenes Geschöpf! Kannst du auch jetzt noch nicht begreifen, warum ich die Malaiinnen lieber zeichne? Kapierst du den Unterschied nicht? Siehst du nicht, dass sie eine Unschuld bewahrt haben, die du verloren hast?«
Sie zog ihren Rock zurecht, rückte sich dann in eine Pose, wie für ein Bild auf einer Schokoladenpackung.
»So, jetzt bin ich bereit.«
»Schön«, sagte ich und zeichnete sie. Am nächsten Tag aber habe ich ihr erklärt, ich wäre doch wohl nicht der Ehemann, den sie brauche, und wir wollten lieber auseinandergehen.
Sie war außer sich. »Was soll ich denn den Leuten sagen?«, fragte sie immer wieder. »Wie kann ich das den Leuten erklären?« Und obwohl ich sie gerade dafür doppelt verachtete, dass ihr so viel an der Meinung der Leute lag, beurteilte ich sie nachher weniger herb, denn die Angst, das Gesicht zu verlieren, war verständlich genug, und wo bedeutete diese Angst mehr als bei den Ostasiaten? Wenn ich heute daran zurückdenke, ist mir klar, dass Stellas Ärger über meine Malerei, den ich damals selbstgefällig als Eitelkeit auslegte, durchaus berechtigt gewesen ist. Der schöpferische Impuls hatte seine Wurzeln in der Sexualität, und gewiss hatte ich aus demselben Grunde Freude daran, Malaiinnen zu malen, aus dem andere Künstler Akte malten. Ein Maler, der behauptet, dass der weibliche Körper ihn nur als abstrakte Form interessiert, redet Unsinn – mag er doch Bettkissen porträtieren! Die Malaiinnen erweckten in mir Gefühle, die, da ich ihnen unmittelbaren Ausdruck versagte, in anderer Form zutage traten, und gerade dies gab meinen Bildern den Wert, den sie allenfalls noch hatten. Stella hatte solche Gefühle nie in mir geweckt. Und natürlich spürte sie das. »Wenn er Malaiinnen malt und nicht mich, dann kann er mich nicht lieben«, das war ihre instinktive Reaktion. Und da hatte ich mir eingeredet, ihr Argument wäre primitiv, stamme nur aus ihrer völligen Unkenntnis aller höheren Motive der Kunst. Natürlich war sie vollkommen im Recht. Ich hatte sie nie geliebt – keinen Augenblick lang.
Einige Wochen nach meinem Bruch mit Stella erhielt ich einen Brief aus London, von der Kunsthandlung Ullman, der ich meine Bilder eingesandt hatte, und er enthielt einen Scheck über dreiundsechzig Pfund.
Der Brief war von Roy Ullman, dem Besitzer und Leiter der Galerie, unterzeichnet; er entschuldigte sich, dass der Scheck wegen der hohen Spesen der Galerie und wegen der Kosten der Bilderrahmen nicht größer ausgefallen war. Warum er nicht früher geschrieben hatte, erklärte er nicht, aber er erwähnte, dass er vierzehn meiner Arbeiten in eine Gruppenausstellung einiger junger Maler aufgenommen habe – allerdings erst nach einigem Zögern, wie er gestand. Wie die beiliegenden Zeitungsausschnitte bewiesen, habe die Kraft und Intensität des Gefühls bei meinen Arbeiten die Schwäche der Komposition und mannigfache Mängel der Technik aufgewogen. Des Weiteren hieß es: »In der Tat kann man ohne Übertreibung sagen, dass Ihre Bilder Erfolg gehabt haben, und Sie können sich zu einem Triumph gratulieren. Indessen …« Indessen empfahl er mir doch, zunächst ein Jahr lang nichts auszustellen, ich würde mich in dieser Zeit zweifellos über Erwarten entwickeln. »Sie haben«, schloss der Brief, »ein verblüffendes und ungewöhnliches Talent, und ich weiß, dass wir uns von Ihnen auf Großes gefasst machen dürfen.«
Der ersten Aufregung über diesen Brief folgte die neue Gewissheit, dass ich ein Genie und zum Höchsten berufen sei. In aller Unbefangenheit nahm ich die Tatsache hin, dass ich ein übergeordnetes Wesen war. Das dauerte ungefähr eine Woche. Ich fühlte mich nicht nur dank meiner Erhabenheit größer, ich war es sogar – denn sowohl George Wheeler als auch Tubby Penfold bemerkten es unabhängig voneinander. In der nächsten Woche aber stellten sie, wiederum beide, fest, dass ich auf mein normales Maß zusammengeschrumpft war. Und ich konnte mir vorstellen, dass es sogar nicht einmal mehr normal war – denn während ich verzweifelt versucht hatte, mich auf der Höhe meines aufgeblähten Selbstbewusstseins zu halten, hatte ich entdecken müssen, dass ich vollkommen leer war, ohne Inspiration, ohne Talent. Nichts gelang mir. Kein Genie, nur ein ganz mittelmäßiger Kleckser. Ich stürzte in alle Abgründe der Verzweiflung. Selbst die Wendungen in Ullmans Brief, den ich zur Wiederherstellung meines Mutes hervorholte, schienen mir jetzt leer und unaufrichtig. Was riskierte er dabei schließlich? Und was war, bestenfalls, mein »Triumph« anderes als eine Laune der Kunstsnobs von Mayfair, die sich gleich darauf der nächsten Sensation, der nächsten Entdeckung zuwandten? Und was gar den Scheck betraf, der mir in meiner ersten Überraschung als ein Vermögen erschienen war – jetzt fand ich ihn kläglich, wenn man den Aufwand an Zeit und Anstrengung in Rechnung stellte.
Meine Verzweiflung und Arbeitsunfähigkeit lasteten zwei Monate auf mir; dann schlug das Pendel zur Mitte zurück. Ich war weder ein Genie noch die pure Mittelmäßigkeit, sondern besaß ein gewisses Talent, das nur mit Geduld und harter Arbeit fruchtbar zu machen war. Kaum hatte ich mich damit abgefunden, als auch der schöpferische Impuls sich wieder regte.
Etwa einen Monat später fuhr ich zum Wochenende nach Singapur. Seit einem Jahr war ich nicht weiter als bis Kuala Lumpur gekommen, und die große Stadt wirkte erregend auf mich. Ich schlenderte durch die chinesischen Märkte, nahm dort meine Mahlzeiten ein, besuchte das Kabarett Cathay. Stundenlang trieb ich mich in den flitterüberladenen chinesischen Vergnügungsparks herum, wo nebeneinander Boxkämpfe im Freien, eine kantonesische Oper, chinesisches Striptease und Wettfahrten auf der Schaukelbahn zu sehen waren. In einem der Tanzpaläste tanzte ich mit einem Taxigirl. Zwei Tage später fuhr ich mit dem Zug wieder nach Norden, angewidert von der Vorstellung, dass ich von Neuem in dieser Endlosigkeit graustrunkiger Bäume untertauchen sollte, in der Marter einer Arbeit, die so viel von meiner Zeit in Anspruch nahm und mich vom Malen abhielt. Und ich begann mit dem Gedanken, einmal Bukit Merah zu verlassen, zu spielen. Ich hatte nahezu vierhundert Pfund erspart, seit ich nach Malaya gekommen war. Wenn ich vorsichtig war, konnte ich damit ein Jahr fristen – ein Jahr, in dem ich nichts tat als malen. Und während ich gerade diesen Gedanken in meinem Kopf wälzte, sagte ein Major, der in meinem Abteil saß, seufzend: »Auf mein Wort, ich wollte, ich wäre wieder in Hongkong.«
»Warum?«
»Singapur ist ja ganz nett, nur ist es eben eine Stadt wie jede andere. Hongkong aber, das ist wirklich China. Treten Sie eine Minute aus dem Stadtzentrum heraus, und Sie bekommen keinen Europäer mehr zu sehen. Und wahrhaftig, Hongkong ist schön.«
»Ja, das habe ich auch gehört.« Und mir fiel der Gärtner ein, den wir zu Hause hatten, in meinen Kindertagen; als Gärtner hatte er nicht viel getaugt, denn eigentlich war er ein Seemann; seine braunen, muskulösen Arme waren tätowiert, da hatte ich unter einem blauen chinesischen Drachen das Wort Hongkong gelesen. Dieser Gärtner war unbestritten der Held meiner Knabenzeit, und ich konnte ihm unermüdlich zuhören, wenn er auf seinen Spaten gestützt von Kanonenbooten und Opiumhöhlen erzählte, von Feuerwerken und dem Perl (das war ein Strom), von chinesischen Beerdigungen mit sechs Blechbläserkapellen und berufsmäßigen Klageheulern, die weiße Kapuzen trugen wie die Ku-Klux-Klan-Leute, schluchzten und wimmerten und mit den Zähnen knirschten. Dann aber, im alleraufregendsten Moment, konnte der Gärtner sagen: »Aber jetzt Schluss damit, sonst krieg ich Krach mit deinem Vater!« Ach, welche geheimnisvolle Welt lag hinter seinen Worten!
»Wahrhaftig«, sagte der Major, »wenn Sie solch eine Dschunkenflotte mit vollen Segeln in den Hafen einfahren sehen, stolz wie mächtige Schoner … nein, das muss man gesehen haben. Wirklich, Sie sollten nach Hongkong fahren.«
»Ich werde es tun«, sagte ich. Mein Entschluss war gefasst.
»Auf Urlaub?«
»Nein, um dort zu leben.«
Ich eröffnete George Wheeler meine Neuigkeit, sobald ich daheim war. Er war nicht gerade entzückt, denn er hatte mich gut bezahlt, damit ich mich einarbeite, und hatte damit gerechnet, dass ich länger bleiben würde. Als er aber sah, dass mein Entschluss feststand, machte er gute Miene, lächelte grimmig und sagte: »Nun ja, Sie werden ja eines Tages berühmt werden, mit so einem Mann muss man sich gut stellen. Ein Stengah gefällig?« Und als ich mich mit dem Whisky entspannt hatte und auch er so aufgelockert war, wie es ihm seine chronische innere Verkrampftheit nur erlaubte, lachte ich und sagte: »Schuld sind ja eigentlich nur Sie. Sonst hätte ich mit dem Malen nie angefangen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Dieses strenge Verbot der miscegenation.«
Eine Minute lang sah er mich verdutzt an, suchte den Zusammenhang zu erfassen, dann sagte er: »Ach, Unsinn. Sie hätten sich nie mit einer Eingeborenen eingelassen. Sie sind nicht von der Sorte.«
»Nun, in Wirklichkeit …«
Schon wollte ich ihm von dem Mädchen mit den lustig-frechen Augen und den provozierenden Hüften erzählen, das so oft an meinem Bungalow vorbeigekommen war, aber er ließ mich nicht aussprechen.
»Natürlich hätten Sie das nicht getan … Sie sind viel zu anständig dazu. Das weiß ich, seit ich Ihr Everest-Bild gesehen habe. Ein schönes Werk. Nur ein anständiger und sittsamer Mensch kann so etwas malen.«
Und da ihm die Wahrheit die Freude an dem Bild verdorben hätte, biss ich mich auf die Zunge und sagte bloß: »Nun, ich freue mich, dass Sie es gern mögen.«
»Es ist ein Kunstwerk.«
Ein neuer Gehilfe wurde am Ort aufgetrieben. Er hieß Hewitt-Begg, und nach seinem ersten Gespräch mit Wheeler sagte er zu mir: »Diese Sache mit den Weibern macht mir nichts aus. Ich übe Yoga.« Und das tat er wirklich, saß kreuzbeinig, nur in ein Lendentuch gehüllt, seinen weißrosigen englischen Rumpf steif wie ein Götze, einen Finger gegen das Nasenloch gepresst, und erzeugte alarmierende Geräusche, indem er bald nur durch das eine, dann wieder nur durch das andere Nasenloch atmete. Seinen Atem regelte er dabei nach einer Uhr, die vor ihm auf dem Boden lag.
Ich blieb ein paar Wochen, um ihn in die Arbeit einzuweisen, dann brachte mich Wheeler in seinem Wagen nach Port Swettenham, wo ich an Bord eines Frachters ging. Das Schiff hieß Nigger Minstrel und war nach Malakka, Singapur, Manila und Hongkong bestimmt.
3
Ich hatte, als ich zum ersten Mal darauf stieß, nicht die leiseste Ahnung, dass etwas mit dem Nam Kok nicht in Ordnung sein könnte.
Fünf Wochen war ich gerade in Hongkong, hatte eben in einem Haus an der Berglehne hinter Wanchai vorgesprochen, in dem ein möbliertes Zimmer zu vermieten war. Das Inserat war von einer Mrs Ma aufgegeben worden, und ich fand sie in ihrer Wohnung im zweiten Stock, aber schon als sie mir die Tür öffnete und ich an ihr vorbei in das kleine Wohnzimmer blickte, in dem es von Kindern, Großeltern, Cousins, Tanten und Onkeln wimmelte – ein Dutzend war es, gering gerechnet –, hatte ich begriffen, dass ich hier nicht die Gelassenheit und Abgeschiedenheit finden konnte, in der ich malen mochte. Und so war ich eher froh gewesen, als Mrs Ma mir eröffnete, das Zimmer sei bereits an einen Chinesen vermietet. Es tat ihr leid, wie sie mir versicherte, und wenn sie gewusst hätte, dass ich kommen würde, so hätte sie wohl anders disponiert, hätte einen englischen Mieter vorgezogen, denn so hätten sie und ihr Gatte Gelegenheit gefunden, ihr Englisch zu verbessern. In diesem Sinne wollte sie mich wenigstens für meinen vergeblichen Weg mit einer Tasse Tee entschädigen, die ich denn, steif auf einem harten Stuhl mit steiler Lehne sitzend, trank; die Verwandten, die im Zimmer herumhockten, nahmen von meiner Gegenwart kaum Notiz.
»Nun, vielleicht finde ich etwas in Wanchai«, sagte ich. »Es ist einer der wenigen Bezirke, in denen ich es noch nicht versucht habe.«
Mrs Ma, ein zwitscherndes niedliches Vögelchen, kicherte, als ob ich gescherzt hätte. »Nein, Wanchai würde Ihnen wohl nicht gefallen«, sagte sie.
»Warum nicht?«
»Wanchai ist sehr lärmend … kein Europäer wohnt in Wanchai … nur Chinesen.«
»Genau das möchte ich ja«, sagte ich. »Das ist ja gerade das Fade an meinem jetzigen Quartier, dass es dort nur Engländer gibt.« Ich erzählte ihr von Sunset Lodge, das auf der niedrigsten Terrasse des Peak lag, auf der Europäer sich respektablerweise ansiedeln können, und wo ich bis jetzt gewohnt hatte – nicht aus dem Bedürfnis nach Achtbarkeit, sondern weil ich nichts Billigeres gefunden hatte. Ich erzählte auch von meinen Mitbewohnern: den Bridgespielern, die sich um elf Uhr vormittags an den Bridgetisch im Salon setzten und den ganzen Tag über nicht mehr aufstanden; von den traurig blasierten Frauen, die zwar sagten: »Natürlich geht es uns hier wunderbar«, aber doch aus ganzer Seele wünschten, sie wären wieder daheim in Sutton; von den zänkischen Weibern mittleren Alters und den schwatzhaften Ladys, die überall auf der Lauer lagen und, ging man ihnen in die Falle, den Strahl ihrer Rede auf einen richteten; und wie ich es mir schließlich angewöhnt hatte, mich durch den Kücheneingang in mein Zimmer zu schleichen, um nicht in einen solchen Hinterhalt zu geraten: Das klang recht komisch, wenn ich es erzählte, aber war es in Wirklichkeit nicht. Ich war der Verzweiflung nahe; denn nun war ein ganzer Monat meines Jahres verstrichen, ohne dass ich mich an die Arbeit gemacht hatte. Nichts getan. Zuerst war Hongkong mit seiner überquellenden, sich drängenden und stoßenden Menschenmasse, mit seiner erregenden Atmosphäre zu betäubend, zu verwirrend gewesen; zu überreich waren die Eindrücke auf mich eingeströmt, als dass ich sie hätte fassen können. Das muss alles erst Gestalt annehmen, hatte ich mir gesagt, in ein oder zwei Wochen werde ich mich zurechtgefunden haben. Doch nichts nahm Gestalt an. Es war mir unmöglich gewesen, mein Interesse um irgendeinen Punkt zu sammeln, ich fand keinen Ansatz, mit dem ich beginnen konnte; und schon stieg in mir das unbehagliche Gefühl auf, dass ich vielleicht besser getan hätte, auf meiner Gummiplantage zu bleiben. Dann hatte ich zu verstehen begonnen. Meine Arbeit war immer von einem gewissen Gefühl der Teilnahme bedingt gewesen, ich musste mich mit den Menschen, die ich zeichnete oder malte, identifizieren; hier aber war ich nur ein Straßenbeobachter, der aus einer anderen Welt gelegentlich in diese einbrach. Eine unüberwindliche Wand trennte mich von den Chinesen – wie konnte es anders sein, solange ich in Sunset Lodge wohnte? Darum hatte ich mich auf die Suche nach einem anderen Quartier gemacht, war wieder mit der Straßenbahn von Bezirk zu Bezirk gefahren, hatte Straßen abgelaufen, bloß um immer wieder von den Massen der Fußgänger, die sich weiterschoben, von der Unmenge Wäsche, die an den Leinen hing, daran erinnert zu werden, dass dies die übervölkertste Stadt der Welt war. Noch vor ein paar Jahren, gegen Kriegsende, hatte Hongkong gerade eine halbe Million Einwohner gezählt; als aber dann nach der Revolution in China die Flüchtlinge in Strömen über die Grenze kamen, war die Stadt auf zweieinhalb Millionen angeschwollen, und es gab Leute, die sie jetzt bereits auf drei Millionen schätzten – wer konnte es sagen? Und als dann die Erstankömmlinge sich in jeden irgend erreichbaren Raum gedrängt hatten, jedes Zimmer in zehn, fünfzehn, zwanzig »Bettplätze« geteilt war, da waren für die Übrigen nur die leeren Baustellen und Hügelhänge geblieben, allenfalls jämmerliche Hütten, die man sich aus Brettern, Planken, Konservenbüchsen und alter Sackleinwand zusammenflickte. Wurde jemals irgendwo ein Raum frei, so verlangte man dafür horrende Mieten, die kein Gesetz in Grenzen halten konnte. Und so hatte ich ein zweites Mal nichts gefunden, was innerhalb meiner Möglichkeiten lag, und war, enttäuscht und wegmüde, bereits am Aufgeben; nur Mrs Mas Inserat hatte mich heute Nachmittag wieder auf die Beine gebracht.
Ich setzte die bemalte Tasse ab und sagte: »Der Tee war köstlich. Und Sie waren sehr freundlich.«
»Aber durchaus nicht, keineswegs«, kicherte sie höflich. »Der Tee war jämmerlich.«
»Durchaus nicht, er war köstlich.« Ich erhob mich, um zu gehen.
»Hoffentlich wollen Sie nicht wirklich nach Wanchai gehen«, sagte sie besorgt, als sie mich zur Tür begleitete. »Wanchai ist viel zu lärmend … viel zu schmutzig. Die Leute dort sind schrecklich arm, Sie werden einen ganz falschen Eindruck von den Chinesen erhalten. Sie wollen doch nicht wirklich dorthin?«
»Nun, vielleicht nicht.«
Ich tat es aber trotzdem, stieg die Hügelböschung auf den endlosen steilen Treppen hinab, die direkt in den ältesten Teil von Wanchai führen, in dieses Gewirr enger Gässchen, in denen alle Abflüsse verstopft sind und Händler auf den Trottoirs hocken, Gässchen voller anregender Geschäftigkeit. Die Sonne brannte herab, zeichnete scharfe Schatten auf den Boden und verlieh der Wäsche, die über unseren Köpfen baumelte, die Heiterkeit sich bauschender Segel. Ich entdeckte ein Postamt und trat ein, weil ich hoffte, der Schalterbeamte würde Englisch sprechen. Als ich ihn aber fragte, ob er ein vermietbares Zimmer wüsste, schüttelte er den Kopf und sagte: »Nein, bedaure, nichts zu verkaufen.«
»Ich will ja gar nichts kaufen«, sagte ich, »ich suche ein Zimmer.«
»Bedaure. Nur verkaufen Briefmarke.«
Ich überquerte die Hennessy Road mit ihren klirrenden und ratternden Straßenbahnen und ihren zwei modern aufgetakelten Kinopalästen, in denen amerikanische Filme gezeigt werden, kam an den Kai und zur Seemannsmission. Gleich neben der Mission lag ein großes Hotel namens Luk Kwok, berühmt als Stätte chinesischer Hochzeitsfeierlichkeiten und unverkennbar viel zu teuer, als dass eine Anfrage ratsam gewesen wäre. Weiter abwärts am Kai löschten Kulis barfuß und mit nacktem Oberkörper Dschunken, wie Ameisenzüge auf den Laufstegen entlangziehend. Sampans lagen zwischen den Dschunken vertäut und schlingerten in den von vorbeifahrenden Schnellbooten aufgewühlten Wellen. Die Straßenfront war von engen, offenen Verkaufsgewölben eingenommen, zwischen denen schmale, dunkle Treppenhauseingänge zu den übervölkerten Wohnungen hinaufführten; auf dem Pflaster spielten Kinder ihre Hüpfspiele, während sie aus Schüsselchen Reis in ihre Mäuler schaufelten, denn chinesische Kinder scheinen nur in Bewegung zu essen.
Ich saß auf der Plattform der Treppe und blickte auf das Wasser hinab. Ein Monat verloren, dachte ich. Ein ganzer Monat verstrichen, und nichts für die Ewigkeit getan. Ich muss etwas unternehmen. Muss mich zusammenreißen.
Aber nein, das hatte ja keinen Zweck. Ich hatte mich schon zusammengerissen, nichts hatte es genützt. Zum Malen kann man sich nicht zusammenreißen. Das wäre genauso, als ob man sich dazu zwänge, eine tickende Uhr nicht zu hören. Je energischer man es versuchte, umso lauter würde sie einem ins Ohr pochen.
Zuweilen, dachte ich, ist die Willenskraft ihr eigener Feind. Man kann nicht malen aus Willenskraft.
Ja, sich auflockern, sich entspannen, das war das Rezept. Nur wenn man sich entspannt, nur wenn man nicht nach den Dingen greifen will, die man ersehnt, nur dann sind sie plötzlich nahe.
Ich lehnte mich an den sonnengewärmten Stein. Eine Rikscha kam vorbei, die nackten Füße des Kulis klatschten laut auf das Pflaster. Dann fiel mein Blick auf eine Lichtreklame zwischen den Läden. Die blauen Neonröhren waren zu den komplizierten dekorativen Formen chinesischer Schriftzeichen gebogen. Die beiden letzten konnte ich entziffern. Sie bedeuteten: Hotel.
Das scheint eher für mich zu passen, dachte ich. Und direkt am Kai. Natürlich wäre das herrlich. Zu gut, als dass nicht ein Haken daran wäre. Immerhin, versuchen konnte man es doch.
Ich stand auf, überquerte den Kai und trat in den Eingang unter dem blauen Neon. Noch immer regte sich in mir kein Verdacht. In der Tat wirkte die Hotelhalle solid respektabel, mit ihrem nicht mehr ganz jungen Empfangsbeamten an der Theke, mit dem altmodischen Lift, der mit einem Kabel betrieben wurde, den eingetopften Palmen am Treppenabsatz; das Ganze erinnerte an ein altmodisches Familienhotel in Bloomsbury. Ich fühlte sogar eine gewisse Entmutigung. Zum Kai von Wanchai passte das alles nicht – und obendrein würde es aller Wahrscheinlichkeit nach zu teuer sein.
Ich trat an die Theke und fragte den Empfangschef: »Was kostet ein Zimmer monatlich?«
»Monatlich?«
Die Finger des Angestellten schienen auf den Kugeln seines Rechenbrettes stecken zu bleiben: Er hatte eben aus Ziffern, die er seinem Hauptbuch entnahm, Berechnungen angestellt, mit der Gebärde eines Mannes, der ein Musikinstrument betätigt. Sein chinesisches Gewand, der Kutte eines Mönchs nicht unähnlich, verlieh ihm einen altmodischen Anstrich, der irgendwie zu den Topfpalmen und dem vorsintflutlichen Lift passte. Sein Kopf war kahl geschoren; er hatte einige Silberzähne im Mund.
»Monatlich?«, wiederholte er.
»Ja. Gibt es bei Ihnen keine monatlichen Arrangements?«
»Wie lang wollen Sie wohnen?«
»Nun, mindestens einen Monat.«
Er streifte mich mit einem sonderbaren Blick, dann begann er wieder auf seinem Rechenbrett zu hantieren. Die Kugeln klapperten unter seinen Fingern.
»Zweihundertsiebzig Dollar«, verkündete er schließlich.
»Monatlich?«
»Ja, für den Monat.«
Ein Hongkong-Dollar war einen Shilling und drei Pence wert, zusammen machte das also etwa siebzehn Pfund – ein wenig teurer als Sunset Lodge, aber wenn ich billig aß, konnte ich es mir gerade noch leisten. Ich wollte das Zimmer sehen, und der Mann an der Theke rief einen der Boys telefonisch herbei, während ich zum Lift schritt. Der Liftjunge lehnte an einem Spiegel und las eine chinesische Zeitung. Er faltete seine Zeitung zusammen, schlug knallend die Gittertür zu, zog an dem Kabel, und wir rumpelten aufwärts; bei jedem Stockwerk gab es einen lauten metallischen Klang. Im dritten und obersten Stock, in dem ich ausstieg, ließ ein winziger Radioapparat auf dem Tisch des Etagendieners das quäkende Falsett einer kantonesischen Oper hören. Der Etagendiener, ein lächelnder, munterer Junge von etwa zwanzig Jahren, trug ein weißes Jackett, weite Baumwollhosen und Filzpantoffeln. Er führte mich den Korridor entlang und sperrte das letzte Zimmer auf.
»Sehr schöne Zimmer, Herr«, sagte er schmunzelnd.
Es war nicht schön, aber sauber und mit seinem breiten, harten Bett, einem schäbigen Toilettentisch, Kleiderschrank und dem unvermeidlichen Emailspucknapf durchaus zweckmäßig. Auch ein Telefon und ein gepolsterter Korb für eine Teekanne war da: Ich entsann mich, gehört zu haben, dass Tee in chinesischen Hotels stetig und kostenlos nachgeliefert wird. Man konnte fast von Tee leben; jedenfalls bedeutete das eine beträchtliche Ersparnis.
»Und schöne Aussicht, Herr.«
Er öffnete die Tür zu dem Balkon, der überdacht, aber wundervoll hell war: ein vollendetes Atelier. Und die Aussicht war wirklich herrlich, denn der Eckbalkon überschaute ein gewaltiges Panorama. Auf der einen Seite die Dächer von Wanchai, im Hintergrund die Wolkenkratzer von Hongkong und der Peak, vorn der Hafen, voll aneinandergedrängter Schiffe jeder Größe und Form: Frachter, Personendampfer, Kriegsschiffe, Fährboote, Dschunken, Sampans, Wallawallas und unzählige komische, jeglicher Form und Anmut bare Kreuzungen aus all diesen Typen, manche vor Anker liegend, andere in träger Bewegung, manche geschäftig hin- und hereilend, im Zickzack den Hafen durchmessend. Und auf der anderen Seite des Hafens, so nah, dass ich die Fenster des Peninsula-Hotels zählen konnte, der Pier von Kowloon, hinter dem kahle Hügel aufstiegen, weit ins Land, nach China hinein verlaufend.
Ich sagte: »Das Zimmer passt mir recht gut.«
»Mein Name ist Tong Kwok-tai, Herr«, sagte der Etagendiener mit ergebenem Lächeln. »Werden Sie mich, bitte, immer verbessern, wenn ich etwas Englisch schlecht sage?«
»Bisher war nichts zu verbessern, Ah Tong.«
»Sie sind zu freundlich, Herr.« Und als wir in das Zimmer zurücktraten, fragte er: »Sie haben ein Mädchen hier, Herr?«
»Ein Mädchen? Nein.«
Ich nahm an, dass er unter »hier« Hongkong verstand, und begriff immer noch nicht. Ich fuhr in dem rumpelnden Lift hinunter und hinterlegte bei dem Empfangschef eine Summe als Anzahlung. Er schrieb in chinesischer Schrift eine Quittung aus. Durch eine Drehtüre hörte ich aus einem Nebenraum gedämpfte Tanzmusik. Mit einer Kopfbewegung nach der Tür deutend fragte ich: »Was ist das?«
»Bar.«
»Gut, ich trinke ein Bier.«
Ich schritt durch die Halle, und gerade in diesem Augenblick schwang die Tür herum und ein Matrose der Königlichen Marine kam heraus. Er war klein, drahtig, sonnenverbrannt. Auf der Mütze trug er in goldenen Lettern die Aufschrift: H. M. S. Pallas.
Er nickte mir zu, flüchtig grüßend.
»Großer Gott, die Marine«, lachte ich. »Die hab ich zu allerletzt hier erwartet.«
Sein Seitenblick war ebenso seltsam wie der des Mannes hinter der Theke. »Viel anderes werden Sie hier nicht treffen, Kamerad«, sagte er. »Im Nam Kok nicht.«
»Nicht? Sie meinen, dass es hier keine Chinesen gibt?«
»Nur die Mädchen, die sind alle Chinesinnen.«
Wieder schwang die Tür auf, und ein chinesisches Mädchen kam herausgeflattert, lachte und sagte zu dem Matrosen: »He, du hast mich sitzen lassen.« Sie hatte hohe Absätze und trug ein Cheongsam-Kleid mit hohem Kragen und seitlich geschlitztem Rock. Ich fand sie sehr hübsch.
»Und sie sind brave Dinger, wenn man sie anständig behandelt«, sagte der Matrose mit Besitzermiene. »Was, Nelly? Stimmt das nicht?«
»Sicher, wir sind furchtbar nett«, bestätigte das Mädchen kichernd. »Aber komm jetzt, du redest zu viel. Machst mich chokka.«