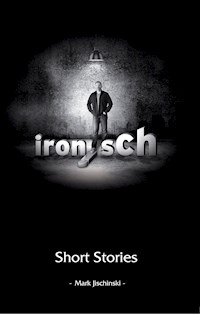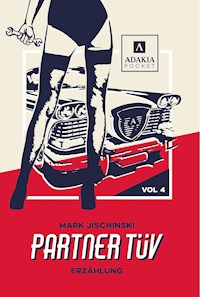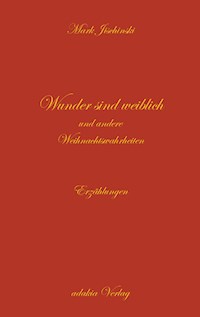Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adakia Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie viel Rückzug brauchen wir, um der Reizüberflutung zu entgehen? Ändern wir uns selbst im Kern, wenn wir die Umstände ändern? Wo finden wir den ganz individuellen Sinn des Lebens, wenn an jeder Ecke Ablenkung und Verführung lauern? Erik Fink ist auf der Suche nach Lebenssinn und zieht sich in ein Haus auf dem Land zurück. Er saniert es, lebt sich ein und merkt sehr schnell, dass man alte Gewohnheiten nur sehr schwer ablegt. Frauen, 20er-Jahre-Partys im »Swinging Village« und die Fas¬zi¬na¬ti¬on der »Lost Generation« sind Verlockungen, denen er sich nicht entziehen kann. Ein Roman über die Suche nach dem Glück in einer Welt, die alles bietet, um die innere Leere zu füllen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Jischinski
Swinging Village
Roman
adakia Verlag UG (haftungsbeschränkt)
Richard-Wagner-Platz 1, 04109 Leipzig
Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte Daten sind im Internet über die Homepage http://www.dnb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig.
Gesamtherstellung: adakia Verlag, Leipzig
Coverfoto: Shutterstock, Artem Shutov Leo 618009656
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
1. Auflage, Oktober 2019
ISBN 978-3-941935-46-4
»Da lag sie. Mausetot.«
Ich drehe mich um.
»Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken.« Ein alter Mann mit kurzen weißen Haaren steht im Türrahmen und streckt mir die Hand entgegen. »Brause, wie das Getränk.«
Wahrscheinlich meint er damit seinen Namen. »Erik Fink«, antworte ich deshalb und strecke ihm meine Hand entgegen.
»Ziehen Sie hier ein?«, fragt er und beschreibt einen vagen Bogen mit dem Arm, der das Haus meinen könnte, aber auch halb Europa.
»Sieht so aus. Und wer lag dort?«, frage ich mit einem Nicken in Richtung Fenster.
Brause starrt ins Leere, dann in meine Richtung, aber sieht durch mich hindurch und fixiert einen Punkt im Nirgendwo. »Frau Lorenz, die Vorbesitzerin. Wir kannten sie schon ewig, meine Frau und ich. Sie ist wunderlich geworden, aber hatte den Haushalt noch gut im Griff.« Er schaut sich betont langsam um. »Zumindest einigermaßen.«
»Woran ist sie denn gestorben?«
»Einsamkeit, Krebs, Haushaltsunfall, keiner weiß es. Mord war es jedenfalls nicht. Aber sie lag lange dort. Ich finde«, er bewegt die Nase wie ein Kaninchen, »man kann es noch riechen.« Er läuft im Raum auf und ab. In seiner blauen Latzhose mit dem Zollstock in der Seitentasche und mit einem neugierigen Mustern jeder Ecke des Raums sieht er aus wie ein Arbeiter, der die Baustelle vor der Sanierung abschreitet. »Es muss schlimm sein, die letzten Jahre allein zu leben.«
Zuerst dachte ich, dass das Röcheln aus den alten Leitungen in den Wänden kommt und sich trübes Wasser durch Ablagerungen und Unrat kämpft. Doch es stammt eindeutig aus der Lunge des Herrn Brause, den die paar Meter, die er im Zimmer auf und ab gegangen ist, sichtlich anstrengen. Seine Stirn ist rot wie ein Pavianarsch. Ein paar Mal atmet er tief ein und aus, schnauft wie ein altersschwaches Tier, das sich jeden Moment zum Sterben bettet.
»Am Ende war es sicher erlösend für die Grete. Nur schade, dass ihre Enkelin im Urlaub war und ich sie finden musste.« Er steht nun vor mir und legt mir die Hand auf die Schulter. Mit seinem Mund ganz nah an meinem Ohr flüstert er: »Das sind Bilder, die vergisst man einfach nicht. Der Tod hat kein schönes Gesicht. Sehen Sie zu, dass Sie ihn ganz schnell aus diesen Mauern bekommen. Nicht, dass sich der Gevatter hier einnistet. Sie wirken noch so jung.«
Er klopft ein paar Mal kräftiger auf meinen Rücken, als es sein Atem vermuten lässt und nickt bedeutungsvoll. Brause schwitzt stark.
Ein LKW ist zu hören. Er bremst scharf und laut. Ich schaue durch das Fenster nach draußen und sehe den Möbelwagen. »Entschuldigen Sie mich bitte«, sage ich zu Brause, der im Schädelbereich wie ein in Flammen stehendes Michelinmännchen aussieht und mir im Weg steht. Ich ziehe den Kopf ein, um durch die niedrige Wohnzimmertür zu passen und gehe durch den Flur nach draußen.
Einer der Möbelpacker kommt mir entgegen. »Wo sollen wir alles hinstellen?«
Ich habe keine Ahnung. »Stellen Sie bitte alles in das Wohnzimmer im Erdgeschoss nach hinten rechts. Ich sortiere mir dann die Kisten und Möbel, wie ich es brauche.«
»Alles klar«, sagt der athletische Mann und geht zum Transporter. Ich laufe zurück ins Haus und schaue mich genauer um. Der Eingangsbereich ist holzvertäfelt und dunkel, Spinnweben hängen an den Decken und Wänden und die Gardinen an den Fenstern zum Hof stammen aus dem letzten Jahrhundert. Beim einzigen Besichtigungstermin sah es bei Weitem nicht so schlimm aus. Der Makler führte mich flink durch alle Räume, rasselte das übliche Geschwätz herunter, das sie in der Ausbildung lernen, wenn sie eine Bruchbude schnellstmöglich loswerden wollen. Mir war es egal. Ich wollte nicht lange suchen. Wenn ich gezögert hätte, dann wäre ich nie hierhergekommen.
»Ich kaufe das Haus«, sagte ich dem in seinem schicken Anzug völlig deplatziert wirkenden Makler, der vor Freude fast in sein iPad biss. Nun bin ich hier, die Möbelpacker tragen meine Sachen in ein Haus, das ich nicht einmal richtig kenne und Brause, der möglicherweise mein neuer Nachbar ist, kann ich nicht mehr finden. Ich rufe seinen Namen in jede Richtung, aber er ist weg. Die Treppe nach oben ist aus dunklem Holz. Sie knarrt bei jedem meiner Schritte vor Altersschwäche und die Stufen sind durchgetreten und gebogen. Im Obergeschoss angekommen, stehe ich in einem kleinen Flur von drei mal drei Metern, von dem aus es links in ein Miniaturzimmer geht. Es hat vielleicht acht Quadratmeter, ein winziges Fenster spendet kaum Tageslicht und ein Fußboden, der diese Bezeichnung verdient, fehlt. Ich sehe schiefe Balken und zwischen ihnen nur Lehm und Dreck. Daneben ist das Schlafzimmer. Alte Möbel stehen ungeordnet darin. Vom Stil her 60er Jahre und älter. Eine Kommode, ein Schrank, ein Nierentisch. Ein Bett gibt es nicht mehr, aber ich kann an der Wand deutlich erkennen, wo es stand und auch die Nachttische hinterließen helle Umrisse als Zeugnisse einer bewohnten Vergangenheit. Ich verdränge den Gedanken, dass die alte Frau Lorenz hier geschlafen hat. Zuhause sterben die Menschen kaum noch. Normalerweise haben die Erben diesen Akt bereits zu Lebzeiten vorsorglich in Heime verlagert.
Das dritte Zimmer ist nicht bewohnbar. Völlig entkernt, blanke Lehmwände und alle zwei Meter ein maroder Balken. Auch hier ist der Fußboden aufgerissen und die Decke fehlt. Es zieht direkt vom Dach herunter, das Holz ist morsch und durch die Fenster pfeift der Wind. Ich schlage den Kragen meiner Jacke hoch. Hier wartet eine Menge Arbeit, aber so habe ich es gewollt.
Unten kann ich die Möbelpacker schnaufen hören. Sie wuchten Schränke und Kisten ins Wohnzimmer. Ich werfe noch einen Blick ganz nach oben. Eine kleine, völlig verdreckte Treppe schlängelt sich bis unters Dach. Ausbaureserve nennt man das wohl. Mal schauen, was ich damit mache.
»Hallo?«, höre ich eine angenehm gefärbte Frauenstimme aus dem Erdgeschoss rufen.
Ich gehe die Treppen nach unten. Eine attraktive Rothaarige steht im Flur und reckt ihr hübsches Gesicht nach oben. Mitte vierzig, maximal, nicht zu aufdringlich geschminkt und mit einem umwerfenden Lächeln. Sie trägt ein blaues Kleid, darüber einen schwarzen Mantel und drückt eine Tasche an ihre Brust.
»Sind Sie der Neue?«
»Hallo und ja, das bin ich wohl«, antworte ich.
»Guten Tag! Sie müssen dann Herr Fink sein, oder?«
»Ja«, sage ich, noch hin und weg von ihrer leicht dunklen Stimme.
»Ich bin Claudia Lorenz. Die Enkelin der Vorbesitzerin.«
»Ah, ja«, bemerke ich unbeholfen. »Richtig, die Dame, die leider hier gestor…«
»Ja, leider«, antwortet die Enkelin schnell. »Aber vierundneunzig ist so schlecht nicht.«
Sie stellt ihre Tasche auf eine kleine Kommode im Flur und offenbart eine ansehnliche Figur in ihrem Kleid, die der nun leicht geöffnete Mantel nicht mehr verbergen kann. Ich bemühe mich, nicht zu offensichtlich auf ihre Brüste zu starren.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, frage ich.
Sie schenkt mir ein entwaffnendes Lächeln. »Wir haben zwar schon alles ausgeräumt, aber ich würde gern noch einmal alles durchsehen. Vor allem oben. Darf ich?«, fragt sie und tritt vor mich. Ich stehe auf der untersten Stufe der Treppe, trete neben sie und weise ihr mit einer Geste den Weg nach oben.
»Danke.«
Der Blick aus ihren blauen Augen geht durch meine hindurch, sprengt alle Nervenbahnen und lähmt mein Sprach- und Denkzentrum. Niedere Bedürfnisse werden dafür deutlich aktiver.
Sie geht voraus und wackelt mit einem sagenhaften Hintern, den ich trotz der Unmenge Stoff geradezu spüren kann. Alles wirkt wie die perfekte Inszenierung in einem Hollywoodfilm, den ich direkt vor mir sehe. Die elegante und erfolgreiche Frau aus der Stadt nimmt Abschied vom Haus ihrer Kindheit. In einer Rückblende sieht man sie als kleines Mädchen mit einem Lachen voller Zahnlücken, in einer staubigen Latzhose, die Füße in schlammigen Gummistiefeln. Die Oma kocht derweil ein Essen aus Zutaten, die sie gemeinsam im Garten geerntet haben und abends spielen sie Mikado. Oder sie lesen bei einer Kanne Tee, während der Kachelofen sein einlullendes Brummen von sich gibt. Nun stöbert sie in den Möbeln der Oma, um auf Relikte aus einer viel zu fernen Vergangenheit zu stoßen. Dinge, die einen Platz in ihrem Herzen haben und die die Erinnerung wach halten. Dabei trifft sie auf einen schmuddeligen Typen, den sie noch nicht einzuordnen weiß, der aber ganz eindeutig scharf auf sie ist. Sie merkt es mit Sicherheit, während er sie anstarrt wie ein kleiner Junge, der mit der Situation völlig überfordert ist.
Sie steht jetzt im kleinen Flur oben, schaut sich um und zieht mit einer gleichsam banalen, wie sinnlichen Bewegung die hohen Schuhe von den Füßen. »Ganz schön eingestaubt alles. Können Sie mir bitte aus dem kleinen Schrank unten im Flur die Gartenschuhe bringen?«
Natürlich kann ich das. Zwei Träger wuchten gerade den alten Schreibtisch durch die Tür ins Wohnzimmer und ein dritter folgt ihnen mit zwei übereinandergestapelten Kisten. Ich finde die Schuhe sofort. Größe 37 in einem englischen Blumenmuster. Irgendwie kitschig, aber mit Stil. Ich gehe zurück nach oben und werde auf halber Strecke durch ihren perfekten Fuß gestoppt, den sie mir frech entgegenreckt. Sie streckt ihn durch und er ist direkt vor mir, auf Augenhöhe. Zum Anbeißen schön, der perfekte Fuß und eine Einladung für die Entwicklung eines Fetischs mit Extremitäten. Trotzdem ziehe ich ihr die Gartenschuhe nicht über, sondern recke sie ihr entgegen. Sie bedankt sich und schlüpft hinein. Dann stehen wir nebeneinander im Flur. Die Muffigkeit ist verschwunden, ebenso der Geruch von feuchtem Lehm und Dreck. Alles ist erfüllt von ihrem Duft. Sie zeigt in das kleine Zimmer links neben uns.
»Das war in den Ferien mein Domizil. Hier habe ich gelesen und geträumt. Einfach nur schön.«
»Wenn man vom Boden absieht«, sage ich.
»Ja, das ist blöd. Es gab jemanden vor Ihnen, der das Haus nach dem Tod meiner Oma haben wollte. Der Verkauf war schon ziemlich weit vorangeschritten und er hat angefangen, Böden und Decken rauszureißen. Dann hat ihm jemand gesagt, dass das ein Haus aus dem 18. Jahrhundert ist und dass es unter Denkmalschutz steht.« Sie geht in das Zimmer und duckt sich im Türrahmen, obwohl sie wirklich nicht riesig ist. Eins siebzig vielleicht.
»Das wussten Sie aber, oder?«, fragt sie mich mit einem Seitenblick und ich hebe meinen Kopf in Richtung des ihren, löse mich blitzschnell von ihren Beinen.
Der Makler sprach davon. Aber es interessierte mich nicht. Dieses alte Haus hatte ich sofort in mein Herz geschlossen. »Ja, das ist mir bekannt«, sage ich und stehe nun neben ihr im Minizimmer. »Wirkt ganz schön klein, wenn man zu zweit drin steht«, versuche ich einen Scherz.
»Als ich noch klein war, war es riesig«, sagt sie mit deutlicher Sentimentalität in der Stimme.
Wohl kaum der richtige Zeitpunkt für weitere Späße.
»Dann lasse ich Sie mal in Ruhe suchen und umschauen. Oder brauchen Sie mich?«
»Nein, schon gut. Wenn doch, melde ich mich.«
Ich lasse sie allein, gehe nach unten und stelle mich vor das Haus. Ich höre eine Krähe, die viel zu laut schimpft. Die großen Äste der Obstbäume biegen sich kahl im Wind und zwischen ihnen sind Seile gespannt. Hänge ich dort in Zukunft meine Wäsche auf? Eine Katze schleicht durch das nasse Gras und ich sehe zum kleinen Fenster hoch. Hoffentlich ist sie auch eine Nachbarin. Ist zwar unwahrscheinlich, aber hoffen darf ich.
Der Möbelpacker kommt auf mich zu und reicht mir einen Zettel. »Wir sind fertig. Alle Möbel und Kisten stehen im Wohnzimmer, wie abgesprochen. War ja auch nicht viel. Unterschreiben Sie mir das bitte noch?« Ich nehme den mir angebotenen Kuli und unterzeichne das Blatt Papier.
»Gut, dann war’s das. Die Rechnung kommt mit der Post. Einen schönen Tag noch«, sagt er und reicht mir die Hand.
»Einen Moment bitte«, sage ich, greife in meine Hosentasche und gebe ihm zwei Zwanziger. »Für Sie und Ihre Kollegen. Vielen Dank.«
Er bedankt sich und geht zum Transporter.
Die Möbel und Kisten stehen eng beieinander und ich bin froh, dass ich die Einzelteile des Betts und die Matratze an leicht zugänglichen Orten finde. Zum Aufräumen habe ich jetzt keine Lust. Ich stehe im völlig überfrachteten Wohnzimmer und atme tief durch. Morgen ist auch noch ein Tag, sage ich mir und hebe die Matratze auf.
»Wir hatten wohl schon alles eingepackt«, höre ich Claudia Lorenz hinter mir sagen. Ich lasse die Matratze wieder fallen und drehe mich um. Sie steht da mit leicht gefärbten Wangen, über die sich die feuerroten Locken ihrer Haare schwingen, auf jeder Wange ein Grübchen vom Lächeln.
»Wie bitte?«
»Ich habe nichts gefunden. Deshalb denke ich, dass wir schon alles beieinander hatten.«
Schade. Ich gehe ein paar Schritte auf sie zu.
»Dann melden Sie sich einfach, wenn Sie doch etwas vermissen.«
»Das mache ich. Und Ihnen wünsche ich viel Erfolg beim Einräumen und Einleben im Dorf. Bis bald.«
Sie streckt mir ihre Hand entgegen. Ich drücke sie mit einem Lächeln. Kein Ehering, nicht einmal eine Kuhle, wo einer gewesen sein könnte.
»Das hoffe ich. Einen schönen Tag noch.«
Wir gehen nach draußen und sie läuft los.
»Frau Lorenz«, rufe ich und sie wendet sich zu mir. »Ihre Schuhe«, sage ich und zeige auf ihre Füße. »Sie haben noch die Gartenschuhe an.«
Sie lacht schallend und herzlich. Mir gefällt diese echte, authentische Art. »Wo habe ich nur meine Gedanken?«, fragt sie laut und ich wünsche mir, dass einer ihrer abwesenden Gedanken bei mir war. Ich hole die Schuhe aus dem Haus und sie wechselt sie. Dabei verzichte ich auf einen Aschenputtelmoment für mich und lasse sie allein gewähren.
»Nun aber wirklich«, sagt sie energisch. »Einen schönen Tag noch und viel Erfolg bei allem.«
Damit verschwindet sie und ich stehe ein paar Augenblicke später allein inmitten von Umzugskisten und Möbeln in einem Raum, der knappe zwei Meter hoch ist. Eine Glühlampe baumelt an einem Kabel von der Decke. Schwere Balken ziehen sich von einem Ende des Raums zum anderen. Dunkles Holz, völlig erdrückend. Ich werde die Decke in diesem Zimmer weiß streichen, das schöne Holz hin oder her.
Ich verrücke ein paar Kisten und sorge danach dafür, dass ich im oberen Raum schlafen kann. Vor allem schaffe ich Platz im Wohnzimmer um den Kachelofen herum. Noch bevor es dunkel ist, lodert es behaglich in ihm, ich öffne die Türen und er wärmt alle anderen Räume. Am Abend liege ich auf der Matratze im Schlafzimmer, einem schlauchartigen Raum, knapp zwei Meter fünfzig breit, aber sieben Meter lang. Neben mir auf dem Boden steht eine uralte Nachttischlampe, die mir ein schwaches Licht spendet. Meinen Blick lasse ich über die Decke schweifen, wo an unzähligen Stellen Strohhalme aus dem Lehm ragen. Die Balken der Wand und der Decke sind vergilbt und zum großen Teil von Würmern zerfressen. Den Kopf in meine verschränkten Arme gebettet, schaue ich mich um und lächle. Gut, dass ich das gemacht habe, ohne großartig nachzudenken. Das wird eine sehr befriedigende Arbeit werden. Ein richtig schönes Projekt.
Am nächsten Morgen klopft es energisch an der Haustür.
»Hallo?«, hallt eine tiefe Männerstimme von unten durch den gesamten Flur zu mir nach oben.
»Moment!«, schreie ich, so laut ich kann, stehe auf und steige in meine Jeans. Dann ziehe ich einen Pullover über das T-Shirt und schlüpfe in die Turnschuhe. Ich habe dieselben Klamotten vom Vortag an, etwas anderes ist noch nicht ausgepackt.
Ich öffne die Tür und ein beleibter, überaus gemütlicher Fleischer steht in der Tür. Es gibt Menschen, die bekommen die Berufswahl in die Wiege gelegt. Zartrosa Haut, dicke Backen und eine Nase wie … Nein, er sieht doch nicht aus wie ein Fleischer, eher wie ein Schwein. Ein kleines Schwein. Er ist das Ferkel.
»Bruns, hallo«, begrüßt er mich mit einem Grunzen und entgegengestreckter Hand. »Sie sind der Neue, nicht wahr?« Sein Grinsen geht von einer Schwarte zur anderen und verdrängt dabei zwei Kilo Fett auf jeder Seite. Der Druck seiner Haxe zerquetscht meine Hand spielerisch.
»Ja«, zische ich unter Schmerzen und atme durch, als er wieder loslässt.
»Ich dachte, dass ich mal hallo sage«, bellt er eine Spur zu laut. »Kommen Sie doch heute Abend mal in den Krug. Ist ja nicht weit von hier. Einfach Richtung Dorfmitte und dann laufen Sie direkt drauf zu. Das erste Bier geht aufs Haus.«
»Ah, sind Sie der Wirt … ähm, also der Inhaber vom Dorfkrug?«
»Ja, aber nicht nur. Ich bin der Bürgermeister. Also nicht vom Dorf, sondern von der Verwaltungsgemeinschaft. Ehrenamt, klar. Wenn Sie Probleme haben, kommen Sie am besten direkt zu mir in die Wirtschaft.«
Er drängt sich an mir vorbei. Geradezu spielerisch schiebt er mich zur Seite, als wäre ich ein störendes Möbel, ein Leichtgewicht noch dazu. Wie ein Bausachverständiger lässt er den Blick schweifen, vom Boden zur Decke, in alle Ecken, die Treppen hinauf und dann öffnet er auch noch die Tür zum Wohnzimmer.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragt er mit Schweiß auf der Stirn. »Das sieht nach einer Menge Arbeit aus.« Er trägt ein schwarz-weißes Flanellhemd, das er tief in eine schwarze Cordhose geschoben hat. Über seinen mächtigen Bauch spannen sich rote Hosenträger und die Füße stecken in unglaublich großen Gummistiefeln. Er schaut zur Treppe hinauf. »Sagen Sie mal …«, fragt er und damit geht er die Stufen nach oben. Das Holz ächzt und atmet die Last aus. »… sieht das eigentlich noch immer so schlimm aus?«, höre ich ihn aus dem kleinen Zimmer rufen. Das Spielzimmer der Frau Lorenz. Ich sehe sie gedanklich vor mir, höre aber nur die Stimme des Ferkels. Eine verstörende Phantasie.
»Da haben Sie sich aber was vorgenommen!«, schreit der Bürgermeister.
Ich will ihm gerade in die erste Etage folgen, da stampft er schnaufend die Treppe herunter und kommt mir entgegen. Er steht vor mir, holt aus seiner Hosentasche ein kariertes Stofftaschentuch und tupft sich in großer Ausführlichkeit die Stirn ab. »Schön geheizt haben Sie ja schon mal. Aber die alten Kachelöfen machen auch ganz ordentlich Alarm.« Er beugt sich zu mir. »Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn sie hier was umbauen. Mit dem Denkmalschutz habe ich es nicht so.« Bruns kommt noch ein Stück näher und ich merke, wie sich die Härchen an meinem Ohr und im Nacken aufrichten. »Sie können ja unmöglich so bauen wie vor ein paar hundert Jahren, nicht wahr?«
Er tritt wieder zurück und zwinkert mit einem Auge. Ich hoffe, dass es eine verschwörerische Geste ist und kein nervöser Tick, denn er sieht damit eher entstellt aus, als jovial. Er nickt vor sich hin und dabei wackelt sein dünnes blondes Haar auf dem Kopf.
»Draußen müssen Sie aber schon mal alles herrichten. Jetzt im Herbst und im Winter mag das ja noch gehen, da heißt es nur streuen und Schnee schippen, wenn er denn kommt. Aber im Frühling und Sommer sehen es die Gemeindemitglieder gern, wenn die Gehwege frei von Unkraut und Dreck sind.« Er legt mir die Hand auf den Arm. »Aber nur die Ruhe, nichts überstürzen.«
Ich nicke. »Ja, natürlich«, bestätige ich vorsichtshalber.
Bürgermeister Bruns steht unbeholfen in der Diele, wippt vor und zurück und lächelt mich an. Wartet er auf einen Kaffee, den ich ihm noch nicht anbieten kann? Hofft er auf eine Einladung zum Frühstück in den Krug? Auf meine Kosten?
»Und?«, fragt er schließlich, was mir allerdings mangels Präzision nicht weiterhilft. Sein Blick ruht auf mir wie der eines enttäuschten Lehrers, der eine einfache Frage gestellt hat, der dumme Schüler aber die Antwort nicht weiß.
Ich sehe ihn fragend an, lächle, ziehe beide Augenbrauen nach oben, nicke. Gefühlt verbringen wir mehrere Minuten mit der sehr offenen Frage.
»Was verschlägt sie hierher in unser schönes Dorf? Wollen Sie hier arbeiten, pendeln Sie?«, lüftet er endlich das Geheimnis.
Ich überlege. Was geht ihn das an? Ich bin da, das muss reichen.
»Im Moment kümmere ich mich erst einmal um das Haus, lerne die Leute kennen und dann sehe ich weiter.«
»Mmh«, grunzt das Ferkel. Die Röte ist aus dem Gesicht gewichen und er glänzt inzwischen zartrosa. »Ein Aussteiger also. Davon haben wir einige hier. Sie werden schon alle kennenlernen. Sind ziemlich nett, wirklich.«
Damit schiebt er sich an mir vorbei, reicht mir wieder die Hand und zerquetscht meine ein zweites Mal. »Herzlich willkommen, Herr …?«
»Fink. Erik Fink.«
»Wir sehen uns im Krug, Herr Fink. Bis dann!«
Ich trete nach draußen vor das Haus und sehe ihm nach. Das Ferkel läuft den Weg bis zum völlig morschen Holztor mit breiten Schritten, wobei die Oberschenkel aneinander reiben. Dann biegt er nach links ab. Er zeigt auf den Eingang und brüllt: »Das sollten Sie in jedem Fall mal reparieren! Und denken Sie daran, ein Namensschild am Briefkasten zu befestigen. Das muss nun wirklich sein!« Er winkt mir zu und wankt von dannen.
Ich nehme beide Hände vor das Gesicht und atme hinein. Sie riechen nach Schwein. Zähneputzen wäre auch eine gute Idee. Dann rieche ich an meinen Achseln. Duschen ebenso.
Bad und WC befinden sich hinter der Küche. Alte Rohre hängen an der Wand, eine verdreckte Badewanne steht auf brüchigen Dielen und ein baufälliger Badeofen wartet auf den Bestatter. Duschen fällt aus. Ich drehe den Wasserhahn auf und nichts tut sich. Zähneputzen also auch.
Nach dem Pinkeln stelle ich fest, dass ich in den nächsten Tagen mit einem Eimer Wasser aus der Regentonne spülen muss. Die Sanitäreinrichtungen sind also als erstes dran.
»Herr Fink, sind Sie da?«, höre ich es aus dem Flur. Ich laufe durch die Küche und sehe Brause vor mir stehen.
»Tschuldigung, alte Gewohnheit«, sagt er mit einem Achselzucken. »Frau Lorenz hatte mir einen Schlüssel gegeben, um immer mal nach ihr zu schauen. Sie war ja nicht mehr so gut auf den Beinen. Hat aber noch alles hinbekommen, na ja, fast alles.«
Er steht in meinem Flur, als wäre er hier zu Hause und nicht ich. Im Moment habe ich eher das Gefühl, in einer Bahnhofshalle zu wohnen, als im eigenen Heim.
»Wohnen Sie eigentlich allein hier?«
»Ja.«
»Keine Frau? Oder …«, er räuspert sich, »ein Mann?«
»Nein, ich lebe allein.«
»Aber Probleme bei Frauen haben Sie doch nicht, oder?« Er schaut mich von oben nach unten an. Ich fühle mich wie bei Germanys next Topmodel für Senioren. Lachen muss ich trotzdem.
»Nein. In der Regel haben die Probleme mit mir.«
Brause nickt verschwörerisch. »Dann haben Sie ja genügend Zeit. Legen Sie sich mal ins Zeug. Arbeit ist ausreichend da, nicht wahr?« Er geht schweren Schrittes nach draußen und ich sehe ihm nach. Den Schlüssel hat er wieder in seine Arbeitshose gesteckt. Der Brause ist seit mindestens zwanzig Jahren Rentner, trägt aber einen Blaumann, als würde er noch immer einer Beschäftigung nachgehen. Arbeitsam ein Leben lang.
»Ach, Herr Brause«, rufe ich und folge ihm auf den Hof. Er dreht sich um und sieht mich fragend an. »Wäre es wohl möglich, dass ich in den nächsten Tagen einmal … ähm … also bei Ihnen … duschen darf?«
Brause mustert mich und stemmt die Hände in die Seiten. »Ich hatte mich gewundert, warum jemand ein Haus kauft, bei dem die Wasseranschlüsse abgeklemmt sind und dann holterdiepolter einzieht, ohne das vorher zu ändern.«
Das »vorher« betont er übermäßig deutlich.
»Nun ja, ich hatte es eilig mit dem Umzug und war mir nicht ganz im Klaren darüber, wie die Lage hier ist. Genau genommen bin ich etwas überrascht, aber ich komme auch damit zurecht, in den nächsten Tagen mit der Regentonne vorliebzunehmen.«
Brause schüttelt den Kopf. »Ihr jungen Menschen werdet immer komischer. Von intelligenter Planung und gescheiter Durchführung seid ihr Generationen entfernt. Aber Hauptsache, ihr wisst, wie man etwas googelt oder bei Amazon bestellt.«
»In einer Woche sieht das schon anders aus, lieber Herr Brause. Dann werde ich das Bad saniert haben. Es ist als erstes dran. Wenn ich Sie damit zu sehr beläs…«
»Nein«, fällt er mir ins Wort. »Das ist kein Problem. Wir sind hier auf dem Land und da hilft man sich. Kommen Sie mal mit.«
Er stampft vor mir her, schnaufend wie eine Lok, zu seinen schweren Schritten und dem noch schwereren Atem gesellt sich das beständige Klacken, mit dem der Zollstock in der Hose wackelt.
»Hier können Sie ein paar Tage duschen und sich frisch machen.« Wir stehen in einem Raum, der früher ein Schuppen gewesen sein mochte, nun aber ein blitzblankes Bad mit Waschbecken, Dusche, Sauna und Tauchbecken ist. Die Fliesen, Armaturen und die Duschkabine sehen teuer und gepflegt aus. Brause errät mein Erstaunen.
»Wenn Sie mal ein Leben lang fleißig waren, können Sie sich das im Alter auch leisten«, grinst er breit. »Die Tür vom Hof und die hier lasse ich einfach offen, dann können Sie die nächsten Tage reinspazieren, wann immer Sie wollen.«
»Danke«, sage ich. »Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Und das Wasser bezah…«
Brause hebt die Hand und unterbricht mich. »Bitte, unterstehen Sie sich! Für die paar Liter will ich nichts haben. Hauptsache ist nur, dass Sie nicht in der Nacht duschen oder hier mit irgendwelchen Weibern Schweinkram anstellen. Auch wenn es nur unser Zweitbad ist.«
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen.«
»Bei Ihrer Generation weiß man nie …« Er kneift die Augen zusammen und stiert mich an. »Was arbeiten Sie eigentlich?«
»Im Moment gar nichts. Ich mache ein Sabbatical und dann schaue ich, was kommt. Bin für alles offen und konzentriere mich jetzt erst mal auf mein Haus.«
Brause nicht anerkennend. »Muss man sich erst mal leisten können«, brummt er.
Ich bedanke mich noch einmal herzlich und grüble auf dem Rückweg darüber, wie wohl die eigentliche Sanitäreinheit bei Brause aussieht, wenn dieser Prunkbau lediglich die kleine Nasszelle für die Zeit nach der Gartenarbeit und für das Saunieren ist.
Den restlichen Tag über laufe ich durch mein neues Zuhause und mache mir Notizen, was ich in welchem Raum brauche. Baumaterial, Hilfe von Fachleuten, Maschinen und Werkzeuge. Ich baue das Bett und den Kleiderschrank im Schlafzimmer auf, arrangiere die vorhandenen alten Möbel zu einem ästhetischen Ganzen, ich schließe das Radio an und räume Schuhe, Kleidung, Versicherungsordner, Kontoauszüge, Töpfe, Pfannen und Besteck ein. In die Küche stelle ich den Kühlschrank, einen Stuhl, einen Tisch und die Spüle und schon habe ich einen ersten Platz, an dem ich essen kann.
Gegen sechs schleiche ich zu meinem Nachbarn und versuche, beim Duschen so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Doch Brause ist nicht da, ich bin ganz allein und genieße die heiße Dusche und das Wasser, das den Schmutz des Tages von meiner Haut spült. Zurück im Haus durchwühle ich lustlos ein paar Kisten und sortiere Kleinkram. Die Zeit fliegt vorüber und gegen acht frage ich mich, ob ich dem Ferkel einen Besuch in seinem Stall abstatten sollte. Darauf habe ich aber keine Lust. Weder auf den Herrn Bürgermeister selbst, noch auf andere, nicht minder neugierige Eingeborene. Die junge Frau Lorenz startet außer Konkurrenz, aber das tue ich wohl auch bei ihr. Deshalb nehme ich mir das erstbeste Buch aus einer der vielen noch nicht ausgepackten Kisten, setze mich in den Sessel im Wohnzimmer und lese im Licht der funzeligen Deckenlampe. Weit nach Mitternacht lege ich »Die Geschichte der Baltimores« zur Seite und schaue aus dem Fenster. Eine eisige Novembernacht, das Außenthermometer zeigt minus zwei Grad. Ich bin hellwach und kann noch nicht schlafen. Das Buch fesselt mich, aber es gehört genau damit zu den Büchern, die ich nicht in einem Ritt durchlesen will, weil ich länger Freude daran haben möchte. Außerdem will ich die erste Nacht nicht im Wohnzimmer verbringen. Als Neuling sollte ich mir die Zeit nehmen und meine Umgebung entdecken, ganz gleich, wann. Zehn Minuten später stehe ich dick angezogen vor dem Haus. Die Leute aus dem Dorfkrug sollten ihn längst verlassen haben, deshalb ist eine Besichtigung von außen im Moment ungefährlich und nicht begleitet von neugierigen Fragen zu meiner Person.
Der Mond scheint hell über dem Dorf, auf dem Kopfsteinpflaster der Straße glitzern die ersten Eiskristalle und es weht ein kalter Wind. Vielleicht doch keine so gute Idee, um diese Zeit meine neue Heimat zu erkunden. Je näher ich dem Kirchturm in der Dorfmitte komme, desto dichter stehen die Häuser. Sie wirken alle gleich klein und gedrungen. Alte Fachwerkhäuser, die wahrscheinlich in den 90ern saniert worden sind, an denen nun aber erneut der Zahn der Zeit nagt. Hinter einigen Fenstern brennt Licht. Ich schaue auf meine Uhr. Es ist halb zwei. Ich weiß nicht, wer hinter den Rollos und Vorhängen den Abend und die Nacht verbringt, aber arbeiten müssen diese Bewohner wohl nicht. Oder sie ackern im Schichtdienst und sind vor wenigen Minuten nach Hause gekommen.
Irgendwo zentral in der Mitte des Dorfs muss dann auch der Dorfkrug vom Bruns kommen. Ich schaue nach vorn und passiere ein kleines Haus, das nach einiger Zeit wieder ein freistehendes ist. Es ist von einem gepflegten Garten umgeben. Die Straßenlaternen sorgen mit Unterstützung des Mondes dafür, dass ich den gestutzten Rasen sehr gut sehen kann, die akkurat geschnittenen Hecken und die Rosensträucher.
»Hallo, guten Abend«, höre ich eine Frauenstimme. Erschrocken fahre ich herum. Ich kann meinen Herzschlag im ganzen Körper spüren. Vor mir steht eine Person undefinierbaren Alters mit einem kaum erkennbaren Äußeren. Eingehüllt in eine riesige dunkle Kutte, mit einer pelzigen Kapuze und einem Gesichtsschutz. Nur die Augen funkeln etwas im Licht, aber wirklich genau kann ich nichts erkennen. Mein Puls beruhigt sich wieder.
»Guten Abend«, sage ich trotzdem unsicher.
»Schön hier, oder?«, fragt sie und eine weiße Atemwolke löst sich dabei aus dem Stoff über ihrem Mund. »Sie sind der Neue aus der 25«, stellt sie fest und ich überhöre ein mögliches Fragezeichen. »Wollen Sie einen Tee? Es ist ganz schön kalt geworden.«
»Ja, warum nicht«, sage ich.
Wenige Augenblicke später sitze ich in dem Haus mit dem gepflegten Garten. Das Holz im Kachelofen knackt laut, eine Stehlampe spendet warmes Licht und vor mir steht ein Tee. Es riecht weihnachtlich.
»Schwarzer Tee mit Zimt«, sagt meine Gastgeberin, die sich aus der Kutte und unzähligen anderen Sachen geschält hat und nun in einem Rollkragenpullover und in einer Jeans vor mir sitzt. Die Füße hat sie in dicke Wollsocken gepackt. »Ich spaziere gern noch rum«, sagte sie mir beim Eintreten in ihre Wohnung und mehr Erklärungen gibt sie nicht.
Sie ist wahrscheinlich Ende dreißig, hat eine durchschnittliche Figur, ein Durchschnittsgesicht, das aber einen gewissen Reiz hat, und sie ist durchschnittlich groß. Eine Frau, die irgendwo an einem Schalter oder in einem Büro arbeitet und glücklich mit einem einfachen Leben ist. Eine, die man schnell wieder vergisst.
»Mögen Sie Cracker?«, fragt sie mich, als wäre ich Gast bei ihrem Geburtstag oder als hätten wir ein Date.
»Nein, danke. Nicht um diese Zeit«, sage ich freundlich und nippe an meinem Tee. Die Wärme tut gut.
»Ich bin übrigens Juliane. Sie können auch Juli zu mir sagen. Wie der Monat.«
»Erik. Erik Fink«, antworte ich.
Sie lächelt breit und zeigt dabei sehr helle Zähne. Ihre Augen sind braun. Sie sind wahrscheinlich braun, aber ich bin mir nicht sicher, weil das Licht so schummrig ist. Die brünetten Haare sind lang und glatt und sie streicht sie immer wieder verlegen aus dem Gesicht, was unbeholfen aussieht, aber auch ein klein bisschen süß.
»Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment? Ich will nur kurz nach meinem Sohn sehen.«
»Aber ja, natürlich. Ich kann auch gehen. Es ist schließlich schon …«
»Nein, auf gar keinen Fall«, unterbricht sie mich energisch. »Bleiben Sie bitte. Tom ist elf Jahre alt und kein Kleinkind mehr, alles okay.«
Sie geht die Treppen nach oben und ich schaue mich um, lasse die Einrichtung auf mich wirken. Schwere Holzmöbel, alles echt. Die Wände aus Lehm, naturbelassen. Auf den Fensterbrettern flackern Kerzen und vom braunen Kachelofen strömt beständig behagliche Wärme in meine Richtung. Wann hat sie eigentlich die Kerzen angezündet? Es gibt keinen Fernseher, aber ein nostalgisches Radio und einen Plattenspieler. Jede Menge Bücher auf Stapeln in den Ecken, auf den Kommoden und in den Regalen.
Die Treppe knarrt und ich schaue hoch. Juli kommt nach unten und trägt einen roten Seidenkimono und Stilettos. Die Absätze kann ich auf jeder Stufe wie einen Pistolenschuss hören. Der arme Tom, denke ich sofort. Dann steht sie vor mir. Der Kimono ist nur notdürftig verschlossen und gibt ausreichend Raum zur Entfaltung für ihre überraschend prächtigen Brüste in einem schwarzen BH. Auch den Spitzenslip kann ich deutlich sehen. Julis Figur ist der klassische Durchschnitt einer Frau, doch auch der ist verführerisch genug.
»Ich habe es mir etwas bequemer gemacht«, sagt sie, als wäre eine Erklärung für das Offensichtliche noch notwendig, und setzt sich direkt neben mich aufs Sofa.
»Das sehe ich«, sage ich mit trockenem Mund.
Sie lächelt. »Oh, Entschuldigung«, sagt sie und steht schnell wieder auf. Dabei beugt sie sich in meine Richtung betont weit nach vorn, schaut mir in die Augen und lächelt breit. Sie geht in die Küche und kommt mit zwei Gläsern und einer Flasche Wein zurück.
»Mögen Sie Weißwein?«
»Ich, ähm … ja, sicher.«
Sie gießt den Wein in die Gläser und mustert mich dabei immer wieder kurz.
»Ich mag grau meliertes Haar«, flötet sie.
Mein Haar ist an den Seiten sehr früh ergraut und ich hätte es gern noch so wie früher. Voller und dunkelbraun.
»Ich mag Männer, die etwas auf den Rippen haben, aber trotzdem noch athletisch sind.«
Sie macht mich an. Dieser Gedanke setzt sich in mir fest. Ich weiß, dass ich zu viel wiege. Zu wenig Sport, das falsche Essen und nicht ausreichend gesundes Zeug. Und das gefällt ihr?
Sie drückt mir ein Glas in die Hand und wir stoßen an.
»Herzlich willkommen bei mir, lieber Herr Fink. Hoffentlich leben Sie sich gut ein und halten es etwas länger aus, als Ihr Vorgänger.« Sie trinkt das Glas in einem Zug aus, dann rückt sie noch näher an mich heran. Ich klammere mich an meinem fest, als könnte es mir helfen, mich unsichtbar zu machen, eine Wand zwischen uns zu schieben. Nicht, dass sie mir völlig unsympathisch ist und ich mich nicht nach Zweisamkeit, zumindest zeitweiser, sehne, aber es geht selbst mir zu schnell. Ihre Blicke durchbohren mich, sie fährt sich langsam mit ihrer Zunge über die Lippen.
»Wie ist Ihr erster Eindruck?«, fragt sie und ich weiß nicht, in welche Richtung ihre Frage zielt.
»Ein schönes Dorf. Ich mochte es sofort. Klein und gemütlich, aber nicht zu weit weg von der Stadt. Wenn man das pralle Leben vermisst, dann sind es nur ein paar Minuten … ach … sagen Sie, Juli, fahren hier eigentlich Busse in die Stadt?«
Ich kann ihren Gesichtsausdruck nicht deuten. Habe ich den falschen Eindruck geschildert und es ging ihr nicht um das Dorf, sondern um sie und um diesen Moment?
»Haben Sie denn kein Auto?«, fragt sie erstaunt und die Fragezeichen in ihren Augen werden trotz des schwachen Lichts riesig.
»Nein. Ich habe mich mit dem Taxi herfahren lassen und wollte alles hinter mir lassen. Mein altes Leben, die Wohnung, das Auto … sowieso alles Dinge, die keinen wirklichen Wert haben.«
Sie nickt und beißt sich dabei auf ihre Unterlippe. »Ein Schulbus fährt jeden Tag bei uns durch. Sonst käme Tom ja nicht zur Schule. Zur Not können Sie den nehmen. Oder Sie rufen sich wieder ein Taxi. Ist ja nicht weit.« Sie nippt von ihrem Glas und dann ruht ihr Blick auf mir.
»Ist Ihnen warm genug?«, fragt sie mit einem gekonnten Wechsel der Stimmlage. Sie setzt den Wein auf dem Tisch ab, nimmt mir das Glas aus der Hand und legt ihre auf meinen Oberschenkel. Ein Schwall Parfum umhüllt mich. Nicht unangenehm. Ein bisschen zu schwer und zu blumig, aber okay. Ich schlucke trocken. Normalerweise bestimme ich das Tempo, doch Juli ist verdammt schnell.
Die Treppe knarrt. »Mama?«
Ich atme wieder.
»Ja, mein Schatz«, sagt sie, schließt den Kimono und schnellt von mir zurück.
»Ich kann nicht einschlafen. Lesen habe ich schon probiert.«
Sie steht auf und empfängt ihren Sohn am Ende der Treppe. Tom trägt einen gestreiften Schlafanzug und sieht darin so dünn aus wie ein Sträfling, der Wochen in einer Arrestzelle ohne Nahrung verbracht hat.
»Sag unserem Gast, also Herrn Fink, guten Abend«, schlägt ihm seine Mutter vor und schiebt das Gerippe in meine Richtung. Er streckt mir eine Hand entgegen – spindeldürre Haut, die sich über zerbrechliche Knochen zieht – und ich drücke sie nicht zu fest.
»Hallo Tom, was lässt dich denn nicht schlafen? Waren wir zu laut?«
»Nein, manchmal geht es eben nicht. Ich denke zu viel nach«, sagt er bestimmt und für meinen Geschmack deutlich zu klar und zu wach. Er setzt sich auf das Sofa neben mich und strahlt mich an.
»Spielen Sie Karten?«, fragt er mich.
»Eigentlich nicht. Also eher selten.«
»Mama, wo sind die Uno-Karten?«
Schon fliegt der rote Kimono an uns vorbei zum Schrank und holt eine Schachtel mit bunten Karten heraus. Juli setzt sich so, dass ich nun von meinen beiden Gastgebern flankiert bin und Tom schaut mich aus dunkel geränderten Augen an wie ein Untoter, der sich in der Tür geirrt hat. Ich habe keine Ahnung, ob Uno altersgerecht ist oder nicht. Mich beschleicht das unangenehme Gefühl, dass der Kleine mich verarscht.
»Ich gebe als erste«, sagt Juli enthusiastisch und mischt die Karten wie ein Profi in Vegas. Nun erwacht der Untote zu etwas wie Leben und erfreut sich am Spiel. Seine Mutter tischt zwischen den Spielen Knabbereien und Tee auf. Kurz vor vier schiele ich auf die Uhr, verkneife mir ein Gähnen und grinse Juli an, die dann und wann unauffällig zufällig ihre Hand auf mein Knie legt oder meinen Oberschenkel streift. Wenn sie sich energisch nach vorn beugt, um freudig »Uno« zu rufen, hilft mir ein Blick in den Kimono, die Zeit zu überstehen.
Halb sechs legt Juli den Kopf schief, schaut milde auf ihre schwächliche Brut und sagt: »So, mein Liebling, jetzt wird es aber Zeit für dich. Verabschiede dich von Herrn Fink und dann bringe ich dich ins Bett.«
Der Kleine tut, wie ihm geheißen, drückt mir flüchtig die Hand, wirft mir einen überaus merkwürdigen Blick zu und läuft wie ein Schlafwandler die Treppe nach oben. Hoffentlich hat er überhaupt etwas von den letzten Stunden wahrgenommen. Zehn Minuten später steht Juli vor mir und lächelt wie eine Madonna im Kerzenlicht.
»Und was machen wir jetzt?«, fragt sie verrucht und nestelt am Gürtel ihres Kimonos herum. Ich bin hundemüde, aufgerieben vom exzessiven Uno-Spiel und zu nichts mehr fähig, was mit den Dingen innerhalb des Kimono-Gürtels zu tun hat.