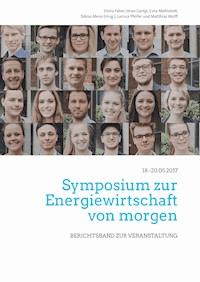
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Vom 18.05.2017 bis zum 20.05.2017 kamen Studierende aus Oldenburg, Darmstadt und vielen anderen Städten Deutschlands in Oldenburg zusammen, um über die Zukunft der Energiewirtschaft zu diskutieren und in Workshops gemeinsam an ganz konkreten Fragestellungen zu arbeiten. Neben interessanten Fachvorträgen und der Arbeit in den Workshops hielt das Programm auch den Besuch des Bremer Weserstadions und der dortigen Photovoltaikanlage sowie eines auf die Energiewirtschaft spezialisierten Start-Up-Zentrums bereit. Der vorliegende Bericht möchte einen Überblick über das Symposium und die dort diskutierten Themen geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VORWORT DES HERAUSGEBERS
Die Energiewirtschaft befindet sich seit Jahren in einem tiefgreifenden Wandel. Erneuerbare und volatil einspeisende Erzeuger ersetzen konventionelle mit fossilen und atomaren Brennstoffen betriebene Kraftwerke. Die gesamte Stromerzeugung wird dadurch grüner, wetterabhängiger und wesentlich dezentraler. Wo früher zentrale Großkraftwerke den Strom auf Ebene der Übertragungsnetze eingespeist haben, wird heute immer mehr Strom dezentral auf Ebene der Verteilnetze eingespeist. Dieser Paradigmenwechsel in der Stromerzeugung bringt viele Herausforderungen auf lokaler Ebene mit sich und bedingt, dass heutzutage wesentlich mehr Akteure aktiv in die Gestaltung und den Betrieb des ganzen Stromsystems eingebunden sind, als zu Zeiten der konventionellen Großkraftwerke. Dieser Trend zu einer steigenden Akteursvielfalt und zu mehr Wettbewerb wird durch die vom Gesetzgeber Ende des vorigen Jahrhunderts angestoßene Liberalisierung weiter verstärkt.
Die Energiewirtschaft ist demzufolge ein äußert spannendes Gebiet mit einer Menge Raum für fachliche Diskussionen. Vor diesem Hintergrund kamen vor rund einem Jahr mit Justin Müller und Maximilian Bannasch zwei Studierende der IBS IT & Business School Oldenburg und der Hochschule Darmstadt auf die Idee, gemeinsam ein Symposium zu den Fragen der zukünftigen Energiewirtschaft von morgen zu veranstalten. Herr Müller, der im Rahmen seines dualen Studiums an der IBS Oldenburg bei der EWE AG beschäftigt ist, konnte seinen Arbeitgeber überzeugen, sich an der Planung, Gestaltung und Finanzierung des Symposiums zu beteiligen. Mehrere Kollegen des Oldenburger Forschungsinstituts OFFIS und der BTC AG konnten dankenswerterweise für Fachvorträge gewonnen werden. Schnell war auch klar, dass die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der Stiftung der deutschen Wirtschaft (sdw) stattfinden sollte, da sich Herr Bannasch und Herr Müller in diesem Kontext kennengelernt hatten und so eine Vielzahl motivierter und breit interessierter Studierender angesprochen werden konnte.
Vom 18.05.2017 bis zum 20.05.2017 war es dann soweit. Studierende aus Oldenburg, Darmstadt und vielen anderen Städten Deutschlands trafen sich bei uns in Oldenburg, um über die Zukunft der Energiewirtschaft zu diskutieren und in Workshops gemeinsam an ganz konkreten Fragestellungen zu arbeiten. Neben interessanten Fachvorträgen und der Arbeit in den Workshops hielt das Programm aber auch den Besuch des Bremer Weserstadions und der dortigen Photovoltaikanlage sowie eines auf die Energiewirtschaft spezialisierten Start-Up-Zentrums bereit.
Der vorliegende Bericht möchte einen Überblick über das Symposium und die dort diskutierten Themen geben. Er soll als Erinnerung für die Teilnehmer dienen und darüber hinaus eine Basis für weiterführende Diskussionen und Initiativen zu den behandelten Themen legen.
Abschließend möchte ich mich im Namen des gesamten Organisationsteams bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken und allen Lesern viel Freude beim Lesen wünschen.
Herzliche Grüße,
Dr.Tobias Menz
Inhalt
HINTERGRUND
Herausforderung Energiewende
Wie kam es zur Idee des Symposiums
Welche Bedeutung hat die Energiewirtschaft für den Nordwesten
Programm und Ablauf der Veranstaltung
IMPULSE
Herausforderungen der Energiewirtschaft von morgen
Smart City Lab Oldenburg
Blackout – Sicherheit der Energiesysteme
Digitalisierung und Exponentialfunktionen
WORKSHOPS
Geschäftsmodelle für die Energiewende
Elektromobilität und Verkehrskonzepte
Apps für die Energiewende
Energiewende für Jedermann
NETWORKING & ENERGIEWENDE VOR ORT
Get-Together in der Alten Fleiwa
Ein Stadion unter Strom
Ein Kraftwerk voller Ideen
ABSCHLUSS & RÉSUMÉ
Marktplatz der Ergebnisse
Persönliches Résumé von Prof. Dr. Jan Hendrik Grävenstein
Persönliches Résumé von Prof. Dr. Lutz Stührenberg
Hintergrund
Windpark in Norddeutschland, Quelle: Oldenburger Energiecluster e.V.
HERAUSFORDERUNG ENERGIEWENDE
Zuverlässig, planbar und günstig oder unregelmäßig, unbeeinflussbar und teuer? Brauchen wir mehr Erneuerbare Energien oder sollte nicht lieber alles so bleiben wie es ist?
Autoren: Momin Hashmi, Kiana Slembeck, Alena Mattfeldt, Marius Curtius
Die Energiewirtschaft ist für das Funktionieren einer Gesellschaft von essentieller Bedeutung. Energie wird in allen Lebensbereichen benötigt und ist insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung unverzichtbar.
Die Energiewirtschaft zählt zu den schadstoffintensivsten Sektoren und hat daher eine hohe Verantwortung für die Umwelt und zukünftige Generationen. Dementsprechend wichtig ist die politische Regulierung des Sektors. In Hinblick auf die gesellschaftliche Verantwortung ist ein Umdenken in der Energiewirtschaft unvermeidlich. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, ist ein Wandel von fossilen Rohstoffen hin zu einer Versorgung durch Erneuerbare Energien (EE) notwendig, wodurch sich in Zukunft aber neue Herausforderungen für den Energiesektor ergeben werden.
Liberalisierung
Bis Ende der 1990er-Jahre wurden die Netze, die Erzeugung und der Vertrieb aus einer Hand, von vertikal integrierten Unternehmen, verantwortet. Auf Grund der volkswirtschaftlichen Ineffizienz dieser vertikal integrierten Marktstruktur sowie der steigenden Bedeutung des Umweltschutzes wuchs die Notwendigkeit an deutlichen Veränderungen. Angestoßen von politischen Novellierungen entwickelte sich über die Jahre aus den Monopolen ein freier Wettbewerb. Lediglich der Bereich der Netze wurde nicht liberalisiert, sondern wird weiterhin von Monopolisten betrieben, da eine doppelte Netzinfrastruktur aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll wäre.
So ist die heutige Energiewirtschaft von intensivem Wettbewerb in der Erzeugung und im Vertrieb, sowie von starken politischen Regulierungen geprägt.
Energiewende
Vor allem das 2015 unterzeichnete internationale Klimaschutzabkommen von Paris verfolgt das Ziel, CO2-Emissionen deutlich zu senken. Daraus folgt, dass viele Staaten zunehmend EE in das Energiesystem integrieren müssen, da diese das größte Potenzial haben, eine möglichst CO2-freie Energieversorgung zu gewährleisten.
Insbesondere Erzeuger wie Photovoltaikanlagen (PV) und Windparks sind für das Klimaschutzabkommen und somit für die Umsetzung der Energiewende zielführend und werden daher in vielen Ländern politisch gefördert. Ihre fluktuierende Stromerzeugung stellt jedoch eine große Herausforderung für die Netzstabilität und die Versorgungssicherheit dar, da der regenerativ erzeugte Strom und der Stromverbrauch oft nicht übereinstimmen. Windparks produzieren nämlich lediglich dann Strom, wenn genügend Wind weht und PV-Anlagen dann, wenn ausreichend Sonne scheint. Durch unbeständige Wind- bzw. Wetterverhältnisse entstehen Schwankungen in der Stromerzeugung, wodurch die Stromeinspeisung vom tatsächlichen Bedarf abweichen kann. Aus diesen Differenzen zwischen Einspeisung und Verbrauch resultieren Frequenzveränderungen im Netz, die eine potentielle Gefahr für die Netzstabilität darstellen und von den Netzbetreibern immer wieder ausgeglichen werden müssen. Ein Ausfall könnte enorme Schäden, sowohl an der Netzinfrastruktur, wie auch an der Infrastruktur der Industrieunternehmen und Haushalte herbeiführen. Vor allem Ausfälle in Bereichen kritischer Infrastrukturen, wie Krankenhäuser und Rettungsdienste, müssen unbedingt vermieden werden, da diese auf eine zuverlässige Energieversorgung angewiesen sind.
Die sogenannte Dunkelflaute beschreibt eine Situation, in der sowohl kein Wind weht, als auch keine Sonne scheint und dementsprechend kein Strom aus Windkraft- und PV-Anlagen produziert wird. Da EE bereits mehr als 30% des deutschen Strommix ausmachen und somit längst einen großen Anteil des deutschen Strombedarfes decken, ist Deutschland schon heute stark von dieser Energiequelle abhängig. Da Deutschland eine CO2-neutrale Energiewirtschaft ansteuert, die zum Großteil auf EE basieren soll, ist der Erhalt der Versorgungssicherheit von essentieller Bedeutung.
Neue Geschäftsmodelle
Doch wo Probleme sind, finden sich auch Lösungen. So werden bereits heute Geschäftsmodelle entwickelt, die die oben skizzierten Herausforderungen der zukünftigen Energieversorgung adressieren.
Dabei spielt insbesondere die intelligente Datenverarbeitung durch sogenannte Smart Grids eine große Rolle. Die Energieversorgung soll künftig digitalisiert werden, sodass Informationen über Verbrauch und Einspeisung mit den Netzbetreibern kommuniziert werden. Die Netzbetreiber haben dadurch die Möglichkeit, in Echtzeit Einund Ausspeisung zu koordinieren und so eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Dafür werden bei Verbrauchern intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, als Übermittlungsmedium installiert.
Da der Strom in Zukunft vermehrt dezentral auf allen Spannungsebenen u.a. auch von privaten Haushalten eingespeist wird, bauen Netzbetreiber beispielsweise regelbare Ortsnetztransformatoren, die es ermöglichen, Teile der Spannungs- und Frequenzschwankungen vor Ort auszugleichen. Die Digitalisierung des Stromnetzes könnte es ermöglichen, die an Bedeutung gewinnenden EE und die damit einhergehende schwankende Erzeugung in Einklang mit dem Verbrauch zu bringen. Versorgungssicherheit, wie wir sie heute kennen, soll so auch in Zukunft gewährleistet werden.
In konventionellen Großkraftwerken kann die Erzeugung reguliert und somit an den Bedarf angepasst werden. Dadurch, dass tendenziell mehr Strom durch EE produziert wird und die Relevanz der konventionellen Kraftwerke abnimmt, entsteht ein weiteres Problem: Wenn kein Strom durch EE erzeugt werden kann, beispielsweise während einer Dunkelflaute, muss der Strombedarf trotzdem gedeckt werden. Dementsprechend sinnvoll ist es, den Strom, der zuvor im Überschuss produziert wurde, zu speichern und später darauf zurückzugreifen. Die zeitliche Abkopplung von Erzeugung und Verbrauch ermöglicht somit eine flexiblere Versorgung, die noch unabhängiger von konventionellen Kraftwerken ist.
Im Rahmen der Energiewende ist insbesondere für solche Speicherlösungen ein Markt entstanden, in dem viel geforscht und diverse Lösungen entwickelt werden. Momentan sind viele Speicher noch nicht effizient oder in der benötigten Größe nicht realisierbar, nichtsdestotrotz haben sie ein großes Potential und spielen eine wichtige Rolle in der Energieversorgung von morgen. Vor allem die Pumpspeicherkraftwerke in Norwegen bieten eine umweltfreundliche Speichermöglichkeit. Sie zeigen beispielhaft, wie die Umwelt für Speichertechnologien genutzt werden kann und verdeutlichen, dass auf dem Weg zur Energiewende innovative Lösungen gefragt sind. Doch nicht nur die Umwelt profitiert von der Energiewende, auch die Verbraucher können künftig ihren Nutzen ziehen. Da in Zukunft Informationen über Verbrauch und Erzeugung übermittelt werden, können Geräte entwickelt werden, die ihren Verbrauch dem aktuellen Strompreis anpassen. Wenn über den Bedarf hinaus eingespeist wird, beispielsweise weil der Wind gerade stark weht, sinkt der Strompreis, woraufhin die Nachfrage steigt, sodass Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sind. Da die Geräte ebenfalls digital mit dem Netz verbunden sind und Daten über den aktuellen Strompreis empfangen, kann ein individuelles Verbraucherverhalten eingestellt werden. Somit kann beispielsweise bestimmt werden, ob Strom zusätzlich durch Wärme- oder Kältespeicher verbraucht werden muss. So entstehen auch hier viele neue Geschäftsmodelle.
Tankklappe eines Elektrofahrzeugs,
Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft
Photovoltaikanlage auf einer Scheune
Quelle: Oldenburger Energiecluster e.V.
Mit der Energiewende steigt die Bedeutung des Stroms und gerade der Verkehrssektor ist ein Bereich, der zwar einen großen Energieverbrauch aufweist, dieser aber größtenteils auf umweltschädliche Brennstoffe wie Benzin zurückzuführen ist und nur zu einem geringen Teil durch Strom bei Elektroautos. Markthindernisse, wie geringe Speicherkapazitäten oder eine noch nicht flächendeckend ausgebaute Ladeinfrastruktur verlieren immer mehr an Substanz, da aufgrund des großen Potentials der E-Mobilität viel in dem Bereich geforscht wird.
WIE KAM ES ZU DER IDEE DES SYMPOSIUMS?
Die Idee des Symposiums „Energiewirtschaft von morgen“ stammt von den zwei Studenten Justin Müller aus Oldenburg und Maximilian Bannasch aus Darmstadt. Wie es dazu kam und welche Tipps sie Studenten in diesem Kontext mitgeben, erläutern sie in diesem Interview.
Interview von Larissa Pfeifer
Wie kam es zu der Idee, dass zwei Studenten ein Energiesymposium ins Leben rufen?
Justin Müller: Das Symposium entstand tatsächlich eher durch Zufall. Wir haben uns im Rahmen der Stipendiatentätigkeit bei der Stiftung der deutschen Wirtschaft (sdw) kennengelernt und herausgefunden, dass wir beide Energiewirtschaft studieren. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Hochschule Darmstadt, an der Maximilian studiert, eher einen technischen Schwerpunkt hat und die IBS Oldenburg eher wirtschaftlich orientiert ist. Schnell sind wir uns darüber einig geworden, dass dort Synergien geschaffen werden können und warum setzt man so etwas nicht in einer gemeinsamen Veranstaltung um?
Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der jeweiligen Akademien, der sdw und des EWE-Konzerns folgte relativ schnell das Einverständnis und wir konnten mit der Planung starten. Natürlich lief das nicht immer ganz ohne Hindernisse ab, aber durch stetiges Nachhaken und Telefonieren konnten wir so das Konzept auf die Beine stellen.
Was ist aus eurer Sicht der Mehrwert dieser Veranstaltung?
Maximilian Bannasch:





























