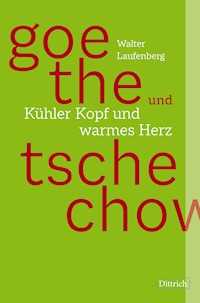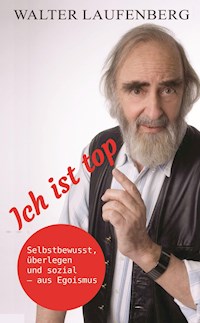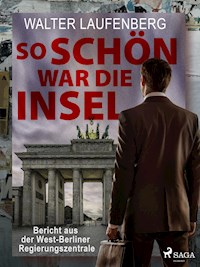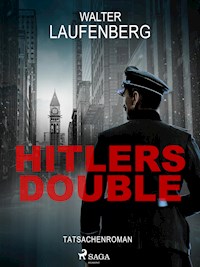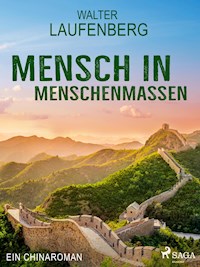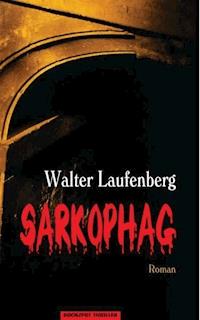Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über die Freundschaft zwischen Frauen und ein symbolträchtiges Sylvesterfeuerwerk, das das Ende eines stürmischen Jahrzehnts besiegelt! Zwei Jugendfreundinnen begegnen sich in Berlin Ende der 70er Jahre völlig unerwartet und unter dramatischen Umständen wieder: Einst waren sie unzertrennlich und doch auch ein klein wenig Rivalinnen, dann trennten sich ihre Wege, und nun sitzt die eine als Terroristin in Untersuchungshaft, und die andere muss sie als Strafrichterin verurteilen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Laufenberg
Tage des Terrors. Tatsachenroman
Saga
Tage des Terrors. TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 2000, 2020 Walter Laufenberg und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726576702
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Bis auf die Orts- und Zeitangaben sowie ein paar Figuren der Zeitgeschichte ist im folgenden alles frei erfunden. Jeder Name, jede Person, Handlung und Einstellung, ebenso jedes Gefühl, Urteil und Vorurteil. Und auch mit Ihrer Zeit, liebe Leserin, lieber Leser, hat dieses Buch natürlich nichts zu tun. Etwaige Übereinstimmungen mit Lebenden oder auch Nichtlebenden, mit ihren Äußerungen und sonstigen Taten, können deshalb nur Zufall sein, sind also nicht dem Autor anzulasten. Vielmehr müßte den Grund dafür jeder bei sich selbst suchen.
1.
Berlin, Frauenhaftanstalt Lehrter Straße. Eher Fluch als Adresse. Und der Hochsicherheitstrakt, das kranke Herz des schwerblütigen Gebäudekomplexes, ist der gräßlichste Fluch. Ist wie eines dieser Schwarzen Löcher im All, in denen eine ganze Welt verschwunden ist. Die Wirklichkeit einer vergessenen Art von Lebewesen. Verloren. Doch in diesem Schwarzen Loch gab es plötzlich Unruhe. Denn einer aus der Welt der Menschen war zu den Verschwundenen herabgestiegen. Was selten geschah. Um so verständlicher, daß Renate Hobbes viele Klopfzeichen und Zurufe zu hören kriegte, als sie nun über die langen, leeren Gänge geführt wurde. Hin zu dem Besprechungszimmer, wo sie mit ihrem Rechtsanwalt und dem Ermittlungsrichter eingeschlossen wurde. Der Richter mußte dabei sein, wußte sie. Wenn er in dem Moment auch nicht ermitteln durfte, bloß zuhören. Als zwar stummer, aber immer noch gefährlicher Augen- und Ohrenzeuge.
„Untersuchungsgefangene Renate Hobbes“, hatte die Schließerin gesagt und sie wieder so verliebt angesehen, als sie die Gefangene aus ihrer Einzelzelle abholte, „Ihr Wahlverteidiger will mit Ihnen sprechen.“
Jetzt saß die Gefangene da, eine Frau von Mitte dreißig, die unter dem kalten Neonlicht, faltig-grau im Gesicht und mit seltsam leeren Handbewegungen, eher wie eine Endvierzigerin wirkte. Sie begrüßte ihren Wahlverteidiger mit einem bemühten Lächeln.
„Frag nicht, wie es mir geht, Mani“, sagte sie, „und starr mich nicht so an. Sag mir lieber, wie es weitergeht.“
„Ich finde, die Sache läuft gut“, tröstete der Anwalt sie. „Die Staatsanwaltschaft hat nur heiße Luft in der Flinte. Du hast doch die Akte gelesen?“ Und als sie leicht nickte. „Nun, erkennst du dich darin wieder?“
Der Ermittlungsrichter sah so unbeteiligt drein wie möglich. Der Anwalt strahlte soviel Optimismus aus, wie ihm nötig schien. Die Frau zwischen den beiden Männern sah sich hilflos nach den kahlen Wänden um und schwieg. Dann griff sie mit der linken Hand in ihr volles, dunkles Haar und drehte versonnen Löckchen um den Zeigefinger. Der Richter hielt sich hinter seinem ausdruckslosen Pokerface versteckt. Der Verteidiger blieb der Strahlemann, doch wurde er zunehmend unruhiger, je länger seine Mandantin schwieg. Daß sie sich nur nicht durch meine saloppe Frage zu einer Äußerung verleiten läßt, die gegen sie verwandt werden kann. Davor muß ich sie bewahren. Aber noch ehe er seine Frage mit einem nächsten Satz wegwischen konnte, stöhnte Renate Hobbes auf: „Nein, ich erkenne mich nicht darin. Ich erkenne überhaupt nichts mehr hier, hier in diesem...“
„Reiß dich zusammen, Renate“, unterbrach er sie schnell, „du weißt, es geht um sehr viel. Und du darfst dich dabei nicht als unwichtig ansehen.“
Der stumme Zeuge hätte zu gern nachgehakt, hätte gern gewußt, wobei die Beklagte nicht unwichtig sein sollte. Aber das hier war die Sprechzeit ihres Verteidigers, nicht seine. Und so sagte er sich: Keine Frage, es geht natürlich um den demnächst anstehenden ersten Verhandlungstermin in der Sache Renate Hobbes. Und war, was er am liebsten war: beruhigt.
„Ja, ja“, sagte die Gefangene endlich. Sehr nachdenklich geworden. „Ja, – daß ich nicht unwichtig bin, das sage ich mir täglich, seit ich hier einsitze. Seit über einem Jahr sage ich mir das nun schon, Tag für Tag. Und du willst mir das jetzt auch noch einreden. Hast du mir sonst nichts zu sagen, Manfred?“
Ihr Ton war zuletzt energisch geworden, protestierend und fordernd. So daß ihr Anwalt sich beeilte, zu beschwichtigen: „Alles gut, alles gut, wirklich alles. Aber ich nehme an, daß du noch Fragen hast zu den Angaben in der Akte.“
„Fragen? – Nicht direkt Fragen. Aber mir fiel auf, eine der drei Roben, die mich verknacken wollen, ist eine Frau.“
„Das stimmt.“
„Das gefällt mir nicht. Ich habe so ein unbestimmtes Gefühl, als ob mir von daher die größte Gefahr droht. – Und auf meine Gefühle kann ich mich verlassen.“
„Da kann ich dich beruhigen“, war der Anwalt wieder ganz ihr Seelsorger. „Frau Kleine Sextro, diese Richterin, die ist eine sehr ausgeglichene und immer freundliche Frau. Sie ist übrigens in deinem Alter. Ich habe sie noch heute früh im Gericht gesprochen. Da war sie so verstört. Irgendwelche Schmierfinken hatten an die Wand neben ihrer Haustür geschrieben: Es liegt was in der Luft – nicht nur auf der Straße! Sie war ganz aufgeregt, als sie mir das erzählte. Unerhört so was, habe ich ihr gesagt.“
Etwas blitzte auf in den Augen der Beklagten, als sie jetzt ihren Anwalt ansah. Der Ermittlungsrichter kriegte das nicht mit. Jetzt wußte Rechtsanwalt Schallenberg seine Mandantin mit dem Wichtigsten versorgt, mit dem, was sie am dringendsten brauchte. Mit Hoffnung. Er war mit dem Start seiner kleinen Plauderei zufrieden. Die Verständigung hatte geklappt. Der stumme Zeuge war offenbar für die Hintertöne taub. So konnte der Anwalt das lockere Gespräch zielstrebig fortsetzen, konnte schnell zur Sache kommen. Renate Hobbes war hellwach und spielte wunderbar mit, immer noch mit dem Zeigefinger Löckchen drehend. Wie gelangweilt. Wenn nur nicht der lauernde Blick uns verrät, mit dem sie mich ansieht, überlegte Schallenberg. Doch der Ermittlungsrichter sah vor sich hin, offensichtlich über die Harmlosigkeit des Gesprächs glücklich.
Schallenberg suchte die richtige Wendung, die ihn auf Frieder Fehlhaber bringen würde. Klar, daß sie über Frieder was hören will. Klar, daß sie Tag und Nacht an ihren Frieder denkt. Der jetzt so allein ist wie sie. Und ich könnte ihr gute Nachricht bringen. Das aber wieder so auszudrücken, daß ich mich nicht dem Verdacht aussetze, mit den Terroristen gemeinsame Sache zu machen, ihr Postillion in Anwaltsrobe zu sein, das ist die Schwierigkeit.
Doch dann endlich hatte er es. „Vorweihnachtszeit“, sagte er orakelhaft. „Friederfüllt die Welt, in der doch noch so viel passieren kann, ehe das Jahr wirklich zuende ist. Ja, so viel. Aber jedenfalls im Moment geht es gut, ist alles beim alten. Ja, alles noch beim alten.“
Renate Hobbes sah ihn aufmerksam an. Köstlich, dieses Wort friederfüllt, triumphierte es in ihr. Und alles noch beim alten. Das hieß also, daß auch Frieder noch nicht verurteilt war, daß er wartete wie sie. Er in Stuttgart-Stammheim, das wußte sie. Und nun wußte sie auch, daß er nicht auf seinen Prozeß wartete, sondern auf seine Befreiung. Die also noch vor Ende der Jahres durchgeführt werden sollte. Da blieb nicht mehr viel Zeit, aktiv zu werden.
Leider auch nicht mehr für weitere Erklärungen. Die Schließerin kam mit ihrem filmreif rasselnden Schlüsselbund. „Die Sprechzeit ist zuende“, sagte sie.
„Alles, alles mögliche Gute“, wünschte die Untersuchungsgefangene ihrem Anwalt zum Abschied. Und der wunderte sich nicht. Er wußte, daß sie verstanden hatte.
„Geht in Ordnung“, sagte er beim Hinausgehen.
Der Untersuchungsrichter trottete hinter ihm her, stumm, wie es seines Amtes war. Er könnte in seinem Bericht über dieses Gespräch nicht viel bringen, überlegte er. Nur, daß die Beklagte und ihr Anwalt über Weihnachten gesprochen haben, das könnte er hineinschreiben. Und natürlich die Bemerkungen über die Richterin Kleine Sextro. Ja, die natürlich auch. Eine Überlegung, die brisanter war, als der Untersuchungsrichter ahnte.
2.
Was ist nur los mit ihr? Sie ist nicht wie sonst, wenn ich sie abhole, fiel ihm auf. Sie ist so verstört. Als hätte sich heute die ganze Tristesse dieser öden Gerichtsflure auf sie gestürzt. Dieser Gänge ohne Anfang und ohne Ende. Als hätte ihr enges, kahles Richterzimmerchen mit der seelenlosen Nummer 1035 an der Tür und den paar geschmacklos zusammengewürfelten Möbelstücken sie in die Zange genommen. Dieses kleine Gesicht, so blaß. Und diese ausgeknipsten Augen, erschrak er.
„Laß uns nur ganz schnell gehen, Rainer“, flüsterte sie, als sie ihre Richterrobe auf den Kleiderbügel und in den Schrank hängte. Überhastig, aber ordentlich wie immer, dachte er. Er wollte ihre Aktentasche nehmen, wie gewöhnlich. Diese kleine Hilfe, nie der Rede wert, doch das Mindeste, was er hier in der für ihn fremden Welt für sie tun konnte. Aber sie war schneller als er, packte die Tasche mit beiden Händen, drückte sie fest an sich und hastete hinaus auf den Flur, überließ es ihm, den Schlüssel nach außen zu stecken, ihn herumzudrehen und rauszuziehen. Und klaubte ihm gleich darauf den Schlüssel aus der Hand, übertrieben energisch, wie er fand. Und schob ihn zum Fahrstuhl. „Frag mich jetzt nichts“, sagte sie, als er den Mund aufmachen wollte. Panik, überlegte er, die ganze Frau eine einzige Panik. Und zog es vor, sie nicht weiter zu behelligen.
„Was ist nur mit unserer Richterin Kleine Sextro los“, sagte der Pförtner zu dem Polizisten, der neben ihm stand. „So ist die ja noch nie hier durchgerannt. Schmeißt einem den Schlüssel beinahe an den Kopf. Und nichts wie weg, ohne jeden Gruß. Ohne uns einen schönen Feierabend zu wünschen. Also so was.“
„Da kann ich notfalls drauf verzichten“, meinte der Polizist. „Aber wer war denn das sonderbare Subjekt, das sie abgeholt hat?“
„Das? – Na, ihr Mann, der Maler.“
„Eine Richterin – und ihr Mann ein Maler?“
„Ja, aber ein richtiger Maler. Ein Kunstmaler oder wie der sich nennt. Also nicht so ein Anstreicher.“
„Um so schlimmer. Den könnte man ja wenigstens noch brauchen. Aber so einen, nee.“
Kaum aus dem Bus ausgestiegen, auf den letzten paar hundert Metern Heimweg, kam Rainer dann doch mit der Frage heraus: „Also, Annemarie, nun sag schon. Was ist los? Hat es Ärger gegeben im Büro?“
„Was heißt hier Ärger gegeben“, kam es mehr resigniert als tadelnd. „Bei mir kann es keinen Ärger geben, wie du weißt. Weil ich keinen Chef habe. Bei mir gibt es nur Fälle. Immer andere Fälle. Ärgerliche auch. Und unangenehme. Und der neueste Fall ist wieder so einer. Ein höchst unangenehmer. Ein Terroristenprozeß.“
„Na und? Für dich doch nichts Neues.“
„Nein, eigentlich nichts Neues. Da hast du recht. Aber diesmal ist doch alles anders als sonst. Viel, viel schlimmer.“
„Warum?“
„Still jetzt“, herrschte sie ihn flüsternd an. Passanten kamen ihnen entgegen. Ein harmloses älteres Paar. Danach noch ein paar Kinder. Kein Grund für diese Geheimnistuerei, wurde Rainer ärgerlich. „Also, was ist nun? Wieso steht jetzt ein Terroristenprozeß an, der anders ist als sonst, viel schlimmer?“
Sie waren am Gartentörchen angelangt. Sie schob ihn so ungeduldig wie stumm hindurch und ins Haus. Und als die Haustür hinter ihnen ins Schloß gefallen war und er gerade einen Satz vorformuliert hatte, der mit Unverschämtheit, mich so herumzuschubsen, beginnen sollte, sagte sie: „Weil – na weil die Beklagte Renate Hobbes heißt.“
„Renate Hobbes, Renate Hobbes“, überlegte Rainer Kleine Sextro laut, „den Namen hast du doch – ja, davon hast du schon oft, ja, sag mal, ist das denn nicht – tatsächlich?“
„Ja, tatsächlich. Die Beklagte ist meine Klassenkameradin Renate Hobbes“, kam es fast tonlos, „meine alte Freundin, von der ich dir schon so oft erzählt habe.“
Und nach einer Pause, die er ihr gelassen hatte, um sie nicht noch zusätzlich zu irritieren: „Meine einzige Freundin. Die ich seit dem Anfang des Studiums nicht mehr gesehen habe. Du weißt ja, ich bin mit meinen Eltern schon nach den ersten Semestern nach Bonn gezogen und habe dort studiert. Renate war hier an der Freien Universität geblieben. Damit war etwas zuende gegangen, was wir immer als die schönste und intensivste Freundschaft empfunden hatten, zu der junge Menschen überhaupt fähig sind. Wir haben uns nie mehr wiedergesehen, seitdem unsere Wege so auseinandergelaufen waren. Nie mehr. Sonderbarerweise. Und irgendwann dann auch nicht mehr geschrieben oder angerufen. Wie so was einschläft auf die Entfernung. Na ja, neue Menschen, neue Kontakte. Aber jetzt begegnet sie mir in einer Akte, die auf meinen Tisch kommt. Als leibhaftige Beklagte. Strafsache Renate Hobbes. Jetzt soll ich sie verurteilen wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der Beihilfe zur Entführung und zum Mord.“
Nun machte Rainer Kleine Sextro einen ebenso verstörten Eindruck wie seine Frau. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sagen konnte: „Aber das kannst du doch nicht machen. – Ich meine, sie verurteilen. – Deine Freundin Renate. Das kannst du doch nicht tun.“
„Ja, das kann ich nicht tun, da hast du recht. – Aber ich kann es auch nicht lassen.“
„Was?“
„Ich kann sie auch nicht einfach nicht verurteilen. Ich kann mich nicht rausstehlen aus dieser Sache.“
„Aber sicher kannst du. Du kannst dich als Richterin doch selbst ablehnen. Wegen Befangenheit.“ Soviel wußte Rainer von der Stellung einer Richterin. Und er brachte sein Fachwissen mit einem gewissen Stolz an.
„Du weißt ja schon gut Bescheid in meinem Job.“
„Danke für das Lob.“
„Aber dann weißt du auch, was der Geschäftsverteilungsplan des Gerichts ist. Das ist das oberste Gesetz des Gerichts, ist quasi unsere Bibel. Dahinter steht das Gerichtsverfassungsgesetz. Das gibt jedem Angeklagten einen Anspruch auf den sogenannten gesetzlichen Richter, das heißt auf einen Richter, der zufällig und nicht per Beschluß oder durch sonstige Manipulation ausgewählt wurde. Deshalb wird die Justitia immer mit verbundenen Augen dargestellt. – Und der Geschäftsverteilungsplan regelt eben nicht nur, welche Akte welchem Richter auf den Tisch gelegt wird, er regelt auch die Vertretung, das heißt wer wen vertreten muß.“
„Du sagst es. Du kannst dich also vertreten lassen.“
„Sehr richtig. Mich selbst ablehnen, mich vertreten lassen, das würde ich am liebsten tun.“ Und nach einer Pause, während der sie im Zimmer auf und ab lief: „Wenn ich nicht wüßte, wer mich dann vertreten müßte: Dr. Grotan. Wenn ich nicht wüßte, was für ein Terroristenfresser der Mann ist. Und was für ein Weiberhasser dazu. – Nein, Rainer“, brach sie plötzlich in Tränen aus, „nein, diesem Richter nicht, dem kann ich Renate nicht ausliefern.“
„Das heißt, dann willst du also selbst...“
„Nein!“ schrie sie, „ich will nicht, ich muß! – Ich selbst muß über Renate zu Gericht sitzen. Ich muß meine beste, meine einzige Freundin verurteilen“, lief sie heulend ins Schlafzimmer.
3.
Der schwarze Schnee der Großstadt, er ließ keine vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Dieses scheußliche schwarze Streugut, das die Stadt neuerdings einsetzte, mit Schnee vermischt war es einfach überall. Auf den Straßen als plattgefahrener Schneedreck. Auch auf den Bürgersteigen, mit Hundekot angereichert. Und sogar die Wege durch die Vorgärtchen waren schwärzlich von Streugut. Mitgeschleppt von den Profilsohlen der zwei Millionen Menschen, die aufregenden Feiertagen entgegengingen.
Es liegt was in der Luft – nicht nur auf den Straßen. So wurden die Leute von Beschriftungen gewarnt, die in den letzten Nächten an immer mehr Mauern und Bauzäunen erschienen waren.
Anfang Dezember des Jahres 1979. Früher Wintereinbruch. Und Berlin wurde – je mehr Schnee fiel – immer düsterer. Die Zeitungen versuchten abzulenken. Sie erklärten in ausführlichen Darstellungen, wieviel besser die neue Methode sei, gegen die Schneemassen und gegen Glatteis anzukämpfen. Sie verurteilten das bisher verwendete Salz als Umweltfeind Nummer eins. Sie appellierten an das Mitgefühl der Hunde- und Katzenfreunde und trafen damit Hunderttausende mitten ins Herz. Ja, es ging um die schmerzenden Pfoten und das unwillkürliche Ablekken des Salzes, um unmenschliche Tierquälerei also, mit der nun endlich Schluß gemacht werde. Die Alleebäume mußten ebenfalls herhalten. Das viele Grün, der Stolz der Berliner, sei in höchster Gefahr, erfuhr man jetzt täglich aus der Morgenzeitung. Winter für Winter habe das Salz sie an den Wurzeln gepackt. Es gehe nicht an, daß man länger die Augen davor verschließe, daß man das vielgerühmte Grün der Stadt ermorde, diese lebenswichtige grüne Lunge Berlins verkommen lasse. Wenn die vielbesungene Berliner Luft bleiben solle, was sie war, dann dürften die baumbestandenen Straßen nicht zu Pökelalleen verkommen und so weiter.
Als Annemarie Kleine Sextro an dem Morgen aus dem Haus getreten war, hatte sie an der Wand neben ihrer Tür gelesen: Es liegt was in der Luft – nicht nur auf den Straßen. Mit dicken Pinselstrichen flüchtig hingeschmiert, rot. Und wo der Pinsel neu angesetzt worden war, mit frischer Farbe aus dem Eimer, da war es runtergelaufen von den Buchstaben, in dicken roten Tropfen, die wie Blut angetrocknet waren. Nasen, hatte sie gedacht, Nasen würde Rainer das nennen. Der Täter könne nicht einmal eine glatte Wand anstreichen, würde er schimpfen. So ein Stümper und so fort. Sie fuhr sich mit der Hand ins Gesicht und bemerkte die verlegene Handbewegung erst, als sie die Kälte spürte. Als ob der Tod persönlich einen anfaßt, durchfuhr es sie. So kalte Hände, das kenne ich sonst an mir nicht. Sie nahm sich vor, nächstens die Handschuhe schon vor dem Hinausgehen anzuziehen, nicht erst auf dem Weg zum Bus.
Der Dreck, der vieltonnenweise über alle Straßen und Bürgersteige verteilt worden war, wurde zum Stadtgespräch. Das Granulat, wie das neue Streumittel offiziell hieß. Aber der schöne Name nützte auch nichts. In den Leserbriefspalten der Tageszeitungen gifteten Autofahrer die Umweltschützer an. Sie rechneten heile Katzenpfoten und gerettete Bäume gegen die Blechschäden auf, gegen blutende Köpfe und ausgefallene Arbeitszeit, wenn der Wagen auf dem Eis wegrutscht, unaufhaltsam, weder auf die Bremse noch auf die Steuerung reagierend, weil das Salz fehlt. Und dieses Granulat verlängere nur noch den Bremsweg, wetterten sie gegen die Neuerer los.
Der erste, der Annemarie Kleine Sextro an diesem Morgen im Berliner Kammergericht begegnet war, abgesehen von den schwerbewaffneten Polizisten und dem Pförtner, die unten im Eingang eine furchterregende Schleuse aus Barrieren, grimmigen Mienen, Fragen und Kontrollblicken aufgebaut hatten, – der erste Kollege war Manfred Schallenberg. Ausgerechnet dieser Schallenberg, hatte sie gedacht. Würde mich nicht wundern, wenn der von der bedrohlichen Schrift neben unserer Tür wüßte.
„Guten Morgen, Frau Kleine Sextro“, rief er schon aus etlichen Metern Entfernung.
„Guten Morgen, Herr Schallenberg.“ Wohldosiert, nicht zu freundlich, nicht zu distanziert.
„Sie sehen ja aus wie halberfroren“, blieb er bei ihr stehen. „Mußten Sie so lange auf den Bus warten?“
„Er weiß also Bescheid, überlegte sie. Er weiß, was mich erschreckt hat. Ist doch klar. Als ihr Wahlverteidiger steckt er mit ihr und ihren Kumpanen unter einer Decke. Bemüht leger sagte sie: „Ich kann das Durchleuchten im Eingang nicht vertragen. Wohl so eine Art Filzallergie, was ich da habe.“
„Daß Sie das sagen? Wo Sie doch auf der anderen Seite stehen“, tat er verwundert. „Bei mir ist das ja was anderes. Ich träume nachts schon von Kontrollen, so zuwider ist ...“
„Als Richterin stehe ich weder auf der einen noch auf der anderen Seite, Herr Schallenberg. Die vielen Durchleuchtungen scheinen Ihre Erinnerung an die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zu verdunkeln.“
„Ja, sehr richtig, Rechts-Staatlichkeit, daran darf nicht gerüttelt werden“, lachte er. Und wiederholte „Rechts-Staatlichkeit“, indem er den Begriff dehnte und zur Nahkampfwaffe verbog.
„Nur gut, daß Sie mir das nicht im Ernst nachsagen können, Herr Schallenberg. Oder?“
„Erbetteln Sie sich nicht von mir Ihre Absolution. Ich bin nicht Ihr Seelsorger, ich bin Anwalt, – guten Morgen, Frau Richterin.“
„Guten Morgen auch Ihnen, Herr Rechts-Anwalt“, dehnte sie das Wort, wie er es gemacht hatte. Er eilte laut lachend weiter. Lachen kann der Mann, einfach toll. Er hätte Vertreter werden sollen statt Anwalt. Eigentlich hätte ich ihn ja Herr Links-Anwalt nennen müssen, überlegte sie im Weitergehen. Aber das wäre eine Beleidigung. – Obwohl, eigentlich könnte Schallenberg das nicht als Beleidigung empfinden. Er nicht.
Sie betrat ihr Zimmer gleichzeitig mit dem Büroboten. Woitolla, wie immer im grauen Anzug und mit Schlips und Kragen, die grauen Haare akkurat gescheitelt und gewellt. Böse Zungen tuschelten, daß er sich jeden Morgen mit der Brennschere den Kopf in Ordnung bringen müsse. Ach, Unsinn, ich sollte meinen Kopf in Ordnung bringen. Annemarie Kleine Sextro mochte den Alten. Und der spürte das. Er schätzte ihre Freundlichkeit gegenüber den unteren Rängen, wie er zu sagen pflegte. Und ihre Gewohnheit, manchmal ein paar Worte mit ihm zu plaudern, nutzte er manches Mal ganz schön aus.
„Das mit den Kontrollen unten im Eingang ist ja schrecklich“, seufzte er. „Nun bin ich doch schon elf Jahre hier tätig, und jetzt tun die, als ob ich ein gefährlicher Verbrecher wäre. Immer wieder mich ausweisen müssen und mich abtasten lassen. Können wir nicht mal wieder was anderes machen als diese Terroristenprozesse, Frau Richterin?“
Klar, er wollte sich wieder ein Plauderpäuschen verschaffen. Warum auch nicht. Das mit dem Wir fand Annemarie köstlich. Trotzdem warf sie nur ein „Ja, sehr unangenehm“ hin und hantierte hastig mit den Akten und Büchern auf ihrem Schreibtisch. Und der Bote verstand und ging. Ist mir unverständlich, warum manche Kollegen den Mann so grob behandeln. Woitolla versteht es doch meisterhaft, sich diskret zurückzuziehen. Spürbar, daß er einmal bessere Zeiten gesehen hat, wie er selbst es nennt. Selbständiger Schneidermeister. Den Konkurrenzkampf nicht durchgehalten, wie er sagt. Dann Chefverkäufer in einem der führenden Modehäuser. Und jetzt auf Nummer Sicher im öffentlichen Dienst. Ein Versager halt, hat er die Schultern hochgezogen, als er mir das erzählt hat. Beim ersten wie beim zweiten und dritten Mal. Und ich, ich habe Verständnis gezeigt. Ich bin ja ebenfalls im öffentlichen Dienst. Also habe auch ich versagt? Schon dachte sie wieder an Schallenberg und seinen Hohn: Rechts-Staatlichkeit. – Nein, das soll man mir nicht nachsagen können. Und auch nicht, daß ich versagt hätte. Da muß ich durch!
4.
Wieder wie gestern und vorgestern, wie morgen und übermorgen eingerahmt von dem scheußlichschlichten Mobiliar des Richterzimmers. Annemarie Kleine Sextro sah sich mit wehem Blick um. Nur das für die Arbeit Allernotwendigste, übriggeblieben aus den diversen Berliner Justizverwaltungen der letzten siebzig Jahre. Die schiere Demut, wenn das eine Klosterzelle wäre. Der erste Schritt zur Heiligkeit. Hier aber eher die schiere Ignoranz gegenüber allem am Menschen, was nicht unter den hehren Begriff Ratio fällt. Alt gewordene Sachen, doch dadurch weder würde- noch wertvoll geworden, nur abgegriffen, unansehnlich. Ein Ambiente zum Davonlaufen. Oder zum Insichgehen. Annemarie entschied sich für die zweite Variante. Dafür, sich wieder einmal in Erinnerung zu rufen, wie sie zu dem geworden ist, was jetzt an ihrer Tür steht, außen: Richterin am Kammergericht.
Die Schule, nun ja, die hat man absolviert, weil die Eltern es von einem erwarteten. Und dann dastehen mit dem Abiturzeugnis in der Hand, auf das man so lange hingelebt hatte. Und sich selbst sagen müssen: Ist ja wohl stark übertrieben, Zeugnis der Reife. Ich bin jung und nicht reif. Das hätten die wohl gern. Reif, überreif und bald schon nicht mehr konsumierbar. Ich war tatsächlich alles andere als reif damals. Mehr mit Büchern lebend als mit Menschen. Ich kannte doch nur Bücher, außer Renate und meinen Eltern. Typisches Einzelkind, das von den Eltern, die ihre Ruhe haben wollen, auf ein stilles Hobby abgeschoben wird. Bücher sind auch Gesprächspartner, ja, und bei denen kann man eine bessere Auswahl treffen, so hatte ich mich gegen den Hohn der Klassenkameradinnen verteidigt, die mehr von Jungen hielten als von Büchern. Aber für meine Verträumtheit, für dieses verschwommene Gefühl der Unsicherheit auch, dafür hatte ich damals keine Entschuldigung bei der Hand. Dieses Manko wollte ich mir mit der Juristerei wegkurieren. Das Jurastudium als Selbsttherapie. Das dürfte ich ja niemals aussprechen.
Sie legte die Strafakte Renate Hobbes auf augeschlagen vor sich auf den Tisch. Wir waren halt kleine Mädchen, so knospig noch, so rundum unerfahren, wie sie in Mädchenbüchern beschrieben sind. Was wir werden wollten, das wußten wir nicht. Doch was wir alles nicht werden wollten, das wußten wir genau. Nur ja nicht das Übliche. Nur nicht wie unsere Eltern werden. Aber einen Mann haben, ja, das wollten wir beide. Und natürlich nur einen ganz außergewöhnlichen Mann. Den tollsten Mann überhaupt. Diese Gedanken entwickelten sich schneller weiter als wir selbst. Einem besonderen Mann die besondere Frau sein. In einer modernen Partnerschaft lebend. Als die unerschütterlich verständnisvolle und nicht wegzudenkende Gefährtin eines der Großen der Zeit. Eine Art Simone de Beauvoir zumindest.
Habe ich vielleicht nur deshalb so schnell Karriere gemacht? Ich und eine Karrierefrau, so ein Witz. Alles nur, weil wir als Mädchen so herumgesponnen haben. Weil eine Richterin mir was Besonderes zu sein schien. Natürlich keine Ahnung davon, was es in Wirklichkeit heißt, Richterin zu sein. Und dann sogar Richterin am Landgericht und jetzt hier am Kammergericht. Abgeordnet an dieses nächsthöhere Gericht, um mich weiterzuqualifizieren. Das dritte Staatsexamen, wie der alte Kollege am Landgericht sagte. Robenau hieß er. Das kann ich jetzt eigentlich vergessen. Aber mit Anerkennung im Ausdruck gesagt. Und wohl auch mit einer guten Portion Neid. Denn wer kommt schon so weit, und das sogar in recht jungen Jahren.
Annemarie Kleine Sextro konnte sich nicht dazu überwinden, noch einmal die Akte durchzulesen, noch genauer. Zum dritten Mal. Gestern, als ich Rainer beim Überpinseln des Spruchs überrascht habe, hätte ich ihm da sagen sollen, warum ich das nicht wollte? Warum ich es lieber hätte, daß er in seinem Atelier arbeitet statt draußen? Nein, das kann ich ihm nicht sagen. Das würde sofort einen grandiosen Vortrag über Freilichtmalerei und ihre Überlegenheit über die Ateliermalerei auslösen. Pleinairmalerei, Pleinairmalerei und ihre ganz unvergleichliche Atmosphäre. Dabei, darum ging es ja nun wirklich nicht. Aber das dürfte ich ihm nicht sagen. Ich darf ihm nicht sagen, wovor ich Angst habe. Das würde ihm ein ruhiges Weiterarbeiten unmöglich machen. Aber wenn Rainer was passieren würde, das wäre entsetzlich. Das ja, das wäre der Hebel, mit dem sie mich fertigmachen könnten. Und Rainer ist so arglos. Er kennt nur seine Arbeit. Also mußte ich ihn machen lassen. Nun steht neben unserer Haustür ein neuer Spruch, von Rainer in kunstvoller Schrift gestaltet, auf der frischen Übermalung: Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein! – Die Aufforderung „tritt ein“, wenigstens die hätte er sich besser gespart.
In der untersten Schublade ihres Schreibtisches im Kammergericht am Lietzensee lag die Notiz des Ermittlungsrichters über das Gespräch der Untersuchungsgefangenen Renate Hobbes mit ihrem Wahlverteidiger Manfred Schallenberg. Der stumme Zeuge hatte schriftlich festgehalten: „... berichtete der Anwalt dem Häftling Hobbes von einem Gespräch, das er an diesem Morgen mit der Richterin Kleine Sextro hatte und in dem sie ihm erzählt hatte, daß in der Nacht zuvor eine Wand ihres Hauses mit der Aufschrift beschmiert worden war: Es liegt was in der Luft – nicht nur auf der Straße.“
Das will er von mir gehört haben? Nein, das weiß er nicht von mir, sondern von seinen Kumpanen. Da hat er sich selbst verraten. So was Dummes. Auch der gerissenste Anwalt macht also mal einen Fehler. Aber das bleibt hier unter Verschluß. Damit mir nicht wieder Personenschutz aufgedrängt wird. Die mit ihrem peinlichen Getue und ihrem ständigen Schutzgerede. Hat mir gerade gereicht beim letzten Prozeß. Als die Nachbarn sich damals beschwert haben, daß sich immer Polizei in unserem Viertel herumtreibe. Ja, herumtreiben, so haben sie das genannt. Man könne es ja nicht mehr riskieren, nachhause zu fahren, wenn man bloß ein einziges Glas Bier getrunken hat. Und Freunde und Bekannte lehnten Einladungen ab, weil die Beamten in ihrer Langeweile sogar das Reifenprofil der dort geparkten fremden Wagen überprüften. Und der Nachbar, der spät am Abend heimgekommen war und gleich rot sah, weil er in seinem Fernsehsessel einen Nebenbuhler überrascht zu haben glaubte. Beinahe wäre er zum Polizistenmörder geworden. Hätte der Fremde ihn nicht sofort mit entsicherter Dienstpistole in Schach gehalten. Dem armen Kerl war einfach nur kalt geworden, und die Frau hatte ihn gern hereingelassen, weil er ihr ein Gefühl von Sicherheit gab, wie sie nachher erklärte. Und klar, daß er seine Jacke und die Dienstmütze abgelegt hatte im gut geheizten Wohnzimmer. Nein, nur nicht noch einmal diesen Schutzterror. Kühlen Kopf bewahren, Annemarie. Und diesmal jegliches Aufsehen vermeiden.
Woitolla kam herein. Sie schrak zusammen wie ertappt. Er merkte, daß er störte, legte die Akten wortlos auf den Aktenbock, stellte fest, daß nichts als Ausgang dalag, und verschwand fast unhörbar. Eine schreckliche Unsitte eigentlich, dachte sie, daß Boten einfach alle Türen aufmachen dürfen. Ohne anzuklopfen. Was mich allerdings bisher nicht erschreckt hat. Woitolla hat mich nur ein einziges Mal erschrecken können. Als er das erste Mal zu mir hereinkam und ich dachte, ich muß ihm zur Begrüßung ein paar freundliche Worte sagen. Wie er mir da gleich gesagt hat, er freue sich, einmal eine Vierzigerin als Richterin hier zu sehen. Und ich habe mich gewehrt, dumm drauf reingefallen, nein, ich sei noch lange keine vierzig, erst gerade fünfunddreißig. Und er entschuldigte sich, das habe er nicht gemeint. So was spreche er doch niemals an bei Damen. Nein, meine Konfektionsgröße sei vierzig. Unten zumindest. Ich hätte beim Kleiderkauf immer das Problem, daß ich zwei verschiedene Größen kombinieren müßte, unten vierzig und oben zweiundvierzig. Aber das sei ja heute möglich. Er zumindest, er hätte mir das immer ermöglicht. Wenn er jetzt noch die Möglichkeit dazu hätte. Und stellte sich als gelernter Schneider und ehemaliger Chefverkäufer vor. DOB und HOB, sagte er und übersetzte dann freundlicherweise gleich: Damen- und Herren-Oberbekleidung. Ja, ein freundlicher Mensch, dieser Woitolla. Und offenbar eine Kapazität. Denn wie er mich taxiert hatte, das stimmte haargenau. Aber mit seiner langen spitzen Nase, so bedrohlich, und dieser Art, einen gleich auszuziehen – das macht er bei jedem sofort bei der ersten Begegnung, bestätigten mir die Kollegen, und manch einer reagiert sauer –, das ist auch wirklich unangenehm, fast schon unheimlich. Aber andererseits – einmal so ausgezogen, hat man auch keine Scheu mehr vor ihm, wenn er einfach so zu einem ins Zimmer tritt. Wie der Hausarzt ans Bett.
Und kam endlich zurück zu der Notiz des Ermittlungsrichters und zu ihrem Entschluß, sie wegzuschließen. Und war schon wieder bei Woitolla, der sich als Versager bezeichnet hatte. Muß ich jetzt immer daran denken, wenn ich ihn sehe? Und mich fragen, ob ich ebenfalls versage? Ja, müßte ich jetzt nicht Schallenberg auffliegen lassen? Ich habe ihn in der Hand, ganz klar. Er hat sich als konspirativ tätig verraten. So einem Anwalt muß das Handwerk gelegt werden. Ja, aber er ist der beste Anwalt, den Renate finden konnte. Ein Meister seines Fachs und ein Naturtalent in der Kunst, alles zu verdrehen. Ihr diesen Anwalt nehmen? Nein.
Die Richterin ließ den Protokollzettel in der untersten Schublade verschwinden. Sie konnte sich nicht dazu durchringen, Meldung zu machen, wie es ihre Pflicht gewesen wäre. So hatte sie nun zu ihren Zweifeln, ob sie eine Versagerin sei, auch noch mit der Frage fertigzuwerden, ob sie überhaupt noch neutral sei. Als Richterin stehe ich weder auf der einen noch auf der anderen Seite, habe ich gegenüber Schallenberg aufgetrumpft. Jetzt muß ich mir einreden, daß ich mich gerade mit der Unkorrektheit, die vorgeschriebene Meldung zu unterlassen, als neutral erweise. Gerade damit. Weil es nicht an mir liegen soll, daß Renate Hobbes gut wegkommt, sondern an ihrem guten Anwalt. Und dieser Schallenberg ist der einzige Anwalt weit und breit, der es schaffen könnte, sie herauszuhauen aus dem Schlamassel, in den sie sich gebracht hat. Mit offenen Augen und in voller Absicht. Mein Gott, ja: dolus directus. Und ich kann nicht einmal sagen: unnötigerweise. Weiß ich doch, warum sie getan hat, was man ihr jetzt vorwirft. Unsere Kleine-Mädchen-Träumereien. Damit bin ich praktisch mitschuldig geworden. Denn was beinahe wie eine Wette war, eine Lebenswette – die den tolleren Mann kriegt, ist die Siegerin –, das hat sie dahin gebracht, wo sie jetzt ist. Und mich dahin, wo ich jetzt bin. Und genau das bringt uns beide demnächst im großen Saal des Kammergerichts von Berlin zusammen. Ja, – aber daß unsere Lebenswege so wieder zusammenfinden könnten, wer konnte das ahnen.
Sie bekam die Akte Renate Hobbes nicht mehr vom Tisch. Sie las darin und suchte und suchte, als ob es um ihr eigenes Leben ginge. Und irgendwie tat es das ja auch. Beihilfe zur Entführung und Ermordung des Unternehmers Alex Heuchemer, so nannte die Staatsanwaltschaft das, was in den Flugblättern der Clique hieß: Gefangennahme und Hinrichtung eines Volkschädlings. Das auf einen Nenner zu bringen, das wird die Aufgabe von Manfred Schallenberg sein. Die Beklagte hat sich nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Typisch. Sie wird sich auch während des Prozesses mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dazu äußern. Das entspricht ihrer sturkonsequenten Art.
5.
Das war in den letzten großen Ferien vor dem Abitur. Bei zwei Familien auf der Nordseeinsel Juist konnte man uns brauchen. Mehr wußten wir nicht. Doch – daß wir kein Geld verdienen würden, lediglich ein kleines Taschengeld für unsere Arbeit erhalten sollten, daneben aber freie Unterkunft und Verpflegung. Und natürlich geregelte Freizeit. Und das war es, was uns besonders gereizt hatte: das ganz andere Ferienerlebnis. Kein Problem, das Geld für die Bahnfahrt von den Eltern zu erbetteln. Es ging ja ums Initiativwerden, um Hilfsbereitschaft und Idealismus. Das gab den nötigen Rückenwind. Und der Begriff Au-Pair-Mädchen klang ja recht gut. Wenn die auch normalerweise im Ausland arbeiten, um die Fremdsprache zu lernen. Unseren Eltern war das Angebot auf Juist viel lieber als ein Auslandsaufenthalt. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ich habe es noch im Ohr.
Da sind die beiden Mädchen auf der Fähre, mit der sie von Norddeich übersetzen zu ihrer Trauminsel Juist. Deutlich zu sehen, daß sie sich fühlen – im Lande geblieben oder nicht – wie auf großer Fahrt. Und dann dieser kuriose Trip mit der nostalgisch schnaufenden Inselbahn von der Mole zum Bahnhof. Das Erlebnis hat begonnen. Wie sie mit dem Gepäck in der Hand aus dem kleinen Bahnhofsgebäude kommen, die paar Straßen hinunter gehen, in ein neues Leben hinein, das sich ihnen mit einem quirlig vollen Platz und bunten Blumenrabatten vorstellt. Da steht plötzlich der Fotograf vor ihnen und hat sie schon im Kasten. Wie er das ausdrückt. „Übermorgen abzuholen, meine Damen. Adresse steht hier auf dem Kärtchen. Wünsche Ihnen schöne Ferien!“
Da waren wir auf einmal Damen. Und Feriengäste. Das Foto muß ich noch irgendwo haben, überlegte Annemarie. Schade, daß ich damals nicht ein ganzes Album angelegt habe, mit Fotos, Fahrscheinen, Eintrittskarten und getrocknetem Dünengras. – Was war daran noch zu trocknen? Aber damals kamen ja noch nicht diese Unmengen von Bildern zusammen bei jeder Reise. Und wir waren ja auch keine Damen auf Urlaubsreise. Daß wir uns am nächsten Abend um acht im Bahnhof treffen wollten, um unsere ersten Erlebnisse zu besprechen, das hatten wir schon im Zug fest vereinbart. Auf was sonst sollte man sich festlegen, wenn man überhaupt keine Vorstellung von dieser Insel hat. Nach diesem ersten Treffen, nach dem ersten Tag als Au-Pair-Mädchen würden wir einen besseren Treffpunkt kennen.
Anne findet ihre Familie gleich am Hauptplatz, wo eine kleine Gartenanlage und ein Musikpavillon Kurort mimen. Ein imposantes Haus, das Wohnung und Praxis der Familie Dr. Silbrig enthält. Genaugenommen sogar zwei Praxen, denn Herr Dr. Silbrig und auch Frau Dr. Silbrig arbeiten als praktische Ärzte. Doch mit den zwei Behandlungszimmern und den beiden Wartezimmern – eins ist der Extraraum für Privatpatienten, damit die wartenden Kassenpatienten nicht sehen, wie diese zwischendurch ins Ordinationszimmer geholt werden –, mit Röntgenraum und Umkleidekammer und den Labors habe Anne nichts zu tun, erklärt die Ärztin. Nur mit den beiden Söhnen der Dr. Silbrigs, die drei und fünf Jahre alt und ein sehr freies Leben gewohnt seien.
„Das ist unsere stolze Zukunft. Wir werden unseren Söhnen später eine exzellente Ausbildung zuteil werden lassen“, sagt Dr. Silbrig. „Wenn sie nur erst mal groß wären“, ergänzt seine Frau. Und er darauf: „Sorgen Sie derweil dafür, daß sie in der Zwischenzeit nicht allzuviel Unheil anrichten.“
Das so gesagt, wie man zwei Koffer bei der Gepäckaufbewahrung abgibt. Damit hat er sie aus den Händen. Und die Sache ist für ihn erledigt. Für Anne aber ist das schon mehr wie ein doppeltes Klicken von Handschellen rechts und links an ihren schmalen Jungmädchenhandgelenken. Womit zwei Delinquenten an sie gefesselt sind. Transportsicherung. Bis sie endlich groß sein würden. Annes Handgelenke sind natürlich nicht die ersten und würden auch nicht die letzten sein, die dafür herhalten müssen. Ein billiges Verfahren nennt Frau Dr. Silbrig das. Sie selbst sei nun mal von ihrer hochqualifizierten Ausbildung her zu teuer, um den ganzen Tag auf die Kinder aufpassen zu können. Und die Mädchen, die herkämen und ihr diese Belastung abnähmen, die hätten dafür die Möglichkeit, sich schon im Umgang mit Kindern zu üben und sich so auf ihre zukünftige Rolle als Mutter vorzubereiten.
Daß ich selbst später auch einmal zu hochqualifiziert sein könnte für diese Rolle, das habe ich nicht erwidert, wohl auch gar nicht gedacht, überlegte Annemarie. Die Ärztin war ja auch noch nicht fertig mit ihrem Einführungsvortrag.
„Und diese Chance haben Sie in einem kultivierten Haushalt in einem Kurort, müssen Sie bedenken, und das bei freier Unterkunft und Verpflegung. Und ein Taschengeld bekommen Sie noch obendrein. Gar nicht zu sprechen von der unbezahlbar guten Luft, die Sie hier atmen. Etwas ganz anderes als verpestete Großstadtluft.“
„Aber das ist die berühmte Berliner Luft, die wir zuhause haben“, muß das Mädchen da doch widersprechen. Bemüht, das als eine witzige Bemerkung erscheinen zu lassen. Ein Vortrag über Autoabgase und über Juist als Insel ohne Autos und über das einmalige Reizklima der Nordsee ist die Folge, über den Salz- und Jodgehalt der Luft und so weiter, mit noch dreimal „unbezahlbar“. Da kann das Au-Pair-Mädchen nur noch heftig zustimmend nicken. Genau wie bei der Zuweisung des Zimmers. Ein Verschlag im Keller, neben dem Heizungsraum.
„Mit separatem Eingang“, sagt Frau Dr. Silbrig und zeigt auf die Waschküchentreppe an der Rückseite des Hauses. „Das alles gehört zu Ihrem Reich“, macht sie eine weite Armbewegung. „Natürlich nur die persönliche Wäsche der Familie. Mit der Praxiswäsche haben Sie nichts zu tun, die wird rausgegeben. Und sogar ein Teil der Haushaltswäsche wird auswärts gewaschen. Die geht über die Geschäftsbücher, weil das absetzbare Betriebskosten sind. Aber was die Leibwäsche betrifft, die ist Ihre Angelegenheit.“ Und zeigt ihr, wie die Waschmaschine zu bedienen ist und wo sie das Bügelbrett auflegen und das Bügeleisen einstecken kann.
„Mit dem Kochen haben Sie nichts zu tun. Einkaufen und Essenmachen, dafür haben wir am Vormittag eine Haushaltshilfe. Bloß der Abwasch ist Ihre Angelegenheit. Abends gibt es bei uns immer kalte Küche. Das ist gesund. Da können Sie sich allerdings ein bißchen bei nützlich machen. Und natürlich morgens das Frühstück. Das ist sehr wichtig. Auch für die Gesundheit. Das muß pünktlich um halb acht auf dem Tisch stehen, weil um neun Uhr die Praxis beginnt und ab halb neun schon Privatpatienten behandelt werden. Mein Mann trinkt koffeinfreien Kaffee mit Milch, ich trinke starken Tee, schwarzen Tee natürlich, mit Zitrone. Die Eier in kochendem Wasser drei Minuten. Die Brötchen bekommen Sie ab sieben beim Bäcker zwei Straßen weiter zum Strand runter. Sie selbst frühstücken schon vorher zusammen mit den Kindern in der Küche. Die Kinder sind, während wir frühstücken, im Kinderzimmer. Am Abend müssen die Kinder um halb acht im Bett sein, vor Beginn der Tagesschau muß im Kinderzimmer das Licht aus sein und absolute Ruhe herrschen. Was Sie dann machen, ist Ihre Sache. Wie gesagt, separater Eingang, wir sind da sehr tolerant. Aber dafür wollen wir von Ihrem Privatleben auch nichts wissen und überhaupt nichts mitkriegen. Ich nehme an, Sie wissen, was ich meine.“
An diesem ersten Abend wartet Anne vergebens im Bahnhof auf ihre Freundin. Eine gute halbe Stunde lang studiert sie Fahrpläne und Prospekte und Karten, bis sie nicht länger warten kann, weil ein paar junge Burschen auf sie aufmerksam werden. Also schleicht sie heim in ihren Keller und hofft auf den nächsten Abend.
Renate ist nicht früh genug weggekommen aus der kleinen Pension, in die es sie verschlagen hatte. Beinahe neun ist es schon, als sie zum Bahnhof kommt. Da kann sie dann auch nur herumstehen und warten und schließlich ebenfalls vor den abenteuernden Blicken davonlaufen. Dabei hat sie so viel zu berichten. Von dem winzigen Kämmerchen, das ihr Zimmer ist. Und von seiner traumhaften Lage: im Keller. Gleich neben der Küche und der gefährlich steilen Treppe nach oben. Und von diesen Leuten und und und.
Als die beiden Mädchen sich am dritten Tag auf ihrer Trauminsel endlich am Bahnhof treffen, fallen sie sich in die Arme, als hätten sie eine lange Seereise machen müssen, um sich wiederzusehen. Sie legen gleichzeitig los mit ihren Berichten, und die klingen bei beiden gleich trist.
„Zwei kleine Jungen ohne jede Erziehung. Dazu gehörten ein paar starke Männer mit Zwangsjacken. Und wenn ich mich durchsetzen will, dann beschweren sie sich prompt bei ihrer Mutter. Und die macht mir dann doch tatsächlich noch Vorhaltungen, und das vor den Kindern. Einfach unmöglich.“
„Den ganzen Tag soll ich Serviererin machen. Das nennen die Au-Pair-Mädchen. Weil die Serviererin ein Kind kriegt. Nur immer schwervolle Tabletts schleppen, aus dem Keller, wo die Küche ist, über eine irre steile Treppe in die erste Etage, in den Speiseraum und morgens auch noch in alle Zimmer. Einfach verrückt.“
„Dieser rechtlose Status eines Au-Pair-Mädchens ist unerträglich. Und die Kinder wissen ganz genau, daß man nichts zu sagen hat. Ich soll für die doch nur ein Spielzeug sein, an dem sie sich nicht weh tun können.“
„Das ist glatte Ausbeutung. Denn eine Serviererin kriegt richtigen Lohn und nicht nur dieses kleine Taschengeld, das ich kriege. Und dafür den Muskelkater in den Beinen und in den Armen, die Schmerzen in den Schultern. Ich glaub, ich spinne, daß ich so was für andere Leute mache.“
Sie haben nicht die Ruhe, sich in eine Eisdiele zu setzen. Sie sind so aufgeregt, daß sie spüren: wir passen da nicht hin. Sie passen tatsächlich nicht zu diesen Leuten, die herumssitzen und sich ihre Urlaubswochen genießerisch als ein Eis nach dem anderen auf der Zunge zergehen lassen. Jede mit einem Eishörnchen in der Hand, gehen sie im Eilschritt an den Strand.
„Es endlich mal sehen, das Meer.“
„Ja, guck es dir genau an, denn gleich ist die geregelte Freizeit schon wieder vorbei. Dann müssen wir ins Bett, um morgen früh fit zu sein.“
„Das sag ich dir, das mach ich nicht lange mit.“
„Ich auch nicht, da kannst du Gift drauf nehmen.“
„Aber laß uns erst mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Aller Anfang ist schwer, heißt es ja.“
„Na, wenn du meinst. Vielleicht wird es tatsächlich nachher besser.“
Als Anne und Renate sich zwei Tage später wieder treffen, vor der Eisdiele diesmal, da sieht die eine der anderen auf den ersten Blick an, was sie denkt. Nämlich dasselbe wie sie selbst: Nicht nur der Anfang ist schwer, das Ganze ist nichts.
„Ich packe morgen früh meine Sachen und sage der Pensionswirtin, daß sie selbst das Frühstück auf die Zimmer bringen kann. Lieber fahre ich nachhause und laß mich von meinen Eltern auslachen, als mich hier so ausnutzen zu lassen. Und dieser Entschluß steht felsenfest.“
„Gut, auch ich mach morgen früh Schluß. Nach dem Frühstück für die Kinder und mich werde ich den Eltern sagen, daß ich das weitere Gedeihen ihrer mißratenen Söhne ihrer liebevollen Fürsorge überlasse – genau wie ihre schmutzige Wäsche.“
„Die Leute hier, ich weiß nicht, die sind so was von grapschig, das gibt‘s doch gar nicht.“
„Und entschuldigen alles damit, daß sie nur so eine kurze Saison haben.“
„Früher sollen die sich von Strandräuberei ernährt haben.“
„Davon habe ich auch schon gehört. Falsche Lichter haben sie aufgestellt, damit vorbeifahrende Schiffe vom Kurs abkommen und stranden. Und die dann ausplündern, das war ihr Geschäft.“
Damit hatten wir uns so weit freigestrampelt aus unserer persönlichen Malaise, daß wir uns in die Eisdiele setzen konnten wie Touristinnen. Und uns zwei große Eis mit Früchten leisten. Sollte das doch die letzte Gelegenheit sein, ein bißchen Juist zu genießen. Und das mit dem Vorgeschmack der schon bald wiedererlangten Freiheit.
6.
Wie die beiden Au-Pair-Mädchen sich am nächsten Morgen mit ihrem Gepäck am Bahnhof treffen, ist ihnen anzusehen, daß sie glücklich und unglücklich zugleich sind. Sie habe keinen Pfennig Geld bekommen, gesteht jede der anderen. Das Taschengeld sollte erst später gezahlt werden, die ersten Tage seien ja bloß Einweisung, habe es geheißen. Doch sind sie stolz darauf, daß sie sich durchgesetzt haben.
„Wir haben uns jedenfalls erfolgreich gegen die unverschämte Ausnutzung gewehrt. Wer sind wir denn.“
„Aber dafür ist nun auch schon das Ende der großen Reise gekommen. – Oder ob man hier auch bessere Jobs finden könnte?“
„Eine ganz neue Überlegung. Auch nicht schlecht.“
Zum Hinundherdenken haben die Mädchen noch genug Zeit bis zur Abfahrt des Inselbähnchens, das sich nach den Schiffsanlegezeiten richtet. Und die sind abhängig von Ebbe und Flut. Und sie haben bisher weder Ebbe noch Flut gesehen. „Jetzt nur keine Tränen“, ruft Renate ihre Freundin zur Ordnung.
Da spricht sie ein Mann an, der sich ihnen als der Leiter eines Kinderheimes vorstellt. „Hallo Mädchen, ich sehe, daß ihr gerade angekommen seid und nicht wißt wohin. Ich warte hier auf einen neuen Transport von Kindern, alles behinderte Kinder. Wenn ihr dafür was übrighabt, und wenn ihr meiner Frau in der Küche zur Hand gehen wollt, dann kann ich euch brauchen. Ihr könnt gleich mit dem Fuhrwerk mitfahren. Unterkunft und Verpflegung frei, ein kleines Taschengeld und eure geregelte Freizeit habt ihr auch. Denn die Kinder sind noch klein und müssen noch viel schlafen. – Na, habt ihr Lust?“
So taucht die Trauminsel Juist, gerade erst untergegangen im Sturm der Entrüstung, plötzlich wieder auf. Mit einem freundlichen Gesicht, mit einem schlichten Hallo Mädchen, mit einem Pferdefuhrwerk und mit einer richtigen Aufgabe, wie die beiden sich voller Stolz gegenseitig klarmachen. Mit einer großen Aufgabe.
„Das sind also unsere beiden neuen Küchenhilfen, Fräulein Hobbes und Fräulein Mietzner“, werden sie von der Leiterin des Kinderheimes begrüßt und den anderen Mitarbeitern vorgestellt. „Hier geht alles nur mit dem Vornamen, klar? Das dient der Arbeitserleichterung und schafft eine einzige große Familie. Also, wie werdet ihr gerufen?“
„Renate.“
„Anne.“
Die Arbeit im Kinderheim hatte Spaß gemacht. Kartoffeln schälen und Zwiebeln schneiden, Gemüse putzen, Tische decken und abräumen, servieren und den Riesenabwasch machen. Alles Tätigkeiten, bei denen man sich unterhalten konnte oder auch Radio hören, singen und lachen. Und zwischendurch an den Strand gehen, gleich hinterm Haus, und sich von der Sonne rösten oder von den Wellen umwerfen lassen. Genau wie die Kurgäste. Und das kostenlos. Nicht einmal Kurtaxe bezahlen müssen, diesen unvermeidlichen Extrazoll, über den die anderen am Strand so oft schimpften. Und bei alledem noch das angenehme Gefühl zu haben, daß man etwas Sinnvolles tut. Daß man hilft, wo Hilfe nottut. Was wollten wir noch mehr?
An einem der ersten Abende in ihrem kleinen Zimmer – Anne und Renate haben ihre Betten übereinander – beugt Renate sich hinunter und flüstert: „Du, Anne, jetzt weiß ich, wie das gemeint ist, wenn man sagt: Nur was man für andere tut, tut man für sich. Irgendeiner hat das doch mal so schön ausgedrückt.“
„Ja, – war das nicht Max Stirner?“
„Der? – Nein, ich glaub mehr Albert Schweitzer oder so einer.“
„Jedenfalls hat er das schön gesagt.“
„Und jedenfalls hat er recht damit, das spüre ich jetzt ganz deutlich.“
Die beiden wohnen nicht in dem Kinderheim, in dem sie arbeiten, sondern privat. Soweit auf Juist überhaupt noch irgendwas als privat zu bezeichnen ist, formulieren sie ihre Zweifel an dieser Benennung. In der viel zu kurzen Saison wird an die Gäste vermietet, was sich nur vermieten läßt. Und die kleinste Ecke im Keller oder unterm Dach wird noch zum Komfortdoppelzimmer hochgejubelt, wenn auch die Betten übereinander sind. Das gilt als typisch Schiffskoje, bringt also zusätzliches Lokalkolorit, verstehen sie – und müßte eigentlich noch einen Aufschlag kosten. Aber in dem Haus hier ist man zum Glück nicht so, freuen sie sich. Im übrigen kriegen sie schon zu spüren, daß die Eingeborenen der Insel auf eine lange Strandräubertradition zurückblicken. In ihrer nicht so richtig geregelten Freizeit merken die beiden bald, daß die Preise in einem erschreckenden Kontrast zu ihrem Taschengeld stehen. Kino? – Zu teuer. Friseuse? – Unbezahlbar. Ausflugsfahrten? – Glatt zu vergessen. Da bleibt gerade mal ein Eis auf die Hand. Oder eine Cola. Die kann man lange stehenlassen. Und ein Taschenbuch hin und wieder, das ja nur die Hälfte kostet, weil sie es beide lesen, das muß sein. Aber wie sie dann diese Seife im Schaufenster sehen, da müssen sie sich jede ein Stück kaufen, denn erst in der Kombination ist das ja ein unwiderstehliches Angebot. Das eine Stück trägt die Aufschrift CRAZY und das andere SPLEEN. Das, meinen sie ausgelassen lustig, das passe haargenau zu ihnen.
Und jetzt weiß ich nicht mehr, wer von uns welches Stück Seife bekommen hat. Egal. Ist ja kein großer Unterschied zwischen den beiden Bezeichnungen. Wie wir beide auch nicht sehr verschieden waren. Ein bißchen verrückt sein, das konnten wir beide. Wie ich eines Tages Renate überrascht habe mit meiner Idee: „Wir könnten ein Versandgeschäft aufmachen.“
„Ein Versandgeschäft? – Mit was denn?“
„Mit Pferdeäpfeln. Davon liegen hier doch genügend herum. Und die werden uns jeden Tag frisch geliefert, sogar kostenlos.“
„Ja, und zuhause in Berlin, die Laubenpieper, die würden sich die Finger danach lecken.“
„Puh, allein schon diese Vorstellung.“
Wir konnten uns halbwegs kaputtlachen. Über nichts und alles. Wenn wir nicht gerade sehr ernsthaft dabei waren, dem Guten im Menschen auf die Beine zu helfen. Ja, diese sechs Wochen auf Juist, das war meine schönste Zeit, dachte Annemarie Kleine Sextro. Und sicher würde Renate das genauso sehen. Renate – jetzt hier in meiner Nähe. Gefangen, eingesperrt im Hochsicherheitstrakt. Noch um etliches scheußlicher untergebracht als ich in meinem bloß schäbigen Richterzimmerchen. – Nur keine Tränen! So würde Renate mich jetzt zur Ordnung rufen.
Und flüchtete sich sofort wieder in die Vergangenheit: Das war für uns beide das erste Mal ein Leben in einer völlig anderen Welt. Wahrhaftig eine Insel der Seligen. Ohne Autos, ohne Fabriken. Das romantisch klingende Pferdegetrappel auf den Straßen, auf dem rotbraunen Klinkerpflaster. Und die Luft, die nach Meer roch und nach Salz schmeckte. Und Tag für Tag dieser frische Wind. Immer noch kürzer hatten wir uns die Haare geschnitten, gegenseitig. Wie Leichtmatrosen sähen wir aus, hatte die Heimleiterin gesagt. Wie hieß sie noch? – Dreßen. Frau Dreßen. Eine mütterlich-mollige Frau und bei aller aufgesetzten Berufsstrenge so was von gutmütig. Und die Kinder, behinderte Kinder, körperlich und teilweise auch geistig behindert, die waren restlos glücklich, wenn wir sie in den Bollerwagen packten und mit ihnen querfeldein rasten und sie plötzlich einfach in den Sand kippten.
Die Angestellten sahen das nicht so gern. Sie verwiesen auf ihre spezielle Ausbildung und ihre Prüfungen. Sie wüßten, wie solche Problemfälle zu behandeln sind. Und wir verstanden überhaupt nicht, wieso es um Problemfälle gehen sollte. Für uns waren das einfach unbeschwert fröhliche Kinder. Wie wir selbst. „Deshalb wohl“, sagte die Richterin vor sich hin.
7.
Wie wir uns ereifert haben über die Predigt des Pfarrers. Speckeisen nannten wir ihn. Weil er so ähnlich hieß, wir seinen Namen aber nicht gleich richtig verstanden hatten. Der Dialekt der Inselleute machte uns doch Schwierigkeiten. Und nachzufragen, daran dachten wir überhaupt nicht. Noch schöner, nein, noch schöner könnte er wirklich nicht ausfallen, der Name eines fetten Pfarrers. Damals ging ich ja noch gelegentlich in den Sonntagsgottesdienst. Genau wie Renate. Ein überraschend moderner Klinkerbau mit einem wuchtigen Turm über dem Haupteingang. Der stand da wie der letzte Stummel eines bald völlig verbrauchten überdimensionierten Zimmermannsbleistifts. Himmelsschreiber, ja, so nannten wir diesen Kirchturm. – Aber wie Pfarrer Speckeisen die Frauen um Jesus dargestellt hat, das schrie zum Himmel. Fanden wir wenigstens. Wobei wir ausnahmsweise einmal verschiedener Meinung waren.
Da erzählt so ein Pfarrer auf der Nordseeinsel Juist, wie Jesus im fernen Palästina in einem Dorf von einer Frau namens Marta eingeladen wird, zu ihr nachhause zu kommen und ihr Gast zu sein. Irgendwie bringt er das auf die bekannte Formel: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. „Das ist so üblich gewesen damals“, sagt er, „als es noch keine Hotels und Pensionen und christlichen Hospize gab. Leute, die wie Jesus predigend umherzogen, waren stets darauf angewiesen, daß ein lieber Mitmensch sich so für sie begeisterte, daß er sie in sein Haus einlud. Die Marta“, so Speckeisen, „war zwar solch eine begeisterte Zuhörerin, aber nur, bis sie es geschafft hatte, den vielbestaunten Prediger zu ihrem Gast zu machen. Von dem Moment an hatte sie für ihn kein Ohr mehr. Sie kümmerte sich nur noch um die Bereitung des Essens. Sie wollte ihm nämlich zeigen, was für eine perfekte Gastgeberin sie war. Ganz anders ihre Schwester Maria, die mit ihr in dem Haus wohnte. Die setzte sich zu Füßen des Meisters nieder und lauschte aufmerksam seinen Worten. Und als Marta sich nach einer Weile bei Jesus beschwerte, daß ihre Schwester nur dasitze und ihr die ganze Arbeit überlasse, und ihn bat, er möge sie anweisen, ihr ein bißchen zur Hand zu gehen, da mußte die gute Frau sich sagen lassen: ,Marta, Marta, du kümmerst dich zuviel um Unwichtiges. Deine Schwester Maria hat den besseren Teil gewählt.‘
Es ist halt mehr Ehrerbietung“, deutet der Pfarrer die Geschichte, „einem zuzuhören, als einem was zu essen zu machen. Denn im ersteren Falle zeigt man dem Gast, daß man ihn für überlegen hält, im zweiten Fall dagegen stempelt man ihn zu einem Bedürftigen ab und zeigt sich ihm überlegen, weil man ja hat, was er braucht.“
Das mit der Ehrerbietung paßte uns beiden nicht. In der Geschichte wurde für unseren Geschmack zuviel Aufhebens um diesen Mann Jesus gemacht. Darin waren wir uns noch einig. Aber die beiden Frauen sahen wir dann doch sehr verschieden.
„Daß die Maria zu Füßen des Meisters saß und ihm nur zuhörte, das glaube ich einfach nicht“, hatte Renate sich entrüstet. „Wenn sie so ein dummes Huhn war, dann brauchte sie nicht in der Bibel erwähnt zu werden. Ich wette, die Maria war die Gesprächspartnerin, die Jesus schon lange gesucht hatte. Endlich hatte er die Frau gefunden, die ihm durch ihre ganz andere Sicht der Dinge dazu verhalf, seine Theorien richtig auf den Punkt zu bringen.“
„Aber davon steht nichts in der Bibel“, hatte ich widersprochen.
„Die Bibel ist ja auch von Männern geschrieben. Deshalb.“
„Trotzdem. Diese Annahme ist eine unzulässige Ausweitung der Geschichte. Mir scheint eher, daß Jesus so stur bei Maria sitzengebleiben ist und die Marta so grob abtat, weil er enttäuscht war.“
„Enttäuscht? Wieso?“
„Weil Marta, die ihn mit nachhause genommen hatte, nicht allein war.“
„Na, davon steht aber auch nichts in der Bibel“, hatte Renate aufgetrumpft. „Das ist also genausogut eine unzulässige Ausweitung der Geschichte.“
„Nicht ganz genauso“, hatte ich mich gewehrt, „denn du hast eine Tatsachenergänzung vorgenommen, während ich lediglich eine Deutung der Tatsachen gebracht habe, was viel weniger an Ergänzung ist – und dazu noch so naheliegend. Schließlich war auch dieser Jesus ein Mann.“
Na ja, wahrscheinlich habe ich mich damals noch nicht so juristisch klar ausgedrückt. Aber so gemeint hatte ich es jedenfalls. So war plötzlich aus der Entrüstung über die Predigt von Pfarrer Speckeisen eine richtig verbissene Auseinandersetzung geworden. Eigentlich die einzige, die wir auf Juist hatten. Plötzlich war da ein Graben aufgerissen zwischen uns, und das nur, weil Renate so vehement für diese Maria und ich genauso für die Marta Partei ergriffen hatte. Zum Glück hatten die Juister Wanderdünen den Graben schon nach einer Nacht unauffindbar gemacht. Und wir beide, wir dachten gar nicht daran, ihn zu suchen. Was kümmerten uns auf unserer Paradiesinsel auch die palästinensischen Schwestern Marta und Maria? Wir waren am nächsten Tag wieder wie immer: in geradezu schlagerverdächtiger Harmonie ein Herz und eine Seele.
8.
Sitzen da zwei Abiturientinnen auf einer der wenigen Bänke in der Halle des Henry-Ford-Baus der Freien Universität Berlin und mimen das erste Mal Studentinnen.
„Ein toller Kasten“, begeistert Renate sich.
„Ja. – Fragt sich nur wozu“, meint Anne nachdenklich. „Eigentlich doch nur viel Raum für nichts.“
„Für nichts? – Im Gegenteil. für Henry Ford, den Wohltäter der Menschheit, der die sinnvolle Tätigkeit abgeschafft und das maschinenartige Funktionieren eingeführt hat. Das Tollste ist, jetzt habe ich gelesen, daß es Untersuchungen gibt, die belegen, daß die Leute sich sogar wohlfühlen bei der Fließbandarbeit. Weil man dabei so schön abschalten kann und vor sich hin dösen. Man muß nicht selbst denken und trägt keine Verantwortung. Na, wenn das kein Fortschritt ist.“
„Der staunenswerte Ford-Schritt der Menschheit“, bestätigt Anne, wobei sie den Fortschritt dehnt und ein möglichst deutliches D spricht.
Solche Wortspiele waren schon damals meine Liebhaberei, überlegte Annemarie Kleine Sextro. Auch Rainer hat dafür was übrig. Während Renate jedesmal, wenn sie auf eine Möglichkeit zu derartigen Wortspielen stieß, es sich verkniff, sie auszusprechen. „Bloße Kalauer“, hat sie einmal gesagt, „ich halte es nicht für richtig, solchen Zufallserscheinungen der Sprache einen besonderen Wert beizumessen.“ Ich fand diese Spielchen trotzdem schön. Und zumindest als ungewöhnliche Anregung zum Nachdenken scheinen sie mir auch heute noch sinnvoll. Renate aber ging damals schnell über meinen Ford-Schritt hinweg.
„Ich verstehe ja wirklich nicht, wie du dazu kommst, ausgerechnet Jura zu studieren“, wundert Renate sich.
Und Anne fragt zurück: „Und wie kommst du dazu, ausgerechnet Soziologie zu studieren?“
„Aber gerade Jura? Das ist doch so ein Fach, in dem alles zubetoniert wird, damit sich nur ja niemals was ändern kann. Dagegen die Soziologie, die...“
„Die Rechtswissenschaft ist zwar ein Betonsockel, das scheint mir auch so“, verteidigt Anne ihr Fach, „aber der wird dauernd den Lebensverhältnissen angepaßt. Der Jurist arbeitet in allem, was er tut, an der Weiterentwicklung des Rechts, an seiner Verbesserung und damit am Aufbau einer Welt, in der endlich einmal Gerechtigkeit...“
„Schön wär‘s ja“, unterbricht Renate sie, „nur kann ich nicht dran glauben.“
„Aber deine Soziologie? Glaubst du, die schafft die Welt der Gerechtigkeit?“
Beide haben sie das Vorlesungsverzeichnis in der Hand. Ihr erstes Vorlesungsverzeichnis. Eine stattliche Broschüre. Vorne drauf prangt das große Universitätssiegel mit dem Berliner Bär, der in seinen Pranken eine Fackel hält.
„Die Fackel sieht aus“, meint Renate zu ihrer Freundin, „wie ein überdimensionales Eishörnchen.“
„Ja, und der Bär reißt schon das Maul auf und leckt sich die Lippen vor Heißhunger.“
„Dabei steht er bis an die Brust im Wasser. Hochwasser in Berlin. Auch mal was Besonderes.“ Und lachen wie um die Wette.
Dann deutet Renate auf das Universitätssiegel und meint: „Aber sieh mal. Da stehen die Worte VERITAS, IUSTITIA, LIBERTAS, also Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Deine großartige Gerechtigkeit ist also nur die zweite von den drei hehren Forderungen.“
„Und deine Soziologie ist überhaupt nicht dabei.“
„Oh doch, sie steht sogar an erster Stelle. Denn die Wahrheit ist ja das Ziel, das hinter der Arbeit der Soziologen steht.“
„Aber die Soziologen vermessen die Gesellschaft doch nur, und das mit sehr zweifelhaften Meßmethoden, habe ich gehört“, wird Anne grundsätzlich.
„Natürlich, die vermessen die Gesellschaft. Aber das tun sie, um daraus Erkenntnisse zu beziehen, habe ich gerade erst bei dem Kölner Professor Weisser gelesen, – das ist übrigens einer der wesentlichen SPD-Köpfe – Erkenntnisse also, die sie als Verkehrszeichen, als Warnlichter, als Hinweise und so aufstellen können. Um damit einen reibungsloseren Ablauf des Lebens in einer wirklich freien Gesellschaft zu schaffen.“
„Na schön, Verkehrszeichen. Dann ist das also doch kein Eishörnchen, was der Bär da hochhält, sondern eine richtige Fackel, und die steht für Achtung, allgemeine Gefahrenstelle, also für die Soziologie.“
Erst nach einer längeren Pause greift Renate das Gespräch wieder auf: „Weißt du, was ich auch so toll finde an der Soziologie, das ist, da gibt es einen Professor, der hat sogar richtige Romane veröffentlicht.“
„Ach ja.“
Das Studium selbst zu finanzieren, das war ein Traum, von dem wir damals gern sprachen. Dabei machte es sich gut, daß wir zuhause wohnen und essen konnten, natürlich ohne etwas dafür abzugeben. Und daß wir auch immer noch von den Eltern gekleidet wurden. Das selbstverdiente Geld, das uns reizte, das sollte zusätzliches Geld sein. Für zusätzliche Wünsche. Nur wie und wo es verdienen?
„Das erste Mal eigenes Geld in den Fingern haben“, wie mein Vater das ausdrückte, „das ist schon ein erhebendes Gefühl.“ Dabei legte er aber Wert darauf, daß nicht der Eindruck entstehen könnte, seine Tochter sei auf das Selbstverdiente angewiesen. „Man kann nicht einfach alles mitnehmen, was sich einem bietet, wenn man eine geborene Mietzner ist“, sagte er mit alttestamentarischer Feierlichkeit. Und darin war er ausnahmsweise einig mit Renates Vater. Nur daß der Polizist Hobbes aus seiner ganz anderen Weltsicht heraus die Akzente ein wenig anders setzte: „Du kannst nicht einfach das nächstbeste Angebot annehmen. Es muß das auch zur Tochter eines Staatsbeamten passen.“