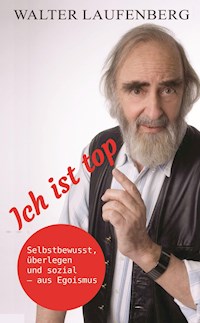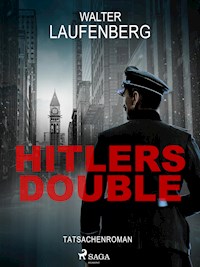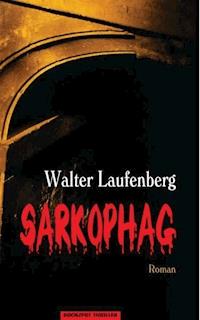Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Goethe und Tschechow – als Schriftsteller sind sie uns wohlbekannt. Die beiden Nationaldichter, die zu Recht auch heute noch die Bühnen der literarischen Welt beherrschen. Aber was für Menschen waren sie? In zwei kompakten Erzählungen blicken wir hinter die Kulissen der Applaus gewohnten Dichter. Wir verfolgen Goethes innerfamiliären Kleinkrieg mit der Trivial-Literatur seiner Zeit und wundern uns über Tschechows pfadfinderhafte Anstrengungen für eine bessere Welt: seine Exkursion auf die Sträflingsinsel Sachalin. Mit viel Augenzwinkern zeigt Laufenberg die Dichterfürsten als Menschen mit ihren Stärken und Schwächen. Geschichten, die so nah an der Wahrheit bleiben, dass sie die beiden Berühmtheiten in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Laufenberg
Goethe und Tschechow – Kühler Kopf und warmes Herz
Zwei Erzählungen
© Dittrich Verlag ist ein Imprint
der Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2022
Printed in Germany
ISBN 978-3-947373-79-6
eISBN 978-3-947373-86-4
www.dittrich-verlag.de
Satz: Gaja Busch, Berlin
Covergestaltung: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhalt
Goethe versus Vulpius, Vulpius, Vulpius und Vulpius
Tschechow zu Gast beim Doppelmörder
Nachwort
Literatur
Die Deutschen schmeicheln sich selbst – ob zu Recht oder nicht, soll einmal dahingestellt bleiben – mit der Verehrung eines Großdichters, der das schöne Leben im Übermaß genossen hat, und das besonders lange. Ein Heros in Sachen Liebe, Macht, Geld und Ruhm mit dem Dauer-Abo auf Erfolg. Beinahe ein teutonischer Teufel, viel zu groß, um als Vorbild zu dienen, der sich jedoch umso besser als der werte Herr Kollege eignet – wenn nicht sogar als Neidobjekt.
Die Russen schmeicheln sich selbst – ob zu Recht oder nicht, soll hier ebenfalls dahingestellt bleiben – mit der Verehrung eines Großdichters, der die Armut, Unfreiheit, Hilflosigkeit sowie das Ertragenmüssen jeglicher Pein freiwillig auf sich genommen und durchlitten hat. Ein russischer Jesus, jedoch einer, der zuletzt über das Kreuz triumphieren konnte und eine Berühmtheit wurde, wenn auch kein Erlöser – aber das wurde offensichtlich auch Jesus nicht.
Goethe versus Vulpius, Vulpius, Vulpius und Vulpius
Bewunderer, kommst du nach Weimar, verkündige dorten – nein, du brauchst nichts zu verkünden, wenn du vor den beiden Heroen Goethe und Schiller stehst. Und vor denen stehst du, weil du sie auf hohem Sockel vor dem Staatstheater findest, ob du sie gesucht hast oder nicht. Dann brauchst du nur die Augen nach oben zu verdrehen, denn diese beiden Großen repräsentieren die Stadt, die du zu betreten gewagt hast.
Ja, die beiden Herren sind die Stadt. So glaubt man zumindest in Weimar. Und auch andernorts. Du wirst dich diesem Glauben anschließen müssen, ob du magst oder nicht. So viel sei aber schon vorweg verraten: Dem Geheimrat Goethe hätte diese bronzene Darstellung von »Dichter-Heroen im Doppelpack« ganz sicher nicht gefallen.
Denn Goethe und Schiller, dieses Paar von Superautoren auf Tuchfühlung und überlebensgroß, mit Goethes Hand auf der Schulter des Kollegen, ein Duo, so erhöht und einsam vor dem Weimarer Theater, beide nach dem kleinen Lorbeerkranz vor dem Bauch grabschend, dieses Bild, Ehrfurcht heischend – es täuscht.
Johann Wolfgang von Goethe war kein Typ für den Paarlauf. Er war ein echter Künstler, und geben wir es doch zu: Künstler sind Egomanen, also Einzelkämpfer. Jeder Künstler strebt für sich den größtmöglichen Erfolg an Renommee und Einnahmen an. Dabei erscheinen ihm die Erfolge der anderen als Kuchenstücke, die ihm entgangen sind. Und weil man zu Lebzeiten noch nicht weiß und wissen kann, dass man einmal als der größte Künstler verehrt wird, lässt einen jedes so entgangene Kuchenstück nach neuen Erfolgen hungern.
Das gilt ganz sicher auch für Goethe. War der doch schon von Kindheit an wie auch in seinen produktivsten Zeiten und noch als Greis eindeutig ein Solist. Er musste immer im Mittelpunkt stehen, und er musste stets der Größte sein. Was damals nicht gerade als schicklich galt. Aber nur so wurde er der Solitär der deutschen Dichtung. Unter dieser narzisstischen Eigenart Goethes hatten die Menschen, die ihm nahestanden, zu leiden. Charlotte von Stein, Friedrich Schiller, Bettine von Arnim und Marianne Willemer werde ich für diese Behauptung in den Zeugenstand rufen, obwohl diese vier in dem hier vor allem zu betrachtenden Kleinkrieg »Goethe gegen die Vulpiusse« nur auf Nebenschauplätzen aktiv wurden.
Die Lebenssituation des Großpoeten Goethe sah ganz anders aus, als das Weimarer Doppeldenkmal uns weismachen will. Schon dieses Seit-an-Seit auf Augenhöhe übertreibt. Galt das doch höchstens für eine sehr kurze Zeitspanne in Goethes ungewöhnlich langem Leben. Zudem waren in ihrer Zeit die beiden Heroen umwimmelt von Hunderten supereifriger Schreiber, von denen viele dem großen Publikum mehr bedeuteten als die später als unsere beiden Dichterfürsten Gefeierten. Da hätten also andere Dichter Anspruch auf den Bronzeguss gehabt. Ende des 18. Jahrhunderts, in der großen Zeit Goethes und Schillers, sollen in deutschen Landen gut 10.000 Menschen schriftstellerisch tätig gewesen sein. Mehr als ein Viertel von ihnen arbeitete in der Romanproduktion, ein Großteil auch fürs Theater.
Da kratzten die Federn, da spritzte die Tinte in großen und kleinen Ortschaften, dass es eine einzige Freude war für die Leseratten. Die bekanntesten Romanschreiber hießen damals Gottlob Cramer, Heinrich Spieß, August Heinrich Julius Lafontaine, Karl Friedrich August Grosse und Heinrich Zschokke. Nie von gehört? Das glaube ich Ihnen. Daneben standen als die erfolgreichsten Bühnenautoren Friedrich Ludwig Schröder, Friedrich Justin Bertuch, August Wilhelm Iffland und August Friedrich Ferdinand von Kotzebue. Allein Iffland hat mehr als 70 Dramen auf die diversen Bühnen in deutschen Landen gebracht. Nur übertroffen von Kotzebue, der rund 230 Stücke auf die Bretter, die damals die Welt bedeuteten, gehievt hat. Daneben stand die beliebte Sparte der Reisebeschreibungen, in der sich vor allem Sophie von La Roche hervortat. Nicht zuletzt sei auch der Autor von begeistert aufgenommenen Reisebüchern genannt, der Vorläufer des amerikanischen Herumtreibers Mark Twain, nämlich der Edel-Herumtreiber Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Alle längst weg vom Fenster, fast alle vergessen. Nicht so der sie alle überragende Bestsellerautor mit dem Namen C. A. V., erster Anwärter auf eine Bronzestatue in Lebensgröße. – Aber von diesem Autor soll erst später die Rede sein.
Zunächst einmal zu der Frage, wie es dazu gekommen war, zu dieser Massenschreiberei für den Tag und für den erwünschten Nachruhm – und fürs Vergessenwerden. Was sollte das? Mir scheint, das war so etwas wie die deutsche Gegenaufklärung. Die Nüchternheit der Aufklärung, die im 18. Jahrhundert den Leuten was fürs Leben zu geben versuchte, indem sie das Volk mündig machte, sie hatte den gegenteiligen Effekt gehabt. Die klugen und engagierten Aufklärer hatten mit ihren alles hinterfragenden Schriften zwar recht gehabt, dabei aber dem Leben allen bunten Putz heruntergerissen. Was Denker wie Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn und Immanuel Kant, um nur drei von vielen zu nennen, den Leuten zugemutet hatten, nämlich selbstbewusst nachdenklich und immer nur rational zu sein, das war im Alltag kaum auszuhalten. Die Leute fühlten sich durch diese radikale Aufklärung nackt und ausgeraubt. Sie brauchten dringend neue Kleider und für die Tagesbewältigung eine neue Farbpalette. War der Arbeitsalltag doch schon hart und kahl und grau genug. Die Menschen, die die Aufklärung erlitten hatten, sie sehnten sich nach aufregenden Erlebnissen und nach Helden, mit denen sie mitzittern und mitjubeln konnten, heute würden wir sagen: mit denen sie sich identifizieren konnten.
Und genau das servierten dem lesefreudigen Publikum die meisten der 10.000 Schreiber, die für den Geschichtenbedarf der Leute arbeiteten. Was sie alles an buntem Treiben geschehen ließen, nicht nur in Fortsetzungsromanen von Zeitungen, sondern auch in gebundenen Büchern, in Kalendarien und anderen Geschichtensammlungen, in den gängigen und kuriosesten Periodika sowie in Erbauungsschriften, Flugblättern und Liedern, das brachte wieder Leben in den tristen Alltag ihrer Mitmenschen. Und manche von den vielen Schreibern hatten damit mehr Erfolg als die beiden Denkmalgrößen Goethe und Schiller zusammen. Weil sie dem Geschmack der einfachen Leute mehr entgegenkamen als die beiden.
Dabei ließen sich die neuen Schilderer des bunten Lebens von den großen Vorbildern anregen und sogar zu neuen Themen verführen. Schillers erste Veröffentlichung »Die Räuber« und Goethes erste Veröffentlichung »Götz von Berlichingen« hatten gezeigt, dass man mit ungewöhnlichen Stoffen und Figuren auf ein breites Interesse stößt. Dabei hatten beide Autoren ihre Stücke auf eigene Kosten drucken lassen müssen, weil die Verleger das Neue daran nicht erkannt hatten. Sowohl die »Räuber« als auch der »Götz« waren für ihre Gebärer zunächst Sorgenkinder. Doch hatten etliche Schreiber für den Alltagsbedarf, anders als die Verleger, das Neue und Besondere an diesen beiden Dramen sofort erkannt und es phantasievoll auf die Spitze getrieben. Raub und Totschlag, so hieß für sie nach Schiller und Goethe die Zauberformel zum Erfolg.
Damit erzielten einige dieser Schreiber für den Massengeschmack prompt höhere Auflagen als die beiden Großautoren, hatten mehr Aufführungen in den Theatern, wurden mehr übersetzt und erhielten mehr Literaturpreise sowie allerlei Gunsterweise von den zahlreichen Fürsten und Fürstchen, die in deutschen Landen regierten und für ihr Prestige gerne Künstler förderten. Plötzlich waren da Leute als die neuen Lieblingsautoren – ohne Goethe und Schiller danken zu müssen – landauf und landab im Gespräch.
Schon kurios, dass ausgerechnet das den ernsthaften Dichtern Schiller und Goethe abgeguckte Räuber- und Rittermilieu zum Familiensilber der Unterhaltungsliteratur wurde. Aber trotz dieser edlen Herkunft ihrer Themen sind heute all diese Wimmelautoren rund um Goethe und Schiller total vergessen. Selbst für die Literaturwissenschaft spielen sie keine Rolle, sind einfach abgetan als Produzenten von Trivialliteratur.
Die Menschen, die in Weimar neben den beiden in Bronze verewigten First-Class-Dichtern gelebt und geschrieben haben, in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts und der ersten Hälfte des folgenden, lieber Bewunderer, du wirst sie nirgendwo liegen sehen. Denn sie sind unter dem Boden versteckt, über den du schlenderst. Nicht mehr auffindbar. Und ihre Namen sind von Wind und Wolken weggewischt worden, als wären sie ohne Gewicht und Bedeutung. Was berechtigt ist, haben Namen doch ohnehin Gewicht und Bedeutung vor allem für einen selbst, nur ausnahmsweise auch mal für andere.
Natürlich war auch schon zu diesen längst verwitterten Zeiten der Name das Wichtigste, das die Menschen hatten, und das nicht nur in Weimar. Vor allem die, die nichts sonst besaßen, also die Nicht-Adligen, bemühten sich um ein bisschen Goldglanz für ihren Namen. Nicht verwunderlich deshalb, dass manch einer den Namen der Familie, den seine Eltern noch mit Stolz getragen hatten, für zu einfach ansah und ihn zu veredeln suchte. Den Namen in die Gelehrtensprache Latein zu übersetzen, das war eine der gängigen Methoden, die sich dafür anbot, wenn man nicht die Chance hatte, in den Adelsstand aufgenommen zu werden. Was ja auch Goethe und Schiller erst mit großer Verspätung feiern konnten.
Zumindest ein Name müsste neben den Namen Goethe und Schiller in den erstaunten Augen der Betrachter des Denkmals vor dem Weimarer Staatstheater aufleuchten: Vulpius. Ob mit einem männlichen Vornamen oder mit einem weiblichen, ist Geschmackssache.
Stelle man sich nur einmal vor, nicht Schiller stünde dort neben Goethe, sondern eine Frau, nämlich Christiane Vulpius. Jeder ist ersetzbar, werter Friedrich Schiller. Also komm herunter vom hohen Sockel. Lass die Vulpius aufs Podest. Dass der lateinisch klingende Name der Frau etwas mit dem deutschen Wort Fuchs zu tun hat, irgendwie schlecht übersetzt, ist naheliegend, aber unwichtig. Der Fuchs stand damals in einem schlechten Ruf. Fuchsen hieß so viel wie herumhuren. Deshalb die Latinisierung? Das war vielleicht das Problem eines ihrer Vorfahren, mit dem die Christiane sich aber nicht beschäftigt haben wird. Hatte sie doch nichts von einer Füchsin, nichts Gerissenes, nichts Überschlaues, auch nichts Schlechtes. Wenn überhaupt mit einer anderen Kreatur zu vergleichen, dann war diese denkmalwürdige Christiane eher eine Kreuzung aus Schmusekatze und Schlachtross. So eine Frau gehörte selbstverständlich nicht zur hochnäsig feinen Gesellschaft der Residenzstadt Weimar, und sie als Goethes Muse zu bezeichnen, wäre nur ein liebevolles Missverständnis. Also gab es keine Chance für Christiane, in Bronze gegossen zu werden.
Und doch wurde Christiane Vulpius die Ehefrau des Großdichters Johann Wolfgang von Goethe. Dabei stießen zwei Familien zusammen, besser gesagt: zwei Familien gerieten in den Clinch, die schon vor wie erst recht nach dieser disparaten Verlinkung im Streit lebten. Was bei der verehrten Institution »Sacra Familia« ja nichts Ungewöhnliches ist. Die Familie Vulpius war, was man alteingesessen nennt. Dagegen war Goethe in Weimar nur zugezogen und schon deshalb bei vielen Weimarern nicht gern gesehen, hatte also die schlechteren Karten. Womit nun die beiden Familien, die in den Jahrzehnten rund um das Jahr 1800 in einem sehr ungewöhnlichen Kleinkrieg aufeinandertrafen, in Stellung gebracht worden sind: Goethe gegen Vulpius. Familie war nur auf der einen Seite, Goethe war allein. Einer gegen vier, und das durch drei Generationen. Das war ein Wettkampf, der in seiner Subtilität und manchmal auch Intensität unvergleichlich war. Weswegen er wohl immer gern übersehen und verschwiegen worden ist. Dabei gibt diese Auseinandersetzung die kräftigsten Farben an das Bild, das Goethe – unabsichtlich – von sich gemalt hat. Und nicht nur das. Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass Goethes Lebenswerk, und damit die deutsche Hochkultur, durch diesen Wettkampf bereichert worden ist. Wie die alte Kaufmannsregel weiß: Konkurrenz belebt das Geschäft.
Vorausgegangen war dem großen Gerangel ein Kampf Glück gegen Pech, so könnte man sagen. Beides so unverdient wie unvermeidbar. Konnte man doch nur den Kopf schütteln über die Ungerechtigkeit von Mutter Natur bei der Verteilung ihrer Gaben. Aber es existierte ja noch keine politische Partei, die sich den Kampf für Gerechtigkeit zumindest auf ihre Fahne geschrieben hatte. Erst allmählich wurde aus dem Ärger über Pech und fremdes Glück der Zwist zweier Familien. Heute nennen wir so etwas einen asymmetrischen Krieg. Weil die Streiter mit so unterschiedlich brauchbarer Bewaffnung antraten, dass ihre Kämpfe fast wie das Aufeinandertreffen römischer Gladiatoren wirkten. Der eine mit Wurfspieß und Schild, der andere mit Kurzschwert und Helm. Also absolut unfair. Und dann noch Überläufer, und wie in jedem Kampf sind die Gegner bald so miteinander verquickt, dass der eine denkt, was der andere denkt. Weil sie sich zwangsläufig ständig miteinander beschäftigen müssen. Das war schon damals das unvermeidliche Miteinander beim Gegeneinander.
So kam es zum Zusammenstoß Nummer 1. Um zunächst einmal nur die Situation an der Frontlinie zu zeichnen: Der 1725 geborene Johann Friedrich Vulpius war zwar unbedeutend, wurde aber später der Vater der Christiane und noch viel später – und nur posthum – Goethes Schwiegervater. Er entstammte einer durchaus ordentlichen Weimarer Familie, in der schon Pfarrer und Gerichtsherren aufgewachsen waren, jedoch war und blieb er selbst ein armer Unglückswurm. Zwar hatte er ein Studium der Rechtswissenschaft begonnen, doch konnte er das nicht mit einem Examen abschließen, weil der Familie plötzlich das Geld fehlte. Warum der Absturz in die Armut, das wurde nicht ausgesprochen. Was man sich auf zwei verschiedene Weisen deuten könnte: Entweder hatte ein Familienmitglied etwas getan, was eine so große Dummheit war, dass man es totschweigen musste, oder ein blindwütiges Schicksal hatte so rabiat zugeschlagen, dass man sich ihm nur noch sprachlos ergeben konnte.
So oder so, jedenfalls war der halbfertige Jurist Johann Friedrich Vulpius gezwungen, schnell eine Arbeit anzunehmen, die ihm ein festes Einkommen sicherte. Wenn das auch ein sehr geringes Einkommen war. Fast das Geringste, das man sich denken konnte. Er wurde als Registrator und Kopist in der Weimarer Herzoglichen Bibliothek beschäftigt. Das heißt, er war ein kleines Rädchen im Getriebe, wie man heute herablassend sagt, damals für die Bibliothek aber so unverzichtbar wie jetzt ein Computer und ein großes Kopiergerät, nur nicht so teuer. Dann hat der Mann auch noch geheiratet, dummerweise nicht reich. Seine Frau brachte nur wenig Geld mit in die Ehe, das schnell verbraucht war. Dennoch hat er, wie das üblich und fast unvermeidlich war, seine Frau immer wieder geschwängert. Nach der sechsten Geburt starb sie. Er aber hat noch einmal geheiratet, noch einmal nicht reich, und weitere vier Kinder gezeugt. Leider starben all seine Kinder weg wie die Fliegen, bis auf einen Jungen namens Christian August und das Mädchen Christiane aus der ersten Ehe sowie deren Halbschwester Ernestine aus der zweiten Ehe. Um beim zoologischen Vergleich zu bleiben: Johann Friedrich Vulpius war ein veritabler Pechvogel.
Auf der anderen Seite Johann Wolfgang Goethe, das Glückskind. In Frankfurt am Main gerade zu der Zeit in eine recht wohlhabende Familie geboren, als der armselige 24-jährige Johann Friedrich Vulpius, der Pechvogel, in Weimar seine geistlose Arbeit in der Bibliothek begonnen hatte. Die Familie Goethe verstand es, den Reichtum zusammenzuhalten, den der Großvater des kleinen Johann Wolfgang mit seinem erfolgreichen Weinhandel zusammengerafft hatte. Wovon der Enkel Johann Wolfgang noch als alter Mann profitieren sollte. Und dieses Geld stank nicht, weil man zu der Zeit als Weinhändler nicht als Dealer abgetan wurde. Denn Alkohol war noch nicht als Rauschgift entlarvt. Ganz im Gegenteil war der Wein als das Blut Christi für die Frommen etwas unvergleichlich Edles, für die Gebildeten ebenfalls, wenn auch eher als der Katalysator der griechischen Philosophie, von der man Einiges in sein Denken übernommen hatte. Aber nichts gegen dieses Denken. Man lebte nach jüdisch-griechisch-christlicher Überlieferung und hielt das einfach für seine eigene Überzeugung. Deshalb war man als gebildeter Mensch ein überzeugter Weinliebhaber.
Der junge Johann Wolfgang Goethe studierte genau wie Johann Friedrich Vulpius die Rechtswissenschaften. Er schaffte zwar das Abschlussexamen, fiel aber bei der Doktorprüfung durch. Er arbeitete danach nur sehr ungern an den Prozessakten des Reichskammergerichts in Wetzlar. Viel lieber saß er in fröhlicher Runde mit anderen Männern beim gespielten Rittermahl an reich gedeckter Tafel. Oder er beschäftigte sich mit dem anderen Geschlecht. Diese Erlebnisse und seine eifrige Lektüre, aber auch, was er aus der Journaille erfuhr, verwandelte er dann in Literatur. So entstand das historische Drama »Götz von Berlichingen« über den Haudegen aus kleinem Adel, der im Bauernkrieg von 1425 von den aufsässigen Bauern gezwungen worden war, ihnen als Anführer zu dienen. Wohlgemerkt beim Kampf gegen den Adel. Also für Götz ein selbstmörderisches Unternehmen. Aber für den echten Haudegen war ein fröhliches Schlagen und Stechen wichtiger als jedes Bedenken. Deshalb hat der Mann die Bauernhaufen mit Begeisterung in eine Schlacht nach der anderen geführt – und in die totale Niederlage. Dieses historische Drama, als Privatdruck selbst bezahlt und veröffentlicht, das war der erste Publikumserfolg des jungen Schriftstellers Goethe.
Dem setzte der 25-Jährige im nächsten Jahr gleich noch eins drauf mit der durch eine Zeitungsmeldung angeregten Romanze »Die Leiden des jungen Werther«. Eigentlich bloß eine Beziehungsstory, nämlich eine Frau zwischen zwei Männern, das Allerweltsproblem, das sich aber als ein veritables Feuerwerk erweisen sollte. Plötzlich war der junge Johann Wolfgang Goethe ein Bestsellerautor, den jeder Leser kannte. Dass sich daraus eine Mode der Selbsttötung junger Männer aus Liebeskummer entwickelte, kann man dem Autor nicht anlasten. Es genügt, wenn man ihm attestiert, dass er mit der Schilderung der Kleidung des jungen Werther zum Modeschöpfer wider Willen wurde.
Dabei war ein ganz anderes Resultat dieses literarischen Frühwerks weitaus bedeutender, nämlich der dadurch ausgelöste Besuch des 17-jährigen Erbprinzen Carl August aus der Familie der Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach bei Goethe in Frankfurt. Was der junge Prinz über den jungen Dichter gehört und von ihm gelesen hatte, begeisterte ihn so, dass er auf der Heimfahrt von seiner standesgemäßen Bildungsreise einen Abstecher an den Main machte. Diese Grand Tour hatte ausnahmsweise nicht nach Italien geführt, sondern nach Frankreich. Sehr richtig so, immerhin war Französisch die Sprache der Fürstenhöfe und Könige. Wenn der jugendliche Reisende auch wenig von der alten Kultur Frankreichs mitbekam, in seinem Alter ja nicht das Spannendste, jedenfalls frischte er so die unverzichtbaren Fremdsprachenkenntnisse auf.
Weil man auf der Bildungsreise schon so weit nach Westen gekommen war, hatte der Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach sich auf der Heimfahrt vor dem Besuch bei Goethes einen Zwischenstopp in Darmstadt gegönnt, um sich dort mit der gleichaltrigen Prinzessin Luise von Hessen-Darmstadt zu verloben. Doch hielt er sich bei ihr nicht lange auf. Wozu denn auch? Eine Verlobung brachte ja nichts als schöne Aussichten. Das war für einen gesunden jungen Mann entschieden zu wenig. Deshalb ließ der frisch verlobte Carl August seine Kutsche nach Frankfurt eilen. Nur schnell hin zu dem verehrten Dichter Johann Wolfgang Goethe. Das war im Jahre 1774. Und der mit so vielen Hoffnungen und ebenso vielen höfischen Verhaltensvorschriften beladene Spross der Weimarer Herzogsfamilie überraschte. Er verstand sich sofort sehr gut mit dem Dichter, der nur acht Jahre älter war und sich über alles und jedes eine eigene Meinung zu bilden wagte, eine jugendlich aufsässige. Die beiden jungen Männer wurden ruckzuck Freunde. Deshalb bedrängte Carl August vor der Heimreise seinen neuen Freund Johann Wolfgang, möglichst bald zu ihm nach Weimar zu kommen. Nicht nur zu einem Besuch, sondern möglichst zum Bleiben.
So etwas zu hören, tut gut, und was uns guttut, das bestimmt unser Tun. Das galt auch für den jungen Goethe. Doch schauen wir zunächst nach Weimar. Dort hatte es gerade eine bedeutende Veränderung gegeben. Das Herzogsschloss war abgebrannt. So etwas war nicht ungewöhnlich. Die offenen Kaminfeuer und die Beleuchtung mit Talglichtern, Kerzen und Fackeln taten sich gern mit der üblichen Schusseligkeit der Domestiken zusammen und entfachten mal hier und mal dort ein Großfeuer. In Weimar hatte das bedeutet: Die noble Herzogsfamilie musste in das bis auf seinen Namen durchaus nicht noble, aber vom Brand verschonte Fürstenhaus umziehen. Wo sie dann für fast dreißig Jahre ein etwas beengtes und wenig prunkvolles Fürstenleben führen sollte, was man natürlich damals noch nicht ahnte. Zunächst war man nur froh, dem Großbrand lebend entkommen zu sein.
In diesem neuen Quartier namens Fürstenhaus wurde im Jahre 1775 der achtzehnte Geburtstag des jungen Carl August gefeiert. Damit wurde er nach damaligem Recht großjährig. Womit er der regierende Fürst des kleinen Ländchens mit Weimar als Hauptstadt wurde. Denn seine Mutter Anna Amalia konnte oder musste – das sah sie etwas anders als viele andere – die für ihren unmündigen Sohn ausgeübte Herrschaftsgewalt an ihn abgeben.
Nicht in dieser neuen provisorischen Residenz, sondern im fernen und prächtigen Karlsruhe wurde dann die Hochzeit des jungen Herzogs Carl August mit seiner Verlobten, der jungen Prinzessin Luise von Hessen-Darmstadt, gefeiert. Mit den üblichen Glückwünschen en masse und großen Hoffnungen. Die sich – bis auf reichlichen Kindersegen – allerdings nicht erfüllen sollten. Im Zeugen von Kindern wird sich der neue Herzog als ein Großer erweisen, mit rund dreißig Bälgern neben den legitimen Kindern aus seiner Ehe mit Luise. Aber das liegt beim Hochzeitfeiern noch im gnädigen Dunkel der Zukunft.
Vom Fürstenhaus in Weimar aus fanden nach der Hochzeit sehr bald ein paar Depeschen den Weg nach Frankfurt am Main. Darin wurde an die ernst gemeinte Einladung nach Weimar erinnert. Und schon packte der Jungautor Goethe seine Sachen und machte sich auf den Weg nach Osten. Freudig bewegt und voller Neugier, was ihn dort erwarten würde. Als Schriftsteller muss man ja was erleben, egal ob Gutes oder Unangenehmes, Hauptsache es ist was Ungewöhnliches. Immerhin zog Goethe mit dem sicheren Gefühl los, in dem jungen und neuen Herrscher des fernen Ländchens einen Freund zu haben. Wenn ihm auf dieser Reise nach Osten jemand gesagt hätte, dass dies der einzige Umzug mit Ortswechsel in seinem Leben sein werde, weil er sein ganzes weiteres Leben in Weimar verbringen und auch dort zu Grabe getragen werde, hätte er ihn für verrückt erklärt. So ungeniert gehen wir mit der Gnade um, nicht zu wissen, was uns die Zukunft bringt.
Zu der Zeit war, wie auch noch heute, wohl das Beste an dem Fürstenhöfchen in dem Hauptstädtchen Weimar die Bibliothek. Schon siebzig Jahre zuvor hatte der Herzog Wilhelm Ernst begonnen, Bücher zu sammeln. Waren Bücher doch vor der Zeit der Journaille neben Flugschriften, Kalendarien, Karten und Bilderbögen so ziemlich die einzigen Medien, die einem die Welt zu erklären versprachen. Die das auf die unterschiedlichste Weise zumindest versuchten und sogar schafften, wenn der Kopf des Lesers entsprechend aufnahmefähig war. Was bei Herzog Wilhelm Ernst anfangs nur ein stets wachsender Haufen von Büchern war, wurde allmählich eine einigermaßen geordnete Büchersammlung, in der dann der glücklose Angestellte Johann Friedrich Vulpius für ein Kleinsthonorar als Registrator und Kopist werkelte. Aus diesem geordneten Grundbestand war unter der für ihren unmündigen Sohn regierenden Herzogin Anna Amalia seit 1766 bereits eine stattliche Bibliothek mit schneeballartig wachsendem Bücherbestand geworden. Denn bei der Frankfurter Buchmesse traten die Abgesandten des Weimarer Hofes regelmäßig als kritisch-fachkundige Bücherkäufer mit genügend Geld im Beutel auf und waren entsprechend gern gesehen. Anna Amalia war so bildungsbeflissen wie viele Mütter, die ihre Kinder mit Büchern versorgen, in der Hoffnung, die würden auch gelesen. Da hatte sie jedoch bei ihrem Sohn Pech. Der hatte wie gesagt ganz andere Interessen.
Doch schauen wir lieber in das Jahr 1775. Der Jungautor Goethe kommt in Weimar an und wird von dem Jungherzog freudig in die Arme geschlossen. Das ist der Beginn einer herzlichen Männerfreundschaft. Dabei hat das Wort Herzog natürlich nichts mit dem Wort Herz zu tun. Sprache täuscht gern. Der neue Herzog ist gerade dabei, seinen Kleinstaat neu zu ordnen. Nach dem Prinzip: Neue Besen kehren gut. Da sind Posten zu verteilen, und der neue Freund aus der großen und modernen Stadt Frankfurt am Main ist bereit, Aufgaben zu übernehmen. So wird Goethe sofort der Chef der Weimarer Bibliothek. Also hat er endlich ein regelmäßiges, festes Einkommen. Dazu kommen in schneller Folge weitere Funktionen. Bald ist Goethe auch für das Hoftheater zuständig, für die Feuerwehr, die Anwerbung von Rekruten und den Wegeerhalt sowie für die Universität in Jena. Es gibt einfach keinen Menschen im kleinen Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, dem der neue Herzog Carl August mehr vertraut und mehr Kompetenz zutraut als seinem juristisch und literarisch gebildeten Freund Goethe.