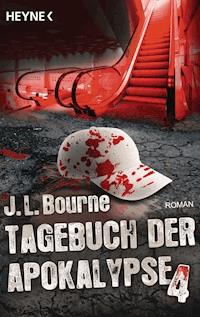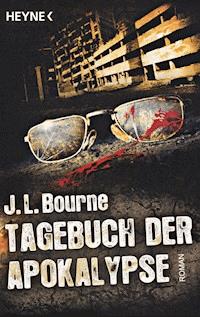8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tagebuch der Apokalypse
- Sprache: Deutsch
Der Kampf ums Überleben geht weiter
Die Welt ist verwüstet, die Toten haben die Herrschaft über den Globus übernommen. Dies ist das Tagebuch eines jungen Soldaten, der sich mit einer kleinen Gruppe Überlebender in der texanischen Wüste der neuen Geißel der Menschheit stellt. Von ihrem vermeintlich sicheren Bunker aus versuchen sie das zu retten, was von der Menschheit noch übrig ist. Doch wie lange können sie durchhalten, wenn die Apokalypse Tag für Tag aufs Neue über sie hereinbricht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DAS BUCH
Die Welt ist verwüstet, bereits seit sechs Monaten streifen die Toten durch die zerstörten Städte, und ihrem Hunger nach Menschenfleisch sind keine Grenzen gesetzt. Eine kleine Gruppe Überlebender ist jedoch fest entschlossen, den seelenlosen Kreaturen nicht kampflos das Feld zu überlassen. Von ihrem Stützpunkt aus, einem verlassenen Bunker mitten in der texanischen Wüste, rüsten sie zum Gegenangriff und versuchen das zu retten, was von der Menschheit noch übrig ist. Aber wie lange können sie durchhalten, wenn die Apokalypse Tag für Tag aufs Neue über sie hereinbricht?
DER AUTOR
J.L. Bourne, geboren in Arkansas, arbeitet hauptberuflich als Offizier der U.S.-Marine und widmet jede freie Minute dem Schreiben. Seine Romanserie Tagebuch der Apokalypse ist in den USA bereits zum Kultbuch avanciert.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.jlbourne.de
Inhaltsverzeichnis
Tagebuch der Apokalypse gewährte uns tiefe Einblicke in das Bewusstsein eines überlebenden Militäroffiziers, der zum neuen Jahr den Vorsatz fasste, ein Tagebuch zu schreiben. Er hat den Vorsatz gehalten und uns in täglichen Einträgen vom Niedergang der Menschheit erzählt. Seine Notizen zeigen uns, wie man von einem normalen Leben in eine Existenz wechselt, in der angesichts heranflutender Horden von Toten, die nicht sterben wollen, nur der Kampf um das persönliche Überleben zählt. Wir sehen, wie er blutet. Wir sehen ihn Fehler machen. Wir werden Zeugen seiner Entwicklung.
Nach zahlreichen Widrigkeiten und Mühsalen entgehen er und sein Nachbar John der regierungsamtlich befohlenen atomaren Vernichtung der Stadt San Antonio (Texas). Nach vielen Abenteuern verschanzen sich die beiden in einer verlassenen Raketenabschussbasis. Frühere Bewohner haben ihr den Namen Hotel 23 gegeben. Nach der Ankunft fängt man einen schwachen Funkspruch auf: Eine Familie, die ebenfalls überlebt und Zuflucht in einer Dachkammer gefunden hat, ist von einer riesigen Horde Untoter umzingelt. Außer William, seiner Frau Janet und ihrer kleinen Tochter Laura hat in ihrem Heimatort niemand überlebt. Nach einer wunderbaren Rettungsaktion tun sich diese drei um des Überlebens willen mit John und dem Erzähler zusammen. Doch reicht dies aus in einer toten, gnadenlos postapokalyptischen Welt, in der ein einfacher Kratzer – von den vielen Millionen Untoten ganz zu schweigen – einen Menschen töten und zum Bestandteil der überwältigenden Untoten-population machen kann?
Die Lage hat in manchen Menschen das Schlimmste hervorgebracht …
Plötzlich werden die Bewohner von Hotel 23 von einer gnadenlosen Banditenhorde angegriffen, die in dem militärischen Stützpunkt mit seinen riesigen Vorräten neue Möglichkeiten für sich sehen. Sie wollen töten, um die Basis zu übernehmen. Es gelingt den Verteidigern zwar in letzter Sekunde, die Angreifer abzuwehren, doch nun müssen sie befürchten, dass diese – falls sie nicht vorher den vielen Millionen hartnäckigen Untoten zum Opfer fallen – irgendwann in größerer Zahl zurückkehren.
Dieses Buch beginnt dort, wo Tagebuch der Apokalypse endete: bei unserem Erzähler und den wenigen Überlebenden einer unvorstellbaren weltweiten Umwälzung, die im Hotel 23 Zuflucht gefunden haben. Folgen wir ihnen durch den zweiten Teil ihrer Reise in die Apokalypse. Stellen Sie sich kurz vor, Sie wären einer dieser Menschen.
Auf ein Neues, aber verrammeln Sie die Tür!
J. L. BOURNE
Am 21. fühlte ich mich langsam besser. Der Angriff der Banditen hatte mir wirklich zugesetzt. Ich stand auf, trank (im Zeitraum mehrerer Stunden) einige Liter Wasser und reckte mich ein bisschen. Dann erkundigte ich mich bei John, wie es an der Oberfläche aussah. Da er in dieser Hinsicht nicht sehr redselig war, folgte ich ihm in den Kontrollraum hinauf und überzeugte mich selbst. In der Nacht zuvor hatte er sich ins Dunkle hinausgeschlichen, von einer Kamera den Sack abgezogen und war zurückgekehrt. Es waren Untote in der Gegend, deswegen war er nicht scharf darauf, allzu lange im Freien zu sein.
Weitere Untote bevölkerten die Ecke, an der die Umzäunung beschädigt war. Die lebenden Leichen waren wie Wasser. Sie strömten immer dorthin, wo der Widerstand am geringsten war.
Meine schmerzhaften Brandverletzungen heilen inzwischen, aber allzu schlimm waren sie ja nun auch nicht. Ich hatte nur ein paar Blasen im Gesicht und anderswo.
Unser Sieg bei der letzten Begegnung mit den Plünderern war größtenteils auf Glück zurückzuführen. Angenommen, sie wären nicht mit einem Tankwagen übers Land gefahren? Dann wären wir jetzt vielleicht alle tot, denn gegen diese Überzahl hätten wir uns nicht wehren können. Nicht nur die Untoten waren uns zahlenmäßig überlegen, sondern auch jene, die uns den Tod wünschten. Ich fürchtete diese Leute fast ebenso wie die wandelnden Leichen. Zumindest theoretisch wären sie uns strategisch überlegen gewesen; sie hätten nur die Köpfe zusammenstecken und sich angemessene Schweinereien ausdenken müssen, um uns von diesem Landstrich zu vertreiben. Wir wissen nicht, wie viele von diesen Banden sonst noch existieren, aber ich bin mir sicher, dass wir im Gegensatz zu ihnen nur eine kleine Minderheit sind.
Kamera Nr. 3 zeigte mir verkohlte Leichen, die um die Wracks des Tanklasters und des Wohnmobils herumtorkelten.
Menschen, die ich getötet hatte.
In dieser Nacht gingen wir raus und machten sie kalt. Um Mündungsfeuer zu vermeiden, schlich ich mich im Dunkeln mit dem Nachtsichtgerät von hinten an sie ran, schaltete meine Waffe auf Einzelfeuer und verpasste ihnen eins in den Hinterkopf. Ich war so nahe an ihnen dran, dass ich jeden einzelnen Schädel fast mit dem Lauf berührte. Jedes Mal, wenn ich den Abzug betätigte, sah ich sie auf den Krach reagieren und sich in der Dunkelheit blind auf das Geräusch zu bewegen. Obwohl die meisten Untoten nichts mehr hatten, was Ohren ähnelte, konnten sie immer noch hören. Das Verfahren wiederholte ich siebzehnmal. Schließlich hatten sich alle zur Ruhe begeben.
Uns fiel auf, dass drei Fahrzeuge bei der kürzlich erfolgten nächtlichen Treibstoffexplosion nicht besonders stark beschädigt worden waren: ein Land Rover, ein Jeep und ein relativ neuer Ford Bronco. Die Fahrzeuge standen gut hundert Meter von der abgebrannten Wiese entfernt. John und ich gingen vorsichtig zu ihnen rüber. Eine nähere Untersuchung ergab, dass die beiden Vorderreifen des Jeeps geplatzt waren. Die Windschutzscheibe sah aus wie ein gewölbtes Spinnennetz.
Der Land Rover und der Ford standen etwa fünfzig Meter von ihm entfernt. Als ich mich dem Rover näherte, stellte ich fest, dass er in einem sehr guten Zustand war. Sein Inneres wurde nicht mehr von seinen früheren Besitzern bewohnt. Wie schön. Wir näherten uns der Tür. Ich öffnete sie und begutachtete eingehend das Innere des Fahrzeugs. Es roch nach Tannenzweigen, was vermutlich mit dem Bäumchen zu tun hatte, das am Rückspiegel hing. Wir stiegen ein, zogen die Türen vorsichtigerweise aber nur so weit zu, dass das Schloss gerade eben fasste. Ich drehte den Zündschlüssel. Der Motor sprang brüllend an. In einer Welt wie dieser hätte ich den Schlüssel vermutlich ebenfalls stecken lassen. Ich schaute mir den dünnen Plastikanhänger an und las: Nelms Land Rover, Texas.
Ich nehme an, die Banditen haben sich das Fahrzeug unmittelbar nach der ganzen Katastrophe in Nelms Autohandel unter den Nagel gerissen. Der Tank ist dreiviertel voll, der Tacho zeigt 4.500 km an. Der Wagen war noch nicht mal eingefahren. Ich legte den Gang ein und raste rückwärts auf die Geländeumzäunung zu. Als wir die von den Banditen mit Säcken verhüllten Kameras erreichten, stiegen wir aus. Wir wechselten uns beim Entfernen der Säcke ab, wobei der eine dem anderen Deckung gab.
Die Lücke in der Umzäunung war ungefähr so groß wie der Land Rover lang. Mir war nicht danach zumute, heute Abend Zäune zu flicken, also frischte ich meine Einparkkenntnisse auf, indem ich den Wagen in die Lücke manövrierte. Mir lag daran, unsere kaltblütigen Freunde daran zu hindern, hinter die Umzäunung zu gelangen.
John stieg an der Beifahrerseite aus. Ich kletterte über den Schaltknüppel hinweg und tat es ihm gleich. Ich drückte das Knöpfchen, warf die Tür ins Schloss und steckte den Schlüssel ein. Wozu das nützlich sein sollte? Ich lasse auch heute noch aus Prinzip keinen Wagenschlüssel stecken.
Ich bin vor ein paar Stunden wach geworden – nach einer erneut schmerzhaften, größtenteils schlaflosen Nacht. Meine Blasen platzen allmählich, was ganz schön wehtut. Ich habe ein paar Blasen an den Augen, dort, wo die Nomex-Klamotten meine Haut nicht geschützt haben. Die Beule am Hinterkopf schrumpft langsam, und seit kurzem juckt es mich beträchtlich mehr als nach dem kleinen Unfall mit dem Tanklaster. Das ist ein gutes Zeichen. Ich gesunde.
Das Internet habe ich aufgegeben. Dort tut sich absolut nichts mehr. Die Webseiten, auf denen ich früher zugange war, um zu sehen, wie die Lage anderswo aussieht, sind alle tot. Damit meine ich die Militärbasen in den vier Ecken der Vereinigten Staaten. Internet-Aktivitäten: keine. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass es keine Rolle mehr spielt, ob da draußen noch jemand ist, der sich ins Netz einloggt. Das Netz-Rückgrat ist gebrochen, und es sieht so aus, als hätten sich alle Typen aus der IT-Branche für die nächsten hundert Jahre zur Mittagspause abgemeldet.
Der Land Rover ist mit einem GPS-Navigationssystem ausgerüstet. Ich war draußen, um das Ding zu überprüfen, und es hat den Anschein, dass das GPS zur Positionsbestimmung nur drei Satelliten empfängt. Ich weiß nicht, wie lange die Satelliten noch in der Umlaufbahn bleiben, wenn die Bodenstationen, die sie steuern, nicht mehr existieren – und ohne die Vögel, die ihnen bisher die Aufnahmen geliefert haben. Wir nähern uns schnell der Eisenzeit. Ich wehre ständig ein geistiges Verlangen nach autodestruktivem Verhalten ab. Ich meine nicht die Gelenkaufschlitzmethode; vermutlich spüre ich lediglich das Verlangen, mehr Risiken einzugehen, weil ich es leid bin, in diesem Dilemma zu leben … Aber da es den anderen nicht anders ergeht, bleibe ich eben. Ich geh nur ein Weilchen mit John raus. Wir wollen versuchen, die umgefahrene Umzäunung zu flicken.
Wir haben den Zaun mit Schrott und Teilen repariert, die von den Trümmern des Banditenangriffs übrig geblieben sind. Wir haben uns auch den Ford Bronco gekrallt. Im Kofferraum lagen vier volle Spritkanister. Ich habe den Rover-Tank mit einem Kanister aufgefüllt; kann ja sein, dass wir ihn irgendwann brauchen. Ich weiß nicht, wieso ich nicht schon früher daran gedacht habe, aber im Verlauf der ganzen Angelegenheit hatte ich unser Flugzeug völlig vergessen. Es fiel mir erst wieder ein, als John mit dem Bronco kam. Wir sind dann zum Wäldchen gegangen, um zu sehen, ob sich jemand an der Kiste zu schaffen gemacht oder sie bei dem Brand vielleicht durch Funkenflug was abgekriegt hat. Sie sah so aus, wie wir sie zuletzt gesehen hatten. Das Laubwerk, mit dem ich sie getarnt hatte, war derart verschrumpelt und braun, dass sie sich erkennbar vom Rest der Vegetation unterschied. John und ich haben weitere Zweige gesammelt und die Tarnung etwas aufgefrischt, dann haben wir die Maschine wieder allein gelassen.
Die Untoten aus unserer Gegend haben sich zerstreut. Die Banditen haben viele von denen ausgeschaltet, weil sie sie über unser Grundstück gejagt haben. Die Kameras zeigen nur ein paar Nachzügler an der vorderen Sicherheitstür. Der Beknackte mit dem Stein wankt noch immer hier rum, wie schon vor mehr als einem Monat. Er schlägt gegen die Sicherheitstür und marschiert zum Rhythmus seiner eigenen Trommel. Das leere Raketensilo ist die reinste Sauerei. Wir haben nicht die geringste Lust, uns darum zu kümmern. Ich weiß nicht, was diese Dinger dazu treibt, nach dem Tod wieder aufzustehen und herumzulaufen, aber ich möchte auf keinen Fall da unten rumschlurfen und mich versehentlich an einem infizierten Kieferknochen verletzen. Hätte ich einen Betonmischer, würde ich das verdammte Loch zuschütten und einfach vergessen.
Wir leben noch, aber unser Szenario spiegelt das jener Menschen, die vor dem Weltuntergang in Krankenhäusern an Maschinen angeschlossen waren. Sie lebten mit geborgter Zeit und waren zum Untergang verurteilt. Uns geht es kein bisschen anders. Irgendwann wird der Mittelwert auch mich erwischen. Es ist nur eine Frage des Wann.
Ich hätte nichts dagegen, noch einen Tanklaster in die Hände zu bekommen (statt ihn in die Luft zu jagen). Dann hätten wir Treibstoff für Expeditionen, die wir vielleicht unternehmen müssen. Ich würde ihn in sicherem Abstand von uns abstellen, denn aus dem Fehler der Banditen habe ich etwas gelernt. Ein üppiges Spritlager wäre ein solches Risiko wert. Ich weiß nicht genau, wie viel so ein Tankwagen laden kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Spritmenge unsere beiden Fahrzeuge eine ganze Weile über versorgen könnte. Einen Tankwagen aufzutreiben dürfte kein Problem sein. Wir brauchen nur einen auf der Interstate aufzulesen, die ein paar Kilometer von hier nach Norden führt.
Wieder kodiertes Gerede aus dem Funkgerät. Diesmal wechseln sie jede Minute die Frequenz. Ich bin sicher, dahinter steckt ein Plan. Braves COMSEC.
Ich kann nicht einschlafen. Tara und ich haben uns heute mehrere Stunden lang unterhalten. Ich komme mir ziellos vor und empfinde nicht allein so. Viele von uns vermissen das Normale; das Gefühl, eine Stempeluhr zu drücken und eine berufliche Tätigkeit als langweilig zu empfinden. Vor dem Untergang hatte ich wenigstens einen Beruf und Ziele. Jetzt habe ich nur noch ein einziges Ziel: am Leben zu bleiben. Die Erwachsenen haben sich heute im Fitnessraum versammelt, Rum getrunken und sich vergnügt. In meiner vom Alkohol erzeugten Euphorie habe ich unsere Lage fast vergessen. Seit wir hier sind, ernähren wir uns von den abgepackten Fertiggerichten des Stützpunktes. Ich würde gern mal was anderes essen, aber Einkaufsfahrten sind tagsüber gefährlich.
Etwa eineinhalb Stunden lang hatten wir Volkstrauertag. Tara und ich waren gestern draußen und haben in einer Art stillem Gedenken an alle, die von uns gegangen sind, texanische Wildblumen gepflückt. Es schmerzt mich unsäglich, wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern als Untote über die Hügel unseres Landes wandern. Ich bin fast versucht heimzukehren, nur um mich davon zu überzeugen und sie, wie es sich für einen anständigen Sohn geziemt, zur Ruhe zu betten.
Lauras Einschulung steht ebenfalls an. Janice hat mich gebeten, ihr ein wenig Weltgeschichte nahezubringen, da mir so etwas in meinem früheren Leben als Offizier Spaß gemacht hat. Lauras Augen wurden groß, als sie hörte, wie die Vereinigten Staaten entstanden und einst Menschen auf dem Mond herumspaziert sind und dergleichen. Sie hat nie eine Welt ohne Smartphones, HTTV oder Internet gekannt und ist noch viel zu jung, um je Schoolhouse Rock gesehen zu haben. Ich würde fast alles dafür geben, nochmal an einem Samstagmorgen in den frühen Achtzigerjahren bei uns im Wohnzimmer zu sitzen und zu singen, »nur ein Bill auf dem Capitol Hill« zu sein. Irgendwie bereitet es mir ein schlechtes Gewissen, dass Laura keine Gleichaltrigen kennt und kein kleiner Bengel bei uns ist, der im Unterricht an ihren Zöpfen zieht.
Ich brauche wirklich Schlaf. John und ich wollen morgen einen Ausflug mit der Maschine machen. Wir wollen Treibstoff für die Kiste aufspüren und uns ein wenig in der Gegend umsehen. Um keinen Beschuss auf uns zu ziehen, wollen wir diesmal weniger tief fliegen. Ich habe noch die Karten von unserem Trip zur Insel Matagorda. Auf ihnen sind auch die Flugplätze der Gegend verzeichnet. Ich würde gern irgendein synthetisches Tarnnetz auftreiben, um die Maschine besser vor neugierigen Blicken verbergen zu können.
Gestern Morgen sind John, William und ich in aller Frühe nach Westen aufgebrochen. Bevor die Sonne im Osten über den Horizont kam, waren wir bereits zum Flugzeug gepirscht. Wir haben es auf den Grasstreifen geschoben, um dort abzuheben. In der Ferne sahen wir ein paar untote Nachzügler herumlatschen. Dann waren wir auch schon in der Luft. Dass William dabei war, hatten wir in letzter Minute entschieden. Er wollte unbedingt mitfliegen. Wir konnten mit dem VHF-Funkgerät der Cessna Verbindung mit Hotel 23 aufnehmen. Falls die Frauen in Schwierigkeiten gerieten, konnten wir mit ihnen kommunizieren.
Wir hielten Ausschau nach einem großen Flugplatz außerhalb großstädtischer Ballungsräume. Bevor ich mich in der Nacht zuvor zum Schlafen gezwungen hatte, hatte ich den William P. Hobby Airport ausgewählt. Er befand sich im Süden Houstons, außerhalb des Stadtzentrums.
Der Flug dauerte nicht lange. Wir passierten unterwegs zahlreiche Örtchen, deren Straßen ausnahmslos mit wandelnden Toten gesprenkelt waren. Nach nicht mal einer Dreiviertelstunde kam der Flugplatz in Sichtweite. Ich hielt es für sicher, runterzugehen, weil man dann vielleicht auch Menschen sah, die uns vom offenen Rollfeld aus beschießen wollten. Als wir uns der langen Bahn näherten, erspähte ich ein neues Todessymbol.
Auf der Landebahn stand eine Boeing 737. Ihr Rumpf war heftig zerknittert, was auf eine schwere Bruchlandung hinwies. Sie war das einzige Großflugzeug auf dem Gelände. Ich sah zwar andere, kleinere Kisten – Privatjets und Propellermaschinen ähnlich der Cessna –, aber die 737 war das letzte große Passagierflugzeug auf dem Hobby Airport. Wir umkreisten den Platz ein weiteres Mal, um uns vor der Landung zu versichern, dass wir die Lage richtig eingeschätzt hatten. In der Ferne, nicht weit entfernt von einem der Hangars, konnte ich einen Tankwagen erkennen. Im Vergleich zu den anderen war der Hangar groß und sehr wahrscheinlich eher für Boeings statt für jene Maschinen gedacht, die nun, für immer nutzlos, auf dem Rollfeld herumstanden.
Die Neugier trieb uns an. Wir beschlossen, in der Nähe der 737 zu landen, um rauszukriegen, ob sie vielleicht Dinge enthielt, die wir brauchen konnten. Es war ein Vorteil, dass sie im Freien stand und nicht an einem Gebäude, das uns für jemanden (oder etwas) zu einer leichten Beute machte, wenn er oder es sich an uns heranschleichen wollte. William sollte draußen, in der Nähe unserer Kiste, Posten beziehen, während wir eine Einstiegsmöglichkeit suchen wollten. Sämtliche Sichtblenden der 737 waren unten, was aber keine Rolle spielte, da die Bullaugen ohnehin gute fünf Meter über dem Boden lagen. Die Notausgänge über den Schwingen waren gesichert, so dass uns bei dem Versuch, sie zu öffnen, kein Glück beschieden war: der verzogene Rumpf hatte sie auch noch heftig verklemmt. So blieb uns nur der Notausgang des Kopiloten auf der Steuerbordseite des Cockpitfensters.
Ich schaute auf der rechten Cockpitseite gute drei Meter hoch in die Luft und wusste, wie wir uns Zutritt zu der Maschine verschaffen würden. Mit einem Enterhaken, den William und ich kürzlich mit einem Seil und etwas Metall gebaut hatten, das von der Tankerexplosion im letzten Monat übrig geblieben war, konnte ich zum Fenster hinaufklettern. Zuerst stützte ich Johns Gewicht auf meinen Schultern, als er nach oben zur Notluke griff, um die luftdicht abschließende Cockpitversiegelung zu lösen.
Ich hätte ihn beinahe fallen gelassen, als er sorglos ein loses Stück Cockpitscheibenglas ins Innere der Maschine schlug. Als mir klarwurde, was er getan hatte, stieß ich einen Fluch aus, grunzte unter seinem Gewicht und fragte ihn, ob der von ihm veranstaltete Lärm im Inneren der Maschine irgendwelche vernehmbaren Reaktionen erzeugt habe. William verneinte, erwiderte aber, dass der aus dem Flugzeug kommende Geruch grässlicher als grässlich sei und die Cockpittür nicht offen stünde. Unter Zuhilfenahme der Pitotrohre, die aus der Aluminiumhaut der 737 hervorragten, kletterte John von meinen Schultern, und wir fassten einen Beschluss.
Mir reichte es. Ich hatte nicht vor, meinen Hals zu riskieren. Ich wollte meinen Arsch nicht durch die enge Luke schieben und ihn mir bei dem Versuch, das Gleichgewicht zu halten, abbeißen lassen. Die Maschine war ein Grab und würde es bleiben. Ich kann mir nur ausmalen, welches Grauen in dem Ding auf uns gewartet hätte. Angeschnallte Passagiere, die hin und her hampeln, um sich von ihren Gurten zu befreien, und tote Flugbegleiterinnen, die vorsichtig durch die Gänge schreiten und ihre Pflicht auch im Leben nach dem Tod erfüllen.
Wir kehrten zu unserer Kiste zurück und besprachen unser Vorhaben erneut: Wir wollten Treibstoff und jene Dinge erbeuten, die wir brauchten. Unser Ziel war der Hangar. Ich bezweifelte, dass es uns gelingen würde, den Tankwagen dorthin zu bewegen, wo unser Flugzeug stand, also stiegen wir wieder ein und fuhren dem Hangar und dem Treibstofflager entgegen. Je näher wir unserem Ziel kamen, umso mehr wertschätzten wir die Aufklärung aus Erster Hand. Durch die Fenster unserer Kiste nahmen wir im Inneren des Flughafengebäudes Bewegungen wahr. Sie wurden ausnahmslos von Untoten ausgeführt. Ich dachte nicht weiter über sie nach, als ich das Grauen aus dem offenen Hangar strömen sah, dem wir uns zügig näherten.
Ich hielt an. Ich ließ den Motor laufen und sprang, das Gewehr in der Hand, ins Freie. John war ebenfalls schnell draußen, und William war gleich neben mir. Er wollte an mir vorbei, doch ich streckte den Arm so aus, wie meine Mutter mich immer zurückgehalten hatte, wenn unser Auto im Begriff war, urplötzlich abzubremsen. William war so auf die Untoten fixiert, dass er beinahe in den rotierenden Propeller unseres Flugzeugs gelaufen wäre.
Wir wichen zurück und beschäftigten uns damit, sie zu beseitigen. Ich nahm etwa zwanzig Gestalten wahr. Ich konnte die Schatten ihrer Bewegungen unter dem Bauch des Tankwagens tanzen sehen. Ich überbrüllte den Motor, damit meine Freunde zuerst jene ausschalteten, die sich dem Propeller näherten, denn an einem Maschinenschaden war mir nicht gerade gelegen. Wir brauchten den Treibstoff und mussten den Motor laufen lassen, bis sie keine Gefahr mehr für uns darstellten. Es war eine Zwickmühle. Ich begann zu feuern. Meine Freunde taten es mir gleich. Ich erledigte fünf. Nummer sechs weigerte sich, zu Boden zu gehen. Ich verpasste ihr zwei Kopfschüsse. Trotzdem ging sie weiter. Ich vergaß ihren Kopf und schoss ihr die Beine unter dem Hintern weg.
John und William machten mit den anderen Untoten kurzen Prozess. Ich knöpfte mir währenddessen die restlichen hinter dem Tankwagen vor. Für den Moment waren wir sie los. Ich schaute mir den Tankwagen an, um nachzusehen, ob er fahrtüchtig war, und schlug mit dem Kolben meines Gewehrs gegen den Tank. Das Geräusch, das ich vernahm, deutete auf Treibstoff im Inneren. Eines kam mir allerdings komisch vor. Warum stellte jemand ein Tankwägelchen für Propellerflugzeuge vor einem Boeing-Hangar ab? Allmählich schwante mir, dass ich seit dem Ende der Welt wohl nicht der einzige Pilot war, der sich auf diesem Flugplatz umgeschaut hatte. Ich fragte mich, ob der Laster kürzlich verwendet oder wiederverwendet worden war oder ich einfach nur zu viel nachdachte.
Bevor ich die Tür öffnete, stieg ich zur Fahrerseite rauf und lugte durchs Fenster. Es gab nichts zu sehen. Der Zündschlüssel steckte. Der Laster war in einem guten Zustand. Ich betätigte den Schlüssel. Der Motor erwachte beim ersten Versuch hustend zum Leben. Entweder hatte jemand den Wagen gewartet, oder wir hatten hinsichtlich seiner Batterie unglaubliches Glück. Ich legte die Pumpenschalter um und stieg aus. Bevor ich den Flugzeugmotor abschaltete, prüfte ich die Umgebung, um sicher zu sein, dass uns niemand überfallen konnte. Als der Propeller langsamer wurde und der Motorenlärm nachließ, fing mein Gehör das nervtötende Klicken von Schmuck auf, das einige Hundert Meter von uns entfernt gegen die Scheiben des Flughafengebäudes schlug und meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Untoten erweckten den Eindruck, gegen den Treibstoffdiebstahl zu protestiern. Sie sahen uns vom Gebäude aus zu und schlugen auf die Scheiben ein. Ihre Armbanduhren, Ringe und Armreife klangen aus der Ferne wie ein lauter Regen auf Sekuritglas.
Ich schraubte die Tankdeckel ab und ging zum Tankwagen hinüber. Als ich den Schaltkasten öffnete, um den Schalter zu betätigen, fiel ein etwa briefbogengroßer gelber Zettel heraus, den der Wind davontrug. Ich lief hinter ihm her, erwischte ihn mit einem Stiefel, faltete ihn auseinander und las:
Familie Davis Flugplatz Lake Charles, Louisiana, 14. 5.
Eine ganze Familie von Überlebenden. Wie klug, die Nachricht im Inneren des äußeren Treibstoffpumpen-Schaltkastens zu hinterlassen. Mit dieser einfachen Geste hatte Davis sich als Mensch mit Grips erwiesen. Er hatte seinen Namen und seinen Wohnort nicht in riesengroßen Buchstaben aufs Rollfeld gesprüht, sondern seine Botschaft an einem Ort hinterlegt, an dem nur ein anderer Pilot sie finden würde. Autofahrer können mit Flugbenzin nichts anfangen; was also soll sie zu einem Flugzeugtankwagen locken? Ich schob den Zettel in die Tasche. Auf dem Weg zur Maschine fiel mir auf, dass John und William auf heißen Kohlen saßen. Ich behielt sie im Auge und füllte die Tanks bis zum Rand. In Erwartung dessen, was ich als Nächstes sagen würde, schien William schon im Voraus leicht zu erblassen.
Es war Zeit, den Hangar zu überprüfen.
Ich weiß nicht, warum sie sich fürchteten. Die Hangartore standen weit offen. Alles, was uns anspringen wollte, brauchte nur herauszukommen und es versuchen. Nach der ganzen Ballerei war ich mir ziemlich sicher, dass sich in diesem Hangar keine Untoten mehr befanden. Ich hatte Recht.
Als wir zu dritt über die Schwelle des riesigen Hangar-Rolltors traten, hätte ich mir beinahe in die Hose geschifft. Irgendetwas rauschte aus der Dunkelheit heran und hätte mich beinahe am Kopf getroffen. Allem Anschein nach hatte eine Schwalbenfamilie ihr Sommernest genau über dem Eingang gebaut, und die Mutter wollte mich nicht in der Nähe ihrer Jungen sehen. Ich hörte sie über mir zwitschern und fragte mich, wie viele Untotenaugen sie in den vergangenen Wochen herausgepickt hatte. Ich hielt mich von dem Nest fern und arbeitete mich nach hinten zu den Vorräten durch.
Der Hangar verfügte über zahlreiche Oberlichter aus Plexiglas. Es war ein schöner, sonniger Tag. Der Geruch des Todes lag in der Luft, doch der Verwesungsmief war den Untoten bei ihrem durch die Hände unseres kleinen Teams besorgten Ableben ins Freie gefolgt. Es dauerte nicht lange, bis wir die Tür des großen Lagerraums fanden.
Ich öffnete sie langsam – mit einer langen Stange, die man normalerweise dazu verwendet, nicht leicht erreichbare Flugzeugbullaugen zu putzen. Abgesehen von Mottenkugelgeruch wehte uns nichts entgegen. Der Raum war sauber. An den Geruch der Untoten war ich gewöhnt, aber wenn es nicht nach ihnen roch, erkannte ich das genauso sicher. Der Lagerraum war beinahe ein kleines Lagerhaus. Die Regale wimmelten von Ersatzteilen für Flugzeuge und anderen Ausrüstungsgegenständen. Wir waren im Wartungshangar der Boeing. Ich suchte aber nicht nach Ersatzteilen für Düsentriebwerke, sondern nach Funkgeräten und sonstigem Zeug.
Dann fand ich etwas, das ich unbedingt nach Hause mitnehmen wollte. Zwei Reihen schwarzer Gerätschaften, die Aktenmappen ähnelten und auf denen »Inmarsat« stand. Wir waren auf Luftfahrt-Satellitentelefone gestoßen. Ich hatte keine Ahnung, ob sie noch funktionierten. Vier der Dinger, sie standen auf der rechten Seite des Regals, waren noch in Kunststoff gehüllt. Wir nahmen sie mit und trugen sie zur Tür. Bei der Fortführung unserer Lagerhallenexpedition fanden wir zahlreiche tragbare Notfunkgeräte, aufblasbare Rettungsflöße und andere nützliche Dinge. Wir nahmen die Satellitentelefone und tragbaren VHF-Notfunkgeräte und gingen hinaus.
Unsere Kiste war voll betankt. Wir besaßen vier neue Satellitentelefone, mehrere tragbare Funkgeräte und hatten zudem die überraschende Entdeckung gemacht, dass eine Familie vor einigen Wochen zu einem Flugplatz in Louisiana aufgebrochen war. Es wurde Zeit, also luden wir alles ein und machten uns auf den Rückflug. Diesmal blieben wir so lange auf einer Höhe über 7000 Fuß, bis sich Hotel 23 beinahe genau unter uns befand. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, von verirrten Kugeln abgeschossen zu werden. Als wir uns dem Stützpunkt näherten, funkte ich Jan und Tara an und meldete: »Navy One – Bug- und Hauptfahrwerk ausgefahren und eingerastet.« Ich fragte mich, ob jemandem das Rufzeichen der Präsidentenmaschine auffiel, aber niemand raffte es. Davis würde es bestimmt raffen. Wir landeten und versteckten die Kiste wie zuvor. Als wir in den Bunkerkomplex zurückkehrten, dachte ich an die Familie Davis. Ob sie den Flugplatz in Louisiana überhaupt erreicht hatte?
Ich habe mich in den vergangenen drei Tagen mit der Gruppe über die Frage auseinandergesetzt, ob ich versuchen soll, die Familie Davis am Lake Charles zu finden. Ich habe das Kartenmaterial überprüft und festgestellt, dass Lake Charles so weit nicht entfernt ist. Natürlich muss ich, sollte ich den Plan verwirklichen, nicht nur die Entfernung, sondern auch den für die Strecke nötigen Treibstoff genau berechnen. Die anderen glauben wohl, dass das Risiko den Nutzen, die Davis’ zu finden, bei weitem überwiegt. John hält sich raus, doch Jan, Tara und William vertreten hartnäckig den Standpunkt, ein solcher Flug könne rasch zu einer Reise ohne Wiederkehr werden.
Obwohl es uns gelungen ist, die Satellitentelefone aufzuladen, gibt es, wie wir feststellen mussten, leider niemanden, den man damit anrufen kann. Sie scheinen aber gut zu funktionieren, wenn wir sie dazu verwenden, sie untereinander anzuwählen. Es hat nicht lange gedauert, ihre Funktionsweise zu verstehen, aber wir haben keine Ahnung, wer die Rechnung kriegt. Ich weiß, dass die Telefone den Fluggesellschaften gehören und weiß auch, dass niemand mehr da ist, der für die Nutzung der Satelliten Rechnungen verschicken kann; ich habe aber die Sorge, es könne eine Art automatische Systemabschaltung geben, wenn so ein Telefon eine gewisse Minutenzahl in Betrieb war.
Im Moment interessiert es mich brennend, was die Leute am Lake Charles gerade tun. Haben sie gehofft, dass jemand ihre Nachricht findet? Ich habe das Bedürfnis, mich mit ihnen zu unterhalten, selbst wenn es bedeutet, dass ich ein Satellitentelefon an einem selbst gebastelten Fallschirm aus der Maschine werfen muss. Das wäre wenigstens etwas. Dann könnten wir mit ihnen kommunizieren, mehr über sie erfahren und Ideen austauschen.
Ich breche heute Morgen auf. John und die anderen bleiben hier für den Fall, dass ich jemanden mitbringe. Ich möchte die Maschine nicht überbelasten. Ich hoffe, die Familie Davis hat sich nicht zu weit vom Flugplatz am Lake Charles entfernt. Während ich hier sitze und den gelben Zettel begutachte, der fast einen Monat alt ist, frage ich mich, ob sie überhaupt noch leben oder vielleicht belagert werden, wie John und ich damals im Tower. William hat mich fast angefleht, ihn mitzunehmen, aber wie gesagt: Es könnte sein, dass ich den Platz für andere Menschen brauche. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, deswegen kann ich das Risiko nicht eingehen, die Kiste zu überladen.
Neben der üblichen Ladung – einer Pistole mit 50 Schuss 9-mm-Munition und dem Gewehr mit mehreren Hundert Schuss – nehme ich zwei aufgeladene Satellitentelefone mit. Wasser und Proviant für mehrere Tage sollen ebenfalls im Laderaum der Maschine heimisch werden.
Ich habe immer gedacht, mir würde, wenn ich irgendwann meine letzten Worte in dieses Tagebuch schreiben muss, etwas Prägnantes und Bedeutendes einfallen. Da ich aber weder prägnant noch bedeutend bin, leihe ich mir einen Satz eines bedeutenden, längst (wirklich und endgültig) verstorbenen Menschen aus: »Bis zum Letzten ringe ich mit dir; aus dem Herzen der Hölle steche ich auf dich ein; um des Hasses willen spucke ich mit dem letzten Atemzug nach dir.« (Herman Melville/Kapitän Ahab).
Und auf geht’s zur Pequod.
Zweihundertsiebzig Kilometer in gerader Linie, das war die Entfernung zum Lake Charles. Es sollte aber kein gerader Schuss für mich werden, da ich mir vorgenommen hatte, nochmal über dem Hobby-Flugplatz zu kreisen, um nachzusehen, ob der Tankwagen – für den Fall, dass ich ihn auf dem Rückflug brauchte – noch dort stand. Ich konnte knapp neunhundert Kilometer zurücklegen, bevor meine Kiste vom Himmel fiel.
Als ich in sechshundert Meter Höhe über den Flugplatz düste, sah ich den Tankwagen dort stehen, wo wir ihn hatten stehen lassen. Ich konnte auch erkennen, dass eine Scheibe des Flughafengebäudes zerschlagen war und zahlreiche Untote aus der neuen Öffnung aus dem Gebäude heraus- und hineinströmten. Sie führte auf ein Dach, das knapp sechs Meter über dem Rollfeld lag.
In der Nähe des Tankwagens sah ich niemanden. Ich weiß allerdings, dass Untote keine Höhenangst und nichts dagegen haben, einfach in den Abgrund zu laufen, wenn sie glauben, aufgrund ihrer Bemühung winke ihnen eine Mahlzeit. Zufrieden mit dem, was ich sah, flog ich nach Nordosten zum Lake Charles. Die Sonne stand hoch am Himmel. Sie leuchtete mir genau in die Augen, als ich in 7000 Fuß Höhe die Horizontale verließ. Eine halbe Stunde später konnte ich in der Ferne die Überreste der Stadt Beaumont ausmachen. Ich beschloss, tiefer zu gehen und nach möglichen Überlebenden Ausschau zu halten. Laut meinem Kartenmaterial war Beaumont ein mittelgroßer Ort.
Rauch und Feuer umwirbelten die höheren Gebäude, aber auch das Innere der Häuser. Sie sahen aus wie Streichhölzer unterschiedlicher Länge. Jedes wies seine eigene Form von Feuer und Rauch auf. Wenn das Satellitenfotosystem unseres Bunkers ordentlich funktioniert hätte, hätte ich mir den Ausflug sparen können. Wir hatten den Passierschein nach Louisiana (den Satellitenfußabdruck) zwei Wochen zuvor verloren. Ich hätte die Koordinaten von Lake Charles sehr gern eingegeben und mir Antworten geholt, ohne das Haus zu verlassen.
In diesem Gebiet gab es keinen Strom mehr. Die roten Antikollisionsleuchten auf den hohen Funktürmen waren allesamt ausgeschaltet, was mir noch mehr Spaß bereitete. Ich flog niedrig und langsam und schaute mir die noch nicht in Flammen stehenden Straßen und Gebäude genau an. Doch sosehr ich meine Augen auch anstrengte: Überlebende sah ich nicht. Das Einzige, was sich an diesem schönen Sommertag da unten bewegte, waren sie … Die, die nicht zu uns gehören.
Nachdem ich dreimal etwas überflogen hatte, das ich für das Stadtzentrum hielt, war ich überzeugt, dass hier niemand mehr lebte. Jedenfalls war kein Schwanz da, der mir ein Zeichen gab. Der Flugplatz von Lake Charles lag knapp achtzig Kilometer östlich von Beaumont. Bei meinem gegenwärtigen Tempo würde ich ihn in 28 Minuten erreichen. Dies erwies sich als sehr lange Wartezeit. Hinsichtlich meiner Begegnung mit den Überlebenden war ich besorgt. Ich wusste ja nicht, was mir bevorstand. Auf dem Zettel in meiner Tasche stand zwar eindeutig »Familie Davis«, aber ich wusste noch immer nicht, ob sie sich als Freund oder Feind erweisen würde. Verdammt nochmal, das Datum betraf den 14. des vergangenen Monats. Ich hatte nicht mal eine Garantie, ob die Leute noch auf den Beinen standen – beziehungsweise noch welche hatten.
Nach nicht allzu langer Zeit konnte ich einen vor dem Bug meiner Maschine größer werdenden sichelförmigen See erkennen. Auf der Landkarte lag er nur ein Stückchen südwestlich meines Zielortes. Ich musste diese Leute finden. Für meine Freunde konnte sich, falls mir etwas zustieß, ein zweiter Pilot als sehr nützlich erweisen. Allein Davis’ Anwesenheit war eine Art Versicherungspolice.
Die Sonne stand noch immer hoch am Himmel. Es war fast 14.00 Uhr, als ich den Flugplatz erreichte. Ich musste einen kleinen Schaufensterbummel machen, um ihn unter mir in dem Qualm und Durcheinander des Stadtgebietes zu finden. Ich ging mit dem Bug runter, verlangsamte auf 70 Knoten und leitete den Landeanflug ein. In der Nähe des Rollfeldes sah ich zahlreiche Gestalten.
Aus meiner Höhe betrachtet schien es da unten jede Menge Überlebende zu geben. Sogar aus der Ferne konnte ich ihre hellen bunten Klamotten erkennen, die sich gänzlich von dem dreckigen zerrissenen Zeug der Untoten unterschieden. Ich hatte sogar den Eindruck, dass die Leute arbeiteten, denn ich sah jemanden, der eine Kelle mit einem Blinker trug, die man auf Flugplätzen dazu verwendet, Maschinen in ihre Parkposition zu lotsen.
Ich weiß nicht, was mich dazu brachte, Dinge zu sehen, die ich sehen wollte, aber ich merkte schnell, dass ich mich getäuscht hatte. Der Flugplatz war in der Hand der Untoten. An der Westseite des Geländes fehlte ein großes Stück Zaun; die wandelnden Leichen hatten sich auf das Gelände ergossen. Ich zog den Bug wieder hoch und wollte am Kontrollturm vorbeifliegen – für den Fall, dass die Familie Davis darin verbarrikadiert war.
Es war niemand darin. Außer den Untoten. Sie waren überall, auch im Inneren des Towers. Als ich ans andere Ende der Rollbahn kam, sah ich unter mir ein Kleinflugzeug stehen. Die Türen standen offen; rings um den Flieger lagen Leichen am Boden. Es waren so viele, dass ich mit dem Zählen nicht mitkam. Einige Leichen lagen rings um die Propellersektion der Kiste – als wären sie genau auf den Propeller zugegangen und auf der Stelle in Scheiben geschnitten worden. Ich sah auch jede Menge Gliedmaßen, meist Arme. Sie lagen um den Vorderabschnitt herum.
Als ich höher ging, bestätigte sich mein Verdacht. Fast genau in dem Moment, in dem ich den Schluss zog, dass es an der Zeit war, nach Hause zurückzufliegen, sah ich sie. Zwei Personen winkten mir aufgeregt von dem Laufsteg aus zu, der um den Hauptwassertank des Flugplatzes herumwand. Sie winkten um ihr Leben. Ein Junge und eine Frau.
Ich zog an ihnen vorbei und ließ die Schwingen wippen, damit sie wussten, dass ich sie sah. Neben den beiden lagen ein Schlafsack und einige Kisten auf dem Wasserturm. Ich konnte kaum fassen, dass sie auf dem Turm festgesessen und doch überlebt hatten. Sie mussten Gott weiß wie lange den Elementen ausgesetzt gewesen sein. Ich war zu schnell, um sie mir genau anzuschauen, aber langsam genug, um zu erkennen, dass sie lebten.
Der Wasserturm stand abseits vom Flugplatz, auf der anderen Seite des kaputten Maschendrahtzauns. Hätte seine untere Hälfte nicht im Schatten von Bäumen und Gesträuch gestanden, hätte ich sie wegen der Untotenschar, die an den Säulen kratzte, auf denen der Turm stand, eher gefunden. So sah ich die ihre Arme unermüdlich in die Höhe reckenden Untoten erst, als ich genau über dem Wasserturm kreuzte.
Auf dem Rollfeld konnte ich unmöglich landen. Bei dem Loch im Zaun wären die Untoten, die die Überlebenden belagerten, sofort auf mich zugeströmt. Der Motorenlärm hätte sie angezogen. Noch dazu hätte ich eins der Viecher beim Start touchieren können, mit katastrophalen Folgen für meine Maschine. Ich hätte gern eine Möglichkeit gefunden, den Leuten mitzuteilen, dass ich zurückkehren würde, aber da das Adrenalin angesichts der Aussicht, die Untoten am Hals zu haben, in mir raste, fiel mir keine ein.
Ich ging höher, ließ den Flugplatz hinter mir und suchte eine passende Landebahn. Ich flog so niedrig wie möglich nach Osten und hielt im Umkreis von fünfzehn Kilometern Ausschau nach einem Platz, an dem ich runtergehen konnte. Laut meiner Karte und der Aussicht aus der Kanzel flog ich genau über der Interstate 10. Auf der nach Osten führenden Spur sah ich überall Fahrzeuge. Die nach Westen führende Spur war hingegen relativ frei. Ich notierte mir geistig die Zeit und das Tempo, mit dem ich flog, damit ich den Rückweg zum Wasserturm besser berechnen konnte.
Während meine Kopfberechnungen sich in meinem Schädel überschlugen, entdeckte ich am Boden eine weitere postapokalyptische Odyssee. Ein großes Stück der I-10 war verschwunden, ebenso wie eine an sie grenzende Überführung. Dort war neben einem Krater ein grünes Militärfahrzeug abgestellt. Mehrere Schilder mit der Aufschrift GEFAHR! umgaben die Stelle. Ich nehme an, der Highway wurde nach dem Untergang bewusst gesprengt, oder die Brücke war zusammengebrochen, und chronische Erosion hat den Rest des Highways mitgerissen. Wie auch immer: Es war die Gelegenheit, die ich nutzen musste. Ich setzte zur Notlandung auf der Interstate an. Mir fiel ein, dass ich vor zwei Jahren über dieses Stück Highway gefahren war, nachdem man mich zu einer militärischen Ausbildung abkommandiert hatte. Nun wollte ich ein Flugzeug dort landen.
Die Straße war frei. Ich sah zwar in der Ferne Trümmer, doch bevor sie zum Problem wurden, würde ich längst am Boden sein. Ich brachte die Maschine runter, wenn auch nicht ohne Komplikationen. Nach dem Aufsetzen trat ich auf die Bremse, um die Geschwindigkeit zu verringern. Ein, zwei, dann vier Untote schlurften aus dem von hohem Gras bewachsenen Mittelstreifen. Es waren weniger als ich erwartet hatte. Als ich etwas fester auf die Bremse trat, spürte ich ein Rucken in den Pedalen. Die Maschine drehte sich jäh nach rechts. Eine der Bremsen war im Eimer. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste das Ruder auf der anderen Seite einsetzen, um die Kiste auf geraden Kurs zu bringen, damit sie ausrollte, bis der Luftwiderstand sie stoppte.
Die Trümmer, die ich bisher für kein Problem gehalten hatte, wurden plötzlich zu einem sehr großen. Ich trat auf die funktionstüchtige Bremse und bewegte das Gegenseitenruder, um nicht vom Kurs abzukommen. Dabei küsste ich leider jedes Mal die rechte Seite des Highways. Hätte ich nicht kurz vor den Trümmern angehalten, wäre es wahrscheinlich zu einem verhängnisvollen Zusammenstoß gekommen. Der Schrott, der meinen Weg fünfzig Meter weiter blockierte, bestand aus einem grünen Army-Laster und einer eingesackten Überführung. Ich bezweifelte, dass zwei Überführungen zufällig so zusammenkrachen konnten. Sie waren wahrscheinlich das Ergebnis eines professionellen Abrisses. Ich hatte kaum genug Platz, die Maschine zu wenden und für einen Start in Position zu bringen. Vorausgesetzt natürlich, ich kam überhaupt zu ihr zurück. Ich schaltete den Motor ab, behielt die kleine Anzahl der in meine Richtung latschenden Untoten im Auge und stellte meine Expeditionsausrüstung zusammen.
Ich griff auf den Rücksitz und nahm mein Gewehr und die Magazine an mich. Die Reservemagazine stopfte ich in meinen Tornister, dann noch vier weitere in leicht erreichbare Taschen. Meine Handfeuerwaffe hing bereits am Gurt. Ich packte des Weiteren vier Flaschen Wasser und zwei Einmann-Rationen in den Tornister. Ich wusste nicht, wie lange die beiden schon auf dem Turm waren und ob sie überhaupt noch über Essen und Trinken verfügten.
Ich machte die Tür der Maschine zu, drehte mich um und zuckte angesichts der fauchenden und verwesenden Visage einer Kreatur zusammen. Ich schlug mit dem Gewehrkolben gegen ihre Schläfe und trat ihr so fest vors Knie, dass sie zu Boden ging. Das Ding war weder eine Kugel noch das unerwünschte Nebenprodukt des lauten Knalls wert. Als ich mich von der Maschine entfernte, rührte es sich nicht mehr.
Ich ging rechtwinklig zur Interstate in den Wald. Ich wollte der Straße von dort aus folgen, weil ich dort vor dem stets suchenden, ständig wachsamen Blick der Kreaturen sicher war. Ich konnte sie im Vorbeigehen hin und wieder zwischen den Bäumen erspähen. Sie kamen mir verwirrt vor und schienen zu ahnen, dass sich in ihrer Nähe etwas Interessantes tat, wussten aber nicht, wie sie davon profitieren konnten. Es war heiß und schwül, aber ich ging weiter. Meine Seele hatte keine Wahl. Schließlich gelangte ich an den Ort, an dem es zu den ersten Überführungseinstürzen gekommen war.
Beim Überfliegen war mir der untote Soldat nicht aufgefallen. Er hatte sich hinter dem Laster in einem toten Winkel befunden. Es war leicht zu erkennen, was ihm passiert war. Der hintere Teil seines grünen Mantels war in die Fahrertür eingeklemmt und verhinderte, dass er sich bewegen konnte. Sein Reißverschluss war bis zum Brustkorb hochgezogen. Er trug einen Stahlhelm, der mit einem Riemen unter seinem Kinn befestigt war. An seiner Schulter und seinem Hals fehlten große Fleisch- und Muskelbatzen. Es war offensichtlich, dass er aus dem Laster gestiegen war, den Mantel eingeklemmt und die Katastrophe geradezu eingeladen hatte. Ich schätze, der Gewinner des Darwin-Preises stand für diesen Monat fest.
Mich ihm zu zeigen hätte nichts gebracht. Er hätte lediglich wie ein Blöder auf den Wagen eingeschlagen und weitere seiner Art angelockt. Ich musste ihn so zurücklassen, wie er war. Ein Teil meines Ichs hätte ihn gern von seinem Elend erlöst, denn als Soldat war er mein Kamerad. Ich ging leise zur Beifahrerseite des riesigen Lasters und schaute hinein. Auf dem Sitz lag eine Pistole vom Typ M-9. Das Fenster war hochgedreht; auf meiner Seite war die Tür verschlossen.
Ich hatte nur mein Gewehr und eine Pistole und hielt es für eine gute Idee, wenn auch die Leute, zu denen ich unterwegs war, eine Waffe besaßen, mit der sie sich während der Rettungsmission verteidigen konnten. Also änderte ich meine Ansicht und beschloss, den Soldaten im Tausch für die Waffe auszuschalten. Ich ging vom Trittbrett runter und begab mich ans Heck. Der Laster hatte eine mit Leinwand bedeckte Ladefläche. Ich lugte hinein, konnte aber nichts Brauchbares sehen. Da waren nur Holzkisten voller Sonstwas. Vielleicht Sprengstoff. Aber auf diesem Gebiet kannte ich mich nicht aus.
Ich hob einen dicken Brocken Interstate auf und warf ihn auf den Beton vor die Füße des Untoten, damit er, wenn ich mich ihm näherte, in eine andere Richtung schaute. Es klappte. Ich erreichte ihn schnell und schob die Mündung meiner Waffe unter seinen Helm, damit ich an dem Kevlar vorbeikam, der seinen Schädel schützte. Ich gab nur einen Schuss ab. Der untote Soldat erschlaffte und hing in seinem Mantel, bis ich die Wagentür öffnete. Ich durchsuchte seine Taschen. Nichts von Wert. Ich nahm die M-9 an mich und machte mich davon.
Ich hatte nicht viel Zeit, mir etwas auszudenken, um die Untoten vom Wasserturm fortzulocken. Wir mussten vor Sonnenuntergang weg sein. Die Neutralisierung der Untoten war keine Option. Ich hatte zwar den Vorteil eines Hirns und meiner Feuerkraft, aber sie waren einfach zu viele.
Ich musste es anders anstellen. Es sah aus, als gäbe es nur eine Möglichkeit: schießend oder brüllend auf sie zustürzen, um sie vom Turm wegzulocken. So ähnlich hatte ich es auch bei der Rettung der Familie Grisham gemacht. Es war natürlich auch gefährlich, denn diesmal hatte ich kein funktionierendes Auto, um sie abzulenken. Mangelhafte Planung. Ich hatte eigentlich nur bei Lake Charles landen, Kontakt aufnehmen und mögliche Überlebende zum Hotel 23 bringen wollen. Auf eine neue lebensgefährliche Rettungsaktion war ich nicht vorbereitet.
Der Wasserturm kam in mein Blickfeld. Ich sah eine Gestalt auf dem Laufsteg. Ich winkte und gab Zeichen, aber es kam keine Reaktion. Allmählich fing ich an, meinen Plan zu hinterfragen. Hatte ich vielleicht all diese Mühen nur auf mich genommen, um zwei Leichen zu retten? Doch dann fanden meine Mühen Bestätigung. Ich sah eine kleine männliche Gestalt am Rand des Geländers, die auf die Untoten hinunterpinkelte. Obwohl ich sie in dem Gebüsch nicht sah, wusste ich, was der Junge tat. Er zielte zweifellos auf ihre Köpfe.
Ich lachte leise vor mich hin, wurde dann aber wieder ernst. Der Wasserturm war nur etwa zehn Meter von dem Zaun entfernt, hinter dem der Flugplatz lag. Der obere Rand des Zauns war nicht aus Stacheldraht und daher leicht zu überklettern. Ich lief also ein Stück, bis ich außer Sichtweite der Belagerer war, und stieg hinüber. Sobald ich den Boden berührte, rannte ich auf den Hangar zu. Ich sah eine Reihe strombetriebener Gepäckkarren, die hinter dem Hangar in eine Ladestation gestöpselt waren. Ich ging langsam zu ihnen hinüber. Da ich nicht wusste, wie lange diese Gegend schon ohne Strom war, wusste ich auch nicht, ob die Karren noch funktionierten. Ich entriegelte einen Karren und zog ihn zur Hangarseite, um einen ausgiebigen Blick auf ihn zu werfen. Ich hatte die Neugier eines Leichnams hinter dem Zaun auf mich gezogen. Er hatte mich offenbar klettern sehen.
Die Gepäckwägelchen funktionierten ohne Schlüssel. Ich nehme an, man wollte vermeiden, dass sie, falls jemand sie verlor und sie auf dem Rollfeld landeten, Schäden an Flugzeugtriebwerken hervorriefen. Ich schaltete das Wägelchen ein, nahm Platz und gab Gas. Der Elektromotor fing an zu rumpeln, doch der Karren bewegte sich nicht. Ich versuchte einen anderen. Es gab mehrere, sie standen in einer Reihe hinter dem Gebäude. Beim dritten Karren hatte ich Glück. Der Motor schnurrte los. Ich schwang mich rauf und fuhr auf die Zaunlücke in der Nähe des Wasserturms zu. Mitten auf dem Rollfeld hielt ich an und sprang ab, ohne das Wägelchen abzuschalten. Ich legte mit dem Gewehr an, feuerte auf den unteren Teil des Turms und nietete so viele Untote um, wie ich konnte. Schließlich blickte jedes untote Auge im Umkreis von drei Kilometern in meine Richtung.
Ich feuerte so lange auf sie, bis sie massenhaft und mit ausgebreiteten Armen durch die Zaunlücke strömten, sichtlich scharf auf mich. Ich wartete, bis sie auf fünfzig Meter heran waren, dann schwang ich mich wieder auf das Wägelchen, gab Gas und lockte die Untoten vom Wasserturm weg. Als ich über das Rollfeld fuhr, lud ich meine Waffe nach. Ich weiß es zwar nicht genau, aber es waren schätzungsweise zwei- bis dreihundert von denen hinter mir her.
Ich erreichte das Ende des Rollfeldes, stieg ab und nahm sie erneut unter Beschuss. Sie waren etwa dreihundert Meter weit entfernt. Ich hatte also noch Zeit. Jene, die sich schon innerhalb der Flugplatzumzäunung befanden, zog ich zuerst aus dem Verkehr. Dann knöpfte ich mir nach und nach diejenigen aus der Masse vor, die am weitesten entfernt waren. Dies würde mir mehr Zeit verschaffen, bevor sie aufholten, wenn ich zum Turm zurückkehrte.
Sie waren nun auf zweihundert Meter herangekommen. Die Meute wurde von so vielen Fliegen umschwärmt, dass mir beinahe übel wurde. Das kollektive Summen der Insekten war lauter als das Ächzen der Untoten. Das Schlimmste an ihnen waren meiner Meinung nach ihre ausgedörrten, verwesenden Gesichter. Ihre Zähne waren zu einem permanenten Fauchen gefletscht und ihre knochigen Klauen ständig nach Beute ausgestreckt.
Es war an der Zeit, die Kurve zu kratzen. Ich sprang auf den Karren und umkreiste die Meute, ohne den Fuß vom Gas zu nehmen. Da das Wägelchen aus Sicherheitsgründen ein bestimmtes Tempo nicht überschreiten konnte, machte ich bestenfalls 15-20 Stundenkilometer. Als ich den Wasserturm erreichte, rief ich den Leuten dort zu, sich bereitzuhalten.
Ich hatte keine Ahnung, ob sie mich hörten oder nicht. Der Hauptteil der Meute war fast einen Kilometer entfernt. Wir hatten Zeit, aber ich musste mich auch noch um ungefähr ein Dutzend Gestalten kümmern, die am Fuß des Turms zurückgeblieben waren. Die Batterie des Wägelchens zeigte erste Anzeichen von Erschöpfung.
Ich erreichte das Loch im Zaun. Buschwerk behinderte meine Sicht, deswegen konnte ich nicht genau erkennen, was mich dahinter erwartete. Ich eröffnete das Feuer, als ich einen Kopf zu sehen glaubte. Ich gab diese Taktik auf und drang vorsichtig ins Gestrüpp unter dem Wasserturm vor. Die hier zurückgebliebenen Untoten waren vermutlich taub, denn sie befanden sich in einem fortgeschrittenen Verwesungsstadium. Möglicherweise hörten sie nicht mal mein Gewehrfeuer. Viele waren einäugig oder sahen gar nichts mehr. Sie gaben ein leichtes Ziel ab. Es dauerte nicht lange, bis die Gegend rund um den Turm sauber war. Ich rief zu den Überlebenden hinauf, sie sollten so schnell wie möglich runterkommen.
Ich höre eine gebieterische Frauenstimme sagen: »Tu, was der Mann sagt, Danny.«
»Ja, Oma«, erwiderte der Junge nervös.
Er kam zuerst. Er war etwa zwölf Jahre alt und hatte brünettes Haar, dunkelbraune Augen und einen hellen Teint. Dann kam die Frau. Sie war vielleicht Ende fünfzig oder Anfang sechzig. Sie hatte lockiges rotes Haar und war leicht übergewichtig. Sie trugen ihre paar Habseligkeiten bei sich und schauten mich fragend an, als sie vor mir standen.
Mein Selbstbewusstsein schien wie die Batterie des Gepäckwägelchens schwächer zu werden, nachdem ich so viele Untote gesehen hatte. Ich besann mich meiner gesamten schauspielerischen Fähigkeiten (im Kindergarten durfte ich mal Abraham Lincoln geben), täuschte den beiden jede Menge Zuversicht vor und begab mich zum Wägelchen.
Die Meute der Verfolger war vielleicht noch sechshundert Meter entfernt und kam rasch näher. Ich stieg auf den Gepäckkarren und schaltete den Rückwärtsgang ein. Ein lautes Warnpiepsen ertönte. Mit einem Kabelbinder band ich das Pedal fest, damit es Gas gab, bis der Karren gegen etwas knallte oder die Batterie leer war. Ich sprang und rollte mich ab, um Verletzungen zu vermeiden. Der Karren düste laut piepsend davon, und zwar genau auf die Untotenmeute zu. Wir liefen auf dem Weg, den ich gekommen war, zu meinem Flugzeug zurück, wobei wir, als wir uns schwerfällig eine Bahn durchs Gestrüpp an der I-10 schlugen, sorgfältig darauf achteten, nicht gesehen zu werden. Hinter uns, aus Richtung Flugplatz, war lautes Stöhnen zu vernehmen. Obwohl ich zugegebenermaßen noch nie einen Untoten so genau untersucht habe, um zu wissen, ob sie überhaupt atmen, nehme ich an, dass sie uns irgendwie wittern.
Als wir uns durch den Wald in die ungefähre Richtung der Maschine schlugen, reichte ich der Frau die zuvor aus dem Army-Laster entwendete M-9. Sie stellte sich als Dean und den Jungen als ihren Enkel Danny vor. Ich schüttelte beiden die Hand und zog den auf dem Hobby-Flugplatz im Tanklaster gefundenen gelben Zettel aus der Tasche.
Die Frau las die Nachricht. Dann füllten sich ihre rot umrandeten Augen mit Tränen. Sie hielt kurz inne und sah mich an. Dann nahm sie mich in die Arme, drückte mich und weinte. Mein erster Gedanke war, Mr. Davis wäre ein guter Freund oder Familienangehöriger gewesen und der Zettel die schmerzliche Erinnerung an dessen vorzeitiges Ableben.
»Ich weiß, dass Sie unglücklich sind, aber wir müssen weiter«, sagte ich. »In dieser Gegend sind viele von denen, und der Karren wird sie nicht lange in die Irre führen.«
Sie beharrte darauf, ein bis zwei Minuten zu pausieren, um sich zu orientieren. Was hätte ich sagen sollen? Hätte meine Mutter je erfahren, dass ich älteren Menschen meinen Respekt versagte, hätte sie mir einen Arschtritt verpasst.
Ich fragte die Frau, was Mr. Davis und seiner Familie passiert sei.
»Danny und ich sind die Familie Davis«, erwiderte sie. »Ich habe den Zettel vor einem Monat auf dem Flugplatz hinterlassen – kurz bevor wir hierhergeflogen sind.«
Verdattert und mit dem Gefühl eines leichten Stichs von sexistischem Neid im Hinterkopf erkundigte ich mich demütig, wer die Maschine denn geflogen hätte.
Sie lächelte ein knappes Sekündchen und sagte dann: »Ich. Ich habe einen Pilotenschein. Weil ich in einer Zeit Pilotin war, in der ein solcher Schein noch etwas bedeutete.«
Um mich nicht als Vollidiot zu erkennen zu geben, suchte ich die Umgebung nach Gefahren ab und unterhielt mich weiter mit der Frau namens Dean. Danny saß zu ihren Füßen auf dem Boden. Sein Köpfchen war ständig in Bewegung, denn auch er hielt nach Gefahren Ausschau.
Als ich mich mit ihr unterhielt, empfand ich friedliche und behagliche Gefühle; als wäre sie die letzte Großmutter auf dem Planeten; als wollte ich nichts anderes, als ihren Geschichten zu lauschen.
Nur hatten wir dafür jetzt keine Zeit.
Ich hatte die Pause hauptsächlich deswegen einlegen wollen, um den beiden nach allem, was sie auf dem Wasserturm erlebt hatten, eine emotionale Rast zu gewähren. Obwohl Dean in jeder Hinsicht fähig schien, für sich selbst zu sorgen, war sie nicht mehr die Jüngste, und ich hatte das Gefühl, dass sie eine kurze Kampfpause gut gebrauchen konnte. Dean zeigte offensichtliche Anzeichen von Unterernährung. Lose Haut hing von ihren Armen und Beinen herab und bewies die Liebe, die sie für ihren Enkel empfand. Danny sah zwar auch nicht gerade toll aus, aber ich erkannte, dass da jemand zu seinen Gunsten auf Nahrung verzichtet hatte.
Mit schlechtem Gewissen und leichter Besorgnis in der Stimme schlug ich vor, uns wieder in Bewegung zu setzen, um so schnell wie möglich zu meinem Flugzeug zu gelangen. Wenn wir gezwungen wurden, am Abend zu fliegen, würde es nämlich nicht einfach sein, den Tankwagen am Hobby Airport zu finden. Als wir gingen, lenkte ich Dean von den Ereignissen des heutigen Tages ab, indem ich sie fragte, warum sie Fliegen gelernt hatte. Sie war gern bereit, darüber zu reden. Während sie leise erzählte, schaute ich an ihr vorbei ständig in die Lücken zwischen den Bäumen, die dann und wann die Interstate enthüllten. Von Zeit zu Zeit sah ich während unseres Marsches zum Flugzeug auch Untote.
Während wir gingen, berichtete sie leise, dass sie vor ihrer Pensionierung als Pilotin für die Feuerwehr von New Orleans gearbeitet hatte. Das Fliegen fehlte ihr sehr, zumal sie es immer als ihre Berufung empfunden hatte, Menschen in Not beizustehen. Während des Gesprächs nannte sie auch ihr Alter, als sie zur Sprache brachte, vor zehn Jahren, mit fünfundfünfzig, in Rente gegangen zu sein. Ich konnte kaum fassen, dass es ihr und dem Jungen gelungen war, so lange in dieser Welt zu überleben. Ich war voller Ehrfurcht und Respekt vor dem Überlebenswillen dieser Frau.
Zwischen dem Flugplatz und uns hielten sich an der Interstate nur wenige Kreaturen auf. Ihr Gestöhne war bei dieser Entfernung nur noch mit viel Fantasie wahrzunehmen. Ich schilderte Dean, wie ich bei der Landung die linke Radbremse verloren hatte sowie meine Hoffnung, den Start nicht wegen eines schönen großen grünen Armee-Lastwagens, der am Ende dieses Teils der Interstate auf uns wartete, abbrechen zu müssen. Sie schien darüber nicht besorgt und stellte keine Fragen bezüglich meiner Flugkenntnisse. Sie war offenbar nur dankbar, am Leben zu sein.
Als wir den Flieger erreichten, öffnete ich die Tür und ertappte mich dabei, Dannys Blick von der Leiche des zuvor von mir erledigten Untoten abzuschirmen. Warum eigentlich? Der Junge hatte wahrscheinlich mehr Untote bepisst, als ich je gesehen hatte.
Nach der Inspektion der Maschine schnallten wir uns an und gingen die Checkliste durch. Damit wir uns verständigen konnten, setzten Dean und ich Headsets auf. Sie half mir bei der Checkliste, da sie über zweihundert Flugstunden in einer Kiste dieses Typs verbracht hat (also weit mehr als ich). Der Motor sprang problemlos an. Ich gab Gas und rollte vorwärts. Es war unnötig, die Bremse zu testen. Das Gebiet war frei. Ich bretterte mit 50 Knoten voraus. Ein einzelner Untoter näherte sich dem Beton der Interstate vom mit Gras bewachsenen Mittelstreifen aus, der die nach Osten und Westen führenden Spuren teilte. Ich war mir nicht sicher, ob er es schaffen würde.
Dann spürte ich, dass das Steuerhorn der Maschine zu mir zurückgezogen wurde. In meinem Headset sagte Deans Stimme: »Diesen Steigflug schaffen wir.« Ich war fassungslos. Unser Steigflug war noch steiler als der, bei dem John und ich von dem unbefestigten Streifen hatten starten müssen, bevor die Raketen San Antonio ausgelöscht hatten. Es waren nicht die Triebwerke, die mich in den Sitz drückten, es war die Schwerkraft. Wir hatten den wandelnden Leichnam verfehlt und waren fast dreihundert Meter vor der Stelle in die Luft gegangen, an der ich vom Boden abgehoben hätte. Ich musste mich zusammenreißen und mir eingestehen, dass Dean beim Fliegen dieser Kiste mehr draufhatte als ich.
Als wir den Laster, den Krater und die Überführung passierten, kam der Flugplatz wieder in Sicht. Aus purer Neugier bat ich Dean, uns nochmal dorthin zu bringen. Als wir über das Gelände hinweg flogen, sah ich jede Menge Untote, die sich am anderen Ende des Platzes um den Elektrokarren scharten. Er hatte sich im Zaun verkeilt und piepste vermutlich noch immer, weil die Untoten sehr daran interessiert waren, ihn in Stücke zu reißen. Vielleicht lag es an seinem Geruch, vielleicht an den Geräuschen, die er von sich gab; vielleicht aber auch an beidem.
Dean fragte nach unserem Ziel. Ich bat sie, ihren Tankwagen anzufliegen. War kein Problem für sie.
Da ich wissen wollte, wie sie auf den Wasserturm gelangt war, stellte ich ihr, nun in der Luft und in Sicherheit, ein paar Fragen. Sie waren am Abend des 14. Mai beim Lake Charles gelandet. Dean erwähnte zwar keine Einzelheiten, begann jedoch, heftig mit den Händen zu zittern, als sie erzählte, wie Danny und sie aus ihrem Flugzeug gestürzt waren und sich so schnell wie möglich zum Wasserturm durchgeschlagen hatten, um nicht gefressen zu werden. Auf dem Turm hatten sie nur das gehabt, was sie tragen konnten. Ich fragte, warum sie nicht mit dem Flugzeug abgehauen waren. Sie antwortete mit einer Gegenfrage: »Haben Sie den Leichenberg vor dem Bug unserer Kiste nicht gesehen?«
Ich erkannte, dass es ihr Unbehagen bereitete, über diese Sache zu reden.
Dean erzählte, dass sie ihr Bettlaken benutzt hatte, um an Wasser für Danny und sich herankommen zu können. Am sechsten Tag, als ihre Trinkwasserrationen zu Ende gegangen waren, war sie über den seitlichen Laufsteig auf den Turm gestiegen. Irgendwie hatte sie den Dachstöpsel aufgeschraubt, durch den das Wasser im Tank normalerweise geprüft wurde. Es war ihr gelungen, das Laken etwa zwanzig Zentimeter tief ins Wasser zu versenken, ohne es zu verlieren. Danny und sie hatten fast einen Monat lang von »frisch gepresstem Louisiana-Lakenwasser« gelebt und sich währenddessen das pausenlose Stöhnen der sie belagernden Toten angehört. Als Dean davon erzählte, begann sie erneut zu weinen.
Über dem Hobby Airport wurde unser Sprit knapp. Wir hätten es mit einem Rest heißer Luft vielleicht noch bis Hotel 23 geschafft, aber ich hielt es für unnötig, dieses Risiko einzugehen. Ich wusste, dass der Tanklaster funktionsfähig war. Ebenso wusste ich, dass er eine Menge Treibstoff enthielt. Als wir über dem Flugplatz kreisten und ein Auge riskierten, näherte sich die Sonne dem westlichen Horizont. Es befanden sich Untote auf dem Dach neben dem zerbrochenen Terminalfenster, und ich sah auch ein paar auf dem Boden vor dem Dach. Einige Kreaturen hatten sich aufgrund ihres Absturzes selbst zur Unbeweglichkeit verurteilt. Tja, die Schwerkraft ist ’ne Sau.
Ich brachte die Maschine runter, fuhr gefährlich nahe an den Tankwagen heran und bat Dean, an Bord zu bleiben. Meine Idee gefiel ihr nicht, denn sie wollte helfen, aber ihr Blick sagte mir, dass sie mir Recht gab. Nach einem Monat auf dem Wasserturm, auf dem sie Kohldampf geschoben hatte, von der Sonne gebraten und von der Kälte geschüttelt worden war, war sie nicht hundertprozentig auf dem Damm. Deswegen hatte ich, trotz der vielen Flugstunden ihrer aktiven Zeit, meine Hände in der Nähe der Kontrollen gelassen. Auch wenn sie ein besseres Gefühl für die Kiste hatte als ich: Sie war fix und fertig.
Ich ließ, wie immer in solchen Situationen, den Motor laufen und ging zum Tankwagen hinüber. Binnen kurzer Zeit hatte ich die Tanks gefüllt und das Flugzeug zu einem neuen Start positioniert. Am Wartestreifen des Hobby-Rollfelds wurde mir bewusst, dass ich mich seit fast zehn Stunden nicht im Hotel 23 gemeldet und die Headsets nicht auf VHF-Funk eingerichtet hatte. Dean und ich hatten uns auf dem Flug zum Hobby Airport unterhalten, und da wir ohnehin außerhalb der H23-Reichweite