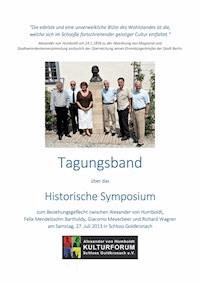
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein großer Naturwissenschaftler und drei bedeutende Komponisten: Um das Beziehungsgeflecht zwischen Alexander von Humboldt, Giacomo Meyerbeer, Felix Mendelssohn Bartholdy und Richard Wagner zu beleuchten, war das Who is Who der deutschen Humboldt-Forschung einen Tag lang in die Humboldt-Wirkungsstätte Goldkronach gekommen. Während bei einem, vom Alexander-von-Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach veranstalteten, historischen Symposium die Fakten vorgestellt wurden, gab es bei einem musikalisch-literarischen Abend Kostproben aus Briefen und Kompositionen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Tagungsband über das Historische Symposium zum Beziehungsgeflecht zwischen Alexander von Humboldt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Giacomo Meyerbeer und Richard Wagner
1. Auflage Juni 2015
Herausgeber: Petra Meßbacher, Hartmut Koschyk MdB
Alexander von Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach e.V.
Schlossweg 5
95497 Goldkronach
Internet: www.humboldt-kulturforum.de
E-Mail-Adresse: [email protected]
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Inhaltsverzeichnis
Einführung.4
Döhring, Prof. Dr. SieghartAlexander von Humboldt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Giacomo Meyerbeer und Richard Wagner: Die Quadratur des Kreises?.7
Schwarz, Dr. IngoWie erhöht man „Intelligenz“ und „Sittlichkeit“ der Berliner? Alexander von Humboldt im öffentlichen Leben der preußischen Hauptstadt.21
Holl, Dr. Frank„Zur Freiheit bestimmt“ – Alexander von Humboldts Blick auf die Kulturen der Welt.34
Lackmann, Dr. Thomas
Tagungsband zum Symposium über Mendelssohn, Meyerbeer, Wagner und Alexander von Humboldt
Goldkronach. Ein großer Naturwissenschaftler und drei bedeutende Komponisten: Um das Beziehungsgeflecht zwischen Alexander von Humboldt, Giacomo Meyerbeer, Felix Mendelssohn Bartholdy und Richard Wagner zu beleuchten, war das Who is Who der deutschen Humboldt-Forschung einen Tag lang in die Humboldt-Wirkungsstätte Goldkronach gekommen. Während bei einem, vom Alexander-von-Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach veranstalteten, historischen Symposium die Fakten vorgestellt wurden, gab es bei einem musikalisch-literarischen Abend Kostproben aus Briefen und Kompositionen.
Ordnung in das Beziehungsgeflecht brachte Professor Dr. Sieghart Döhring vom Meyerbeer-Institut in Thurnau. Alexander von Humboldt und Giacomo Meyerbeer hätten sich nachweislich 1825 in Paris kennen gelernt, sagte Döhring. Humboldt sei später auch die treibende Kraft für die königliche Berufung sowohl Meyerbeers als auch Mendelssohns zum preußischen Generalmusikdirektor in Berlin gewesen.
Sicher nicht persönlich gekannt habe Humboldt Richard Wagner, der in der frühen ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Gegensatz Mendelssohn und Meyerbeer ein „absoluter Nobody“ gewesen sei. Nicht auszuschließen sei allerdings, dass Humboldt eine der frühen Aufführungen des Fliegenden Holländers in Berlin gesehen hat. Allerdings war es auch Richard Wagner, der in seiner 1850 erstmals erschienen und 1869 stark erweiterten und als Buch erschienen Hetzschrift „Das Judentum in der Musik“ gerade Mendelssohn als auch Meyerbeer angriff, sie schwer diffamierte und beiden jegliche Fähigkeit zu künstlerischen Aktivitäten absprach.
Noch wenige Jahrzehnte zuvor habe Wagner beide als künstlerische Vorbilder bezeichnet und besonders an Meyerbeer unterwürfige Briefe verfasst. Sowohl Mendelssohn als auch Meyerbeer waren zum Erscheinungszeitpunkt der Hetzschrift bereits tot. Döhring bezeichnete Wagners Argumentation vor allem deshalb als rassistisch, weil Mendelssohn bekanntlich als Christ getauft wurde und sich ein Leben lang als Christ verstand.
Fest überzeugt ist Döhring davon, dass Alexander von Humboldt musikalisch war. So habe Humboldt beispielsweise die Uraufführung von Meyerbeers Oper „Die Hugenotten“ 1836 in Paris besucht und sich noch vor Erscheinen der Kritiken in Briefen fundiert dazu geäußert. Darüber hinaus sei Humboldt die Nachwuchsförderung ein Herzensanliegen gewesen, auch von jungen Musikern.
Von einer weiteren Beziehung Alexander von Humboldts zur Familie Mendelssohn wusste Dr. Ingo Schwarz, der Leiter der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle an der Akademie der Wissenschaften Berlin-Brandenburg zu berichten. So habe Humboldt ab 1806 in Berlin geomagnetische Messungen unter anderem im Garten des Hauses von Abraham Mendelssohn Bartholdy, dem Vater von Felix und Fanny, durchgeführt. Humboldt sei mit der Bankiersfamilie Mendelssohn Bartholdy nicht nur eng befreundet gewesen, sondern habe ab 1842 in der Berliner Oranienburgerstraße in einem Haus gewohnt, das den Mendelssohns gehörte.
Schwarz sprach von wichtigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die unter anderem den Einfluss der Sonne auf das Magnetfeld der Erde nachweisen sollten. Ähnliche Messungen wie im Garten der Mendelssohns an der Leipziger Straße, unternahm Humboldt auch an anderen Teilen der Erde, unter anderem in Russland. Ein Terracotta-Fries am „Roten Rathaus“ von Berlin zur Geschichte der Stadt zeige noch heute zahlreiche Geistesgrößen der damaligen Zeit, darunter auch Alexander von Humboldt, Felix-Mendelssohn Bartholdy und Giacomo Meyerbeer. Das Fries habe wahrscheinlich nur deshalb die Nazi-Zeit unbeschadet überstanden, weil damals niemand die abgebildeten Persönlichkeiten erkannt habe, so Schwarz.
Nach den Worten von Dr. Thomas Lackmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Mendelssohn-Gesellschaft, steht die Humboldt-Familie, Alexander, sein Bruder Wilhelm und dessen Ehefrau Caroline, mit ihrer Haltung zum Judentum exemplarisch für einen Teil deutscher Geschichte. Während Alexander von Humboldt als „Judenfreund“ eine absolut liberale Haltung an den Tag legte, habe Bruder Wilhelm diese Haltung nur in der Theorie gelebt. In der Praxis habe Wilhelm eher Abstand genommen. Ganz anders dessen Ehefrau Caroline von Humboldt, geborene von Dacheröden. Von ihr seien „richtig schlimme Vorstellungen“ überliefert, während sie konkret auf unterschiedlicher Ebene mit Juden in Kontakt gewesen sei. Über Humboldts vielfältigen Blick auf die Kulturen der Welt sprach schließlich der renommiert e Historiker und Humboldt-Kenner Frank Holl, der erst im vergangenen Jahr das Buch „Alexander von Humboldt in Franken“ veröffentlicht und damit erstmals eine Publikation zum Wirken des Universalgelehrten in der Region vorgestellt hatte.
In diesem Tagungsband finden Sie die Vorträge der Referenten des Symposiums: Prof. Dr. Sieghart Döhring (Vorsitzender der Meyerbeer-Instituts, Thurnau), Dr. Ingo Schwarz (Leiter der Alexander von Humboldt-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften Berlin-Brandenburg), Dr. Frank Holl (Leiter der Münchner Wissenschaftstage, Humboldt-Fachmann, München) und Dr. Thomas Lackmann (Mitglied des Vorstands der Mendelssohn-Gesellschaft e. V., Berlin).
Alexander von Humboldt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Giacomo Meyerbeer und Richard Wagner: Die Quadratur des Kreises?
Prof. Dr. Sieghart Döhring(Vorsitzender der Meyerbeer-Instituts, Thurnau)
Es war eine faszinierende personelle Konstellation mit Zukunftspotential, die sich 1842 in Berlin konkretisierte: Der junge preußische König Friedrich Wilhelm IV. ernannte auf Anregung seines Vertrauten Alexander von Humboldt die beiden bedeutendsten Komponisten der Zeit, Felix Mendelssohn Bartholdy und Giacomo Meyerbeer, zu Generalmusikdirektoren und berief noch im selben Jahr beide in die – ebenfalls auf Betreiben von Humboldts – neu gegründete Friedensklasse des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste; eine der ersten Entscheidungen Meyerbeers in seinem neuen Amt war es sodann, die kurz zuvor in Dresden uraufgeführte Oper Der fliegende Holländer des jungen Richard Wagner an seinem Haus, Preußens führender Bühne, herauszubringen (die Aufführung fand am 7. Januar 1844 statt). Was Humboldt und dem König vorschwebte, nämlich die Rolle Berlins als neue Kulturhauptstadt Europas auch auf musikalischem Gebiet zu begründen – der Tradition verpflichtet und zugleich offen gegenüber dem Neuen – schien für einen Augenblick der Erfüllung nahe zu sein. Und doch sollte es anders kommen: Zwar stürzten sich Mendelssohn und Meyerbeer sogleich voller Energie in ihre neuen Aufgaben, resignierten aber bald angesichts kleinlicher Widerstände lokaler Konkurrenten und ließen sich von ihren Verpflichtungen ganz oder teilweise entbinden. Ihre weit gespannten europäischen Aktivitäten hatten sie ohnehin nie aufgegeben, war ihnen doch stets bewusst, dass selbst ein aufstrebendes Berlin mit Metropolen wie Paris oder London weder sozial noch kulturell mithalten konnte.
Dieses Bedeutungsgefälle war auch dem Newcomer Wagner früh bewusst. Lebenslang zog es ihn aus der provinziellen Enge Deutschlands nach Paris, dem Mekka der Künste im 19. Jahrhundert. Einen ersten erfolglosen Versuch, dort als Komponist Fuß zu fassen, hatte er gerade erst unternommen und als er mit einem zweiten wenige Jahre später erneut scheiterte, änderte er von Grund auf seine Taktik im Kampf um die Führungsposition unter den Komponisten Europas, die nach seiner unerschütterlichen Überzeugung allein ihm zustand. Nicht wie bisher auf den Schultern seiner Vorgänger – so sein Entschluß – suchte Wagner sein Ziel zu erreichen, sondern – man kann es durchaus so ausdrücken – über deren Leichen, nämlich indem er Mendelssohn und Meyerbeer als Juden wahres Künstlertum absprach.
Seinen Angriff startete Wagner erstmals öffentlich, wenngleich unter einem Pseudonym, in dem Essay Das Judentum in der Musik, erschienen 1850 in zwei Nummern der „Neuen Zeitschrift für Musik“. Wegen der geringen Verbreitung dieses Periodikums hielt sich die Resonanz darauf in engen Grenzen (Mendelssohn war drei Jahre zuvor verstorben; Meyerbeer hat den Text überhaupt nicht zur Kenntnis genommen). Umso größer war dann die Wirkung der – leicht überarbeiteten - Wiederveröffentlichung in Buchform 1869. Jacob Katz nannte den Text ein „antijüdisches Traktat, das mit Recht zu den antisemitischen Klassikern gezählt wird“[1]. Zwar war kein einziges der von Wagner vorgetragenen Argumente tatsächlich originell, dennoch entwickelte das Pamphlet enorme propagandistische Stoßkraft, hauptsächlich wegen des nun nicht mehr unter einem Pseudonym versteckten Namens seines Autors, dessen musikhistorische Bedeutung mittlerweile auch von seinen Gegnern nicht mehr in Abrede gestellt wurde. Auf den immer selbstbewusster auftretenden Antisemitismus im neu gegründeten deutschen Kaiserreich wirkte Wagners „Judentum“-Essay geradezu als Brandbeschleuniger mit fatalen historischen Folgen bis weit hinein ins 20. Jahrhundert.[2]
Wie konnte, was so hoffnungsvoll begonnen hatte, so spektakulär scheitern? Als sich die Wege Mendelssohns, Meyerbeers und Wagners zu Beginn der 1840er Jahre in Berlin kreuzten, agierten sie innerhalb eines weit gespannten kulturellen „Netzwerkes“, in dessen Zentrum Alexander von Humboldt als „europäischer Kulturminister“ (Hanno Beck) die Fäden zog. Freilich gab es schon vor Wagners antisemitischem Angriff auf Mendelssohn und Meyerbeer zwischen den Beteiligten Spannungen und Verwerfungen, die das spätere Scheitern der Vision von Berlin als neuem musikalischen „Spree-Athen“ bereits erahnen ließen. Mendelssohn wie Meyerbeer entstammten reichen jüdischen Bankiers- und Kaufmannsfamilien, die zur Hautevolee des gebildeten Berliner Großbürgertums gehörten. Zwar wurde Mendelssohn in Hamburg geboren, aber die Stätte seiner geistigen und kulturellen Sozialisation war eindeutig Berlin. Dort wurde er – wie alle seine Geschwister – christlich erzogen; als Siebenjähriger erhielt er die protestantische Taufe, was ihn als Mensch wie als Künstler maßgeblich geprägt hat. Demgegenüber blieb Meyerbeer dem Judentum, das ihm von der Familie und von den Erziehern in einer liberalen, reformierten Ausrichtung nahe gebracht worden war, zeitlebens treu, wenngleich er es nie praktizierte. Beide genossen sie eine umfassende Ausbildung, die ihnen früh den Zugang zu höchsten gesellschaftlichen Kreisen und zur kulturellen Elite ihrer Epoche eröffnete. Demgegenüber blieb es Wagner aufgegeben, sich aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und unklaren familiären Beziehungen mühsam emporzuarbeiten, denn nach oben wollte er unbedingt; auch das prägt einen Menschen lebenslang. Mendelssohns wie Meyerbeers herausragende kompositorische Fähigkeiten, die sich bei beiden bereits in frühester Jugend offenbarten, entfalteten sich zunächst über das gesamte Spektrum der musikalischen Gattungen, erfuhren aber bald eine Spezialisierung: bei Mendelssohn auf Instrumental- und Kirchenmusik, bei Meyerbeer auf die Oper. Die unterschiedlichen Gattungspräferenzen waren die Folge höchst individueller Personalstile, die sich immer weiter auseinander entwickelten. Dies führte dazu, dass sich beide zwar öffentlich stets mit Respekt begegneten, aber auf künstlerischer Ebene kaum miteinander kommunizierten. Vor allem Mendelssohn fehlte jeglicher Zugang zur aktuellen dramatischen Musik und ihren Innovationen, für die nach dem Urteil der Zeitgenossen vor allem Meyerbeers französische Opern standen. Robert le diable (1831), den er wenige Wochen nach der Uraufführung in Paris hörte, ließ Mendelssohn kalt: „[…] die Musik ist ganz vernünftig […] – aber ein Herz ist nicht dabei […] Musik ist es nicht, ein Gedicht auch nicht, Alles andere unnachahmlich schön.“[3] Für den Enthusiasmus des Publikums und das Lob der Fachkritiker und Komponistenkollegen, die das Werk als Epochenwende in der Geschichte der dramatischen Musik feierten, ging Mendelssohn das ästhetische Sensorium gänzlich ab.
Anders Richard Wagner: Seit er sich zum Opernkomponisten berufen fühlte, drängte es ihn mit aller Kraft aus der provinziellen Enge des deutschen Stadttheaterbetriebs, in dem er seine Anfänge als Komponist und Dirigent absolvieren musste, in die Internationalität der Metropolen. Nach einem kurzen Flirt mit der italienischen Oper, die ihm durch die inspirierende Erfahrung der Gesangs- und Darstellungskunst Wilhelmine Schröder-Devrients in der Rolle des Bellinischen Romeo nahe gebracht geworden war (in dieser Rolle, nicht – wie er später glauben machen wollte – als Beethovensche Leonore, erlebte Wagner die Sängerin erstmals auf der Bühne), wählte er sich Meyerbeer zum künstlerischen Vorbild, in dessen Opern er sein Ideal eines nationale Stile überwindenden musikalischen Ideentheaters verwirklicht sah. Als er sich am 4. Februar 1837 erstmals brieflich an Meyerbeer wandte, den „verehrte(n) Herr(n) und Meister“ (so seine Anrede), formulierte er in der Beschreibung von dessen Werk unverhohlen auch sein eigenes künftiges Programm als Opernkomponist. Seit er in der musikalischen Praxis stehe, so Wagner, „[…] haben sich meine Ansichten über den gegenwärtigen Standpunkt der Musik u. zumal der dramatischen, bedeutend geändert, u. soll ich es leugnen, daß gerade Ihre Werke es waren, die mir diese neue Richtung anzeigten? Es wäre hier jedenfalls sehr am unpassenden Orte, mich in ungeschickten Lobeserhebungen Ihres Genius aus zu lassen, nur soviel, daß ich in Ihnen die Aufgabe des Deutschen vollkommen gelöst sehe, der sich die Vorzüge der italienischen u. französischen Schule zum Muster machte, um die Schöpfungen seines Genie’s universell zu machen. Dieß hat mich denn ungefähr auf meine jetzige Bahn gebracht.“[4] Sodann bittet Wagner Meyerbeer um ein Urteil über seine Oper Das Liebesverbot (1836), deren Partitur er zuvor an Meyerbeers Pariser Librettisten Eugène Scribe gesandt hatte; er bietet an, im Falle einer günstigen Meinung, ein neues Werk für die Pariser Opéra zu komponieren, für das er auch bereits einen Textvorschlag unterbreitet. Vorrangige Absicht seines Briefes war es, überhaupt in Kontakt zu treten mit dem berühmtesten und einflussreichsten Opernkomponisten der Zeit, um dessen Protektion er schmeichelnd bettelt: „Künstlerruhm kann Ihnen fast nicht mehr zu Theil werden, denn Sie erreichten schon das Unerhörteste; überall, wo Menschen singen können, hört man Ihre Melodien. Sie sind ein kleiner Gott dieser Erde geworden; – wie herrlich ist es nun für den, der diesen Standpunkt erreicht hat, zurückzublicken, u. denen, die er soweit hinter sich ließ, die Hand zu reichen, um auch sie wenigstens in Ihre Nähe zu ziehen.“[5] Wie Meyerbeer auf Wagners Brief reagierte, ist nicht bekannt (ein Gegenbrief ist nicht überliefert und Meyerbeers Tagebuch schweigt dazu), jedoch scheint er nicht unbeeindruckt geblieben zu sein, denn als Wagner zweieinhalb Jahre später tatsächlich nach Paris reist, um dort seine Zelte aufzuschlagen, empfängt ihn Meyerbeer im Kurort Boulogne-sur-Mer und lässt sich Teile der Rienzi-Partitur zeigen, an der Wagner damals arbeitete. Der Eindruck scheint ein positiver gewesen zu sein, denn Meyerbeer behielt das Werk im Auge und empfahl es nach seiner Fertigstellung für eine Aufführung in Dresden, die Wagners erster Opernerfolg werden sollte.
Wagner hat seinen ersten Paris-Aufenthalt von 1839-1842 später als eine Zeit menschlicher und künstlerischer Entwürdigung dargestellt, für die er „jüdische Kabale“ verantwortlich machte (einige führende Vertreter der damaligen Pariser Musik- und Kunstszene waren tatsächlich Juden). Aber klagte Wagner wirklich zu Recht an? Immerhin konnte er arbeiten und als Schriftsteller publizieren, und am Ende eröffnete sich ihm, dank Meyerbeers Protektion, eine neue lohnende künstlerische Perspektive in Dresden, wo er bald darauf Hofkapellmeister wurde. Von einem Pariser Misserfolg Wagners lässt sich nur sprechen, wenn man die Augen davor verschließt, dass Wagners Erwartungen durch nichts gerechtfertigt, ja eigentlich anmaßend waren. Die Proportionen zurecht zu rücken, hilft ein einfaches Gedankenexperiment: Wie würde man ein Jahrhundert später über einen Filmemacher urteilen, der sich nach der Produktion eines einzigen – zudem erfolglosen – Streifens in der Provinz umgehend nach Hollywood begibt in der Erwartung, dort sogleich eine Großproduktion angeboten zu bekommen? Genau in dieser Situation nämlich befand sich damals der Opernkomponist Richard Wagner. Öffentlich vorzuweisen hatte er gerade einmal eine Oper, eben Das Liebesverbot, deren einzige (!) Aufführung in Magdeburg zudem in ein Debakel mündete; die bereits fertig komponierten Feen waren noch unaufgeführt und blieben es bis zu Wagners Tod. Die Größen des Pariser Musiklebens standen Wagner keinesfalls feindselig gegenüber, zumal er in Meyerbeer einen prominenten Fürsprecher besaß, dennoch konnte er für sie nichts anderes sein, als ein noch unbeschriebenes Blatt, einer jener zahlreichen, mitunter vielversprechenden jungen Musiker, die in der Metropole mit mehr oder weniger Erfolg ihr Glück versuchten.
Meyerbeers offenkundiges Wohlwollen an seiner Person und seine eigene zunehmende Ungeduld veranlassten Wagner, immer drängender um die Gunst des berühmten Komponisten nachzusuchen und sich ihm im Gegenzug als Helfer und Förderer anzudienen: angesichts ihrer beider Stellungen in der Musikszene ein abwegiger Vorschlag, den der vornehme Meyerbeer kaum anders denn als peinlich empfunden haben kann. Hier eine Probe aus einem Brief vom 3. Mai 1840: „Ich bin auf dem Punkte, mich an Jemand verkaufen zu müssen, um Hülfe im substantielsten Sinne zu erhalten. Mein Kopf u. mein Herz gehören aber schon nicht mehr mir, – das ist Ihr Eigen, mein Meister; – mir bleiben höchstens nur noch meine Hände übrig, – wollen Sie sie brauchen? – Ich sehe ein, ich muss Ihr Sclave mit Kopf und Leib werden, um Nahrung u. Kraft zu der Arbeit zu erhalten, die Ihnen einst von meinem Danke sagen soll. Ich werde ein treuer, redlicher Sclave sein, – denn ich gestehe offen, daß ich Sclaven-Natur in mir habe; mir ist unendlich wohl, wenn ich mich unbedingt hingeben kann, rücksichtslos, mit blindem Vertrauen. Zu wissen, daß ich nur für Sie arbeite u. strebe, macht mir Arbeit u. Streben bei weitem lieber u. werthvoller. Kaufen Sie mich darum, mein Herr, Sie machen keinen ganz unwerthen Kauf!“[6] In einem nachfolgenden Brief an Meyerbeer vom 4. Juni 1840 entschuldigt sich Wagner zwar für den von ihm hier angeschlagenen Ton, mit dem er – so seine Worte – „die Gränze des Zartgefühls u. der Bescheidenheit überschritt“[7], um dennoch alsbald in ebendiesen Ton zurückzufallen. Einen weiteren Brief an Meyerbeer vom 26. Juli 1840 unterzeichnet Wagner gar mit „Ihr unterthänigster Sclave“, wobei die Herausgeber der Wagner-Briefausgabe „Sclave“ als verballhorntes „Scolare“ (= „Schüler“) transkribierten: ein Beschönigungsversuch, der sich weder philologisch noch von der Sache her erschließt, denn Wagners Unterschrift ist zweifelsfrei als „Sclave“ lesbar, und daß Wagner sich gegenüber Meyerbeer so bezeichnet und dies dazu noch ausführlich begründet hat, bezeugt der Text des zitierten Briefes.[8]





























