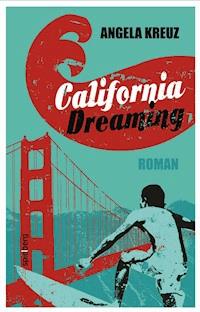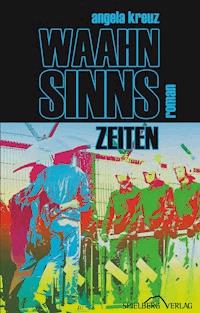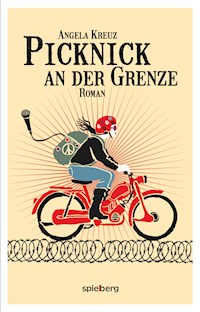Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Spielberg Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1993: Sophie reist nach Prag, um sich einen Traum zu erfüllen – die Aufnahme am renommierten Konservatorium. Doch die Stadt der hundert Türme hält mehr für sie bereit als nur die Aufnahmeprüfung. Unerwartete Begegnungen und die Schatten ihrer deutsch-tschechischen Familiengeschichte werfen Fragen auf, die Sophie nicht länger verdrängen kann. Was verbindet ihre Träume mit den verlorenen Hoffnungen der Vergangenheit? Und welchen Preis ist Sophie bereit zu zahlen, um ihren eigenen Weg zu gehen? Ein mitreißender Roman über Liebe, Verlust und das Ringen um Versöhnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Taktwechsel
Inhaltsverzeichnis
Taktwechsel
Danksagung
Vollständige e-Book-Auflage 2025
Originalausgabe: »Taktwechsel«
© 2025 Spielberg Verlagsgruppe Neumarkt
Spielberg Verlag GmbH, Am Schlosserhügel 4a1
92318 Neumarkt, [email protected]
Umschlagbild: © iStock
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ISBN: 978-3-95452-138-8
www.spielberg-verlag.de
Angela Kreuz, geboren 1969 in Ingolstadt, studierte in Konstanz Psychologie und Philosophie. 2007 erschien ihr erster Roman »Warunee«, gefolgt von »Wahnsinnszeiten« (2009) und »California Dreaming« (2013). Dazwischen kam ihr zweisprachiger Gedichtband »Train Rides and Tides - Ebbe, Flut und zurück« heraus, mit Übersetzungen ins Deutsche von Barbara Yurtdaş. 2017 erschien der Roman »Straßenbahnträumer«, 2018 »Das surrealistische Büro. Kein Roman« und 2019 »Picknick an der Grenze«. Angela Kreuz erhielt für ihr Werk zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Kulturförderpreis der Stadt Regensburg 2012.
Alle Namen, Figuren und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden bzw. verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Taktwechsel
Sophie schulterte ihren Rucksack und hievte den Cellokasten in den Zug. Im Augenwinkel bemerkte sie, wie ihre Großmutter einen Geldschein aus dem Portmonee fischte.
»Oma, bitte.« Sophie fuhr herum. »Ich hab genug Kohle mit.«
»Wie eine Rucksackdeidtsche schaust aus.« Die schmalen Augen sahen Sophie verschwommen an; der rechte Lidstrich war verschmiert. Omas Atem roch süßlich nach Weinbrandbohnen, den Gutenaus Böhmen.
»Na und?«
»Prag ist ein teures Pflaster.«
Sophie spürte steife Finger an ihrer Jackentasche nesteln.
»Danke«, murmelte sie und kletterte in den Zug. Oben richtete sie sich auf.
Der Schaffner ging am Bahnsteig auf und ab und fing an, die Türen zu schließen, lange konnte es nicht mehr dauern, bis der Zug losfuhr.
»Hast du auch deinen Pass nicht vergessen?« Oma machte ein Doppelkinn, ihre Granat-Ohrringe zitterten.
»Welchen Pass?« Sophie gab sich erstaunt.
Omas Mundwinkel wanderten nach unten.
»War ein Witz. Ich ruf euch an, wenn ich ein Zimmer gefunden habe.«
»Du wirst schon sehen, was du davon hast.«
»Bestimmt«, sagte Sophie, »so oder so.«
»Mach uns keine Schande.«
Der Kloß in Sophies Hals drückte. »Ich such mir schon mal einen Sitzplatz.« Sie stieß mit dem Cellokasten die Tür zum Gang auf. Ein paar Leute saßen auf Behelfsklappsitzen. Sophie hasste volle Züge; mit ihrem unhandlichen Gepäck musste sie sich durch eine Horde Kinder zwängen, während die Fahrgäste hinter ihr nachdrückten. Im Gang roch es nach Schweiß, Kaugummi und Leberwurstbroten. Ein Junge spielte mit dem Game Boy, die elektronischen Töne gingen ihr bereits auf die Nerven.
»Tschuldigung, ich muss hier durch.« Sophie wäre am liebsten bei der nächsten Tür wieder ausgestiegen, doch wie sollte sie dann nach Prag kommen. Sie bugsierte den Koffer vor sich her. Hoffentlich kam das Cello nicht zu Schaden, wenn sie überall anstieß; sie hatte es noch nicht abbezahlt. Ihr Geigenbauer würde sie umbringen.
Der übernächste Waggon war weniger voll, und am hintersten Ende fand sie endlich ein leeres Abteil. Sie legte den Cellokasten auf die Sitzbank und verstaute den Rucksack im Gepäcknetz. Was hatte sie nicht alles eingepackt. Als käme sie nie wieder zurück – dabei wollte sie in drei Wochen wieder in Regensburg sein und erst danach richtig umziehen. Vorausgesetzt, dass alles gutging. Es war längst überfällig, dass sie aus ihrer Dachkammer bei Oma und Opa herauskam.
Die Luft war stickig, Sophie zog das Schiebefenster herunter. Eine kühle Morgenbrise strömte herein.
Oma stand verloren auf dem Bahnsteig und zupfte ihr geblümtes Halstuch zurecht. Ihre Blicke kreuzten sich. Sie kam mit gesenktem Kopf auf den Waggon zu.
»Wie soll ich das nur alleine schaffen?« Oma schnäuzte sich geräuschvoll.
»Frau Liebl kommt doch jeden Tag vorbei.« Ohne die Gewissheit, dass jeden Tag der mobile Hilfsdienst zu Opa kam, hätte Sophie es sicherlich nicht geschafft, sich von ihm loszueisen. Oma delegierte lieber, als dass sie sich selbst um alles kümmerte.
Sie sah Sophie skeptisch an. »Und wenn die wieder kündigt wie die Schulz?«
»Na, wenn du sie wie Dienstpersonal behandelst, wäre das kein Wunder.«
»Unsere Dienstboten waren damals genauso frech, die hatten keinen Funken Respekt. Man hat denen ständig hinterherkontrollieren müssen, ob sie nicht wieder die Hälfte vergessen haben.«
»Du warst doch selber mal ein Dienstmädchen.« Sophie konnte diese Sprüche nicht mehr hören.
Oma schnaubte. »Und du bist wie dein Großvater, du hältst auch noch zu denen.«
Es war sinnlos, mit Oma zu diskutieren. Endlich hörte Sophie einen Pfiff, und der Zug setzte sich in Bewegung. Oma winkte mit ihrem Stofftaschentuch und schrumpfte mit jedem Meter, den sich der Zug von ihr entfernte, und von einem Moment auf den anderen wirkte sie wie ein altmodisch gekleidetes Mädchen.
Als Oma hinter der Kurve verschwand, atmete Sophie auf.
Sie schob die Scheibe nach oben, setzte sich ans Fenster und betrachtete die Spiegelung. Ihre hellgrünen Augen sahen müde aus; sie hatte die Nacht kaum geschlafen. An den Pagenschnitt mit Zickzack-Scheitel, den ihr ihre Friseurin eingeredet hatte, musste sie sich erst noch gewöhnen. Das ist der neueste Schrei aus London. Wenigstens kamen ihre Kreolen zur Geltung. Wie wohl die Mädels in Prag herumliefen? Sophies Jeans war zu weit geworden, bei dem ganzen Vorbereitungsstress hatte sie ein paar Kilo abgenommen; sie guckte, ob vor dem Abteil niemand stand, und zog den Gürtel etwas enger.
Der Cellokasten lag breit auf dem Sitz, als ob dort ein Obdachloser schliefe. Das eckige Ungetüm war an mehreren Stellen zerschlissen, sie hatte ihn vor Jahren für dreißig Mark auf dem Flohmarkt gekauft.
Dass Opa neuerdings so viel von der alten Heimat erzählte, brachte Sophie ins Grübeln. Er war seit ein paar Tagen, in denen er kaum noch aus dem Bett gekommen war, ungewöhnlich redselig geworden, und jedes Mal, wenn Oma beim Einkaufen war, hatte er von dieser Jarmila erzählt. Stundenlang war Sophie bei ihm gesessen und hatte Dinge erfahren, von denen sie nichts gewusst hatte. Bis vor kurzem war Opa sehr still gewesen. Es war auch schwer, bei Oma zu Wort zu kommen, die oft in einer Tour redete. Immer wieder fing sie vom Gasthaus Zum Paradies an. Wie eine Platte, die einen Sprung hatte.
Sophie holte ihren Walkman aus dem Rucksack und legte die Kassette mit der Moldau ein, die Opa ihr zum Geburtstag geschenkt hatte; sie leierte bereits vom vielen Abspielen. Sophie war wie süchtig danach. Die Tondichtung rief lebhafte Bilder in ihr hervor, als würde sie sich im Kino einen Film ansehen, den sie selbst gedreht hatte. Das sanfte Murmeln der Quellen bei der Eröffnung klang mittlerweile seltsam verzerrt. Hoffentlich riss das Band nicht. Sie summte die Melodie mit. Irgendwann wollte sie die Orte besuchen, an denen die Moldau entsprang.
Draußen nieselte es. Das satte Grün der Bäume und Sträucher zog vorbei, unterbrochen von blühenden Vorgärten. Sophie legte sich die Jacke über die Knie und schloss die Augen.
Opas Gesprächigkeit kam ihr komisch vor. Wollte er mit seinem Leben abschließen? Sie fröstelte. Opa war so stolz auf sie, darauf, dass sie zur Aufnahmeprüfung fuhr – er hätte auch so gerne am Prager Konservatorium studiert. Wenn nicht so viel dazwischengekommen wäre. Seit sie klein war, hatte sie von Prag geträumt, dem Rudolfinum mit seinen herrlichen Konzertsälen und der perfekten Raumakustik, von der er ihr immer vorgeschwärmt hatte. Näher kannst du dem Himmel nicht kommen.
Der Zug bremste und kam mitten in der Pampa zum Stehen. Sie mussten irgendwo zwischen Regenstauf und Maxhütte-Haidhof sein, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten.
Die Schiebetür wurde beiseitegeschoben, und ein beleibter Schaffner sah Sophie auffordernd an. Lange weiße Locken quollen unter seiner Dienstmütze hervor.
Sophie setzte den Kopfhörer ab, kramte in der vorderen Rucksacktasche und hielt ihm die Fahrkarte hin.
»Warum geht es nicht weiter?«, erkundigte sie sich.
»Streckenstörung.« Er entwertete den Schein und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Ich muss meinen Anschlusszug in Pilsen bekommen und habe nur zwanzig Minuten Aufenthalt.« Sie rieb sich die Nase. »Können Sie mir sicher sagen, ob das klappt?«
»Bin ich der liebe Gott?«
»Na, Sie sehen zumindest so aus«, witzelte Sophie.
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?« Er setzte eine strenge Miene auf, aber Sophie bemerkte, dass er innerlich grinsen musste.
»Das würde ich mir bei ihrer Position nie erlauben«, sagte sie unschuldig. »Sie müssen mir nur Bescheid sagen, ob ich ein Hosianna für Sie anstimmen soll.«
Seine Backen bekamen Farbe, was ihm eher das Aussehen einer in die Jahre gekommenen Putte verlieh. Fehlten noch die Trompete und ein Paar Flügelchen.
»Eine Geige ist das aber nicht«, sagte er mit Blick auf den Kasten.
»Herrje!« Sophie lachte. »Jetzt, wo Sie es sagen.«
Er runzelte die Stirn.
»Aber Sie werden staunen, was für himmlisch hohe Klänge ich auf der A-Seite spielen kann«, frotzelte sie weiter.
Der Schaffner strich sich über den Bart. »Ein Geburtstagsständchen würde mir schon gefallen.«
»Jetzt verschaukeln Sie mich aber.«
»Ich musste für einen Kollegen einspringen«, murrte er.
»Oh, herzlichen Glückwunsch.«
»Der Zug fährt heute zur Feier des Tages durch, Sie können sitzen bleiben.« Er nickte ihr zu und verschwand.
Ein Kaffee wäre jetzt gut. Doch mit Cello und Rucksack im Speisewaggon zu sitzen, würde nur Stress bringen. Und ihre Sachen wollte Sophie auf keinen Fall aus den Augen lassen. Sie packte die Thermoskanne aus und schenkte sich Pfefferminztee ein. Oma hatte ihr Reiseproviant mitgegeben, damit sie unterwegs nicht verhungerte. Sophie biss in eine mit Puderzucker bestreute Buchtel; die Erdbeermarmelade war pappsüß. Ihre Finger klebten. Oma sollte besser auf ihr Gewicht achten, aber auf diesem Ohr war sie taub. Irgendwie drehte sich bei ihr alles ums Essen. Die Speisekammer quoll über von Lebensmitteln, die sie in ihrem Leben nie aufbrauchen konnte, vieles war bereits abgelaufen, aber es durfte ja partout nichts weggeworfen werden. Oma wurde zum Tier, wenn Sophie nur den leisesten Anflug hatte, dort auszumisten. Sie leckte ihre Finger, schüttete ein wenig Tee in ein Taschentuch und putzte sich die Hände. Es klebte immer noch alles.
Der Regen klopfte an die Scheibe. Wie zum Trotz leuchtete der Löwenzahn in tausend kleinen Sonnen zwischen den hügeligen Wiesen; dahinter erstreckte sich der Wald. Der Zug ruckelte und fuhr wieder an. Sophie war länger nicht mehr beim Wandern gewesen, in den letzten Monaten hatte sie sechs Tage die Woche in der Goldenen Ente gekellnert und in jeder freien Minute Cello geübt. Früher war sie öfters mit ihren Freundinnen in den Bayerischen Wald gefahren, sie hatten in einer Hütte übernachtet und bis in die frühen Morgenstunden unterm Sternenhimmel gefeiert. Aber ihre Freundschaften hatten sich in den letzten Jahren zerstreut, eine Freundin nach der anderen war von Regensburg weggezogen. Eine hatte in München angefangen zu studieren, eine in Bamberg geheiratet, eine musste sich rund um die Uhr um ihren Babyunfall kümmern, und eine hatte sich einfach nicht mehr gemeldet. Sophie war auch zu beschäftigt gewesen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Vielleicht traf sie in Prag Leute, mit denen sie etwas erleben konnte. Aber zuerst musste sie die Prüfung schaffen.
Opa hatte damals auch in jeder freien Minute am Cello gesessen und gespielt. Wenn er von seinem alten böhmischen Meistercello sprach, leuchtete sein Gesicht, als hätte jemand hinter den hellen, klaren Augen eine Fackel entzündet, aber daraufhin verfinsterte es sich, und er wurde sehr schweigsam. Er konnte sich an jedes Detail seines Instruments erinnern. Sein musikbegeisterter Vater hatte ein Vermögen dafür ausgegeben. Ob es noch existierte? Mit diesem Luxusstück die Aufnahmeprüfung zu bestreiten wäre etwas gewesen. Sophie hatte sich von ihrem Geld gerade mal ein besseres Schülercello kaufen können. Eigentlich war es ihr zu groß, sie fand beim Spielen keine vernünftige Sitzhaltung. Mit einem Meistercello hätte sie ganz andere Voraussetzungen gehabt.
Sophie sah auf ihre schmalen Finger, die Gelenke taten vom vielen Üben weh. Sie kramte im Kulturbeutel nach der Schmerzsalbe und rieb sich Hände und Unterarme ein. Vielleicht übte sie auch zu viel oder machte irgendetwas falsch. Wenn sie ein paar Jahre früher mit dem Spielen hätte beginnen können, hätte sie nicht diese Probleme, aber so musste sie allen anderen Bewerbern hinterherkommen.
Sie hatte schon in der ersten Klasse mit Cello anfangen wollen, nachdem sie Yo-Yo-Ma im Fernsehen hatte spielen sehen. Ihre Schultüte samt ihren Puppen hätte sie liebend gerne gegen ein Kindercello eingetauscht, aber ihre Eltern waren schlichtweg unmusikalisch, und Oma hatte sich mit Händen und Füßen gewehrt. Cello sei etwas für Männer. Das gehört sich nicht, ein Mädchen soll Klavier lernen. Jahrelang hatte sich Sophie auf dem alten Schinken geplagt, den Oma von einem Landsmann für wenig Geld bekommen hatte, und mit einer verbitterten sudetendeutschen Klavierlehrerin aus der Siedlung, die Kinder hasste, die Klavier hasste und wahrscheinlich auch sich selbst.
Opa hatte seit der Vertreibung kein Cello mehr angefasst und weigerte sich nach wie vor, Sophie zu unterrichten. Ob es ihn zu sehr schmerzte oder er damit nur einem Streit mit Oma aus dem Weg gehen wollte, war Sophie nicht klar – vermutlich beides. Immerhin hörte er ihr in der Dachkammer oft zu und begleitete sie hin und wieder auf dem Klavier, das er regelmäßig stimmte. Sophie leistete sich dreimal pro Woche Cellostunden in der Musikschule, wo Opa bis zu seiner Pension als Hausmeister und Klavierstimmer gearbeitet hatte. Ihre Cello-Lehrerin war während des Prager Frühlings aus der Tschechoslowakei geflohen; sie brachte Sophie alle musikalischen Fachbegriffe auf Tschechisch bei. Seit der Eiserne Vorhang gefallen war, nahm Sophie bei ihr zusätzlich Sprachunterricht und hatte mittlerweile alle verfügbaren Lehrbücher und Hörkassetten aus der Bibliothek verschlungen. Dreieinhalb Jahre war es schon wieder her. In den letzten Monaten waren sie vorbereitungshalber ganz auf Tschechisch umgestiegen, weil sich Sophie mit dem Sprechen immer noch schwertat.
Wie es Opa wohl ging? Seit Wochen war er sehr schwach auf den Beinen; er hatte etliche Untersuchungen im Krankenhaus über sich ergehen lassen, doch die Ärzte konnten keine Ursache finden. Sophie würde jetzt lieber an seinem Bett sitzen und mit ihm die alten Fotos anschauen, die er ihr nach dem Frühstück zugesteckt hatte, als Oma im Badezimmer war.
Die Blechdose mit den Fotos beulte die obere Rucksacktasche aus.
Ausgerechnet jetzt, wo er ihr so viel von früher erzählte, musste sie zur Aufnahmeprüfung nach Prag. Es war ihre letzte Chance, noch in diesem Jahr am Konservatorium aufgenommen zu werden, im nächsten Jahr wäre sie mit 25 Jahren schon zu alt für die staatliche Förderung. Privat zu studieren konnte sie sich schlichtweg nicht leisten. Und wenn es Opa schlechter ginge? Oder noch schlimmer, wenn er in ihrer Abwesenheit sterben würde, bevor sie wieder nach Hause kommen konnte? Er durfte sie gerade jetzt nicht alleine lassen. Sie waren so eng miteinander verbunden, schon immer; sie konnte sich ihr Leben nicht ohne ihn vorstellen. Der Gedanke, ohne Opa weiterleben zu müssen, versetzte sie in Panik. Der ganze Planet wäre leergefegt. Wenn es Opa nicht mehr gab, wem sollte sie dann von ihrem Studium berichten? Oma würde es garantiert nicht interessieren. Vater auch nicht, er hörte nur Schlager. Es würde alles keinen Sinn mehr ergeben.
Vater kam jeden Sonntag zum Mittagessen und redete mit Oma dummes Zeug; er fragte nie, wie es Sophie ging oder womit sie ihre Zeit verbrachte. Sie zog sich in ihre Dachkammer zurück, sobald er im Haus war, und gab vor, keinen Appetit zu haben. Er war wie ein Fremder. Als Mama noch am Leben war, hatte er sich zuhause oft vor ihr aufgebaut und herumgeschrien. Sophie konnte sich nicht daran erinnern, dass Mutter sich einmal gewehrt hatte; sie hatte einfach weiter gekocht und seine Tiraden über sich ergehen lassen.
Nach ihrem Begräbnis hatte Opa Sophie in die Siedlung geholt. Sogar gegen Omas Willen, es war das einzige Mal, dass er sich ihr gegenüber durchgesetzt hatte.
»Das Kind bleibt nicht bei seinem Vater«, hatte Opa hitzig gesagt, was sonst überhaupt nicht seine Art war. Sophie durfte dableiben und musste nicht mehr zu ihm zurück.
Oma war überhaupt nicht begeistert gewesen und hatte Sophie bei jeder Gelegenheit spüren lassen, welche zusätzliche Belastung sie darstellte und wie verkehrt und abartig sie aus den verschiedensten diffusen Gründen war. Sophie hatte nie verstanden, was denn so falsch an ihr sein sollte. Aber bei Opa war sie immer willkommen.
Vaters Blicke waren ihr unangenehm, diese hungrige abgrundtiefe Traurigkeit, die sie aufzufressen schien, wenn sie nicht augenblicklich wegsah. Allein bei dem Gedanken verspannte sich Sophies Rücken, und ein unerträgliches Gefühl von Ohnmacht kroch in ihr hoch. Einmal war er betrunken in ihre Dachkammer gepoltert und hatte irgendetwas von Mama gelallt, doch Oma war ihm hinterhergelaufen und hatte ihn unter wüsten Beschimpfungen hinausgeworfen.
Der Zug blieb wieder stehen. Sophie starrte durch die Scheibe in die Landschaft. Ob ihre Familie auf der Flucht durch dieses Waldstück gelaufen war? Damals war es auch Sommer gewesen. Es war bald ein halbes Jahrhundert her. Soviel Sophie wusste, hatte die andere Oma als Waschfrau im Gasthof gearbeitet; sie war während der Vertreibung gestorben. Vater war damals fünf und Mama drei Jahre alt gewesen. Vielleicht war in der Dose auch ein Foto von den Großeltern, denen sie nie begegnet war. Der andere Opa soll Tscheche gewesen sein – ob er auch geflohen oder dageblieben war? Sie wusste nicht einmal ihre Namen.
Dass Opa sich noch so gut an alles erinnern konnte. Sophie hatte bereits Mühe, sich zu merken, was sie in welchen Semestern an der Uni studiert hatte bei ihren vielen Fächerwechseln. Sie konnte sich nicht vorstellen, Historikerin, Archäologin oder Mathematikerin zu werden – irgendwie fühlte sich alles nicht richtig an außer der Musik. Sie wollte Cellistin werden. Immer schon. Und im Rudolfinum in der Philharmonie spielen. Wie Opa es gerne gemacht hätte. Er hatte einfach Pech gehabt.
Die Abteiltür wurde mit einem Ruck aufgezogen. »Grenzkontrolle, Ihren Ausweis bitte.«
Sophie gab dem Polizisten ihre Papiere. Er musterte ihren Cellokasten argwöhnisch, als hätte sie darin eine der unzähligen Leichen versteckt, die in ihrem Familienkeller herumlagen.
»Möchten Sie sehen, was drin ist?«, fragte sie.
»Bitte.«
Sophie öffnete den Kasten mit ein paar Anläufen und unterdrückten Flüchen; der Verschluss klemmte. Die Saiten des Cellos hatten sich schon wieder abgewickelt und hingen lose herab, irgendwie wollten die Wirbel partout nicht halten. Wenn ihr das während der Prüfung passierte, konnte sie gleich einpacken.
»Keine Angst, das ist nur eine Cello-Leiche«, murmelte sie.
Der Polizist betastete das Cello und schloss dann den Deckel, als wäre er Bestatter und der Kasten ein Sarg. Bei der Vorstellung einer Kinderleiche schauderte Sophie. Oma erzählte immer wieder die grausame Geschichte von der jungen Mutter, die der aufgebrachte Mob mitsamt ihrem Baby über das Brückengeländer in den Fluss geworfen hatte.
»Hätten Sie mal besser Geige gelernt«, sagte der Polizist.
»Sehr witzig«, sagte Sophie.
Etwas später blätterte ein tschechischer Grenzbeamter in ihrem Reisepass. Er sah aus wie Pan Tau mit Dienstmütze und Abzeichen an den Schultern, was ein gewisser Widerspruch in sich war. »Ich habe im Schulorchester Pauke gespielt«, ließ er sie auf Deutsch wissen, »die hätte ich nicht im Zug mitnehmen wollen.«
»Pauke ist wenigstens nicht so kompliziert«, neckte sie ihn.
»Das sagen alle.« Er gab ihr den Pass zurück.
»Wo haben Sie eigentlich ihre Melone und den Regenschirm gelassen?«, fragte sie.
Konnte er nicht eben in Windeseile Opas Meistercello finden?
Er zog die Brauen hoch. »Sie schauen wohl zu viel Fernsehen?«
Sophie schüttelte den Kopf. »Dafür hätte ich gar keine Zeit.« In ihrer Dachkammer gab es keinen Glotzkasten, und sie vermisste ihn auch nicht. Aber früher hatte sie keine einzige Folge der Kinderserie verpasst. »Zumindest sind Sie der erste Tscheche, den ich live zu Gesicht bekomme.«
»Das wundert mich, weil viele meiner Landsleute seit der Grenzöffnung in Deutschland leben.«
»Ich kenne keinen einzigen richtigen Tschechen.«
»Was verstehen Sie unter einem richtigen Tschechen?«
»Vergessen Sie’s.« Sophie winkte ab. »Tschuldigung.«
Er lüpfte die Dienstmütze. »Gute Reise.«
Ob ihr Tschechisch mittlerweile ausreichte, um die Prüfer zu beeindrucken? In ihrer Dachkammer hörte sie einen tschechoslowakischen Radiosender, und wenn Oma nicht da war, sprach sie mit Opa heimlich Tschechisch. Oma wurde jedes Mal ausfallend, wenn sie Tschechisch hörte. Der Tschech ist eine Sau. Wie sie nur auf so etwas kam. Als Wirtin musste sie die Sprache doch gesprochen oder zumindest verstanden haben, schließlich hatten in Šedá viele Tschechen gelebt. Der Zug fuhr wieder an, und Sophie streckte ihre Beine aus. Nach einer Weile machte sie das monotone Rattern schläfrig.
*
»Je tady volné místo?«, fragte jemand. Ob hier noch frei wäre.
»Ano«, murmelte sie im Halbschlaf, sie flanierte eben mit Opa über den Altstädter Rathausplatz an der Astronomischen Uhr vorbei, umgeben von schwirrenden tschechischen Wortfetzen, und ihr war, als würde der Traum einfach so weitergehen. Unwillig öffnete sie die Augen.
Ein Endzwanziger mit Schiebermütze und Cellokoffer stand im Abteil.
»Darf ich?« Er deutete auf ihren Kasten.
Sophie unterdrückte ein Kichern und setzte sich auf, als hätte er sie bei irgendetwas ertappt. Es war zu komisch, dass der Mann auch mit einem Cello reiste.
Er hob seinen Koffer, der mit bunten Aufklebern aus verschiedenen Städten verziert war, ins Gepäcknetz und schob ihren vergammelten Kasten zur Seite, um etwas Platz zu schaffen und sich auf die Bank zu setzen. Eine betretene Stille senkte sich über das Abteil.
Sophie strich sich eine Strähne aus der Stirn.
»Kolegyně?«, sprach er sie an.
Auf der Suche nach tschechischen Wörtern machte sie eine abwägende Geste.
Er trug ein Hemd mit Weste und hatte die Ärmel hochgekrempelt. Auf seinen Unterarmen glänzten rotbraune Haare. »Wo spielen Sie denn?«
»Ich fahre zur Aufnahmeprüfung ans Konservatorium in Prag.«
»Ah«, er kratzte sich am unrasierten Kinn, »da habe ich auch studiert.«
Sophie war plötzlich hellwach. »Wie war es dort?«
»Ich kann mich nicht beschweren; mein Prof hat mich zusätzlich privat unterrichtet.« Ein Sonnenstrahl fiel auf sein Gesicht.
Das Wort doučování fiel ihr ein, Nachhilfeunterricht.
Er gluckste. »Podpora talentovaných.«
Begabtenförderung. Sophie biss sich auf die Lippe. Warum musste sie immer so komische Sachen sagen.
Ihr Blick fiel auf seine Hände; mit diesen Fingern könnte sie auch mühelos alle gestreckten Lagen auf dem Cello greifen. »Und was machen Sie jetzt?«
»Jetzt spiele ich direkt gegenüber.« Er lehnte sich zurück und legte eine Kunstpause ein. »In der Philharmonie.«
»Im Rudolfinum?«, platzte sie heraus.
Er nickte stolz.
Ihre Wangen brannten. Wenn sie das mal Opa erzählte.
»Und wer bereitet Sie auf die Prüfung vor?«, fragte er.
»Professor Kyselý.« So stand es zumindest auf ihrem Einladungsschreiben vom Konservatorium.
»Hm«, brummte er mit einem seltsamen Unterton.
»Kennen Sie den Dozenten?«
»Nur vom Hören-Sagen, ich war zum Glück bei Horáček.«
»Und wie ist Kyselý?« Nach und nach kamen ihr die Wörter etwas leichter von den Lippen, so, als hätte sich in ihr eine verrostete Türe geöffnet.
Der Cellist sah abwesend aus dem Fenster. »Machen Sie sich lieber Ihr eigenes Bild.«
Sie schwiegen eine Weile.
»Sind Sie Finnin?« Der Mann sah sie versonnen an, als würde sie ein schillerndes Nordlicht umfluten. Seine Zähne waren ein klein wenig schief. Wie kam er nur darauf.
Sophie deutete ein Kopfschütteln an. »Nein, ich bin aus Bayern.«
»Sie sind Deutsche?« Er wirkte, als hätte sie ihm eine kalte Dusche verpasst.
»Meine Großeltern kommen aus Böhmen«, sagte sie und musste aus irgendeinem Grund an die Bohémiens denken, die sich in den goldenen 20ern die Zeit in Prager Straßencafés vertrieben hatten.
Sein Blick wurde starr. »Aus dem Sudetenland?«
Sudeten, wie das klang, nach Blut und Boden, nach den verstaubten Fahnen der Landsmannschaften, nach dem ewig Gestrigen. Damit wollte sie nichts zu tun haben.
»Ja«, sagte sie leise, aber od Bohemia klang entschieden besser. Ein nagendes Schuldgefühl machte sich in ihr breit.
Er sah enttäuscht drein, und in seinen Blick mischte sich Misstrauen.
»Sie sind keine Nazis«, fügte sie hinzu.
Was konnte sie denn dafür, dass sie zufällig in Deutschland geboren worden war und nicht in Finnland?
»Das kann jeder sagen«, sagte er zweifelnd. »Wissen Sie das so genau?«
»Bin ich hier in Sippenhaft?« Sophie kam sich mittlerweile vor wie in einem Verhör.
»Sippenhaft?«
»Mein Großvater ist Sozialdemokrat«, knurrte sie zu ihrer Verteidigung. Opa hatte ihr erzählt, wie die Sozis damals von den Nazis verfolgt worden waren. Aber wann er der Partei beigetreten war, wusste sie nicht. Ob er Flugblätter verteilt oder ob er in der Wirtsstube seinen Kopf eingezogen hatte, als die Braunhemden seine Gäste schikaniert hatten? Und ob Oma in der Menge gejubelt hatte, als die Nazis ins Sudetenland einmarschiert waren? Darüber wurde zuhause nie gesprochen.
»Ach so, interessant«, sagte er einlenkend und lümmelte sich in den Sitz; ihre Antwort schien sie etwas zu entlasten.