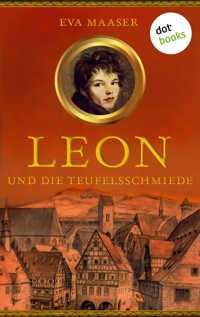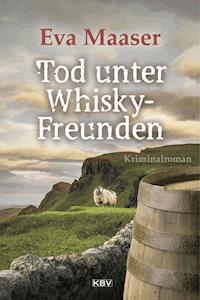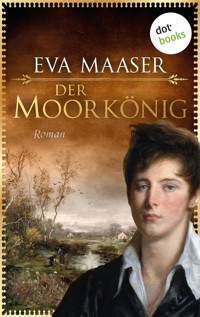Tante Ella und das Geheimnis im Gurkenbeet - oder: Eine Gurke macht noch keinen Frühling E-Book
Eva Maaser
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zum Mitfiebern und Schmunzeln: Der Cosy-Krimi »Tante Ella und das Geheimnis im Gurkenbeet« von Eva Maaser jetzt als eBook bei dotbooks. Carlotta erbt von ihrer Großtante Ella ein zauberhaftes altes Haus gleich neben einem Schloss im Münsterland. Nur der Garten müsste mal wieder auf Vordermann gebracht werden – doch kaum macht sie sich an die Arbeit, grinst ihr aus Ellas Gurkenbeet ein grausiger Fund entgegen! Was, um Himmels willen, hat ihre Tante angestellt? Mysteriös ist auch der zwar adlige, aber vor allem sehr knurrige Nachbar. Und als wäre das noch nicht genug, tauchen ohne Vorwarnung Carlottas drei nervige Exfreunde auf und machen ihr das Leben schwer. Wie soll sie da Ellas Geheimnis entschlüsseln? Denn je mehr sie darüber herausfindet, desto größer wird es ... »Ein Soft-Krimi in feinster Agatha-Christie-Manier.« www.mv-online.de Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der humorvolle Regiokrimi »Tante Ella und das Geheimnis im Gurkenbeet« von Eva Maaser wird alle Fans von M.C. Beaton und Traci Hall begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Carlotta erbt von ihrer Großtante Ella ein zauberhaftes altes Haus gleich neben einem Schloss im Münsterland. Nur der Garten müsste mal wieder auf Vordermann gebracht werden – doch kaum macht sie sich an die Arbeit, grinst ihr aus Ellas Gurkenbeet ein grausiger Fund entgegen! Was, um Himmels willen, hat ihre Tante angestellt? Mysteriös ist auch der zwar adlige, aber vor allem sehr knurrige Nachbar. Und als wäre das noch nicht genug, tauchen ohne Vorwarnung Carlottas drei nervige Exfreunde auf und machen ihr das Leben schwer. Wie soll sie da Ellas Geheimnis entschlüsseln? Denn je mehr sie darüber herausfindet, desto größer wird es ...
Über die Autorin:
Eva Maaser, geboren 1948 in Reken (Westfalen), studierte Germanistik, Pädagogik, Theologie und Kunstgeschichte in Münster. Sie hat mehrere erfolgreiche Krimis, historische Romane und Kinderbücher veröffentlicht.
Eva Maaser veröffentlichte bei dotbooks bereits die Kriminalromane »Der Clan der Giovese« sowie die Rohleff-Reihe mit »Das Puppenkind«, »Die Eisfrau«, »Das Schwanenmädchen« und »Der Purpurjunge«. Kommissar Rohleffs erster Fall »Das Puppenkind« ist auch im Sammelband »Tatort: Deutschland« erhältlich.
Eva Maaser veröffentlichte bei dotbooks außerdem ihre historischen Romane »Krone der Merowinger – Das Schicksal der Königin«, »Krone der Merowinger – Die Herrschaft der Königin«, »Der Moorkönig«, »Die Rückkehr des Moorkönigs«, »Der Paradiesgarten« und »Die Astronomin«.
Zudem erschienen bei dotbooks Eva Maasers Kinderbuchserien um Leon und Kim: »Leon und der falsche Abt«, »Leon und die Geisel«, »Leon und die Teufelsschmiede« und »Leon und der Schatz der Ranen«, »Kim und die Verschwörung am Königshof«, »Kim und die Seefahrt ins Ungewisse« und »Kim und das Rätsel der fünften Tulpe«.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Dieses Buch erschien bereits 2014 unter dem Titel »Eine Gurke macht noch keinen Frühling« bei Knaur
Copyright © der Originalausgabe 2014 Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Madlen, Alexander Raths, FelizDiseno, romini, Kim Willems
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-505-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tante Ella« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Eva Maaser
Tante Ella und das Geheimnis im Gurkenbeet
Ein Wohlfühlkrimi
dotbooks.
Kapitel 1
Zu Tante Ellas Erbe gehörte leider auch die Leiche, die ich eben erst in einem Gemüsebeet hinter dem Haus entdeckt hatte. Nun kämpfte ich mit der Vorstellung, dass der Gurkensalat, den wir mittags als Biokostbeilage zur Tiefkühlpizza gegessen hatten, sein herzhaftes Aroma einer problematischen Düngung zu verdanken hatte. Von dem Salat war noch etwas übrig, das hatten wir abends essen wollen. Schaudernd packte ich die Schüssel und leerte sie in den Abfalleimer unter der Spüle. Als ich mich aufrichtete, sah ich etwas vor dem Küchenfenster erscheinen, es schob sich von unten in mein Blickfeld, etwas Schwarzes und Krummes wie das Teleskop eines Unterseeboots.
Vor Schreck machte ich mir beinahe in die Hose.
Stand ich bereits unter Beobachtung? Mit einer Leiche im Garten hat niemand ein ganz astreines Gewissen. Im nächsten Moment wummerte das Teleskop gegen das Fenster, und mir ging auf, dass es sich um die Krücke eines Regenschirms handelte – eines schwarzen Herrenregenschirms. Bevor ich daran denken konnte, mich zu ducken, damit mich niemand hier sah, tauchte ein Gesicht neben der Krücke auf, und jemand sah mir direkt in die Augen.
Ich blinzelte aufsteigende Tränen weg.
Die Krücke schlug wieder zu, mein Puls begann zu jagen.
»Mom?« Die Stimme kam aus dem Wintergarten.
Am besten rannte ich hinaus, um meinen Besuch abzuwimmeln, falls das überhaupt möglich war. Der Schlag der Krücke gegen das Fenster hatte etwas durch und durch Hartnäckiges an sich.
Gleich darauf stand ich auf dem Vorplatz. Eigentlich brauchte ich Zeit zum Nachdenken und war nicht auf Konversation aus. Genauer gesagt, ich war über die Entdeckung im Gemüsebeet so außer mir, dass ich befürchtete, nicht in zusammenhängenden Sätzen sprechen zu können.
Die Tür hinter mir stand halb offen. Es war eine zweiflügelige Scheunentür, von der die rostbraune Farbe abblätterte. Dahinter erstreckte sich ein großer Raum, von dem rechts eine schmale Treppe ins Obergeschoss führte und links über zwei Stufen eine Tür in die Küche. Mit seinem Fußboden aus abgetretenen Sandsteinplatten bildete er eine Art rustikale Diele. Bestückt war sie mit einem großen Eichenschrank, zwei klobigen Armlehnstühlen, einer Runddeckeltruhe, einem seltsamen, spillerigen Eisengestell als Garderobe und einem winzigen Klo im äußersten Winkel hinter der Treppe. Eine große, breite Fenstertür zum Garten ließ von hinten viel Licht herein. Ich dachte über die Frau nach, die mir gegenüber Posten bezogen hatte, und vor allem darüber, was sie sah oder hoffentlich nicht sah. Es war früher Nachmittag, der Garten hinterm Haus lag nach Südwesten, aber da die Sonne nicht schien und nicht mit Blendreflexen zu rechnen war, musste durch die Tür und die gegenüberliegende Fenstertür ein Blick in den Garten möglich sein. In Gedanken versuchte ich das Gurkenbeet zu orten und wurde immer nervöser. Mir fiel der offene Anbau an dieser Seite des Hauses ein. Ein gut einsehbarer Unterstand für Mülltonnen und Gartengerümpel. Von dort, wo sich die Frau befand, konnte sie vermutlich auch durch den Anbau in den Garten schauen – und eventuell auf das Gurkenbeet.
Gebannt starrte ich ihr ins Gesicht. Aber sie schielte an mir vorbei, als suchte sie etwas.
Sie war um die sechzig, und ich hatte den Namen, den sie genannt hatte, drei Sekunden später bereits vergessen.
Ich hatte keine Erfahrung mit Situationen wie dieser hier. Es war meine erste Erbschaft.
Jetzt sah die Frau mich wieder an.
Ihr Blick durchdrang mich wie ein Angelhaken. Ahnte sie, dass in einem der Gemüsebeete eine Leiche provisorisch bestattet war? War das möglich? Aber wie sollte sie etwas ahnen können, was ich selbst gerade erst entdeckt hatte? Ich merkte, wie wirr meine Überlegungen wurden, konnte mich aber nicht dazu zwingen, klarer und nüchterner zu denken.
Das Atmen fiel mir schwer, doch das lag bestimmt auch am Wetter. Die Luft war so feucht, dass ich den Eindruck gewann, durch einen triefnassen Schwamm Sauerstoff in die Lungen zu saugen. Es kam mir so vor, als wäre ich mit jedem Luftholen näher am Ertrinken.
Dabei nieselte es nur hartnäckig.
Und das war schon eine gewaltige Wetterverbesserung. Denn vor knapp einer Stunde war der reinste Wasserfall durch den Garten gerauscht, hatte Erde weggespült und dabei etwas freigelegt, das meiner bescheidenen Meinung nach niemals hätte freigelegt werden sollen.
Außerdem war es schwülwarm. Meine Kopfhaut begann zu jucken, ich spürte, wie mir der Schweiß, verdünnt vom Regen, durchs Haar rann.
Die Frau vor mir war doch schon einige Jahre über sechzig, korrigierte ich meine erste Einschätzung. Sie hielt ihren großen, schwarzen Regenschirm inzwischen aufgespannt. In dessen Schatten konnte sich das faszinierende Farbenspiel ihrer Kittelschürze nur gedämpft entfalten. Um mich zu beruhigen, versuchte ich den Lilaton, der die Grundfarbe bildete, zu analysieren. Das Entscheidende war allerdings, dass er sich heftig mit sämtlichen Rottönen der aufgedruckten Blümchen biss. Sogar eine Farbschattierung wie von Bitterschokolade war darunter. Es tat fast weh, das zu sehen und nicht sofort darüber reden zu dürfen. Jetzt jedenfalls nicht.
Alles, was ich aus bestimmten Gründen wollte und ersehnte, war, dass die Frau verschwand. Damit war ich wieder bei meinem Ausgangsproblem angelangt.
Ich wusste ja erst seit einer Viertelstunde, dass mein Erbe mehr umfasste, als ich mir vorgestellt hatte.
Im Blick dieser Frau loderte ungezügelte Neugier. Es war anzunehmen, dass sie Tante Ella gekannt hatte. Bloß wie gut?
»Entschuldigen Sie, wie war Ihr Name?«, stotterte ich.
Über das Fundstück, das zweifelsfrei der Rest einer menschlichen Hand war, hatte ich den schwarzen Plastikeimer gestülpt, in dem ich vor dem Regenguss Gürkchen gesammelt hatte. Zu mehr war ich nach dem Fund nicht fähig gewesen. Die Sache musste erst einmal gründlich durchdacht werden, bevor ich mich zu weiteren Maßnahmen entschloss. Leider war mir der Salat inzwischen auf den Magen geschlagen, so dass ich überhaupt kaum noch denken konnte, und mit jeder Sekunde, die verstrich, meldete sich stärker und stärker Brechreiz.
Nach der Flutwelle hatte ich im Garten etwas Ordnung schaffen wollen. Beim Gurkenpflücken hatte ich versehentlich ein paar Pflanzen herausgerissen, was mir in dem Augenblick nicht besonders schlimm erschien. Die Blattranken wirkten schon ein wenig welk, aber da der Gurkensalat so phantastisch schmeckte, wollte ich nach dem Essen den Schaden beheben und die Pflanzen wieder ordentlich eingraben. Aber von der Idee kam ich erst einmal ab, denn der Regen hatte mitten im Beet ein Loch ausgespült. Und aus dem Loch ragte ...
»Sie müssen die Nichte sein«, sagte meine Besucherin und setzte missbilligend hinzu: »Warum sind Sie nicht zur Beerdigung gekommen? Wir hatten fest mit Ihnen gerechnet. Die ganze Nachbarschaft war da – nur Sie nicht.«
Mir lief das Wasser aus den Haaren, ich stand da wie der sprichwörtliche begossene Pudel und wusste nicht, was ich entgegnen sollte. Ich hätte darauf hinweisen können, dass ich nur die Großnichte war.
Was die Frau gedacht, aber nicht gesagt hatte, war: Sie haben alles geerbt und es nicht einmal für nötig befunden, Ihrer Tante die letzte Ehre zu erweisen?
Bestimmt wusste sie, dass ich die Erbin war, so etwas sprach sich in einer Zweitausend-Seelen-Gemeinde schnell herum. Die Missbilligung in ihrer Miene war trotz des Schirmschattens unverkennbar, und ich konnte es ihr nicht einmal verdenken. Bestimmt sah sie in mir die Vertreterin einer Generation, die nicht mehr nach traditionellen Werten erzogen worden war. Aber da irrte sie sich gründlich. Wenn auch, fiel mir nun ein, es meine Mutter Helen mit den besagten Werten selbst nicht so genau genommen hatte, denn sie hätte zur Beerdigung fahren können. Es hat mich gewundert, dass sie sich nicht einmal eine Ausrede einfallen ließ.
Ich wusste erst seit zwei Wochen, dass mir Tante Ella ihr Haus vermacht hatte, genauer gesagt ihren gesamten Besitz – was immer das heißen sollte.
»Nun? Wieso sind Sie erst jetzt hier aufgetaucht?«, brachte sich meine Besucherin wieder in Erinnerung.
Ich musste ihr vorkommen wie eine Schlafwandlerin.
Die Beerdigung Tante Ellas hatte vor vier Wochen stattgefunden, da lag Meggie mit fast vierzig Grad Fieber im Bett und hatte gerade von Sommergrippe auf Bronchitis umgestellt, an die sich noch eine Mittelohrentzündung anhängte. Ich wusste nicht, ob der Hinweis auf die Erkrankung meiner Tochter dem Drachen vor mir als Entschuldigung genügen würde.
Möglicherweise hatte die Frau zu den intimen Freundinnen meiner Tante gehört. Sie spähte an mir vorbei zur Tür. Offensichtlich erwartete sie, dass ich sie hineinbat. Das wäre nur höflich gewesen.
Wir waren erst abends eingetroffen und hatten noch nicht einmal die Koffer ausgepackt. Mein ganzes Arbeitsmaterial war über Nacht im Wagen geblieben, mein Laptop, die Fotoausrüstung, die Box mit den Spezialgrafikkarten, für die ich noch Raten abstotterte, und noch ein paar Schätzchen, die zu meiner Existenzgrundlage gehörten. In Berlin hätte ich mir eine solche Sorglosigkeit nicht erlaubt, aber wer dachte in einem Kaff wie Nienborg an Autoknacker und Diebe?
Autoknacker waren hier vielleicht die harmloseren Verbrecher.
Ich dachte an die Warnung eines Freundes. Sobald ich erwähnt hatte, wo das geerbte Haus stand, hatte er sich über die unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte ausgelassen und dann erklärt, dass die Bewohner dieser Gegend von den Genen her noch auf der Stufe von Höhlenbewohnern standen.
»Mächtige Instinkte, nicht sehr redegewandt?«, hatte ich nachgefragt.
»Die grunzen nur«, hatte er geantwortet.
Fünf Wochen – so lange war Tante Ella jetzt tot – hatten ausgereicht, in ihrem Haus eine Gruftatmosphäre zu schaffen, die selbst bei notorischen Frohnaturen Anfälle von Schwermut auslösen musste. Uns war abgestandene Luft entgegengeschlagen, überall lag dicker Staub auf den Möbeln, und ein Geruch durchzog das Haus, den ich nicht einzuordnen wusste. Am ehesten assoziierte man ihn mit Verwesung. Trotz der Mücken, die von draußen zu uns in das hell erleuchtete Haus taumelten, hatte ich alle Fenster aufgerissen. Der Gestank hielt sich dennoch.
Die erste Aufhellung der Atmosphäre war mittags mit dem intensiven Geruch nach frischen Gurken ins Haus eingezogen, aber nun konnte ich dem nichts Positives mehr abgewinnen.
Ich schüttelte mich, streckte eine Hand aus und suchte Halt an der Hausecke hinter mir.
So alt war meine Großtante gar nicht gewesen – erst fünfundsiebzig –, und sie war sehr plötzlich gestorben. Warum sie ausgerechnet mir ihr Haus vermacht hatte, begriff ich immer noch nicht. Sie war alleinstehend gewesen, und irgendwer musste natürlich erben. Aber wir hatten uns nie nahegestanden. Die Erste in der Erbfolge wäre logischerweise ihre Nichte, meine Mutter, gewesen.
Von einem Streit zwischen der alten Ella und meiner Mutter war mir nichts bekannt.
Irgendetwas schoss am Rand meines Blickfelds um unser Auto und die entferntere Ecke des Hauses herum. Das machte mich zusätzlich nervös. Hier war alles so anders als in Berlin. Schon die erste Nacht hatte mich verstört, weil mir das Verkehrsbrummen von der Schönhauser Allee gefehlt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich bereit gewesen, den Verkehr zu verfluchen – ich hatte ja nicht wissen können, wie abgründig Stille sein konnte. Jetzt bekam sie noch nachträglich eine unheilvolle Bedeutung.
Tante Ella hätte kein Testament hinterlassen müssen, aber sie hatte es getan. Und es bei einem Notar hinterlegt, um ganz sicherzugehen, dass das Haus und alles, was dazugehörte, mir zufiel.
Gestern hatte ich das Erbe noch als Glücksfall betrachtet, jetzt fragte ich mich im Hinblick auf die Leiche: Hatte ich Ella irgendwann so verärgert, dass sie sich posthum an mir rächen wollte?
Es war ein hübsches Haus, falls man Fachwerk, Sprossenfenster und unregelmäßige Grundrisse mochte. Das Gebäude war mehrfach umgebaut und immer mal wieder erweitert worden und wirkte schon von außen ein wenig chaotisch. Die letzte Zutat bestand in einem gigantischen, modernen Wintergarten auf der Rückseite. Es sah so aus, als wäre das Haus an den Wintergarten angebaut worden und nicht umgekehrt. Woher hatte Tante Ella das Geld dafür gehabt? Irgendwie hatte sich bei mir die Meinung festgesetzt, dass sie eine ganz arme Maus gewesen war, die von einer schmalen Rente lebte. Nennenswerte Ersparnisse, hatte mir der Notar am Telefon gleichmütig erklärt, wären jedenfalls nicht vorhanden. Nach Absprache mit der Bank hatte er mir die Kontoauszüge geschickt, die das bestätigten, und ich wusste, dass mein Vater die Beerdigung bezahlt hatte.
Der Blick meiner Besucherin irrte wieder zur Seite, und erst da merkte ich, dass sich Meggie zu uns gesellt hatte. Sie musste durch den Durchgang gekommen sein.
Meggie starrte unsere Besucherin unverhohlen an. Ohne einen Wimpernschlag saugte ihr Verstand jedes Detail der Fremden in sich auf. Ich würde sie später bitten, mir das Muster der Kittelschürze aufzuzeichnen. Kittelschürzen waren in diesem Sommer in Berlin der letzte Schrei, und diese Frau trug eine mit der größten Selbstverständlichkeit. Eine Freundin von mir hatte auf einer Mitternachtsparty Furore mit einer gemacht, die nicht halb so phänomenal wie diese hier gewesen war.
Im Gesicht der Frau zuckte es.
»Meine Tochter«, sagte ich lahm. Normalerweise geht Meggie Fremden aus dem Weg; dass sie sich freiwillig zu uns gesellte, musste einen triftigen Grund haben. Hoffentlich hatte sie nicht unter den Eimer im Gurkenbeet geschaut.
»Guten Tag«, sagte unsere Besucherin reserviert.
»Meggie«, sagte ich mit flacher Stimme.
Meg trat vor, ergriff zackig die Hand der Frau, schüttelte sie, ließ sie los und schnarrte im Stakkato auf einer einzigen Tonhöhe: »Meggie Nollander, sehr erfreut, Sie kennenzulernen.« Hochzufrieden mit sich trat sie einen Schritt zurück.
Der Frau fielen fast die Augen aus dem Kopf.
Wir beide, Meg und ich, sehen uns nur bedingt ähnlich. Meine Haare sind so rot, dass mein Kopf in Sachen Auffälligkeit in Konkurrenz mit einem Feuermelder immer vorn liegt. Dazu kommt noch, dass meine Haare überaus lockig sind und ganz gleich, was ich dagegen unternehme, als wilde Mähne mein Haupt umwallen. Meggies Haarpracht hingegen würde auf jeder Shampoo-Werbung als fototechnisch aufgehübscht angesehen werden, dabei ist alles an ihr echt. Die Haare fallen in großen, schmeichelhaften Wellen auf ihre Schultern, und ihr intensives Rotbraun leuchtet, wie es keine Kur bewerkstelligen könnte.
Meg ist für ihr Alter von elf Jahren groß und dazu athletisch gebaut, ich bin eher klein und ein bisschen mollig. In vier oder fünf Jahren, wenn sie ihre endgültige Größe erreicht haben wird, werde ich wahrscheinlich wie eine Zwergin neben ihr wirken.
Manche halten sie, wenn sie überhaupt eine Verwandtschaft in Betracht ziehen, für meine jüngere Schwester. Das liegt natürlich daran, dass Frauen heutzutage meist erst in meinem Alter – also mit dreiunddreißig – damit beginnen, sich Nachwuchs zuzulegen. Und ich sehe deutlich jünger aus, als ich bin.
»Das ist eine Nachbarin, Meg, sie kommt Hallo sagen«, erläuterte ich dumpf. »Frau ...?« Ich hob die Stimme, um anzudeuten, dass mir immer noch der Name fehlte.
»Da sind sechsunddreißig Schafe auf der Wiese hinterm Haus«, sagte Meggie.
»Siebenunddreißig«, widersprach unsere Besucherin, »es müssen siebenunddreißig sein.«
»Sechsunddreißig«, wiederholte Meggie stur.
»Wenn Meg sagt, es sind sechsunddreißig, sind es sechsunddreißig«, warf ich rasch ein und ahnte bereits den ersten nachbarschaftlichen Konflikt voraus.
»Es sind siebenunddreißig, das muss ich ja wissen, sie gehören meinem Neffen«, entgegnete die Frau ohne Namen und stemmte als Kampfansage eine Faust in die Hüfte.
Ich hatte vorhin vom Garten aus nur einen flüchtigen Blick auf die angrenzende Wiese geworfen. Das hieß, so flüchtig war der Blick auch wieder nicht gewesen. Genau genommen hatte ich mich vergewissert, dass ich mit meiner Entdeckung allein war. Der Garten hinter dem Haus endete an einem Bächlein, über das ein Holzsteg führte. Rechts grenzte der Garten an die alte Burgmauer, links fasste ihn ein Zaun ein, der sich um das Grundstück bis zur Mauer herumzog. An der Burgmauer standen mächtige alte Bäume, zwischen die eine Hängematte gespannt war. Buchsbaum säumte die Beete, das alles sah altmodisch und gediegen aus und ein bisschen verwahrlost. Unter den Bäumen lagen abgebrochene Äste herum, der Buchsbaum hätte einen Fassonschnitt vertragen können, und auf den Wegen zwischen den Beeten wuchs Gras.
Das ganze Anwesen hatte die Form einer Bocksbeutelflasche, wobei der Hals der Flasche recht lang gezogen war und die Einfahrt bildete; eine leicht geschwungene Einfahrt, die direkt an der Burgmauer entlangführte und sich zu einem unregelmäßigen Platz vor dem Haus erweiterte, der von schmutzigem Kies bedeckt war.
Ich musterte meine Tochter. Sie sah immer noch erbarmungswürdig blass aus, und unter den Augen lagen dunkle Schatten. Der Arzt hatte Luftveränderung verordnet und an die Schweizer Berge gedacht. Aber da war uns Tante Ellas Ableben dazwischengekommen, und ich hatte gedacht, hier am Rand der zivilisierten Welt musste die Luft doch auch frisch und gesund sein.
Die Wiese hinter dem Haus sah sehr saftig und grün aus, überhaupt sah die ganze Gegend saftig und grün aus, es gab nicht nur den Bach hinterm Haus, sondern auch einen Fluss, die Dinkel, und einen Bach, der Donau hieß, und einen namens ...
Vielleicht wäre die Frage nach der Anzahl der Schafe unrettbar in einen Streit ausgeartet, da traf uns ein Laut, den ich zunächst nicht einordnen konnte.
Sicher war nur, dass er mich von hinten erreichte.
Ich drehte mich um, da hörte ich ihn schon wieder. Kein Zweifel, das siebenunddreißigste Schaf musste sich in unseren Garten verirrt haben. Das hatte Meggie uns wahrscheinlich sagen wollen. Nun erkannte ich immerhin, dass die Sicht in den Garten begrenzt war, was daran lag, dass das Gelände abschüssig war. Daher hatte der Regen auch so viel Erde wegspülen können. Man sah von hier aus eher über den Garten hinweg. Immerhin fiel mein Blick durch das Dielenfenster hinten auf etwas Weißes, Wuscheliges, das ich als die obere Hälfte eines Schafkopfes erkannte.
Ein Schaf im Garten kam mir im Augenblick ungelegen. Ohne auf unsere Besucherin zu achten, hastete ich in den offenen Anbau und rannte auf der anderen Seite hinaus.
Es hatte aufgehört zu nieseln, zaghaft lugte ein Sonnenstrahl durch die Wolken.
Das Schaf stand heiser blökend mitten in einem der Beete, nicht weit von einem schwarzen Plastikeimer, der als Fremdkörper aus dem Gurkenlaub ragte. Kaum war ich aufgetaucht, setzte es sich in Bewegung, direkt auf mich zu. Nur stand der Eimer im Weg. Im Geist sah ich bereits, wie das Schaf ihn umwarf.
»Husch!«, schrie ich und wedelte mit den Armen.
Das Schaf schrak zusammen und machte einen Satz näher auf den Eimer zu. In meinem Kopf wirbelten die Möglichkeiten durcheinander. War der makabre Fund überhaupt zwischen den Gurken erkennbar? Würde das Schaf etwa drauftrampeln, wenn es erst einmal den Eimer aus dem Weg geräumt hatte? War die Entdeckung, dass wir, Meggie und ich, einen Garten mit Leiche geerbt hatten, nun unausweichlich?
Jemand stürmte an mir vorbei. Es war meine neue Bekanntschaft. Den Schirm musste sie im Anbau gelassen haben. Im Laufen riss sie die Kittelschürze auf und nutzte die Seitenteile als eine Art Flügel. So flatterte sie auf das Schaf zu, das seitwärts auswich und über die nächste Buchsbaumhecke sprang. Der Eimer fiel um, aber das bemerkte die Frau nicht, denn sie war voll auf die Jagd konzentriert. Das Schaf trat den Rückweg an und strebte nun auf das offene Törchen zu, das auf den Steg und die Wiese hinausführte. Vielleicht hätte ich von der anderen Seite kommend den Rückzug unterstützen sollen, aber ich hatte nur Aufmerksamkeit für den Eimer. Ich grapschte danach und stellte ihn wieder an die richtige Stelle. Unterdessen nahm das Schaf einen neuen Anlauf, den Garten zu erobern. Vielleicht war das Grün hier saftiger als auf der Wiese. Immerhin wuchs in einem der Beete eine Art Blattsalat. Aber am Salat zeigte es kein Interesse, an meinem Eimer schon, denn es galoppierte wieder auf mich und den Eimer zu.
Ich hab’s nicht so mit Tieren, ich hatte nie das Bedürfnis nach einer Katze oder einem Hund als Gefährten, und Reiten hatte ich auch nicht lernen wollen.
Tiere haben doch Instinkte. Warum erkannte das Schaf nicht, dass ich nichts mit ihm zu tun haben wollte? Dass ich sogar Angst vor ihm hatte.
Waren die Schafe hier noch dümmer als anderswo?
Unsere Besucherin näherte sich flügelschlagend von der Seite, ich sank auf den Eimer und griff mir ans wild klopfende Herz. Meinen Posten würde ich nicht mehr verlassen, selbst wenn das Schaf über mich hinwegtrampeln würde. Ich schloss vor lauter Qual die Augen. Um mich herum tobte die Jagd und verzog sich den Geräuschen nach schließlich in Richtung Törchen.
Ich hörte, wie das Törchen eingeklinkt wurde, erst dann öffnete ich wieder die Augen.
Die Gefahr war gebannt. Zumindest, was das Schaf betraf.
Meine Besucherin strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und nestelte mit der anderen Hand am obersten Knopf ihres Kittels. Sie schien mir nun ein bisschen verlegen. Ich erinnerte mich, flüchtig eine große weiße Unterhose und einen großen, stramm sitzenden Büstenhalter erblickt zu haben, und begann, über die merkwürdigen Sitten auf dem Land nachzudenken. Wie gesagt, ich stamme aus einem konservativen Elternhaus. Aufgewachsen bin ich in Düsseldorf, ging aber zum Studienabschluss nach Berlin. Dort lernte ich, mich vom unkonventionellen Benehmen anderer nicht irritieren zu lassen. Aber selbst meine exzentrischsten Freundinnen und Freunde würden sich nicht so freizügig benehmen, außer sie waren stockbetrunken. Lag das Verhalten meiner Besucherin vielleicht an der Witterung? In Berlin war es nie so schwül, heiß ja, aber nicht schwül. Führte das Wetter hier noch zu anderen Auswüchsen? Nur zu genau war ich mir dessen bewusst, was sich unter mir befand.
Meine Besucherin hatte sich nun den Kittel fertig zugeknöpft, bückte sich und fieselte eine Gurke aus dem Grün. Sie hielt sie hoch.
»Die sehen gut aus«, erklärte sie.
Ich schauderte.
Die Gurke kam mir vor wie ein emporgereckter grüner Leichenfinger.
Hinten auf der Wiese gesellte sich der Ausreißer wieder zu seinen Artgenossen. Wieso hatte das Schaf überhaupt in den Garten gelangen können? Ich war mir ziemlich sicher, dass das Törchen korrekt geschlossen gewesen war, als ich die Gurken pflückte.
»Falls Sie welche haben möchten, bitte, bedienen Sie sich«, bot ich mit matter Stimme an und sehnte mich nach einem Schnaps oder Cognac, der meine Nerven beruhigte. »Jetzt haben Sie bei mir was gut. Schließlich haben Sie mich von dem Schaf befreit. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft.«
»Das war doch nicht der Rede wert.«
Sie beäugte mich abschätzend.
»Ich kenne mich halt aus mit Schafen«, fuhr sie fort, da ich nichts mehr sagte. Die Verlegenheit der Frau wurde noch ausgeprägter. Sie strich mit einer Hand über die Knopfleiste ihrer Kittelschürze. »Wissen Sie, Sie müssen ja sonst was von mir gedacht haben, als ich gerade ...« Sie druckste herum.
Also war es hier nicht üblich, halb entkleidet Schafe durch einen fremden Garten zu jagen? Vielleicht hatte sie sich den Kittel aufgerissen, weil sie dringend Abkühlung brauchte? Das konnte ich nachvollziehen, mir perlte ja selbst der Schweiß von der Stirn.
Ihre Stirn sah trocken aus.
Ich lächelte ihr gütig zu. Wenn sie doch bloß verschwände und mich endlich mit meinem Problem allein ließe. Immer dringender meldete sich der Wunsch, mich mit der Sache nüchtern auseinanderzusetzen. Kaffee wäre mir nun auch recht, selbst ohne einen Schuss Cognac, doch ich befürchtete, nicht mal ohne Schwindelanfall vom Eimer hochzukommen. Ich fühlte mich müde, geradezu hundemüde, und gereizt. Mir war elend zumute, und ich tat mir überaus leid.
»Aber wenn Sie nichts dagegen haben, pflücke ich mir gern ein paar Gurken, es sind ja auch viel zu viele für Sie und Ihre Tochter, wo Sie doch aus der Stadt kommen, oder legen Sie ein? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen«, fuhr meine Besucherin skeptisch fort und sagte dann etwas Schreckliches:
»Am besten geben Sie mir den Eimer.«
Starr vor Schreck glotzte ich sie an.
»Bitte?«
»Der Eimer, Sie sitzen drauf.«
»Ja.« Ich rührte mich nicht.
Trotz der Hitze fühlte ich mich wie in Eis getaucht. Ich begann zu zittern.
»Soll ich Ihnen aufhelfen?«
Ich kam mir vor, als ob ich in Treibsand stecken würde.
Die Frau streckte die Hand nach mir aus. Eine solide, abgearbeitete Hand mit Altersflecken, Runzeln und breiten, schlecht gepflegten Fingernägeln, so urtümlich und vertrauenerweckend wie das ganze öde Land hier. Aber ich ließ mich nicht darauf ein, nach ihr zu greifen, da sie sich vor meinen Augen in die Klaue eines Untiers verwandelte. Sobald ich nach ihr griff, käme ich zwar aus dem Treibsand heraus, würde aber sofort gefressen.
Meine Mutter meinte immer, ich hätte zu viel Phantasie und sie wüsste nicht, von wem.
Ich schüttelte den Kopf.
»Mein Gott, Sie zittern ja!«, sagte sie. »Hat Sie das Schaf so erschreckt? Sie leben in einer Großstadt, in der Messerstechereien unter Ausländern zum Alltag gehören, erschrecken aber vor einem harmlosen Schaf?«
Ich sah ihr in die Augen und wusste genau, was in ihr vorging. In Gedanken spulten wir beide in Windeseile, aber hemmungslos sämtliche Vorurteile über das Großstadt- beziehungsweise Landleben ab, ganz gleich, wie abgestanden sie mittlerweile waren.
Ich riss mich zusammen. »Ich wohne in einem friedlichen Viertel, das Schlimmste, was bei uns passiert, ist Autoklau.« Das aber fast täglich, hätte ich hinzufügen können.
Woher wusste sie, wo ich lebte?
»Wissen Sie was?«, fuhr ich beherzter fort. »Ich bringe Ihnen später die Gurken vorbei, Sie müssen sie nicht selbst pflücken. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie viel Sie davon haben wollen.« Je länger ich sprach, desto mehr erwärmte ich mich für die Idee. So würde ich mit Anstand die Frau und die Gurken los. Der Salat hatte Meggie ebenso gut wie mir geschmeckt, und bestimmt wollte sie, dass ich morgen wieder welchen zubereitete. Aber das hätte ich nicht über mich gebracht. Nie wieder Gurkensalat!
»Ach was, ich nehme sie jetzt mit, dann kann ich sie gleich einmachen.«
»Einmachen?«, echote ich verblüfft.
»Ja, wissen Sie das denn nicht? Das sind Einlegegurken. Ehrlich gesagt, bin ich erstaunt, dass Ihre Tante die hier angebaut hat. Was wollte sie mit so vielen Gurken? Sonst hat sich immer einer meiner Neffen um den Garten gekümmert, aber dieses Jahr nicht. Wissen Sie, er hat einen kleinen Gartenbaubetrieb. Ihre Tante hat immer nur Blumen haben wollen. Aber dieses Jahr ... Das sind wirklich viele Gurken, möchte wissen, was sie als Dünger genommen hat.«
Ich hätte sie aufklären können.
Und mir ging auf, warum ich gerade an Treibsand gedacht hatte. Langsam, aber sicher sanken meine Füße immer tiefer in die weiche Erde ein, und auch der Eimer, auf dem ich saß. Mein Hintern näherte sich dem, was unter dem Eimer steckte, und ich stellte mir vor, wie unter mir mit einem lauten Knacken die Knöchelchen brachen. Ich schoss hoch, und dabei bewegte sich auch der Eimer. Er stand nun schräg, und der Rand ragte teilweise über das Gurkengrün. Während ich noch mit meinem Gleichgewicht rang, drehte sich alles vor meinen Augen. Dennoch entging mir nicht, dass meine Besucherin sich nach dem Eimer bückte.
»Nein«, röchelte ich mit versagender Stimme, »lassen Sie den bloß stecken. Er ist viel zu schmutzig.«
Ich torkelte um den Eimer herum. Auf der Seite, die aus dem Matsch ragte, tat sich ein dunkles Loch unter dem Rand auf. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und aus den Augenbrauen, um zu sehen, ob da etwas Weißes hervorleuchtete. Ich konnte nichts erkennen, die Sonne blendete mich.
»Das geht schon.« Wieder streckte die Frau die Hand nach dem Eimer aus.
Ich stöhnte auf.
Sie stockte, und noch einmal traf mich ihr forschender Blick.
»Steckt was unter dem Eimer?«
Eine Hand auf den Magen gedrückt, stieß ich einen unartikulierten Schrei aus.
Es kam ja sowieso immer alles heraus, was herauskommen musste, dämmerte mir.
»Ja«, flüsterte ich am Rand des nervlichen Zusammenbruchs, »ich hab’s gerade erst entdeckt. Es ist grauenvoll, aber ... Meine Tochter soll das nicht sehen, verstehen Sie? Es geht ihr nicht gut. Sie darf von diesem Fund nichts wissen, und sie darf sich auf keinen Fall aufregen.«
Ich merkte, wie es mir widerstrebte, das Wort »Toter« oder »Leiche« auszusprechen.
Wo war Meg überhaupt? Ich blickte mich um und entdeckte sie einige Meter weiter. Sie lehnte an der Holzveranda, die sich vor der halben Rückseite des Hauses bis zum Wintergarten hinzog, und sah interessiert zu uns herüber. An der Schafsjagd hatte sie sich nicht beteiligt, sie sich aber auch nicht entgehen lassen.
Ihre Beobachtungen würde sie mir später mitteilen, falls ich lange genug nachbohrte.
»Sie ist sehr blass, das ist mir aufgefallen«, sagte meine Besucherin mitfühlend, rückte dem Eimer wieder näher und wischte sich die rechte Hand am Kittel ab, als könnte sie sie kaum ruhig halten. »Was hat sie denn?«
»Erst hatte sie eine Sommergrippe, dann eine Mittelohrentzündung. Deshalb konnten wir aus Berlin nicht weg. Sie muss sich unbedingt erholen, sagt der Arzt. Er meint, sie hat einen Schatten auf der Lunge und braucht viel frische Luft und Ruhe, um wieder ganz in Ordnung zu kommen.«
Der Blick meiner Besucherin schweifte nun auch zu Meggie, die unbehaglich die Schultern hochzog. Meine Tochter hasst Aufmerksamkeit.
»Das kann sie hier bei uns, da seien Sie man ganz beruhigt«, meinte die Frau zuversichtlich und nahm nachdenklich den Eimer ins Visier. »Und was das betrifft«, sie nickte dem Eimer zu, »das kenne ich. Damit haben wir alle unsere Last. Das liegt an der Gegend.«
Wurde hier mehr gestorben als anderswo? Und immer ziemlich plötzlich?
Im Geist sah ich meine neuen Nachbarn, wie sie Leichen in ihren Gärten verbuddelten.
Oder wovon, zum Teufel, sprach die Frau?
Vielleicht hatte sie meine tiefe Verwirrung nun endlich wahrgenommen.
»Bitte«, sagte sie leise und bedächtig, »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, so schlimm ist es wirklich nicht. Es liegt an all den Bächen. Erst gestern hab ich bei mir eine junge Ratte gefunden, sie ist im Regenwasserfass ertrunken. Ich sehe ja, was hier los ist, da ist ein richtiges Loch in Ihrem Beet, wahrscheinlich ist das Wasser in einen Rattengang eingedrungen, und das Tier hat nicht mehr rausgekonnt und ist ... Was haben Sie denn?«
Sie griff nach meinem Arm, und ich merkte, wie ich schwankte. »Carlo?«, hörte ich Megs alarmierte Stimme. Aufschauend sah ich, wie sie sich in Bewegung setzte. Ich straffte mich, lächelte ihr zu und schüttelte den Kopf.
»Bleib da. Es ist nichts, die Sonne sticht bloß so, dass mir schwindlig geworden ist«, rief ich ihr zu.
Es stimmte, die Sonne brannte nun herunter, und wie die meisten Rothaarigen war ich es gewohnt, mich möglichst im Schatten aufzuhalten. Unter der Sonne wird meine Haut nicht braun, sondern so rot wie rohes Fleisch im Metzgerladen.
Mir klebte das T-Shirt am Leib, ich fühlte mich klebrig und schmutzig, aber mich durchrieselte eine sachte Erleichterung. Meine Besucherin hatte an Ratten gedacht und nicht an ... das, was wirklich in dem Loch steckte.
»Ja, Sie haben recht. Der Regen hat eine Kuhle ins Beet gewaschen, und die Ratte ist darin ertrunken«, flüsterte ich wie eine Beschwörungsformel, »aber damit werde ich schon fertig ... Mit der Ratte werde ich fertig, mit der Entsorgung, meine ich.«
Selbst in meinen Ohren klang das nicht sonderlich überzeugend. Und es war ja nicht einmal eine Ratte, was ich zu entsorgen hatte, sondern etwas viel, viel Schlimmeres!
Allerdings nicht unbedingt von der Optik her.
Der Griff um meinen Arm wurde schmerzhaft grob. »Aber nicht doch! Sie und Ihre Tochter gehen ins Haus, und ich bring die Ratte weg und nehme mir gleich noch Gurken mit.« Einen Moment hatte das Angebot etwas schwindelerregend Verführerisches. Wie wünschte ich mir in diesem Augenblick eine Ratte unter den Eimer, ich stellte mir in seltsamer Intensität eine tote Ratte unter dem Eimer vor, und mir wurde auch nicht schlechter dabei, als mir ohnehin bereits war.
Meggie und ich würden ins Haus gehen, und die Frau kümmerte sich um die Lösung unseres Problems. Wäre es doch nur so einfach!
»Das werden Sie nicht tun«, entgegnete ich bestimmt. »Glauben Sie ja nicht, ich bin eine verhätschelte neurotische Stadtpflanze. Ich komme hier mit allem zurecht. Sie glauben gar nicht, was einem in Berlin so über den Weg läuft. Wir haben Wildschweine, die an der Ampel bei Grün über die Straße gehen. Und was ich die ganze Zeit schon fragen wollte: Haben Sie ein besonderes Anliegen, oder warum haben Sie ans Fenster geklopft?« Das hätte ich längst fragen sollen. »Wissen Sie, normalerweise würde ich Sie auf eine Tasse Kaffee hineinbitten, aber wir müssen erst einmal aufräumen und einiges in Ordnung bringen, wie den Boiler oder was immer es hier gibt, um heißes Wasser zum Duschen zu bekommen. Also, was hat Sie hergeführt?«
»Sie klingen wie Ihre Tante«, sagte die Frau schwach. Mit so viel Widerstand hatte sie offensichtlich nicht gerechnet. Endlich ließ sie mich los und wandte den Kopf suchend hin und her.
»Haben Sie Napoleon gesehen? Meinen Kater? Er ist groß und schwarz.«
Ich schüttelte mich unmerklich. »Ganz bestimmt nicht«, sagte ich entschieden. »Und nun begleite ich Sie hinaus. Kommen Sie! Jetzt Gurken zu pflücken halte ich für keine gute Idee. Sehen Sie sich doch einmal Ihre Schuhe an, Sie haben den halben Garten dran kleben – wie ich auch.«
Es stimmte. Ich trug Sneakers, die einmal blau gewesen waren und inzwischen fast vollständig im Matsch steckten. Es gab einen schmatzenden Laut, als ich sie Schritt für Schritt herauszog. Daran hätte ich vorher denken müssen. Das war das zweite Paar Schuhe, das ich in diesem Beet ruinierte. Beim ersten handelte es sich allerdings nur um Flipflops. Sie standen schlammüberkrustet an der Tür zur Toilette, wohin ich sie warf, nachdem ich den Eimer über das Loch gestülpt hatte. Ich musste schließlich der Frau aus dem Beet helfen, weil sie wegen ihres höheren Gewichts noch tiefer eingesunken war als ich. Breitbeinig watschelten wir über den Weg zurück in Richtung Haus. Meg kam uns an der Veranda entlang nach und traf mit uns am Durchgang zusammen.
»Sagen Sie, kommt Ihr Mann auch her?«, fragte unsere Besucherin und blieb stehen.
»Carlo ist nicht verheiratet«, sagte Meggie feindselig.
Die Frau sah erst Meg, dann mich mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Carlo?«, fragte sie nach einer kleinen Pause.
Und ich hatte wirklich gedacht, sie nähme an dem fehlenden Ehemann Anstoß.
»Meine Tochter nennt mich manchmal so. Ich heiße Carlotta«, sagte ich matt. »Und ehe ich’s wieder vergesse, ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Und falls Sie wirklich Gurken haben möchten, sollte ich auch Ihre Adresse kennen.« Ich würde ihr die Gurken bringen müssen, schon um zu verhindern, dass sie wieder unangemeldet aufkreuzte oder, schlimmer noch, ungefragt in den Garten eindrang und sich selbst bediente. Das traute ich ihr durchaus zu. Sie brauchte nur durch den offenen Anbau oder an der anderen Seite ums Haus herumgehen, und schon gelangte sie zu den Beeten. Ich hätte ein Tor vorn an der Zufahrt gebrauchen können.
Es dauerte noch mindestens eine geschlagene Viertelstunde, bis ich sie auf den Vorplatz zurückgelotst hatte. Dabei zerriss mich die Sorge, dass Meg in der Zwischenzeit unter den Eimer guckte.
Als ich mich gerade von der Frau verabschieden wollte, hörten wir von der Straße her ein Gerumpel, das man überall erkennt.
»Das wird jetzt wohl zu spät sein«, sagte meine lästige Besucherin bedauernd. »Ihre Biotonne steht ja noch am Haus, die hätten Sie längst an die Straße stellen müssen.«
Wir drehten uns um und sahen, wie der Wagen der Müllabfuhr an meiner Einfahrt vorbeiruckelte.
Mir ging Verschiedenes durch den Kopf. Hätte ich die Müllabfuhrtermine gekannt, hätte ich das Ding unter dem Eimer unauffällig entsorgen können. Allerdings wusste ich nicht, was alles an der Hand hing – eigentlich war ja anzunehmen, dass recht viel daran hing, so einfach wäre es nun doch nicht gewesen, mich von dem unerwünschten Fund zu befreien.
Die Gedanken meiner Besucherin bewegten sich anscheinend parallel zu meinen. »Das ist schade, nicht?«, murmelte sie. »Sie hätten die Ratte leicht loswerden können. Warum hab ich nur nicht rechtzeitig daran gedacht?«
Ich war nicht undankbar dafür. Wäre ihr der Gedanke rechtzeitig gekommen, hätte sie vermutlich nichts davon abgehalten, den Eimer aufzuheben.
Als ich endlich auf die Veranda hinaustrat, war Meg nirgends zu sehen. Diesmal war ich barfuß, meine ehemals blauen Sneakers standen neben den Flipflops.
Im Haus war Meg auch nicht, es war beängstigend still, meine Stimme hörte sich nicht gut an, als ich nach meiner Tochter rief. Darin klang Panik auf. Und da überkam mich das ganze Entsetzen noch einmal, ich rannte die Treppe hoch ins Badezimmer, klappte den Toilettendeckel auf, und endlich, endlich wurde ich den Gurkensalat los. Danach fühlte ich mich zwar schwach auf den Beinen, aber unendlich erleichtert. Zumindest so lange, bis mich die Phantasien darüber, was Meg wohl gerade anstellte, wieder einholten.
Ich rannte die Treppe hinunter und nach draußen in den Garten. Der Teil mit den Beeten war gut zu überblicken, aber daran grenzte auf der anderen Seite des Wintergartens eine Reihe dicht stehender Sträucher, und hinter ihnen hatte ich noch nicht nachgesehen. Ein kleiner, von einem Rosenbogen umkränzter Durchgang führte zu den alten Bäumen an der Burgmauer. Ich hinkte darauf zu. Barfußlaufen war ich nicht gewöhnt. Aber ich war bereit, für Meggies Wohlergehen über glühende Kohlen zu gehen.
Sie lag in der Hängematte, die vom Regen noch nass sein musste, einen riesigen schwarzen Kater auf dem Bauch, die Augen geschlossen.
Ich näherte mich so weit, wie es meine Abneigung gegen die Katze zuließ.
Ich hatte als Kind ein Märchenbuch mit vielen Bildern besessen. Eins zeigte die Hexe aus Hänsel und Gretel. Sie blickte außerordentlich verschlagen drein, und auf einer Schulter saß ein gewaltiger schwarzer Kater. Seitdem waren Kater, vor allem schwarze Kater, für mich untrennbar mit Hexen verbunden.
Meine Besucherin hieß Edith Epping, und das war also ihr Kater namens Napoleon. Wäre ich mutiger gewesen, hätte ich ihn am Genick gepackt und von meiner Tochter gezerrt.
Schlief sie? Sie sah wunderbar entspannt aus. Der übliche Hauch von Rührung überkam mich, der Mütter befällt, wenn das Kind schläft und erst mal nicht mehr zur Last fallen kann. Rein theoretisch wäre auch eine von der Krankenkasse bezahlte Kur möglich gewesen. Je länger der Arzt den Schatten auf der Lunge kleinredete, desto mehr wuchs dieser verdammte Schatten in meiner Vorstellung. Und damit hatte mich der Doktor dort, wo er mich haben wollte. Aber ich hätte Meg nur mit Gewalt in ein Schweizer Lungensanatorium verfrachten können. Nicht mal, wenn ich mitgekommen wäre – eine Mutter-Kind-Kur wäre auch noch drin gewesen, das hätte der Arzt schon hingekriegt –, hätte Meg sich eine Kur gefallen lassen. Das war einfach nicht ihr Ding, das sah ihr zu sehr nach Zwang aus. Nach den Sommerferien würde sie die Schule wechseln, ein Jahr später als ihre Altersgenossen. Sie wusste noch nicht, dass ich sie längst in einer neuen Schule in Berlin angemeldet hatte. Ihrer Ansicht nach kam nur ein bestimmtes Internat im schottischen Hochland für sie in Frage. Wieso sie sich das Leben dort angenehmer vorstellte als bei mir in Berlin, begriff ich nicht. Ich hatte ein paar Erkundigungen eingezogen. Der Sitz des Internats war ein einsam gelegener mittelalterlicher Steinkasten mit allen typischen Kennzeichen wie Türmen, Zinnen und einer fehlenden Zentralheizung – eine Art Hogworse oder wie das Harry-Potter-Schulmausoleum hieß. Meg hatte nicht die geringste Ahnung, wie unkomfortabel so eine Burg war, und dazu war das Internat auch noch sauteuer. Kein Gedanke, dass wir uns das leisten könnten. Nach Nienborg hatte ich sie mit dem Versprechen gelockt, mal zu sehen, ob uns Tante Ella genug hinterlassen hatte, um ihren Wunsch wenigstens ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
Leider hatte sie sich ohne mein Einverständnis mit dem schottischen Hogworse bereits in Verbindung gesetzt und das so geschickt gemacht, dass von dort die Aufforderung gekommen war, mal vorbeizuschauen und sich vorzustellen. Am besten, bevor in sechs Wochen das nächste Trimester begann. Mir war klar, dass die scharf auf mein Kind waren. Und das nicht nur wegen der Studiengebühren.
Der Kater schnurrte, ich konnte es bis zu mir hören. Soweit ich wusste, waren Katzen, die schnurrten, gerade friedlich gestimmt. Ich sah also keine unmittelbare Gefahr für Meg. Hatte sie den Kater eingeladen, sich auf ihr niederzulassen? Ich grübelte über ihr Verhältnis zu Tieren nach, kam aber zu keinem eindeutigen Ergebnis. Sicher war nur, dass sie ihnen eher mit Interesse als mit Angst begegnete. Angst machten ihr höchstens Menschen.
Ich sah mich um. Das Plätzchen unter den Bäumen war idyllisch. Die Sonne wurde von den Blättern der Bäume gefiltert, zwei Meter weiter erhob sich die malerisch verwitterte Burgmauer, aus deren Fugen Farne und blaue Blümchen wuchsen. Von hier konnte man auch einen Streifen der Wiese erspähen, auf der sich die Schafe bewegten, darunter ein erstaunlich großes, das sich meinem Garten näherte, wie ich aus den Augenwinkeln wahrnahm. Jedenfalls schlich da etwas Weißes und Großes vorbei. Bevor ich es näher betrachten konnte, war es aus meinem Blickfeld verschwunden. Meg blinzelte und lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf sich.
»Ich hab Erdbeeren gefunden«, sagte sie träge.
»Wieso ist der Kater hier?«
»Die sind lecker.« Meg lässt sich ungern von einem Thema abbringen.
»Ich hab nach dem Kater gefragt. Wie lange ist der schon hier?«
»Weiß nicht, er war da, als ich kam. Das ist Napoleon.«
Also hatte Meg gehört, dass Frau Epping auf der Suche nach dem Vieh war. Warum hatte sie nichts gesagt? Weil ihr gefiel, dass der verdammte Kater da war.
»Du hättest Frau Epping sagen können, dass Napoleon bei uns ist.« Dann wären wir ihn gleich losgeworden.
»Da wachsen noch mehr Erdbeeren, hinter dem Baum.« Meg warf sich etwas in den Mund, und erst da nahm ich zur Kenntnis, was sie gesagt hatte.
»Erstens sollst du kein ungewaschenes Obst essen, zweitens nichts aus diesem Garten, bevor ich mir angesehen habe, wo du es herhast. Man weiß nie, ob das Zeug gesund ist. Verstanden?« Meine Stimme wurde scharf, als ich über die Düngung der Erdbeeren nachdachte. Die Gurken hatten mich sensibel gemacht. Der Kater miaute aufgebracht. »Und setz endlich dieses Tier runter, das hat Flöhe. Heute Nacht kratzt du dich überall, weil du Flohbisse hast.«
Meg schwang unschlüssig ein Bein aus der Hängematte und ließ es erst einmal baumeln.
Mein Gott, war ich blöd! Jetzt fing ich an, mit ihr zu streiten, dabei hatte ich doch etwas Wichtiges zu erledigen, bei dem ich sie überhaupt nicht gebrauchen konnte. Sie sollte nicht mal in der Nähe sein, wenn ich das Loch über der Hand zuschüttete.
Der Kater streckte eine Pfote aus, riss das Maul auf und fauchte.
»Beweg dich nicht«, sagte ich angstvoll. »Ich hole irgendwas, mit dem ich ihn in die Flucht schlagen kann.« Hatte Tante Ella Baseball gespielt? Oder wenigstens Tennis? Aber hier lagen ja jede Menge handliche Knüppel herum!
Der Kater und ich sahen uns an. Sein Blick gefiel mir nicht, er guckte ohne zu blinzeln, so starr und eindringlich – wie Meg, wenn sie unnachgiebiger Stimmung war. Besitzergreifend legte sie dem Kater die Hand auf den Rücken, und da geschah das Wunder. Der Kater schloss die Augen, begann wieder durchdringend zu schnurren, und im gleichen Moment machte auch Meg die Augen zu und drehte den Kopf zur Mauer.
Einer der Hauptnachteile von exklusiven Mutter-Kind-Beziehungen als Lebensmodell besteht darin, dass sich das Grundbedürfnis nach Sex zu einem schmerzvollen Problem auswachsen kann. Dauerhafter Entzug – und hier spreche ich aus leidvoller Erfahrung – wirkt sich nicht nur nachteilig auf die psychische Gesundheit aus, sondern schadet auch dem Immunsystem. Mittlerweile ist das sogar wissenschaftlich erwiesen und Thema in Talkshows! Obwohl ich für gewöhnlich keinen Gedanken an mein Immunsystem verschwendete – außer ich war gerade erkältet –, kränkte es mich, auf ein so einfaches, anerkanntes und fast nebenwirkungsfreies Stärkungsmittel verzichten zu müssen. Hin und wieder ein Schäferstündchen war alles andere als ein unvernünftiger Wunsch. Warum ich jetzt an Schäferstündchen dachte?
Der Mann, der sich am Gartentörchen eingefunden hatte, musste das übergroße Schaf sein, das ich vom Platz unter den großen Bäumen aus den Augenwinkeln bemerkt hatte. Dafür sprach nicht nur die Schafsnase, sondern vor allem der wollweiße, formlose Fusselpullover, den er trotz der schwülen Wärme trug. Vielleicht drückte sich in dieser Bekleidung Solidarität mit den Schafen aus, die ihr Fell auch nicht mal eben ablegen konnten. Mit seiner untersetzten Statur erinnerte er ein wenig an seine Vorfahren, die Neandertaler, auf die mich mein Freund bereits hingewiesen hatte.
Zum Aufhübschen meines Immunsystems käme der Mann auf den ersten Blick jedenfalls nicht in Frage. Einen gewissen Anspruch an die Ästhetik kann ich selbst in größter sexueller Notlage nicht völlig außer Acht lassen, sollte aber eventuell daran arbeiten. So abstinent wie in den letzten Jahren durfte es auf die Dauer nicht weitergehen.
Meg hatte generell etwas gegen potenzielle Lebensabschnittsgefährten ihrer Mutter, das hatten wir mehrfach getestet und waren dabei über ihre einseitige Sicht der Dinge nie hinweggelangt. Ich wusste, anderen alleinerziehenden Müttern ging es nicht besser, das war aber kein Trost.
Ich fragte mich, was im Kopf dieses Mannes vorging.
Ich hatte nach einigem Herumsuchen einen Spaten gefunden und wollte gerade das Loch im Gurkenbeet zuwerfen. Vorher hatte ich den Eimer in der wahnwitzigen Hoffnung beiseitegeräumt, dass mich meine Einbildung in die Irre geführt hatte und in dem Loch gar keine Totenhand steckte. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich etwas beim zweiten oder dritten Blick als etwas völlig anderes herausstellte, das passierte mir hin und wieder, auch in nüchternem Zustand. Von Frau Eppings Mutmaßungen angeregt, hoffte ich auf eine Ratte, so wenig ich Ratten sonst abgewinnen konnte.
Ich hatte mich vorgebeugt und in das Loch gestarrt. Es sah sogar alles noch schlimmer aus als vorher. Die Finger hatten sich gekrümmt und in die Erde gekrallt, als versuchte da jemand, aus dem Loch herauszukriechen. Mir wurde wieder schwindlig, verdammt schwindlig sogar, und mein Magen meldete sich, der ganze Schreck begann von vorn.
Die Hand war nun viel besser zu erkennen, weil die Sonne darauf schien. Mir flimmerte es vor den Augen. Meine Hand krampfte sich um den Spaten, und ich stöhnte auf.
Hatte da jemand was gesagt?
Das war der Moment, als ich – noch immer in gebückter Haltung – aufschaute und die Neandertaler-Schafsnase entdeckte.
Blitzartig wurde mir bewusst, dass ich ein sehr weit ausgeschnittenes T-Shirt und darunter nichts trug. Das hieß, auf die Entfernung von rund fünfzehn Metern ...
Was hatte ich noch mal zu den hiesigen Höhlenbewohnern angemerkt? Nicht sehr redegewandt, bloß mächtige Instinkte?
Aber der Kerl starrte nicht in meinen Ausschnitt, sondern auf meine Füße. Das war sonderbar.
Ich war immer noch barfuß, und natürlich waren meine Füße dreckig bis zu den Knöcheln, denn ich sackte in die Erde ein, wenn auch nicht mehr so tief wie zuvor.
Was hatten meine dreckigen Füße an sich, was einen Mann veranlassen konnte, lieber darauf als auf meinen nackten Busen zu starren?
Er musste so um die vierzig sein. Wesentlich ältere Männer, die ich kannte, würden sich sehr freuen, wenn ich mich so weit vorbeugte, dass sie eine ungehinderte Sicht in meinen Ausschnitt hatten.
Ich schaute selbst hinein. Es war noch alles vorhanden, wie ich es von der kalten Dusche heute Morgen in Erinnerung hatte. Beim Gedanken an die kalte Dusche richteten sich meine Brustwarzen auf.
Ich drückte das Kreuz durch und starrte den Kerl nun unverhohlen missbilligend an.
Da wurde er aufmerksam und sah mir ins Gesicht. Seine Hand, die auf dem Törchen lag, bewegte sich auf die Klinke zu.
»Was wollen Sie?«, rief ich schnell.
»Hm«, brummte er zur Antwort, und seine Hand verharrte in der Luft, legte sich dann aber auf die Klinke.
Ich brauchte ein Schloss an diesem Törchen, ich nahm mir vor, heute noch ein einfaches Vorhängeschloss zu kaufen, das mir ungebetene Besucher vom Hals hielt.
Der Mann hatte nicht nur eine stumpfe Schafsnase, die beinahe auf die Oberlippe hing, sondern Hängebacken, einen viel zu kleinen Mund, buschige Augenbrauen und dünne, sandbraune Haare. Hinter ihm drängelten ein paar Schafe heran, er drehte sich zu ihnen um, und ich erblickte das, was ich an Männern überhaupt nicht leiden kann: eine Hose mit Hängehintern. Es gibt nichts Abtörnenderes als einen Hängehintern. Wenn ein Mann optisch nichts zu bieten hat, erwarte ich zumindest eine gut ausgeprägte, ansprechende Gesäßpartie, die die Hose füllt.
Erst einmal scheuchte der Mann die Tiere zurück. Dabei bemerkte ich, dass er das ebenso lässig wie liebevoll machte: Er gab beruhigende Urlaute von sich, legte ihnen die Hände auf den Rücken und dirigierte sie mit beeindruckender Geschicklichkeit zurück auf die Weide. Irgendwie hatte sein Umgang mit den Schafen Stil.
Ich versuchte den Spaten herauszuziehen und mich an die Arbeit zu machen, bevor der Mann wieder Zeit für mich hatte. Der Spaten saß fest, ich ruckelte daran herum und bekam ihn endlich heraus, fiel dabei aber beinahe ins Loch.
Als ich mein Gleichgewicht wiedergewonnen hatte, war auch der Mann erneut bereit, zu mir in den Garten zu kommen. Seine Hand spielte mit der Torklinke.
Ausdruckslos musterte er den Spaten, seine Augen verengten sich, und sein Blick schweifte eine Spur zu beiläufig über mein T-Shirt. Daran erkannte ich dank langjähriger Erfahrung, dass ihm der Anblick meines nackten Busens doch nicht entgangen war. Seine Instinkte waren also in Ordnung. Aber konnte er verständlich reden?
»Also, was wollen Sie?«, fragte ich möglichst scharf. »Ich hab nämlich zu tun, wissen Sie.« Mit großer Geste deutete ich auf den Spaten.
Er nickte. »Weiß ich. Hab’s gehört. Das sollten Sie aber nicht selbst machen. Ich mach das für Sie. Lassen Sie mal den Spaten stecken.«
Mir schwante etwas. Die Epping-Sippe hatte sich verschworen, in mein Leben einzugreifen. Erst die Tante, nun der Neffe mit den Schafen. In einer der ausgebeulten Hosentaschen des Neffen vermutete ich das Handy, über das seine Tante ihn erreicht hatte. Ich wusste da noch nicht, wie recht ich hatte – mit der Epping-Sippe. Ich fragte mich, ob dieser Neffe das Tor aufgeklinkt hatte, so dass eins der Schafe in den Garten trampeln konnte. Sozusagen als Vorhut der Eppings. Und warum sollte er nicht bereits selbst hier gewesen sein? Vielleicht hatten die Eppings nur darauf gewartet, dass ich die Leiche offiziell entdeckte?
Irgendetwas war hier im Gange, was ich noch nicht durchschaute.
»Sie sind also Frau Eppings Neffe, der, dem die Schafe gehören. Sie hat von Ihnen gesprochen und Sie anscheinend angerufen.«
Er nickte bedächtig. »Lothar Epping.«
Seine Stimme klang überraschend angenehm, vor allem, weil er nicht herumschrie und Meg aufscheuchte. Er sprach aber so deutlich, dass ich ihn auf die Entfernung gut verstand. Freunde würden wir dennoch nicht werden, da war ich mir sicher.
»Also, was diese Ratte betrifft, die hab ich schon in die Mülltonne entsorgt«, log ich forsch und hoffte, dass die Anteilnahme der Eppings nicht so weit ging, dass einer von ihnen in meinem Müll nachschaute. Ich spielte zum zweiten Mal mit dem Gedanken, die Totenhand in die Tonne zu werfen, dachte aber dann wieder, dass es damit wahrscheinlich nicht getan war. »Ich muss nur noch das Loch zuschütten«, fuhr ich fort.
»Der Boden ist lehmig«, wandte Lothar Epping ein, »der klumpt. Da braucht man Kraft für. Warten Sie, ich ...«
Die Eppings hatten eine gemeinsame Eigenschaft: zügellose Hartnäckigkeit.
Mit größter Mühe hebelte ich einen Klumpen Lehmerde aus dem Beet und warf sie in das Loch. Von der Hand ragten nur noch zwei Fingerspitzen heraus.
»Na, bitte! Ich komm allein klar«, sagte ich triumphierend. Ich konnte mich kaum einkriegen vor Freude.
Da hörten wir beide einen Hund bellen. Das Bellen drang aus der Richtung herüber, wo Meg in der Hängematte döste, und es klang tief und bösartig. Mein Herz machte einen Satz, ich spürte einen heftigen Schmerz in der Brust und ging deutlich sichtbar in die Knie.
Das deutete der Neffe als Kapitulation.
Mit verschwimmendem Blick sah ich, wie das Törchen aufschwang und Lothar Epping in meinen Garten stapfte. Ein Schaf kam ihm nach, es hatte sich von hinten herangestohlen, das verschaffte mir einen winzigen Aufschub.
»Das Schaf«, wimmerte ich.
Epping drehte sich um, ich stieß den Spaten in den Grund. Das Schaf trottete zurück auf die Wiese, Epping näherte sich mit großen Schritten.
Der Spaten saß wieder fest, wütend versuchte ich ihn herauszuziehen, mit Erde natürlich, das Ding bewegte sich, aber nicht so, wie ich es wollte.
Lothar Epping war noch einige Meter entfernt.
Konnte er bereits in das Loch sehen?
Noch einmal spannte ich die Muskeln an, hebelte am Spaten, und tatsächlich, es tat sich was. Optimistisch legte ich mich noch mal ins Zeug. Mit einem Ruck kam der Spaten frei, bewegte sich aber mit unaufhaltsamem Schwung weiter. Er rutschte mir aus den Händen, ich drehte mich, stolperte einen Schritt und fiel rückwärts, während der Spaten über mich hinwegsegelte und mit einem satten Plopp irgendwo landete. Lothar Epping beugte sich über mich und hielt mir eine Hand hin.
Da erst merkte ich, dass ich in dem Loch saß, welches ich zuschütten wollte.
»Ich hab’s Ihnen gesagt. Sie schaffen das nicht. Dann kommen Sie mal wieder hoch«, sagte er bar jeden Gefühls. Ich hatte noch nie eine so stumpfe Miene gesehen. Nicht ein Muskel zuckte, der Kerl glotzte so unbeteiligt, als ob er nach einer Mistgabel langte.
Die Hand rückte näher.
Da hatte ich ein Déjà-vu!
Es war gar nicht so lange her, da hatte ich schon einmal hier gesessen, und eine schwielige Hand hatte sich mir entgegengestreckt. Ich musste an »Und täglich grüßt das Murmeltier« denken. Erging es mir wie dem armen Teufel in dem Film? Der erlebte immer wieder haargenau dasselbe noch einmal, es war ein einziger, lang währender Alptraum, bis er endlich zu einer grundlegenden Einsicht über sein verpfuschtes Leben gelangte.
Was hatte ich bloß verbrochen? Außer dass ich mich nicht um Tante Ella gekümmert hatte und ihr Erbe nicht verdiente?
Würde ich nun alle zwei Stunden auf der Leiche sitzen?
Ich konzentrierte mich. Hatte ich etwas unter mir brechen gehört? Knochen? Ich kam zu keiner eindeutigen Erkenntnis. Obwohl es sich nicht so anfühlte – ich spürte auch nichts Spitzes an meinem Hinterteil –, saß ich wie auf heißen Kohlen, und kein normaler Mensch hätte es verstanden, dass ich sitzen bleiben wollte. Und es würde nicht einfach sein, ohne Hilfe aus dem Loch herauszukommen. Das las ich aus Eppings beinahe ritterlicher Geste. Vielleicht sollte ich ja dankbar dafür sein, dass er nicht von einem Ohr bis zum anderen grinste.
Ich fragte mich, ob er überhaupt jemals grinste.
»Gehen Sie weg!«, schnauzte ich ihn an.
Jetzt spiegelte sein Gesicht Betroffenheit.
»Wenn Sie sich nicht eingemischt hätten ...«, fauchte ich weiter und verstummte.
Der Hund bellte wieder.
Wie hatte ich den vergessen können?
Der Lautstärke nach konnte er nicht weit weg sein, das hieß, er war viel zu nah für mein Gefühl. Oder war es Eppings Hund? Schäfer arbeiteten mit Hunden, so viel wusste ich, wenn ich auch sonst keine Ahnung von der Schafhaltung hatte.
Irgendetwas sagte mir, dass es sich nicht um einen Schäfer- oder Hütehund handelte.
Meg war in Gefahr, und ich saß hier herum.
»Meg«, schrie ich außer mir vor Zorn auf mich selbst, »rühr dich nicht! Ich komme.«
Ich wollte nach Eppings Hand greifen, aber er kam mir zuvor. »Ist ja albern«, sagte er, packte mich unter den Achseln, hob mich hoch und stellte mich auf die Füße.
Die Erde drehte sich um mich, ich musste nach Eppings Arm greifen und mich daran festhalten. Mein Hintern fühlte sich scheußlich feucht an, die Hose klebte an mir. Von dem Fusselpullover traf mich der scharfe Geruch nach nassem Schaf, vermischt mit einem Hauch abgestandenem Aftershave – Old Spice vermutlich –, was keine gelungene Mischung ergab. Aber all das war gar nicht wichtig.
»Na also«, sagte Epping bestimmt, »und jetzt ...«
Ich hörte nicht mehr zu.
Ich musste nach Meg sehen, jetzt sofort, nur einen Blick noch vorher in die Grube werfen.
Mir stockte der Atem, während mir durch den Kopf schoss, welch ungeheure Mühe ich mir gegeben hatte, die Entdeckung der Leiche zu verhindern. Es hatte mich ausgelaugt. Sich stundenlang durch den dichtesten Verkehr auf dem Berliner Ring zu quälen war weniger anstrengend. Alles umsonst. Wie eine Verurteilte schielte ich in das Loch und stellte mir die Hand vor, madenweiß und einfach grässlich, aber ...