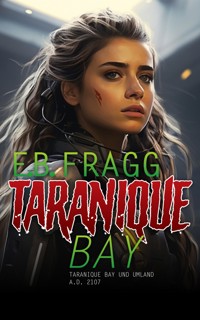
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Taranique Bay, Bundesstaat Calitopia, New-USA im Jahr 2107.
Das Shuttle aus Richtung der Marsstation Deep Haven One ist in der Nähe der Stadt abgestürzt. An Bord waren der letzte Überlebende aus der Crew der Marsbasis und ... etwas. Dieses Etwas hat das Wasser in und um die Stadt befallen und in kürzester Zeit alles Leben vergiftet.
Die meisten Bewohner sind aus der Stadt geflohen. Einige harren mit schwindender Hoffnung auf den Dächern eines Industriegebietes aus. Unter ihnen ist ein Mann namens Fragg, der einen Rucksack mit heiklem Inhalt in einen Bunker bringen soll. Kein leichtes Unterfangen, ist doch jeder Schritt höchst gefährlich.
E.B. Fragg erzählt in drei rasanten und äußerst unterhaltsamen Teilen das Drama um die Stadt Taranique Bay, seine Begegnung mit der toughen Dr. Maggie Simon und seine einzigartige Beziehung zu der künstlichen Intelligenz Tessie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Taranique Bay
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort des Autors
Die Welt im Jahr 2107. Der Mensch hat es auf den Mars gescafft – aber zu welchem Preis?
Für einen sehr kurzen Zeitraum war die Mars-Oberflächenstation Deep Haven One die Krone der menschlichen Schaffenskraft. Abermillionen Kilometer von der Erde entfernt diente sie als Leuchtfeuer auf dem Weg des Menschen zu einer weiteren Eroberung des Weltraumes.
Dann, an einem furchtbaren Tag, der eigentlich ganz gut begonnen hatte, havarierte die Station und löste sich mit einem Knall in ihre Bestandteile auf. Ein einziges der Rettungsshuttles schaffte es zurück zu seinem irdischen Raumhafen, nach Taranique Bay in Calitopia, New USA.
Was dann geschah, erfahren wir in diesem vorliegenden Roman.
Was wir nicht erfahren sind Details aus dem Untergang der Marsstation. Das zu erzählen bedarf eines eigenen Romans. Aber: Keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, Sie haben noch nichts verpasst! Wenn Sie diese Ausgabe von Taranique Bay in der Hand halten und lesen, ist der Roman rund um Deep Haven One noch nicht geschrieben.
Das hatte ich bereits im Jahre 2020 vor, muss ich zugeben. Jedoch lief mir in jenem Jahr vor lauter Projekten die Zeit davon. So ließ ich die Arbeit an genanntem Roman liegen. Um aber am Ball zu bleiben, beschloss ich, zumindest kleine Häppchen zu schreiben. Diese sollten sich um die Ereignisse auf der Marsstation ranken, aber nichts von der Story verraten. Dabei heraus gekommen sind „Bittere Wasser“, „Vier Reiter“ und „Schutt und Asche“; drei rasante und außergewöhnliche Stories, die Sie hier zu einer langen Erzählung verschmolzen finden.
Ich gelobe feierlich, dass ich den Schlüsselroman zu Deep Haven One sobald als möglich nachreichen werde.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und verbleibe
Mit phantastischen Grüßen,
E.B. Fragg
Teil Eins: Bittere Wasser
Das beschissene Reh
Dieses beschissene Reh war immer noch hinter mir her und ließ sich nicht abschütteln. Ich hatte es mittlerweile aus dem Wald heraus in die Ruinen des Stadtrandes geschafft und rannte immer noch um mein Leben. Meine Lunge brannte bereits wie Feuer, obwohl ich relativ fit war. Aber die Luft im Wald war auch nicht zum Atmen gedacht gewesen. Da draußen hatte ich das Reh nicht abschütteln können, aber vielleicht gelang es mir zwischen den zerfallenen Industrieanlagen. Wäre besser, denn entweder würde es mich sonst infizieren oder ich bekäme tierisch den Arsch aufgerissen, weil ich einen Beutemacher in Richtung unseres Camps gebracht hatte. Mist! Wir hätten die Biester allesamt abknallen sollen als wir noch die Chance dazu hatten (und die Munition). Jetzt werden wir von Bambi und seinen abartigen Freunden gejagt. Wahrscheinlich lachen sie sich den Schweif ab, wenn sie sich in ihrer kleinen Freakgemeinde abends bei Blättern und Menschenfleisch von ihren Ausflügen in die Welt der Zweibeiner erzählen. Kacke!
Ich rannte durch ein Loch in der Mauer von Old Country Protein Farms. Die einstmals soliden Betonwände boten noch heute ausreichend Schutz vor dem, was einem der Rest der Natur so entgegenwarf. In der riesigen Werkhalle hatten dereinst smarte Maschinen gesurrt und wohlschmeckende Nahrungsersatzmittel zusammengerührt. Jetzt beherbergte sie einen Haufen Elektroschrott und verbogenes Metall. Aber der Ort war ganz nützlich, um auf kürzerem Wege in Richtung des Zentrums von Taranique Bay zu kommen. Ich duckte mich also zwischen einigen ausgebeuteten Maschinenresten hindurch und presste mich flach an eine der verbliebenen Trennwände. Mein Herz raste und mein Atem ging stoßweise. Gleichzeitig nahm ich den Geschmack von Asche in meinem Mund wahr. Wie immer, wenn man mehr als eine halbe Stunde im Wald verbracht hatte, waren die Filter der Masken zu und langsam aber sicher wurde das Atmen zur Qual. Ich hatte dieses sehr kurze Zeitfenster um einige Minuten überschritten und zahlte nun den Preis dafür. Als mein Atem langsamer ging, hörte ich das Geräusch von Hufen auf Betonboden. Gab dieses Biest denn nie auf? Oder hatte es einfach Bock auf einen großen Becher Nutcracker Special, die hier aufgerissen und von Ratten angenagt herumlagen? Scheiße, echt jetzt.
Ich wagte einen Blick aus meiner Deckung heraus. Das Vieh stand zwischen einigen aufgerissenen Säcken und schnüffelte. Zwar hatte ich in den vergangenen Wochen, seit das alles hier passiert war, schon so einiges gesehen, aber die Abartigen aus dem Wald entsetzten mich immer wieder aufs Neue.
Die Kreatur, die man früher als Reh bezeichnet hatte, war eine entsetzliche Perversion des sonst so anmutigen Tieres. Das eigentlich braune Fell war büschelweise ausgefallen, die verbliebenen Reste graufleckig und strohig. An einigen Stellen wölbten sich ungesunde Beulen, mit blauen Venen versehen, aus dem Rumpf des Tieres. Statt der sonst üblichen vier Beine, hatte dieses Exemplar sechs – was es zu einem gefährlichen Jäger machte. Wir hatten einmal den Schädel einer solchen Schreckgestalt gefunden. Diese hatte eine zusätzliche Zahnreihe gehabt, mit einigen prototypischen Fangzähnen. Es muss ein frühes Exemplar gewesen sein, denn die aktuellen Modelle kamen alle mit zwei sauberen Reihen schöner scharfer Hauer daher, die auch durch dicke Lederkleidung ging. Was am Kiefer neu gebaut wurde, musste offenbar am Rest des Gesichtes geopfert werden. Schöne Rehaugen gab es hier keine zu entdecken. Dafür ein verkümmertes Auge, und ein unnatürlich vergrößertes, welches dazu stark nässte. Alles in Allem ein ekelhafter Anblick.
Das Biest schnüffelte also auf dem Boden herum, in der Hoffnung mich zu wittern. Aber wahrscheinlich verstopften diese Sekrete, die seinen Kopf zu einem einzigen Entzündungsherd verwandelten, seine Nase. Meine Chance, hier aus der Deckung dem Vieh den Garaus zu machen. Zu dumm, dass ich ein echt schlechter Schütze war und meine Munition deutlich begrenzt. Ich hatte eine der wenigen Waffen aus dem Camp bekommen um auf meinem Weg an den Stadtrand nicht ganz ohne was in der Hinterhand dazustehen. Nur konnte ich auf Teufel komm raus nicht schießen. Als es Pistolen und Gewehre noch in ausreichender Menge gegeben hatte, hatten sie mich nicht interessiert. Warum auch, war ja alles in Ordnung? Jetzt, wo sie dringend gebraucht wurden, waren sie Mangelware und die Munition schon größtenteils verschossen. Ohne Hoffnung auf Nachschub. So hatte ich eine Neunmillimeter bekommen, mit fünf ganzen Patronen darin. Nicht gerade ein Kriegsarsenal. Ich zog die Waffe aus dem improvisierten Holster am Bund. Wie ich es bei unserem Erschieße-wenigstens-nicht-die-eigenen-Leute-Training gelernt hatte, griff ich den Stahl und atmete ruhig ein und aus. Das Reh war etwa fünfzehn Meter von mir entfernt und leckte immer noch irgend etwas vom Boden auf. Ich legte an. Kimme und Korn tanzten vor meinen Augen und so sehr ich es versuchte, ich bekam sie nicht ruhig. Nach einigen Augenblicken fasste ich mir ein Herz – jetzt oder nie! Der Schuss knallte trocken und hallte an den Wänden der Halle von Old Country Protein Farms wider. Ich hatte nicht getroffen. Scheiße. Jedes normale Tier wäre nun seinerseits weggelaufen. Nicht dieses Exemplar verderbter Natur. Es bliebt für eine Sekunde stehen. Und das wurde zu seinem Verhängnis. Kurz nach dem Schuss krachte und rasselte es vernehmbar ganz in der Nähe des Tieres. Und von oben raste ein gut fünfzig Zentimeter durchmessendes Stahlrohr hinunter. Wie ein tödliches Pendel schwang es von links nach rechts und riss dazwischen alles mit sich. Es traf das Geschöpf seitlich am Kopf und zerschmetterte diesen in eine Masse aus Knochen und rotem Brei, bevor es nach rechts ausschwang und unterwegs noch einen Verteilerkasten zerlegte. Mein Schuss hatte wohl der schlecht gewarteten Halteapparratur des Rohres den Rest gegeben. Nach dem mein Schuss und das Krachen der Infrastruktur dieses Ladens verhallt war, pfiffen meine Ohren ganz gehörig. Aber das Untier war erlegt. Obwohl sein Organismus ein Zwangstuning erhalten hatte und in seiner Inneren kein Stein aufeinander geblieben war, war es letztlich dennoch aus Fleisch und Blut und damit verwundbar. Ich trat langsam aus der Deckung hervor und betrachtete mein Werk. Der Kopf des Tieres war kaum noch als solcher zu erkennen, aber aus den matschigen Fragmenten sickerte Blut und das, was in der Stadt gemeinhin als Bakterienflüssigkeit bekannt war. Das Zeug war übel. Jedes Lebewesen, das mit ihr in Berührung kam, war mit Sicherheit dazu verdammt, zu einer abartigen Kreatur zu werden. Ich wagte mich nicht näher an den Kadaver heran, um nichts von der Todessuppe an die Füße zu bekommen. Es gab Schauergeschichten, die zwischen den Camps getauscht wurden. Und eine davon handelte von einem unglücklichen Bürger, der auf ein totes Eichhörnchen getreten war und die Seuche damit ins Camp geschleppt hatte. Schöne Scheiße für alle Beteiligten.
In der Halle war es nun still. Die großen Maschinen und Steueranlagen ragten wie Monolithen einer vergangenen Epoche in ihr auf. Sie hatten sich seit Wochen nicht mehr bewegt und zeigten nun erste Anzeichen von mangelnder Wartung. Zwar rostete hier nichts mehr, oder nicht mehr allzu schnell, dafür sah ich abgeschlagenen Kunststoff auf dem Boden liegen, auf einem großen Fleck getrockneten Hydrauliköls. Einige Scherben von ausgeschlagenen Fensterscheiben hatten ihren Weg dazwischen gefunden. Offenbar hatte sich hier eine andere Kreatur als dieses Reh ebenfalls verausgabt. Unter der Decke hatten sich einige Vögel eingenistet. Baum- und Himmelsbewohner kamen allgemein weniger mit dem Bakterium in Verbindung als Bodenbewohner. Der Spatzenfamilie dort oben gingen unsere Probleme hier unten wahrscheinlich gehörig am gefiederten Arsch vorbei. Ich steckte die Pistole zurück in den Halfter. Dabei versprach ich mir, beim nächst möglichen Schießtraining wieder Teil zu nehmen. Mein Glückstreffer war zwar erfolgreich gewesen und nur das zählte, jedoch musste ich mich auf mehr als mein Glück verlassen können.
Ich durchmaß die Halle mit einigen schnellen Schritten in Richtung Hauptausgang. Das Knirschen unter meinen Tennisschuhen war in der Stille unnatürlich laut. Dass ich das bemerkte war ein gutes Zeichen; es bedeutete, dass das Pfeifen in meinen Ohren leiser geworden war.
Der Hauptausgang war eine solide Stahltüre neben einem Kunststoff-Rolltor. Wie viele Türen dieses hochmodern gestalteten Industriekomplexes war sie einst mit einem magnetischen Schloss gesichert gewesen. Als abrupt der Strom weg war, hatten die Türen automatisch entriegelt. Damit standen nun alle Türen in dem gesamten Distrikt offen. Obwohl es anfangs zu einigen Plünderungen gekommen war, hatten die verbliebenen Menschen nach kurzer Zeit das Interesse an für sie sinnlosem Zeug verloren. Zwar wurden dann und wann noch Lager nach Verwertbarem durchsucht. Jedoch waren - wie durch ein Wunder - die harten Verteilungskämpfe hier draußen ausgeblieben. In der Innenstadt sah es wohl ganz, ganz anders aus.
Unser kleines Dach
Ich zog die Tür nach innen auf und trat hinaus in das Grau des Industriegebietes von Taranique Bay, einstmals pulsierendes Produktionszentrum der fortschrittlichsten Maschinen und Güter der Welt, heute das Zuhause von einigen tausend Überlebenden, Bekloppten, Hoffnungslosen und Draufgängern. Und ich war einer von ihnen.
Taranique Bay war mal die modernste Stadt der Welt gewesen. Am Reißbrett geplant und am Pazifik errichtet, hatte sie planmäßig zweihundertfünfzigtausend Leute untergebracht. Das war so ab den zweitausendachtziger Jahren gewesen, als die Große Entwicklung angefangen hatte. Urplötzlich war jemand mit einer genialen Lösung für das Weltenergieproblem um die Ecke gekommen. Mit einem Schlag konnten die armen Länder der Erde mit schier unendlichem kostenlosem Strom versorgt werden. Damit war auch das Hungerproblem bald beseitigt worden und auf der Welt war nach und nach Ruhe eingekehrt. Die bis dahin ohnehin schon starken Länder konnten sich auf ihr nächstes großes Projekt konzentrieren: Die Eroberung des Weltraumes durch den Menschen. Und dafür wurde Taranique Bay erschaffen. Etwas landeinwärts hatte die IRFA, die Internationale Raumfahrtagentur, mein Arbeitgeber bevor alles zum Teufel gegangen war, zuerst das Startfeld der MARCON, des Kontrollzentrums der Marsansiedlung, aus dem Boden gestampft. Die Stadt wuchs dann planmäßig außenrum. Oder links daneben, je nach dem, wie man drauf schaut. Durch das ganze Gehirnschmalz das hier vorhanden war, kamen auch schnell andere kluge Leute in die Stadt und setzten ein Zukunftsprojekt nach dem anderen erfolgreich um. So schnell konnten sich die Bewohner gar nicht umsehen, schon war die ganze Stadt mit autonomen Transport- und Beförderungseinheiten versehen gewesen und hatten das Verkehrsproblem der Metropole in Nichts aufgelöst. Und weil Erfolg nun mal Erfolg nach sich zieht, wurde aus Taranique Bay schnell ein weltbekannter Schmelztiegel für alle, die vor hatten, diesen Planeten ein Stückchen weiter auszuformen.
Unter mir war nun gesprungener Asphalt. Links von mir lag eine kleine Reihe selbstfahrender Lieferbuggies wie ein entgleister Modellzug auf dem Boden. Rechts von mir blockierte ein havarierter Stapel Paletten mit unbestimmtem Inhalt die Straße. Ansonsten waren die Straßen genau so leer wie bereits von der Natur angegriffen. Aus den Ritzen und Spalten drängte Unkraut nach oben, die Zäune um die Werksgelände waren schon eingedellt und an manchen Stellen geknackt worden. Eine wirklich traurige Congrareihe von Fahrdrohnen säüumte den Weg. Mit dem Abschalten des Stroms war auch ihre Aktivität zum Erliegen gekommen. Eigentlich ironisch, dass in einer Welt in der Elektrizität kostenlos verfügbar ist, diese zuerst abgestellt werden muss um die Welt vor dem Exitus zu bewahren. Naja, die Welt vielleicht nicht, aber die Stadt auf jeden Fall.
Ich ging an den Wracks vorbei immer in Richtung Zentrum der Industrieanlagen. In einiger Entfernung konnte ich den Stadtkern sehen, der noch vor ein paar Wochen lichterloh gebrannt hatte. War das ein Aufheben gewesen! Wir im Camp wussten nicht, ob oder wie viele Leute im Stadtzentrum noch lebten. Aber nach dem großen Knall und dem verheerenden Feuer waren es definitiv einige weniger. Wie vielen schon am Anfang die Flucht gelungen war, wusste keiner so genau. Immerhin sprechen wir ja von wenigen Stunden oder vielleicht einem Tag, den sie nach der unglücklichen Ankunft des Shuttles Zeit gehabt hatten, das Weite zu suchen. Und dabei kein Wasser zu trinken. Oder sich nicht aus Versehen die Hände zu waschen. Ja, das Chaos war vorprogrammiert gewesen. Und als dann, als auch den Leute außen klar geworden war was passierte, sie die Stadt abgeriegelt hatten und einer der schwer bewaffneten Helis in die Stadtmitte gekracht war – da war der Ofen erst recht aus gewesen. Dem Industriegebiet hingegen ging es noch leidlich gut. Weniger Menschen auf mehr Platz bedeutete mehr Abstand zueinander. Man konnte schneller weglaufen, wenn einer mit den Zuckungen anfing. Und die Kanalisation war ein technisches Kunstwerk, welches das Wasser der Innenstadt vom Wasser der Fabriken abgeschirmt hatte. Daher gab es hier draußen viel mehr Menschen die es geschafft hatten, nicht zu abartigen Ekelkreaturen zu werden. Und dennoch hatten uns die Leute von außen nicht mehr zu sich gelassen. Das hatte am Anfang niemand so wirklich verstanden. Bis die Nachricht zu uns durchgesickert war, dass sich die Leute in mehreren Städten auffällig benahmen. Und diese Städte auch abgeriegelt worden waren. Ach, es war in kürzester Zeit einfach alles zum Teufel gegangen. Und nun stand ich hier zwischen den verlassenen Hallen der Bay und versuchte mich zu erinnern auf welchem der Dächer wir unser Camp aufgeschlagen hatten. Hier sah wirklich alles gleich aus. Damit wir uns wenigstens halbwegs orientieren konnten, hatten wir aus einer handvoll Warnwesten eine leuchtgeld-silbrige Campflagge genäht und getackert. Diese wehte als Quasi-Banner auf einer der inaktiven Dachantennen. Wieder Ironie, das rudimentärste aller Signalmittel an einem der modernsten Kommunikationseinheiten aufgehängt, damit jemand wie ich zu Fuß durch die Hightech-Fahrgassen der Stadt fand. Naja.
Ein paar Minuten später stand ich an der heraufgezogenen Feuerleiter. Bingo hatte gerade Wache, da war ich mir ganz sicher. »Yo, Bingo! Ich bin wieder da! Lass das Ding runter!« schrie ich nach oben. Ein Kopf erschien über der Kante des Daches. »Parole?« rief er zurück. »Lass den Quatsch! Ich bin’s. Lass die verdammte Leiter runter!« »Ich will erst die Parole hören!« Ich seufzte. Ja, es gab Probleme mit anderen Camps und man könnte mich zwingen, Fremde in das Camp zu lotsen. Ja, ich könnte das Bakterium in mir tragen, mir ein drittes Auge wachsen lassen und Bingo den Kopf abbeißen sobald ich oben war. Aber Bingo war jetzt auch kein Elitesoldat, sondern ein Durchschnittsbürger wie ich. Was sollte er schon ausrichten, wenn die vermeintliche Invasion kam? »Auf jeden Teller gehört Nutcracker Special!« rezitierte ich meinen Text. Wie peinlich. Dabei war das Zeug geschmacklich maximal in Ordnung, und nichts im Vergleich zu Berry Total. Aber sei es drum. »Kannst raufkommen!« schallte es von oben. Bingo sah ich schon nicht mehr. Mit einem rattern fuhr die Feuerleiter vor mir runter. Den Weg durch das Innere des Gebäudes hatten wir vor Tagen schon abgebrochen und versperrt, damit es keine schlimmen Überraschungen gab. Ich erklomm also die Aluleiter und stieg auf das großflächige Dach dieser kaputten Werkanlage. Wir hatten im Inneren mal nachgeschaut. Es war wohl eine große, zivile Schlosserei gewesen. Davon zeugten die Schweiß- und Schneideapparaturen und die Stahlgebilde die wir gesehen hatten. Wer auch immer hier gearbeitet hatte, hatte sie fluchtartig verlassen. Wir hatten noch eingespannte Stahlrohre gefunden, die halb aufgeschnitten waren, mit dem passenden Werkzeug daneben. Lunchboxen mit verfaultem Inhalt hatten auf ihre Besitzer gewartet, die nie wieder gekehrt waren. Und irgendwo lief sogar noch ein Wasserhahn. Von diesem hatten wir uns aber fern gehalten. Wasser war tabu. Selbst hier, wo das Risiko einer Infektion deutlich geringer war. Der Himmel über dem Dachcamp war wolkenverhangen. Da die Sonne bereits unterging (ich war sehr spät von meinem Ausflug zurückgekehrt), wurde es schnell frisch. Dafür würde es heute Nacht nicht allzu kalt werden, alte Pfadfinderweisheit. Okay, vielleicht war ich kein Pfadfinder gewesen, aber so ein bisschen was lernte man auch ohne Spezialausbildung dazu. Ich sah unsere Behelfsbauten auf dem Dach. Wir hatten nur wenige Zelte ergattern können und uns einige Unterstände aus Kunststoffelementen geschnitten. Es war unsere Version einer Wellblechhütte in einem afrikanischen Armenhaus, aber aus Plastik und weniger stabil. Die anderen grüßten mich. Wir waren etwa zwanzig hier oben, an manchen Tagen mehr, und nach manchen schlimmen Nächten auch bedeutend weniger. Wir waren eine abgerissene Truppe, die es mit dem Nötigsten aus dem Haus geschafft hatte und nach einer Odyssee durch die verschiedenen Bereiche der Stadt hier gestrandet war. Von den meisten kannte ich die Namen nicht. Zu viele waren auf der Durchreise an ein anderes Ende der Stadt um von dort aus in das nicht minder verseuchte Umland zu kommen. Einige hatten den kühnen Plan gefasst, auf den Pazifik raus zu fahren und von dort in einem Bogen auf das Festland zurück zu kommen. Aber auch der Ozean war ein gefährlicher Ort geworden. Wo keine fahrende Freakshow auf Booten auf einen wartete, stand schon die Küstenwache bereit um alles Leck zu schießen, was sich ihnen näherte. Diskussionen waren fast ausgeschlossen. Ohne hinreichende Kommunikation zum Rest des Landes würde es auch schwer werden den Plan der Regierung zu erfahren, was unser Fleckchen Erde betraf. Vorerst würden wir alleine klarkommen müssen. Die meisten von uns waren ungewaschen (waschen war nur bei Regen ungefährlich, ansonsten reiner Selbstmord). Viele waren dehydriert, da das Wasser in Flaschen immer knapper wurde und die abgeworfenen Vorräte nicht für alle reichten. Wer hier oben übernachten wollte, musste einen Obolus entrichten. Das klingt erst mal nicht sehr solidarisch, aber es war unabdingbar um die Nummer hier am Laufen zu halten. Andere Camps hatten das nicht und waren in kürzester Zeit aufgelöst worden, meist mit Gewalt von außen. Der Obolus zeigte den Menschen, dass wir es hier ernst nahmen und im Gegnzug für die Sicherheit des Daches und eine Grundversorgung herstellten. Gängige Tauschmittel waren frische Wasserflaschen, Medikamente oder die gute alte Munition. Selbst in einer hypermodernen Stadt wie Taranique Bay gab es vom wohlmeinenden Polizisten bis zum Drogenschmuggler alles – und jeder von ihnen wollte bewaffnet sein. Natürlich hatte es nicht gereicht um die gesunde Bevölkerung substanziell zu bewaffnen. Aber immerhin hatte es uns einen Vorsprung vor den Kranken gegeben. Und so waren heute Patronen in gängigen Kalibern gerne gesehene Zahlungsmittel. Die Patrone, die ich vorhin verschossen hatte, reichte für ein Mittagsschläfchen im Schatten in einer der kuscheligen Ecken unseres Lagers. Zumindest ein wenig Normalität an diesem ganz und gar seltsamen Ort. Ich musste nichts mehr bezahlen. In den Wochen in denen ich hier war und mit dem Camp herumzog, hatte ich mich als ausreichend furchtlos erwiesen um nützlich zu sein. So durfte ich für Fred (einer der wenigen steten Namen hier), unseren Camp-Ältesten, im Umland Dinge erledigen gehen und damit den vollen Komfort eines Null-Sterne Schlafplatzes in einem der Plastikverschläge zu genießen, sowie an den unregelmäßigen und wenig schmackhaften Mahlzeiten teilnehmen. Als er mich erblickte, kam er auf mich zu und sagte »Gut, dass Du wieder da bist. Hast Du was erreichen können?« »Negativ.« gab ich zurück. »Die Geschichte mit dem LKW muss erfunden gewesen sein oder sie haben ihn schon geborgen. Also kein kostenloses sauberes Wasser für uns.« »Fuck!« entfuhr es ihm. »Egal. Das wird schon wieder.« setzte er nach. Der gute alte Fred, durch nichts aus der Fassung zu bringen. »Ruh dich ein bisschen aus, es geht gleich für Dich weiter.«
Der gute alte Fred war auch ein gehöriger Sklaventreiber, wenn man es mal detailliert betrachtete. Aber er hielt diese kleine Schicksalsgemeinschaft zusammen. Und jeder der auf das Dach kam um sich kurz oder lang auszuruhen, respektierte das. Ich schmiss meinen Rucksack in mein Plastikzuhause und gab meine Waffe ab. Fred hatte die Aufgabe eines Waffen- und Proviantmeisters geschickt outgesourct. Jill, eigentlich eine Verkäuferin aus einer der Malls der Innenstadt, verwaltete alle Güter die auf diesem Dach etwas wert waren. Und das waren die paar Lebensmittel die verfügbar waren, sowie die Schießeisen ohne festen Besitzer. Jill grinste mich etwas schief an, als sie die Pistole entgegennahm und das Magazin aus dem Griff gleiten ließ.
»Na, was getroffen?« fragte sie schelmisch als sie die verschossene Patrone bemerkte. »Klar.« gab ich zurück. »Ein mutiertes Reh. Ein Schuss, ein Treffer. Exitus. Liegt in den Farms.« gab ich möglichst cool zurück. »Nicht schlecht!« meinte sie noch anerkennend, bevor sie mit geübten Händen die Waffe reinigte und dann in die verschlossene Kiste zu den anderen legte. »Dann biste ja bereit für was Größeres!« warf sie mir zu. Ich sah sie fragend an. »Fred spricht nachher mit dir. Nimm dir erst mal was zu beißen, geht gleich los.« Auch Jill, so musste ich feststellen, hatte sich Freds Tempo angepasst. Na sei es drum, was Besseres hatte ich ohnehin nicht zu tun. Das Dach hatte vielleicht hundertfünfzig Quadratmeter, aber durch die ganzen Verschläge, das improvisierte Mobiliar und die Infrastruktur zur Wassergewinnung wirkte es wie ein Minidorf. Ich nahm mir eine der begehrten Wasserflaschen und biss herzhaft in ein Dauerwurst-Scheibenkäse-Sandwich. Ein Hochgenuss. Vielleicht nicht zu normalen Zeiten, aber so wie es uns aktuell ging, war einfach nichts normal. Nach meiner kleinen Runde machte ich es mir auf meinem Feldbett bequem. Es war schon seltsam, so dachte ich bei mir. Wahrscheinlich war eine Autostunde nach Osten alles wie immer. Die Leute gingen zur Arbeit, trieben Sport, sahen fern, aßen Junkfood, stritten sich wegen nichts, fickten und schliefen in klimatisierten Räumen. Während wir hier auf einem Teerdach ausharrten und – in meinem Fall - von Tieren gejagt wurden die man sonst nur aus dem Streichelzoo kannte. Im Westen wurde es immer dunkler. Ich hielt es für ausgeschlossen, dass heute noch etwas von Relevanz passierte, trotz Freds Ansage und machte die Augen zu.
Ein später Besucher
Etwas später riss ich sie wieder auf, als Alarmrufe über das Dach gellten. Ich musste gerade richtig weggenickt sein, denn ich sah mich für einige Augenblicke verwirrt um und fragte mich, wer um alles in der Welt plötzlich das Schreien anfing während ich gerade am Verdauen war. Es war mittlerweile stockdunkel, so dass einige Gaslampen entzündet worden waren um uns etwas Licht zu verschaffen. Der Ruf kam von einer der Wachen, die Fred für die Nacht eingeteilt hatte. Einige der anderen von uns waren schon aus den Schlafsäcken gesprungen und auf dem Weg zur Dachkante. »Verletzte!« schallte es von dort bald. Und: »Kein Feuer!« Feuer war mit unsere größte Gefahr hier oben. Wenn das Haus unter uns brannte, wurde es sehr ungemütlich. Das musste auf jeden Fall verhindert werden. Daher war es auch nicht erlaubt gewesen, ohne Erlaubnis ein Feuer anzumachen oder einen Gaskocher zu benutzen. Wir hatten von anderen Camps gehört, die damit verdammt schlechte Erfahrung gemacht hatten. Der Ruf Kein Feuer war also tröstlich, obwohl er von Verletzte schnell relativiert wurde.
Der Verletzte war eine junge Frau mit einer üblen Wunde am Bauch. Zwei von unseren Dachleuten schleppten sie aus einer Seitenstraße heran. Fred dirigierte schnell und geschickt weitere Helfer die Feuerleiter herunter. Während die beiden Retter etwas außer Atem aber sonst unversehrt in der Kühle der Nacht ausdampften, wand sich die Frau mit Schmerzen auf dem Boden. Ich hatte ein wenig Ahnung von erster Hilfe und dem Behandeln von Verletzungen. Daher schob ich mich durch die Dachbewohner nach vorne. Nicht, dass diese keine Ahnung hatten, aber ich hatte lieber die Hand drauf, wie man so schön sagt. Vielleicht war ich auch der nächste Fred, wer weiß? So präsent wie ich mich machte, war ich wahrscheinlich wie geschaffen dafür.
Die Frau presste sich die Hand auf den Bauch, um Blut und Schmerz im Zaum zu halten. Wir mussten sie beruhigen, um sie dazu zu bringen die Hand wegzunehmen. Die Wunde war ein hässlicher Riss, der durch die Haut ins Fettgewebe gegangen war. Sehr schmerzhaft und es würde eine Narbe bleiben, aber nichts weiter Gefährliches. Wahrscheinlich hatte sie Glück im Unglück, dass sie den Angriff (ich ging davon aus, dass es einer gewesen war) überlebt hatte und auch sonst unbeschadet geblieben war. Als ich ihr die Wunde mit einem sterilen Tuch und etwas Mull provisorisch verbinden wollte, setzte sie sich auf. »Bleib liegen!« wies ich sie an. »Sonst geht die Wunde gleich wieder auf und du verlierst noch mehr Blut. Wir müssen jemanden finden, der das ordentlich näht.« Zu meiner Verwunderung antwortete sie: »Nein, nein ... geht schon.« Ihr Atem wurde ruhiger und sie sah von jetzt auf gleich deutlich vitaler aus. »Ein bisschen Wasser, dann wird das schon wieder. Wäre ja gelacht!« Ich wurde stutzig ob ihres Verhaltens. »Bleib nochmal kurz liegen.« wies ich sie erneut an. Dann wickelte ich den Mull rückwärts wieder ab. Unter den Klammern waren nur noch Kratzer zu sehen, wie von einer Schürfwunde. Dort, wo eben noch ein ordentlicher gezackter Riss gewesen war, war das Gewebe in Rekordzeit geheilt. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich stand auf und wich einen Schritt zurück. »Was hast du denn?« fragte die junge Frau verwirrt. »Stimmt etwas nicht?« »Ja, leider.« antwortete ich ihr fast tonlos. Und dann, etwas lauter: »Fred!« Fred schob sich ebenfalls durch die Umstehenden nach vorne und sah mich fragend an. »Die Wunde.« Ich deutete auf die Stelle, die eben noch stark geblutet hatte. Die Kleidung der Frau war um den ehemaligen Schnitt herum schwarz von getrocknetem Blut. »Sie ist geschlossen.« setzte ich nach. Fred sah der Frau in die Augen. In seinem Blick lag Mitleid. »Tut mir leid.« brachte er hervor. »Sie sind infiziert.« »Nein, das kann nicht sein!« rief die Frau. »Ich hatte keinen Kontakt zu infizierten! Und die Wunde vorhin habe ich mir bei einem Sturz geholt, ich wurde nicht gekratzt!« Sie spürte, dass es buchstäblich um ihr Leben ging. »Ein Schluck Wasser aus der falschen Stelle reicht bereits. Wahrscheinlich haben Sie es noch nicht einmal gemerkt.« »Ich ...« Die Frau wollte noch einmal zu einer Verteidigung ansetzen, dann aber schwand ihr Widerstand. »Ich hatte solchen Durst! Die Automaten in der Alley sind alle leer. Und das Wasser in einem der Kanister sah sauber aus. Es roch auch gut!« Tränen stiegen ihr in die Augen. »Was soll ich jetzt tun?« Was die Frau vielleicht spüren konnte, aber nicht sah, war die etwa golfballgroße Schwellung, die sich still und leise an ihrem Rücken ausgebildet hatte. Ich sah sie durch Zufall, da das Licht einer unserer Lampen von hinten auf sie fiel. Wie an einer subkutanen Schnur gezogen, bewegte sie sich aufwärts immer an der Wirbelsäule entlang. In anderen Camps hatte sich die Legende gebildet, dass es sich dabei statt um eine bakterielle Entzündung um eine exotische Käferart handelte, die sich bei Menschen einnistete und die Infektion verursachte. Das wäre schön gewesen, denn Käfer hätten wir deutlich besser unter Kontrolle bekommen können. Der Golfball brauchte etwa zehn Sekunden, dann hatte er den Rücken der Frau durchmessen. »Fred!« mahnte ich mit eindringlicher Stimme und nickte diskret in Richtung ihres Rückens. »Was kann ich tun?« wiederholte die Frau. Fred sah kurz zu mir und dann wieder zu ihr. »Nichts mehr. Tut mir leid.« schloss Fred. Die Frau erfuhr nie, was sie nur einen Augenblick später traf. Aus der Menge war ein Bewohner hervorgetreten, der die einzige Heilung brachte die wir kannten: Den schnellen und schmerzlosen Tod. In diesem Fall durch einen kräftigen Hieb mit einem Stahlrohr in den Nacken. Einige Freiwillige brachten den Körper, der nur kurze Zeit vorher noch die junge Frau gewesen war, zu einem verschließbaren Raum in einem der anderen Gebäude. Wir hatten meist keine Zeit, ein Grab auszuheben um unsere Toten zu bestatten. Und so wurden sie gelagert, in von außen abschließbaren Räumen, gut sichtbar als improvisierte Krypta markiert. Wie viele dieser Gräber es in der Stadt geben mochte, wagte niemand zu schätzen.
Nachdem sich die Szenerie aufgelöst hatte und etwas Ruhe eingekehrt war, kletterten wir nach oben, aufs Dach, zurück. Fred nahm mich beiseite. »Leg dich wieder schlafen. Heute Nacht geht nirgendwer mehr runter. Morgen Früh nach dem Frühstück geht es für dich weiter.« Na, wenigstens gab es vor dem nächsten Trip noch was zu essen.





























