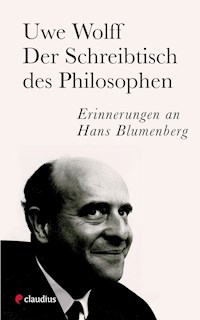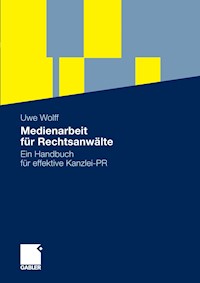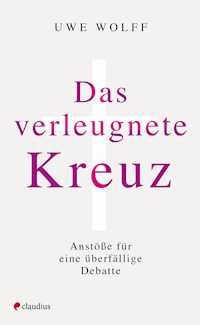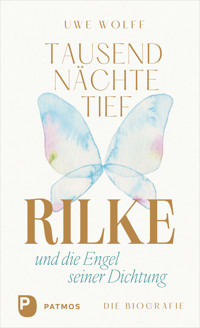
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Lebensthemen sucht sich niemand aus. Oft wirken sie im Verborgenen, manchmal werden sie drängend und verlangen nach Klärung. Sie wollen geleistet werden, wusste Rainer Maria Rilke (1875–1926). Dass bislang niemand eine Biografie über Rilke und seine Engel geschrieben hat, ist erstaunlich. Offenbar fliegen Engel unter dem Radar der Wahrnehmung. Den Wissenschaften sind sie zu flatterhaft, den Kirchen zu esoterisch. Rilkes Freundinnen aber nahmen die Engel als sein Lebensthema ernst. Dem geht Uwe Wolff in dieser spirituellen Biografie nach. Er erzählt von Rilkes innerem Leben und von jenen Frauen, die seinen Weg zur Vollendung der »Duineser Elegien« begleiteten, seiner größten Dichtung – mit ihrem Leitmotiv: den Engeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»Einzeln sind wir Engel nicht; zusammenbilden wir den Engel unsrer Liebe«(Rainer Maria Rilke an Lou Albert-Lasard)
Inhalt
Sternstunde mit Engeln:Schloss Duino – ein Kraftort
Kindheit:Der Junge in Mädchenkleidern
Valerie von David-Rhonfeld:Wer ist Rilke?
Heiliges Russland:An der Seite von Lou Andreas-Salomé
Ehe und Vaterschaft:Der Kampf mit dem Engel der Berufung
Der engelgleiche Mann:Begleiterinnen und Weggefährtinnen
Duineser Elegien:Die große Herrlichkeit
Die Unvergleichliche:Nanny Wunderly-Volkart
Marina Zwetajewa:»ganz Russland heult nach Dir«
Valmont und Raron:Tod und Begräbnis
Testament:Der Rose reiner Widerspruch
Literaturverzeichnis
ÜBER DEN AUTOR
ÜBER DAS BUCH
IMPRESSUM
HINWEISE DES VERLAGS
Anmerkungen
Sternstunde mit Engeln:Schloss Duino – ein Kraftort
Mit großer Freudebetrachtete er die prachtvollen Engelgestalten der Bibel:die drei Engel, die zu Abraham kamen,der Engel, welcher mit Sarah sprach –immer diese Engel,die er unaufhörlich suchte …(Fürstin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe,Erinnerungen an Rainer Maria Rilke)
Hoch über der Adria ruht das Schloss Duino. Es gehörte Fürstin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe (1855–1934). Unter ihrem Schutz schrieb Rainer Maria Rilke (1875–1926) im Winter 1911/12 die ersten jener weltberühmten zehn Engelgedichte, die später nach ihrem Ursprungsort »Duineser Elegien« genannt wurden. Vollendet wurden sie erst zehn Jahre darauf in einem Walliser Schlossturm. Dieses Mal stand Nanny Wunderly-Volkart (1878–1962) Rilke zur Seite. Der Fürstin aus uraltem katholischem Adel und der seelenverwandten Freundin aus der reformierten Schweiz verdanken wir Rilkes Engelgedichte. Heute gehören sie zur Weltliteratur und sind in viele Sprachen übersetzt worden.
Noch immer gibt es Besucherinnen des Kultortes Duino, die viele Verse von Rilkes Dichtung aus dem Gedächtnis zitieren können. Nach einer Besichtigung des Schlosses wandern sie auf dem Rilkeweg (»Sentiero Rilke«), vorbei an Überresten von Bunkern aus dem Ersten Weltkrieg, hinunter in die Bucht von Sistiana. Wer nach der Begegnung mit den himmlischen Mächten Erdung im Irdischen sucht, findet sie bei einer Grillplatte im »Rifugio Rilke«. Den Dichter hätte er in dieser lauten Bar mit herrlichem Meerblick allerdings nicht angetroffen. Der schmächtige kleine Mann mit Schuhgröße 38 und einem Körpergewicht von 50 Kilogramm war Vegetarier und nahm wegen seines Reizmagens die kargen Mahlzeiten am liebsten allein ein.
Schloss Duino war sein Kraftort: Eine Stätte der Begegnung des europäischen Hochadels, der internationalen Politik und der Kunst, ein magischer Raum der Beschwörung von Geistern bei spiritistischen Sitzungen. Rilke war offen für das Wunder, das Geheimnisvolle und Unergründliche, für Signale aus dem Weltall und dem Weltinnenraum der Seele.
Das im Mittelalter erbaute Schloss über dem Meer erfuhr Zerstörungen und wurde immer wieder neu errichtet oder erweitert. 1916 erlebte es den Beschuss durch die italienische Marine. Nach dem Wiederaufbau bezog die deutsche Kriegsmarine dort Quartier. Dann kamen Titos Partisanen und später die Alliierten. Sie blieben bis 1954 im Hauptquartier für die Zone A des Freistaates Triest. Rilkes Engel wissen wie das Leben spielt. Zwischen den ersten Versen der Engeldichtung und ihrer Vollendung liegt der Erste Weltkrieg. Rilke musste nicht wie unzählige Männer seiner Generation an eine der Fronten ziehen und sich den Stahlgewittern aussetzen. Adelige Freundinnen bewirkten seine Freistellung vom Militärdienst. So überlebte der Dichter und mit ihm seine Dichtung. Die »Duineser Elegien« sind auch ein Spiegel jener schrecklichen Jahre.
Rilkes Engelgedichte sind keine leichte Kost und keine fröhlichen Muntermacher für Geschenkbücher. Elegien sind Klagegesänge wie der liturgische Ruf »Kyrie eleison! – Herr, erbarme Dich!« – in der Kirche oder im »Requiem« von Wolfgang Amadeus Mozart. Sind Engel nicht Ausdruck der Lebensfreude, des Vertrauens, der Zuversicht, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe? Gewiss. Was aber geschieht, wenn sich das Leben im Krisenmodus bewegt und Beistand so bitter nötig ist wie nie zuvor? Dann ist Engelsgeduld gefordert.
Rilke befindet sich seit Jahren in einer Dauerkrise, als er im Winter 1911/12 auf Schloss Duino Quartier bezieht. Die Gastgeberin und der Dichter hatten sich in Paris kennengelernt. Hier führte die Fürstin einen Salon, in dem sich Kulturträger jener Vorkriegszeit mit den Schönen und Reichen zu gegenseitiger Förderung trafen. Rilke brauchte Geld. Andere Schriftsteller übten neben ihrer Dichtkunst einen Brotberuf aus. Franz Kafka arbeitete bei einer Prager Versicherung als Jurist, die junge Agnes Miegel verdiente ihren Lebensunterhalt als Lehrerin, Gottfried Benn und Hans Carossa waren Ärzte. In den Salons der Welt von gestern traf Rilke Menschen mit unerschöpflichem finanziellem Hintergrund. Doch war mäzenatische Zuwendung nicht ohne Gegenleistung zu bekommen. Die fürstliche Unterstützung von Rainer Maria Rilke war auch eine Investition in die Zukunft. Reichtum kann vergehen, Schlösser können zerfallen, Literatur von Weltrang aber bleibt: Sie verwandelt Lebenszeit in Weltzeit. So dachte mancher Wohltäter in einer Zeit, die sich die kommenden Bildungsverluste nicht vorstellen konnte. Vielleicht werden eines Tages selbst die Namen von Johann Wolfgang von Goethe und Thomas Mann vergessen sein, vielleicht wird niemand mehr wissen, wer Plato oder William Shakespeare war, doch heute ist Rilkes Name noch immer ein Publikumsmagnet und erstaunlich viele Menschen kaufen und verschenken nicht nur seine Bücher, sondern lesen sie und lernen sogar einzelne Verse auswendig. Rilke liebte es, im kleinen Kreis oder in trauter Zweisamkeit seine Gedichte vorzutragen.
Die Fürstin begegnete in ihrem Salon keinem Unbekannten. Ihr Hausphilosoph Rudolf Kassner (1873–1959) hatte sie auf den Dichter aufmerksam gemacht, der noch jünger aussah, als er an Jahren zählte. Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe war nicht nur vermögend, sondern konnte Gespräche in sechs europäischen Sprachen führen. Sie hatte Rilkes Talent erkannt und trieb ihn mit Ungeduld und Strenge, seinem Ruf als Dichter zu folgen und sich nicht in Nichtigkeiten zu verzetteln. Aus ihrer weit verzweigten Familie sind Nonnen und Priester mit erheblichem Einfluss auf den Vatikan hervorgegangen, darunter der Kurienkardinal Gustav Adolf Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1823–1886). Aus Angst vor möglichen Giftanschlägen der Jesuiten hatte er bei jeder Messe einen Vorkoster. Streitbar war auch die 20 Jahre ältere Fürstin. Sie hätte Rilkes Mutter sein können, doch pflegte sie kein mütterliches Verhältnis zu ihrem Dichter. Vielmehr wirkte sie wie eine Lehrerin uralter Schule: immer fordernd und fördernd, immer hilfsbereit, doch stets an einem Ziel ausgerichtet. Eine Frau mit hoher Selbstdisziplin, gereift in den Schicksalsschlägen des Lebens, die Orientierung schenkte, Klartext sprach und alles Getue verachtete. Wenn sie Rilke zu langen Aufenthalten auf ihren Schlössern einlud oder ihren Fahrer freistellte, damit er Rilke quer durch Europa kutschierte – Übernachtungen in den besten Hotels am Platze selbstverständlich inbegriffen –, so erwartete sie von ihm eine entsprechende Gegenleistung: die Vollendung der »Duineser Elegien«.
Schloss Duino war Rilke von früheren Besuchen vertraut und als Schreibklausur bewusst gewählt worden, als er im Herbst 1911 an die Adria reist. Hier hatte er ideale Arbeitsbedingungen. Aber hohe Dichtung ist mehr als ein Handwerk. Seminare für kreatives Schreiben lehren das Verseschmieden. Ein Johann Wolfgang von Goethe, ein Friedrich Hölderlin, ein August von Platen oder ein Rainer Maria Rilke ist noch nie aus einer Schreibschule hervorgegangen. Dichtung ist unverfügbar wie die Gnade. Engel erscheinen nicht auf Kommando. Doch gilt es, sich für ihre Ankunft bereit zu halten und dem Wunder die Hand auszustrecken. Rilke kannte schwere Anfechtungen, aber er hatte auch zuweilen Engelsgeduld.
Nachdem Rilke die ersten Verse seiner Engeldichtung wie ein Geschenk empfangen hatte, verstummte die Stimme der Inspiration. Zehn Jahre wird es dauern, bis er vollenden konnte, was auf Duino begonnen wurde. Die Engel sind sein Lebensthema. Lebensthemen sucht sich niemand aus. Sie sind einfach da und mit der Geburt als Auftrag gegeben. Manchmal wirken sie still im Verborgenen, manchmal werden sie drängend und verlangen nach rascher Klärung. Sie wollen geleistet werden.
Kindheit:Der Junge in Mädchenkleidern
Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunftwerden weniger … Überzähliges Daseinentspringt mir im Herzen.(Rainer Maria Rilke, IX. Duineser Elegie)
Rose Ausländer, Annette von Droste-Hülshoff, Mascha Kaleko oder Marie-Luise Kaschnitz haben wunderbare Engelgedichte geschrieben. Doch machen Engel keinen Unterschied zwischen schreibenden Frauen und Männern. Fragen des Geschlechtes interessieren die Wegbegleiter nicht. Sie verlangen nicht einmal ein Bekenntnis oder eine Kirchenmitgliedschaft als Vorleistung für ihre Gegenwart. Engel schaffen Tatsachen, überzeugen durch ihr Erscheinen und sind immer für eine Überraschung gut. Selbst Zweifler und Zyniker können zu Zeugen ihres Wirkens werden. So bekennt Gottfried Benn (1886–1956), er habe Menschen mit der reinen Stirn der Engel getroffen und sich oft gefragt, woher das Gute komme, ohne eine Antwort zu finden. Engel vom Himmel und Engel in Menschengestalt überzeugen durch reine Gegenwart. Ein Licht geht auf, wo Dunkelheit herrschte. Klarheit und Klärung kommen.
»Handle so, dass die Engel zu tun bekommen!«, lautete Franz Kafkas (1883–1924) humorvolle Empfehlung für den Umgang mit Engeln. Als Rainer Maria Rilke am 4. Dezember 1875 in Prag geboren wurde, waren Schutzengelbilder nicht nur in katholischen Häusern zu finden. Engelbilder waren Gebrauchskunst, Ikonen zum Innehalten und Niederknien, Einladung zum Lobpreis und Rühmen. Kinder verrichteten ihre Abendgebete unter den beliebten Reproduktionen des Schutzengelmalers Bernhard Plockhorst (1825–1907). Auf ihnen waren weibliche Engel mit weit ausladenden weißen Flügeln zu sehen, unter denen ein Mädchen im rosa Kleid und ein Junge mit blauer Hose sicheres Geleit auf dem Lebensweg erfuhren. Schutzengel sahen aus wie jugendliche Mütter in weißen wallenden Nachthemden. Rosa galt noch über ein Jahrhundert als Mädchenfarbe. Auf dem Bild symbolisierte ein wild tosender Bach all jene Strömungen des Lebens, die Kindern gefährlich werden können. Wie man den Gefahren begegnet, zeigte der Schutzengel. Er führte die Kinder über einen schmalen Steg und wehrte dabei mit sicherem Tritt eine Schlange als Symbol des Bösen ab.
Damals hingen in den Wohn- und Arbeitszimmern des Bürgertums Reproduktionen von Raffaels »Sixtinischer Madonna« mit ihren weltberühmten Putten. Da die wenigsten Häuser über Wohnraum in den Dimensionen der Dresdner Galerie Alte Meister verfügten, gab es die Madonna mit dem Kind und die zwei Kinderengel als Einzeldrucke. Leo Tolstoj schrieb seine Romane und Erzählungen unter ihrem Schutz. In England schufen Maler wie Edward Burne-Jones oder John William Waterhouse ätherische Engelgestalten aus der Anderwelt neben mädchenhaften Madonnen und erschöpften Artusrittern. Rilke liebte zarte Mädchengestalten wie Abisag von Sunem. Sie sind dem jungen Dichter ein Symbol der Sehnsucht nach beflügelnder Liebe:
Plötzlich bin ich wie verstoßen,und zu einem Übergroßenwird mir diese Einsamkeit,wenn, auf meiner Brüste Hügelnstehend, mein Gefühl nach Flügelnoder einem Ende schreit.(Rainer Maria Rilke, Mädchen-Klage)
Entweder – oder: Die Schutzengel des späten 19. Jahrhunderts schufen eine Gegenwelt zum Maschinenzeitalter und der Industrialisierung. Sie boten einer spirituell entwurzelten Generation ein Refugium und eine Gegenwelt zum aufkommenden Atheismus und Materialismus. In einer Zeit noch immer hoher Kindersterblichkeit gehörten sie zu den Ritualen der Trauerarbeit. Der Maler Wilhelm von Kügelgen berichtet in seinem Bestseller »Jugenderinnerungen eines alten Mannes« (1870) von seinen früh gestorbenen Geschwistern. Nach dem Glauben der Eltern wurden diese Familienmitglieder mit ihrem Tod zu Engeln, die ihre Flügel schützend über ihre irdischen Geschwister hielten. Auch in der Familie der französischen Nationalheiligen Therese von Lisieux glaubten die Schwestern an die unsichtbare Gegenwart ihrer früh verstorbenen Brüder in der Gestalt von Schutzengeln.
Rainer Maria Rilke war wie Annette von Droste-Hülshoff ein Siebenmonatskind. Die Sorge um seine immer angegriffene Gesundheit hat seine Mutter Sophie Rilke nie verlassen. Auch deshalb suchte sie den Beistand der Engel und Heiligen. Jeder Tag im katholischen Kalender hat seinen Heiligen. Rilke wurde am Barbaratag geboren. Diese Heilige gilt als Schutzpatronin der Bergleute und aller Menschen, die mit Entschiedenheit ihre Bestimmung suchen und leben wollen. Auf Bildern wie Raffaels »Sixtinischer Madonna« erkennt man Heilige an ihrem Attribut. Barbaras Symbol ist der Turm. Als Barbara ihren spirituellen Weg unbeirrt ging, ließ sie ihr Vater in einen Turm einmauern. Natürlich konnte er mit dieser brutalen Maßnahme den Willen seiner Tochter nicht brechen. So wurde die Schutzpatronin auch zum Vorbild für Rilke, der seine Engelgesänge der »Duineser Elegien« im Turm von Muzot im Schweizerischen Wallis vollenden wird.
Sophie Rilke (1851–1931) trug den Namen der göttlichen Weisheit, die besonders in der russischen orthodoxen Kirche verehrt wird. Früh trennte sie sich von ihrem Mann Josef Rilke (1838–1906). Die beiden hatten am 24. Mai 1873 geheiratet. Ihr erstes Kind war ein Mädchen. Es soll den Namen Zesa getragen haben. Diesen überliefert die in biografischen Dingen nicht immer glaubwürdige Jugendfreundin Rainer Maria Rilkes, Valerie von David-Rhonfeld (1874–1947). Rilkes Schwester kam ebenfalls als »Frühchen« auf die Welt und starb kurz nach der Geburt. Als Rainer Maria Rilke am Barbaratag des Jahres 1875 in einer Hausgeburt in der Prager Heinrichsgasse 19 zur Welt kam, ergriff die traumatisierte Mutter erneut Panik. Sollte auch dieses Kind sterben? Als Katholikin suchte sie den Schutz der Muttergottes und weihte ihren Sohn der Maria. Am 19. Dezember 1875 wurde das Kind in der Prager Kirche St. Heinrich II. und Kunigunde getauft. Die Mutter gab ihm den sprechenden Namen René (»renatus«) – der Wiedergeborene. Das war eine Rollenzuweisung und eine Deutung des Verlustes ihres ersten Kindes. Sophie wollte in dem Säugling die wiedergeborene Tochter erkennen. Erst Rilkes Freundin Lou Andreas-Salomé (1861–1937) wird ihn dazu auffordern, seinen Vornamen René zu ändern.
Der Vater bleibt in Rilkes Leben eine unbedeutende, aber auch unbelastete Figur. Rilke ist ohne ein Vaterbild, an dem er sich messen, reiben und aufrichten konnte, durch die Pubertät geschritten. Es gibt in seinem Leben keine Männerfreundschaften, keinen »besten Freund«, nicht einmal einen männlichen Gegner von Rang. Jean Rudolf von Salis (1901–1996) sieht bei Rilke »ein Element femininer Seelenveranlagung«.1 Doch was ist männlich, was weiblich?
Josef Rilke hatte aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst beim Militär beenden müssen. Das Soldatentum und besonders die Offizierslaufbahn standen damals in hohem Ansehen, wenngleich sich hinter der Fassade der Uniformen durchaus fragwürdige Existenzen verbergen konnten. Theodor Fontanes Romane mit ihren überragenden Frauengestalten zeigen die Brüchigkeit dieser Männerwelt. Rilkes Vater wurde nach der Aufgabe des Militärdienstes Eisenbahner. Warum sich die Eltern bereits 1884 räumlich trennten, ist nicht bekannt. Sophie Rilke kam aus einem vermögenden Elternhaus. Rilkes Vater war ein armer Schlucker. Es waren jedoch gewiss nicht nur die sozialen Unterschiede, die zu einer Trennung führten. Rilkes Mutter litt an einer Hypersensibilität, die sich zuweilen auch motorisch durch das Zittern ihrer Hände bei gleichzeitiger Entschiedenheit in ihrer Stimme mit österreichischem Akzent bemerkbar machte. Sophie Rilke wusste, was sie wollte. Im Katholizismus mit seinen Ritualen fand ihr Leben die Form, derer es bedurfte. Vielleicht konnte oder wollte der Vater diesen strengen religiösen Weg nicht teilen. Josef war über lange Zeit der beliebteste katholische Vorname für Jungen. Auch nicht religiöse oder der Kirche entfremdete Menschen wussten, dass Josef der Adoptivvater Jesu war. Tischler von Beruf und eine Generation älter als Maria, hatte der verwitwete Familienvater die Tempeljungfrau geheiratet, um ihr den Schutz der »Engelehe« zu bieten. Als »Josefsehe« ist sie noch heute unter Paaren bekannt, die aus ganz unterschiedlichen Gründen keinen Sex haben wollen.
Die ebenfalls Gedichte schreibende Mäzenin Hertha Koenig (1884–1976) war mit Sophie Rilke befreundet und hat in ihren Erinnerungen »Rilkes Mutter« (1963) das Bild einer Frau mit entschieden religiöser Ausstrahlung gezeichnet. Wie die Nonnen stand sie morgens um fünf Uhr auf und folgte über den ganzen Tag dem Stundengebet ihrer Kirche. In diesem spirituellen Rhythmus wuchs auch ihr Sohn auf. Die Mutter lehrte ihn das Beten und Niederknien. Gemeinsam besuchten sie täglich die Messe. Direkt neben ihrer Schlafstätte befand sich ein Gebetsstuhl, in dem das »Renétscherl« neben der Mutter kniete oder allein, wenn sie krank oder kränkelnd im Bett lag. Dann sprach er voll Liebe und Fürsorge seine Fürbitten zur Gesundung der Mutter. Vor dem Zubettgehen küsste er das Kruzifix. In dem Roman einer Krise »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge« (1910) hat Rilke diese Kindheitsmuster übernommen und auf den dänischen Helden übertragen. Die Romanfigur teilt auch die Liebe des Autors zu Hunden und Kaninchen. Malte vollzieht nicht nur den Rollenwechsel vom Jungen zum Mädchen, er trägt sogar den Namen von Rilkes Mutter Sophie:
Es fiel uns ein, daß es eine Zeit gab, wo Maman wünschte, daß ich ein kleines Mädchen wäre und nicht dieser Junge, der ich nun einmal war. Ich hatte das irgendwie erraten, und ich war auf den Gedanken gekommen, manchmal nachmittags an Mamans Türe zu klopfen. Wenn sie dann fragte, wer da wäre, so war ich glücklich, draußen »Sophie« zu rufen, wobei ich meine kleine Stimme so zierlich machte, daß sie mich in der Kehle kitzelte. Und wenn ich dann eintrat (in dem kleinen mädchenhaften Hauskleid, das ich ohnehin trug, mit ganz hinaufgerollten Ärmeln), so war ich einfach Sophie, Mamas kleine Sophie, die sich häuslich beschäftigte und der Maman einen Zopf flechten mußte, damit keine Verwechselung stattfinde mit dem bösen Malte, wenn er je wiederkäme.
Man mag von diesen Ritualen halten, was man will. Für Rilkes seelische Entwicklung und sein Frauenbild waren sie prägend. Der Dichter ist Frauen immer mit Achtsamkeit und Respekt begegnet. Doch seine Ehe und alle Liebesbeziehungen scheiterten. Er war wie ein Minnesänger aus alter Zeit bereit zum Dienen und Niederknien. Aber er hatte auch immer seinen eigenen Vorteil im Blick. Rilke hat bis zu seiner Einschulung Mädchenkleider getragen. So wollte es die Mutter. Also wollte er es auch. Dass sich Jungen im Karneval als Mädchen verkleiden und einen Rollenwechsel auf Zeit durchführen, gehört zum Spiel der Erprobung von Identität. Im Rollenspiel mag sich eine noch unbekannte und unbenannte Sehnsucht nach einem anderen Körper andeuten. Als Kleinkind hat Rilke unmittelbar erlebt, wie sein Auftritt in Mädchenkleidern der Mutter Freude bereitete. Später hat er im Rückblick des Gedichtes »Kindheit« Befremdung formuliert. Hat er sie bereits als Kind empfunden, aber nicht ausgesprochen?
Und durch das alles gehn im kleinen Kleid,ganz anders als die andern gehn und gingen –:O wunderliche Zeit, o Zeitverbringen,o Einsamkeit.
Rilke liebte die Einsamkeit, war sie doch Voraussetzung für sein Schreiben. Die Zweisamkeit mit der Mutter hatte vielleicht eine Einsamkeit in der Beziehung zu anderen Kindern zur Folge. Hatte der Junge in Mädchenkleidern Freunde oder Freundinnen? Wurde er wegen seiner Verkleidung gemieden? Immerhin hatte der Knabe einen Freund auf vier Beinen an der Seite: einen kleinen Terrier, so unruhig und immer unter Spannung stehend wie die Mutter, doch sehr gut erzogen und daher aufs Wort folgend.
In dem kleinen Zyklus »Aus einer Sturmnacht« erinnert sich Rilke an seine Schwester Zesa, deren ungelebtes Leben er nach dem Willen der Mutter führte:
In solchen Nächten wächst mein Schwesterlein,das vor mir war und vor mir starb, ganz klein.Viel solcher Nächte waren schon seither:Sie muß schön sein. Bald wird irgendwer sie frein.
Jeder Mensch habe seinen eigenen Schutzengel. Davon war Rilke überzeugt. Andere Religionen sprechen vom Karma, den Schicksalsfäden der Nornen. Doch nicht alles kommt vom Himmel oder liegt in den Genen. Jedes Kind bewegt sich auch im Netzwerk der Familienaufstellung. Rilke hat seine Rolle als wiedergeborenes Mädchen gerne gespielt. Er besaß eine sehr empfindsame Natur, kränkelte oder war tatsächlich krank. Welcher Lehrer wollte hier ein Urteil fällen? So kam der junge Rilke unter dem Schutz seiner Mutter zu einer enormen Fehlstundenzahl in der Schule. Offenbar wuchs er in einem schulischen Umfeld auf, das seine Sonderrolle akzeptierte. Noch als Elfjähriger reiste er zur Einschulung in die Militärunterrealschule St. Pölten mit einem Koffer voll Spitzenunterwäsche und Rüschenhemdchen. Die Nächte im Schlafsaal mit 40 oder mehr Kameraden waren eine Qual, aber gequält wurde der Sonderling nicht. Er war so anders als seine Mitschüler, so fremd und wie von einem anderen Stern, dass sie ihn nicht nach Schülerart ausgrenzten, sondern ihm Bewunderung zollten. Rilke hatte im Rollenwechsel jene Resilienz erworben, die ihn als Fremdling in der Fremde überleben ließ. Bereits in der Militärschule war er als dichtender Kauz geachtet und durfte zu Beginn der Stunde nach vorne zum Lehrerpult kommen, um seine Verse vorzutragen. Diese Integration des fremden Kindes war nur möglich auf dem Hintergrund einer Kultur, in der Dichtung und der dichterisch Begabte einen besonderen Rang außerhalb der Normen einnahm.