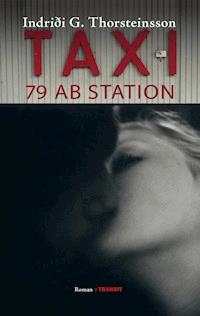
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Reykjavik, Anfang der fünfziger Jahre: Ragnar, Taxifahrer, fährt einen betrunkenen amerikanischen Soldaten zu seinem Luftwaffenstützpunkt in Keavik. Auf der Rückfahrt sieht er eine auffällig elegante Frau vor ihrem liegengebliebenen Buick stehen; er stoppt und bietet seine Hilfe an. Aus dieser Bekanntschaft entwickelt sich eine heftige Liebesbeziehung, die in Eifersucht und andere Turbulenzen gerät, als Ragnar von Gógós Ehemann und dazu noch von einem weiteren Liebhaber namens Bill, einem amerikanischen Soldaten, erfährt. Ein temporeicher, hinreißend trocken geschriebener Roman aus den fünfziger Jahren, als Island sich plötzlich in der modernen, von Amerika geprägten Zeit wiederfand - mit völlig veränderten Lebens- und Moralvorstellungen. Die Geschichte einer fast unmöglichen Liebe - und gerade darum so spannend
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Ähnliche
Inhalte
Impressum
Titelseite
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
Die Veröffentlichung dieses Buches wurde finanziell unterstützt
durch: Bókmenntasjóður, Isländischer Literaturfonds.
© Estate of Indriði G. Þorsteinsson
Originaltitel: 79 af stöðinni, 1955
Veröffentlicht mit Genehmigung von
Forlagið Publishing. www.forlagid.is
© 2011 für die deutsche Übersetzung:
: TRANSIT Buchverlag GmbH, Berlin
www.transit-verlag.de
Umschlag und Layout: Gudrun Fröba
eISBN: 978-3-88747-261-0
Indriði G. Thorsteinsson
Taxi 79 ab Station
Aus dem Isländischen übersetzt
von Betty Wahl
EINS
Es war ein Abend im Mai. An diesem Tag waren vier Düsenmaschinen über Reykjavík geflogen. In beträchtlicher Flughöhe hatten sie die Stadt überquert, und kaum jemand beachtete sie; an das ständige Pfeifen der Triebwerke hatte man sich längst gewöhnt. Die Maschinen waren im großen Bogen westlich über den Faxaflói geflogen, dann über der Halbinsel Reykjanes heruntergegangen und schließlich auf dem Flughafen von Keflavík gelandet. Es war ein ruhiger Abend.
Drei Männer betraten die Hotelhalle und nahmen am Tisch unter der Zimmerpalme Platz. Sie bestellten eine Runde Doppelte, kippten sie hinunter und ließen sich gleich noch einmal nachfüllen. Einer von ihnen war Martinez, Unteroffizier der amerikanischen Luftwaffe. Die beiden anderen, der Kleine Mann und der Uhrmacher, waren seine Kameraden und schienen viele der Anwesenden zu kennen. Es hatte geregnet, und nun hingen zähe Nebelschwaden in der Luft, obwohl es noch am Morgen sonnig gewesen war. Im Hoteleingang glitzerte es feucht in den Haaren der hereinkommenden Gäste. Der Straßenlärm drang nur gedämpft durch den Nebel und war für das Grüppchen unter der Palme kaum zu hören. Der Kleine Mann erhob sein Glas. Er war in irgendeinem Ministerium beschäftigt, schon sein Vater hatte in schweren Zeiten einen Ministerposten bekleidet und dabei wenig Dankbarkeit geerntet. Mit dem erhobenen Glas in der Hand wandte er sich jetzt an Martinez: Sein Name erinnere ihn an Rum, aber daran war Martinez schon gewöhnt. Er stammte aus einer spanischen Familie, war klein und dunkelhaarig, mit gelblicher Gesichtsfarbe, einer breiten Nase und tiefbraunen Augen. Auf seinem Haar lag ein bläulich schwarzer Schimmer. Er habe gar nicht gewusst, einen so bedeutungsvollen Namen zu tragen, sagte er und strich sich über seine rabenschwarz glänzende Mähne. Seine Vorfahren seien vor langer Zeit auf den Spuren des Kolumbus übers Meer gesegelt. Die hätten den Namen Martinez getragen und alle seien sie gedrungen und schwarzhaarig gewesen, breitnasig und mit braunen Augen. Erwartungsfroh hatten sie ihre alte Heimat verlassen, denn im Land des Kolumbus, so hieß es damals, gäbe es Gold in Hülle und Fülle. In weiß getünchten Tavernen, wo fette Gastwirte unter trüben Lämpchen servierten, hatten sie bärtige Männer, die nach Westen über den Ozean gesegelt waren, vom Gold erzählen hören.
Bevor getanzt wurde, war der Saal hell erleuchtet gewesen, doch kaum hatte der Geiger den Bogen angesetzt, wurde das Licht gedämpft. Die Trommel gab ein paar Schläge vor, dann setzte mit tragendem Rhythmus die Melodie ein. Die drei erhoben wieder ihre Gläser, und Martinez erzählte von Rosalind und dem Jungen. Er zog Fotos von ihnen hervor, und die beiden anderen fanden Rosalind wunderschön und den Jungen prächtig geraten. Dann stießen sie an, auf Rosalind Martinez in Denver, Colorado, und auf Carlos Martinez, ihren Sohn.
Ein junges Mädchen stand an der Bar und wartete darauf, dass der Kellner ihr einen Sitzplatz an einem der Tische zuwies. Martinez schaute zu ihr hinüber, doch sie sah schnell weg und starrte vor sich auf den spiegelblanken Bartresen, der ihr Gesicht schemenhaft zurückwarf, zerstückelt von Kratzern und Scharten zahlloser Messer und Gläser. Hartnäckig fixierte sie die Tischplatte, ihr entstelltes Spiegelbild mit dem undeutlichen Schatten ihrer vollen Lippen. Als sie seinen Blick nicht mehr auf sich spürte, öffnete sie ihre Handtasche, betrachtete sich im Taschenspiegel auf der Innenseite der Lasche und zog sich sorgfältig die Oberlippe nach. Martinez beobachtete, wie sie zwischen den Tischen hindurchlief, mit großen Schritten, dem Kellner dicht auf den Fersen. Er hatte Frau und Sohn wieder in seiner Brieftasche verstaut und dachte schon längst nicht mehr an Denver, Colorado. Er bat die anderen ihn für einen Moment zu entschuldigen und stand schnell und etwas ungeschickt auf, ohne seinen Stuhl nach hinten zu schieben. Die anderen sahen, wie er das Gleichgewicht verlor, schräg nach hinten kippte, durch die Luft segelte und dann flach auf dem Boden aufschlug. Die Palme hatte er im Fallen mitgerissen. Die Kellner eilten herbei und richteten den Baum hastig wieder auf. Erde war auf den Fußboden gekippt, wurde zusammengekehrt und wieder im Blumenkübel festgeklopft. Martinez rappelte sich hoch, Gesicht und Brust mit Blumenerde verschmiert, sie klebte an seiner Wange und rieselte aus seinem Ohr. Drei Kellner wedelten eilfertig mit ihren Handtüchern an ihm herum und baten ihn gleichzeitig um Entschuldigung. Er lächelte und sagte, es sei vollkommen in Ordnung, doch einer von ihnen folgte ihm bis auf die Toilette, um ihn noch gründlicher zu säubern. Er bürstete ihm über die Wange, pulte ihm die Erde aus dem Gehörgang und wischte ihn feucht ab. Dann trocknete er ihm das Gesicht und fegte ihn gewissenhaft von oben bis unten sauber, zwischen den Knöpfen, unter dem Kragen und auf den Schultern. Als er damit fertig war und sich verbeugt hatte, konnte Martinez endlich auf dem Örtchen verschwinden. Als er wieder an den Tisch kam, waren die anderen schon bei der nächsten Runde.
— Wie wär’s mit einem Tanz?, fragte Martinez.
Sie hatten sich schon, bevor sie ins Hotel gekommen waren, so einiges genehmigt, und die drei Doppelten hier hatten sie nicht gerade nüchterner gemacht.
— Such dir nicht die längste Bohnenstange aus, sagte der Kleine Mann, — bei deiner Größe. Einen kleinen Scherz ließ er sich ungern entgehen.
— Na klar gehst du tanzen, sagte das Uhrwerk.
— Klein und fett, lang und dürr, wie auch immer. Die eigene Frau in weiter Ferne, und das schon ein ganzes Jahr: Wer wollte da wählerisch sein?, seufzte Martinez. Er dachte an das Schlafzimmer zuhause und an die Nächte mit Rosalind kurz nach der Geburt des Jungen. Das Lämpchen am Bett hatte die ganze Nacht über gebrannt, von Zeit zu Zeit ließ der Junge ein Wimmern hören, und dann gab sie ihm die Brust. In diesen Tagen war in ihrem Leben für nichts anderes als für den Kleinen Platz gewesen. Er hatte sie auch nicht berühren dürfen, bevor sie sich von der Geburt erholt hatte und sie wieder zärtlich zu ihm sein konnte, ohne dass es ihr unangenehm war. Inzwischen war der Junge sicher schon richtig groß und ins andere Zimmer umgezogen. Martinez stand auf, rückte seine Krawatte zurecht und drückte die Zigarette aus.
— Einen trinken wir noch, bevor du tanzen gehst, sagte der Kleine Mann.
— Na schön, antwortete Martinez, setzte sich wieder und dachte nicht länger an Frau und Kind.
— Ihr solltet die Finger von den Mädels lassen, sagte der Kleine Mann. Der Kellner eilte herbei und füllte die Gläser nach.
— Wir sind doch keine Eunuchen!, gab Martinez zurück.
— Die Army ist das einzige verdammte Problem, sinnierte der Kleine Mann. In der Politik kannte er sich aus.
— Auf die Probleme!, rief Martinez, und der Kleine Mann fand, etwas mehr Ahnung von Politik könne ihm nicht schaden.
— Es mag ja sein, dass Ihr es nur gut meint, dass ihr bloß nichts zu essen kriegt und übernächtigt seid und allein deshalb so stumpf und verbissen in die Welt guckt. Aber trotzdem…
— Was?, fragte Martinez.
— Nichts. Die Höflichkeit der kleinen Staaten, sagte das Uhrwerk.
— Jetzt geh ich aber tanzen!, verkündete Martinez. Die beiden anderen waren überzeugt, dass er von Politik nicht die Bohne verstand. Martinez stand auf und hob sein Glas. Seine braunen Augen blickten ruhig, und die rabenschwarze Mähne glänzte.
— Auf die Höflichkeit der kleinen Staaten!, rief er. Die anderen lächelten, als er sein Glas absetzte und sich in Richtung Tanzfläche aufmachte. Ein paar Tische weiter blieb er stehen. Das Mädchen schaute an ihm vorbei und tat so, als habe sie nichts mitbekommen. Er streifte sie wie zufällig an der Schulter. Sie sah ihn an und schüttelte den Kopf. Dann verbeugte er sich vor ihren beiden Begleiterinnen, aber auch die wollten nicht tanzen. Das Mädchen von der Bar war nirgends zu sehen.
Als er an den Tisch zurückkam, sahen sie schon von weitem, dass er gekränkt war, und schauten angestrengt beiseite. Kurz darauf prosteten sie sich wieder zu. Er dachte an zuhause, an die Streifzüge Sonntagmorgens in den Wiesen oberhalb der Farm, wo es von Kaninchen nur so wimmelte. Old Jones hatte gute Jagdhunde gehabt, wie oft war er von ihrem aufgeregten Gekläffe in aller Frühe aus dem Schlaf gerissen worden. Kaum waren sie oben auf der Anhöhe, wurden die Hunde losgelassen und fegten sofort durchs Gestrüpp davon. Diese Kaninchen waren ziemlich widerspenstig, nur frische und unverbrauchte Hunde taugten zur Jagd.
— Ich nehme an, sie wollten nicht, weil ich Soldat bin, vermutete Martinez.
— Wer weiß das schon, sagte das Uhrwerk.
Martinez verzog das Gesicht.
— Verdammter Bockmist, brummte er, noch immer beleidigt, und die beiden anderen wussten, dass es dazu nichts weiter zu sagen gab.
— In Shanghai waren sie da entgegenkommender, sagte Martinez, nun wieder mit einem Lächeln. Der Uhrmacher lehnte sich auf seinem Stuhl nach vorne.
— Haben sie nicht auch sonderbare Uhren, dort in Shanghai?, wollte er wissen.
Sie prosteten erneut.
— Wie waren sie denn?, fragte der Kleine Mann.
— Reizend waren sie. Es war ein original japanisches Haus, und wir waren lange auf See gewesen.
— Das war sicher ein Mordsspaß, nach so langer Zeit, sagte der Kleine Mann.
— Sie pudern sich am ganzen Körper, und hinterher sieht man aus wie der reinste Mehlsack.
— Aber Uhren hast du keine gesehen?, fragte das Uhrwerk.
— Ich kann mich nicht erinnern.
— Die Chinesen machen ganz hervorragende Wanduhren, sagte er. — Sie sollen begabte Holzschnitzer sein.
— Du verwechselst da was, korrigierte der Kleine Mann. — Die Chinesen sind begabte Porzellandreher.
— Ein uraltes Kulturvolk, ergänzte das Uhrwerk.
— Am ganzen Leib waren sie gepudert, sagte Martinez. — An ihrem ganzen verdammten Hurenleib. Dann kippten sie noch ein paar Doppelte, mittlerweile war es spät geworden. Martinez hatte die Ellenbogen auf den Tisch gestützt und fühlte sich pudelwohl. Die beiden anderen begannen zu singen, er hörte zu, bis der Hotelportier an ihren Tisch trat und sie daran erinnerte, dass es Zeit war zu gehen. Der Kleine Mann und das Uhrwerk ließen ihren Gesang jäh verstummen und gingen hinaus. Sie schlenderten über den Hotelvorplatz und ließen sich auf einer der Bänke unter der Statue nieder. Vom Meer wehte ein kalter Nachtwind, sie redeten nicht miteinander und zogen die Köpfe fest in ihre Mantelkrägen.
Martinez blieb allein zurück.
Jemand klopfte ihm leicht von hinten auf die Schulter. Er sah sich um.
— Hi there.
— Hi, Sanchez.
— Was gibt’s Neues?, Sanchez setzte sich zu ihm.
— Nichts Neues, antwortete Martinez.
— Warum setzt du dich nicht zu mir rüber.
— Hast du ein paar flotte Käfer?
— Ich hab zwei Damen am Tisch. Und das ist genau eine zu viel, sagte Sanchez.
— Ist sie hübsch?
— Sie hat was.
— Viel?
— Genug.
— Okay, sagte Martinez. Sie gingen zum Tisch hinüber. Er konnte die Mädchen nur verschwommen erkennen. Eine von ihnen lachte, als er näher kam, das musste die sein, die Sanchez ihm zugedacht hatte.
— Kalifornien, ich komme!, rief er und legte dem Mädchen seinen Arm um die Schultern.
Geige, Klavier und Trommel verstummten. Der Geiger legte sein Instrument in den Kasten, nahm das kleine Samtkissen unter dem Kinn hervor und verstaute es ebenfalls. Im Saal gingen die Lichter an. Martinez behielt das Mädchen im Arm. Er führte sie quer durch den Saal, in die Eingangshalle und hinaus auf den Gehsteig vor dem Hotel. Sie überquerten den Vorplatz, gingen zur Statue hinüber und setzten sich auf eine Bank. Martinez küsste sie, aber es machte ihm keinen rechten Spaß. Er hatte auch keine Lust, sich mit ihr zu unterhalten, sondern ging zu dem kleinen Rasenstück hinüber und legte sich dort kurzerhand ins Gras. Sobald er lag, hatte er sie schon vergessen, und er bemerkte auch nicht, wie seine Freunde an ihm vorbei in Richtung Straße liefen. Sie hatten beobachtet, wie Martinez das Mädchen hinausgeführt, es dann allein gelassen und sich ins Gras gelegt hatte, bis es schließlich gegangen war. Nun kamen sie zu ihm und halfen ihm auf die Füße. Sie stützten ihn links und rechts unter den Armen und zogen ihn zurück auf den Gehsteig.
— Rosalind …, murmelte Martinez.
— Was?, fragte das Uhrwerk.
— Nur du, Rosalind. Du, und der Kleine.
— Er meint seine Familie zuhause in Denver, erklärte das Uhrwerk. Sie nahmen Martinez in die Mitte und liefen auf die Straße zu. Er schwieg. Er sprach weder von Rosalind, noch von dem Jungen, sondern ging schweigend zwischen den beiden, mit hochgezogenen Schultern, da sie ihn unter den Achseln gepackt hatten. Sein Kopf war ihm auf die Brust gesackt, und sein Hals kippte im rechten Winkel nach vorn.
ZWEI
Wir hatten die Partie gerade begonnen.
Im Radio dudelte Tanzmusik, und ich warf einen Blick zur Wanduhr. Es war fünf nach halb zwölf. Wir hatten erst ein paar Züge gespielt, und die Bilanz war auf beiden Seiten eher mäßig. Guðmundur zog mit dem Springer und bedrohte meinen Läufer. Neunundsiebzig ab Station, sagte das Mädel über den Lautsprecher. Im Aufenthaltsraum saßen nur wenige Fahrer.
— Ich lass mir wegen einer Schachpartie doch keine Fahrt durch die Lappen gehen.
— Du bist dran, sagte er. Das Mädel vorne im Glaskasten rief zum zweiten Mal meine Nummer.
— Pass auf deinen Läufer auf, sagte er. Schach war für Guðmundur eine bitterernste Sache, und von einer einmal angefangenen Partie konnte er sich nur schwer losreißen. Zu seinem Leidwesen wurde diese Begeisterung nicht von allen geteilt.
— Zum Teufel mit dem Läufer, brummte ich und stand auf. Guðmundur stopfte sich eine Pfeife. Er war um die vierzig und ein ausgezeichneter Schachspieler.
— Bist du heute Abend hier?, fragte er.
— Nein, ich fahr hinterher gleich nach Hause, sagte ich und stand schon im Türrahmen vorne am Schalter. — Ich schenk dir die Partie. Macht zweimal gewonnen und ein Unentschieden. Guðmundur steckte seine Pfeife an.
— Nein, wir merken uns die Positionen, sagte er hastig. Er wusste, dass man schon auf mich wartete.
— Meinetwegen, antwortete ich und ließ den Türgriff los. Ich sah, wie das Mädel hinter der Scheibe unruhig wurde, denn meine Fahrgäste standen schon draußen auf dem Gehsteig. Die Lampen am Dachgiebel über dem Eingang warfen einen hellen Lichtkegel auf den Vorplatz des Gebäudes und auf die Männer, die auf mich warteten. Es waren zwei, mit einem Dritten, den sie unter den Achseln gepackt und ins Schlepptau genommen hatten. Offenbar ein Soldat. Seine Hose stand offen und hing auf Halbmast, das Hemd war aus dem Hosenbund gerutscht und quoll ihm vorne aus der Jacke, die bis zum Gürtel aufgeknöpft war. Ich ging auf den Parkplatz hinaus zu meinem Wagen und gab den Männern ein Zeichen, mir zu folgen. Der Soldat trottete schwerfällig zwischen den beiden anderen, und ich stand neben der geöffneten Hintertür und nahm an, dass die beiden ihn begleiten würden. Einen sturzbetrunkenen Fahrgast zu chauffieren war kein Vergnügen. So einer konnte sich in den unwahrscheinlichsten Momenten plötzlich auf seinem Sitz aufrichten und sehr ungemütlich werden. Sie bugsierten ihren Kameraden fürsorglich auf den Rücksitz, die obere Körperhälfte zuerst, die sie vorsichtig in die Polster lehnten, dann verstauten sie seine Füße, einen nach dem anderen, auf den Boden unter dem Sitz. Das alles ging reibungslos vonstatten, während ich ihnen die Wagentür aufhielt und wartete. Der Lichtschein vom Giebel der Station fiel durch das Heckfenster und beleuchtete das Gesicht des Soldaten von der Seite. Sein Kopf lehnte schief auf der Kante der Rückenlehne, seine Augen waren geschlossen. Der untere Rand seiner Nase und alles, was darunter lag, verschwand im Schatten. Seine Stirn dagegen wurde vom Lichtkegel direkt beschienen und leuchtete hellbraun, fast weiß, unter dem lackschwarzen Haarschopf.
— So, sagte der eine der beiden. Er wurde wohl allmählich ungeduldig und wollte nicht länger herumstehen, auch wenn er sich nicht beklagte. Wahrscheinlich hatte er die Warterei sogar gründlich satt, denn mittlerweile war es ziemlich kalt.
— Wir werden ihm die Fahrt wohl bezahlen müssen, sagte der andere und fingerte in seiner Brusttasche. Also wollten sie selbst nicht mitfahren.
— Was macht das?
— Wohin?
— Raus zum Flughafen.
— Hundertfünfundsiebzig Kronen, sagte ich. Mir erschien die Nacht auf einmal außergewöhnlich kalt und außergewöhnlich dunkel. Keine schönen Aussichten, mit diesem volltrunkenen Kerl im Wagen, eine so lange Strecke, und dann noch mitten in der Nacht.
— Hundertfünfundsiebzig, wiederholte der andere. Er war groß von Statur, und unter seinem Hut standen graue Strähnen hervor.
— Ich zahle hundert, sagte sein Freund und zog langsam und bedächtig seine Hand aus der Tasche. Er hielt mir einen zerknitterten Geldschein auf der flachen Hand entgegen und wartete.
— Das ist ein Heidengeld, sagte der Grauhaarige.
— Kann man nichts machen, entgegnete der andere.





























