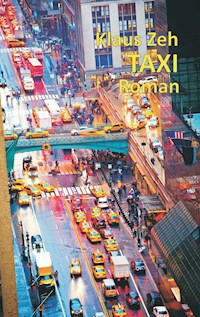
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Heiligabend im Taxi. Mit Heiligabenden hat der Fahrer und Besitzer des Taxis so seine Erfahrungen. Vor zwei Jahren schoss ihm ein Junkie ins Bein, und dass er danach wieder mit dem Boxen anfing, macht die Sache nicht besser. Doch dieser Heiligabend ist anders. Unterwegs auf den schneeverwehten Straßen, in der Stadt, über Land, immer wartend auf eine Nachricht von Malaika, seiner verheirateten Geliebten, ereignet sich Unerwartetes. Immer wieder rühren die Erlebnisse an seine Vergangenheit: seine Kindheit mit dem alkoholkranken, gewalttätigen Vater; seine Schwester, die ihm immer Zuflucht und Ermutigung bot; sein waghalsiges Intermezzo in Detroit, der Stadt des Soul; den langen Kampf um die Befreiung aus seinem inneren Gefängnis; und nicht zuletzt an seine Liebe zur Musik. Als die nächtliche Irrfahrt fast zu Ende ist, geschieht dann doch noch ein kleines Wunder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Heiligabend im Taxi. Mit Heiligabenden hat der Fahrer und Besitzer des Taxis so seine Erfahrungen. Vor zwei Jahren schoss ihm ein Junkie ins Bein, und dass er danach wieder mit dem Boxen anfing, macht die Sache nicht besser. Doch dieser Heiligabend ist anders. Unterwegs auf den schneeverwehten Straßen, in der Stadt, über Land, immer wartend auf eine Nachricht von Malaika, seiner verheirateten Geliebten, ereignet sich Unerwartetes. Immer wieder rühren die Erlebnisse an seine Vergangenheit: seine Kindheit mit dem alkoholkranken, gewalttätigen Vater; seine Schwester, die ihm immer Zuflucht und Ermutigung bot; sein waghalsiges Intermezzo in Detroit, der Stadt des Soul; den langen Kampf um die Befreiung aus seinem inneren Gefängnis; und nicht zuletzt an seine Liebe zur Musik. Als die nächtliche Irrfahrt fast zu Ende ist, geschieht dann doch noch ein kleines Wunder.
Klaus Zeh, Jahrgang 1965, wirkt als Sänger, Liedermacher und Musikjournalist und war für mehr als zehn Jahre mit einem musikalischen-literarischen Irlandprogramm unterwegs. Er lebt in Reutlingen. Bisher veröffentlichte er Gedichtbände und Musik-CDs. Taxi ist sein erster Roman.
…aber nur die Musik sollte kämpfen, nicht die Menschen.
Bob Marley
Einer Löwin,
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Danksagung
1
Der Scheißkerl hatte mir direkt ins Bein geschossen.
Ich setzte gerade an, ihm zu erklären, dass ich zu Beginn meiner Nachtschicht noch so gut wie nichts in meiner Kasse hätte, als er plötzlich eine Waffe aus der Innentasche seines schmuddeligen Parkas zog.
Kleinkalibrig, kaum der Rede wert, und doch genug, damit die Kugel ein Loch in meinen Oberschenkel bohrte, an der Unterseite wieder austrat, um im Autositz stecken zu bleiben.
Dort steckt sie heute noch. Ich hab sie stecken lassen, um immer an diesen beschissenen Abend erinnert zu werden. Wobei ich das überhaupt nicht nötig habe, denn die Narbe auf meinem rechten Oberschenkel erinnert mich bei jeder Luftveränderung daran.
Ich denke oft an diese Nacht.
Manchmal wache ich morgens auf und weiß, dass ich davon geträumt habe, obwohl ich mich nicht mehr an den Traum erinnern kann.
Die Narbe juckt dann, Schweiß perlt mir von der Stirn und in meiner Nase klebt der Geruch, den ich unmittelbar nach dem Schuss im Taxi gerochen hatte.
Eigentlich hatte ich zuerst nichts anderes wahrgenommen als diesen Gestank. Ich habe wochenlang mein Taxi geschrubbt, bis mir klar wurde, dass der Geruch in meiner Nase hing. Also ha be ich mir Parfüm an die Nasenwände geschmiert. Wochenlang. Bis mir klar wurde, dass der Geruch in meiner Erinnerung haftet.
Ich kann nichts dagegen tun. Vergessen würde helfen, aber wer kann schon vergessen.
Einen Tag nach dem Überfall besuchte mich der Krankenhausgeistliche und sprach mit mir über Vergebung. Er hätte mit mir über das Vergessen sprechen müssen. Darüber, dass es nicht geht, selbst wenn man sich noch so sehr anstrengt. Will man vergessen, gelingt es nicht. Will man es nicht, gelingt es, ohne dass man es merkt.
Ich habe bis heute nicht vergeben.
Dem Mann, der mir ins Bein schoss, wegen dem ich monatelang vor Angst nicht mehr arbeiten konnte, zu Therapeuten und Psychiatern rannte, Medikamente schluckte, die mich völlig neben mich stellten, wegen dem ich mich monatelang nicht mehr aus dem Haus traute, Nachbarn für mich einkaufen gingen, wegen dem ich zu etwas wurde, das ich mir niemals zugetraut hätte, der mich an Abgründe führte, mich zu Albträumen zwang und noch immer zwingt – warum sollte ich ihm vergeben?
Er wurde noch in derselben Nacht gefasst, weil er eine Tankstelle ausraubte. Alles in einer Nacht, und noch dazu in unserer Stadt. Gerade mal eine Großstadt und alles andere als durch ihre Kriminalität berühmt, eher durch ihren Fleiß und dessen wirtschaftliche Erzeugnisse. Eine ruhige, behäbige Stadt, in der es die Kunst ebenso schwer hat wie der nächtliche Taxifahrer, denn nahezu alles, was es hier quer durch die Nacht zu fahren gibt, sind menschliche Schicksale, die irgendein Lebenssturm an meine Taxitüren spült.
Übriggebliebene, Vergessene, Säufer oder Huren, Jugendliche, die längst in ihren Betten sein sollten und deren Eltern nicht die Polizei verständigen, sondern mich. Ein paar Reisende, die aus welchem Grund auch immer ihre letzten Züge verpassen, oder Liebespaare, die ich so schnell wie möglich ins nächstliegende Hotel fahren soll und die nicht einmal die wenigen Minuten bis dahin abwarten können und ihr Date schon auf meiner Rückbank beginnen. Menschen, die Nachtjobs nachgehen und mich brauchen, weil noch keine öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind.
Nein, ich habe ihm noch nicht vergeben. Ich weiß nicht einmal, ob der Junkie, der mir für 17,80 Euro den Oberschenkel zerfetzte, noch einsitzt oder schon wieder auf freiem Fuß und am Fixen ist.
Lange wünschte ich mir, er möge sich den goldenen Schuss setzen. In irgendeiner verdreckten U-Bahn-Toilette verrecken. Aber das hörte auf. Heute bin ich froh darüber. Und ich bin froh, wieder arbeiten, wieder fahren zu können. Auch wenn es mich an manchen Tagen Überwindung kostet, in den Wagen zu steigen, den Motor zu starten und loszufahren.
Manchmal steige ich wieder aus, gehe in die Wohnung zurück, verausgabe mich beim Schattenboxen, lasse die Musik aus den Lautsprechern dröhnen, und versuche es erneut.
Die roten Boxhandschuhe auf der Rückbank helfen mir. Und meinen Fahrgästen sollen sie zeigen, ihr Taxifahrer boxt, am besten also nicht auf dumme Gedanken kommen.
Zwei Jahre ist der Überfall nun her, auf den Tag genau.
Heute ist wieder Heilig Abend, und ich spüre, wie die Erinnerung an diesen Abend vor zwei Jahren für mich noch immer wie eine Bedrohung wirkt.
Ich kann meine Teetasse nicht richtig greifen, weil ich zittere, und immer, wenn mich eine solche Welle erfasst, tigere ich ruhelos umher. Auch jetzt wieder.
Mein Gefängnis ist in mir. Jedenfalls fühlt es sich so an, in manchen Momenten, wenn ich Glück habe; für Stunden, wenn ich Pech habe.
Ich werde wütend und verzweifelt zugleich, bleibe vor dem Plattenspieler stehen, ziehe eine Schallplatte aus dem Regal, nicht irgendeine, eine ganz bestimmte, lasse sie aus der Hülle gleiten, lege sie auf den Plattenteller und setze den Tonarm auf.
Es dauert ein paar Takte, bis mich der Klang ergreift.
Wenn ich Glück habe, geht es von da an recht schnell. Heute habe ich Glück. Ein innerer Horizont öffnet sich. Die Musik findet ihr Echo.
Mit geschlossenen Augen horche ich auf die Regungen in mir. Auf den Klang dort drin.
Gegen diesen Klang kommt die Welt nicht an. Ich weiß nicht, woher er kommt, nur dass es ihn
gibt.
2
Ein Jahr nach dem Überfall begann ich wieder zu boxen.
Die Gespräche mit meinem Therapeuten taten gut, waren notwendig, die Tabletten hilfreich, manchmal. Aber ich wusste, ich musste den Kämpfer in mir wieder wecken.
Mein Vater hatte ihn vor über dreißig Jahren geweckt. Hatte ihn aus mir heraus geprügelt, oder in mich hinein, wie man es nimmt. Jeden Abend Boxen und Sandsacktraining. Er hielt mich stets eine Armlänge von sich weg und traf regelmäßig meine Nase, bis ich weinend und blutend die Handschuhe in die Ecke schmiss oder meine Mutter auftauchte und schimpfend die Boxerei verbot. Bis zum nächsten Abend.
Das Grinsen meines Vaters hat sich wie ein Brandzeichen in mich eingebrannt.
Immer wenn ich unter seiner ausgestreckten Geraden wegtauchen wollte, verpasste er mir einen Aufwärtshaken. So ein Ding ans Kinn spürst du gewaltig. Oder er traf die Nase. Das gab Prellungen, dass man sich tagelang vor Schmerzen die Nase nicht mehr putzen konnte. Und bei jedem Treffer grinste er bis an die Ohren und setzte zum nächsten Schlag an. Wenn er mich an den Ohren traf, tat es besonders weh. Nach einem Treffer begann es zu klingeln im Ohr und zu brausen und zu hämmern bis ins Hirn. Die Knie wurden mir weich und ich begann wegzusacken.
Als ich zwölf war, gab ich ihm die Handschuhe zurück und beendete meine Boxkarriere.
Ungefähr zur selben Zeit riss ich alle Elvis-Poster von meinen Wänden. Auch den Bravo-Starschnitt, der heute ein kleines Vermögen im Internet brächte. Ich hatte wirklich jeden Zeitungsausschnitt und Artikel gesammelt und mein ganzes Zimmer mit Elvis-Postern tapeziert. Es sah beeindruckend aus. Aber Elvis war zum Schlappschwanz geworden. Der Rebell der 50er Jahre war nie ein Rebell, sein ganzes Auftreten nur Show. Er war nie ein Marlon Brando oder James Dean. Eigentlich nur ein Muttersöhnchen und Duckmäuser, der jede Forderung seines Managers erfüllte, zur Armee ging, um einen Skandal zu verhindern, unbedingt eine Minderjährige heiraten wollte, weil er sich vor gleichaltrigen Frauen fürchtete. Der dreiunddreißig Filme drehte, davon einer schlechter als der andere, alles nur des Geldes wegen. Und dann seine Alkohol- und Tablettensucht. Ein Waschlappen. Und das alles wurde mir klar, weil ich zu lesen begonnen hatte. Mich informierte.
Mit zwölf passierte mir das. Kein schlechter Anfang.
Fortan übte ich in kleinen Schritten die Rebellion gegen meinen Vater, doch manchmal waren die Schritte so klein, dass nur ich sie bemerkte. In einem nicht geschenkten Lächeln etwa, wenn er wieder mal einen Witz auf Kosten anderer riss, oder indem ich zehn Minuten zu spät nach Hause kam und ihn anlog.
Ich dehnte die Zeit meines Nachhausekommens immer mehr aus und ließ mir Lügen für meine Verspätungen einfallen.
Ja, ihn anzulügen machte mir größte Freude. Wenn ich ihm eine haarsträubende Geschichte verkaufen konnte, obwohl er mich fixierte, seinen Blick in mich bohrte, und ich am Ende als unentdeckter Lügner in mein Zimmer verschwinden konnte, war ich der Sieger.
Manchmal fanden die Schritte auch nur in meinem Inneren statt. Gedanken, die sich zu einem Trotz formten, einem Widerstand, der immer weiter in mir anwuchs, zu meinem Credo wurde und mich meine ganze Kindheit und Jugendzeit begleitete: Ich wollte nicht so werden wie er. Nicht ein solcher Mensch, und auch kein solches Leben führen. Niemals!
Doch vorerst tappte ich in seine Fußstapfen.
Mein Vater hatte mir gezeigt, wie man schlagen musste, um den Gegner auf die Bretter zu schicken.
Die Bretter, das waren ein paar Straßen, die unser Viertel vor dem nächsten abgrenzten. Ein paar quer, ein paar längs, eine Handvoll Straßenecken und eine stattliche Ansammlung von Hinterhöfen, die Schutz und Basis waren für eine Gang, die ich anführte, mit zwölf.
Es war die Zeit, als wir mitten in der Nacht auf standen, um einen echten Rebellen und Helden zu sehen, ein Großmaul sondergleichen, das wir liebten: Muhammad Ali.
Im Oktober 1974 hatte Ali zum zweiten Mal den Titel im Schwergewicht gewonnen.
Als alter Mann, wie Vater sagte.
Er schlug George Forman in Kinshasa. Die Welt und ich schauten zu.
Mein Vater meinte, während Ali in den Seilen hing und Foreman schlagen ließ, bis Foreman die Luft ausging, ich solle wieder mit dem Boxen anfangen. Ich tat es nicht. Erst wieder ganze dreißig Jahre später.
Es war ein seltsames Gefühl gewesen, als Erwachsener, gut dreißig Jahre später, mit diesen Erinnerungen loszuziehen und Boxhandschuhe zu kaufen.
Ich bin einfach in den Boxstall gegangen, erzählte dem Trainer etwas vom Kämpfen und wie wichtig es manchmal im Leben sei, er hatte vielsagend gelächelt und mir ein „Herzlich Willkommen“ erwidert.
Es waren gut zwanzig Jungs anwesend, boxten an Sandsäcken, zwei waren beim Sparring im Ring, einige hüpften Seil oder boxten vor Spiegeln gegen ihr Spiegelbild. Der Trainer hatte in die Runde gerufen, mich lauthals vorgestellt und alle unterbrachen ihr Training und kamen an, um mich lächelnd per Handschlag zu begrüßen.
Ich war verblüfft, welche Freundlichkeit mir ge radezu entgegenbrandete. Es rührte mich. Nach dem Jahr, das ich nach dem Überfall hinter mir hatte, war dies hier reinste Labsal. Schon in diesen ersten Minuten spürte ich, dass es hier nicht nur um Kampf und Sieg ging, sondern vor allem auch um Respekt.
In den folgenden Monaten erwarb ich ihn mir auch im Ring, wohl auch, weil ich altershalber von fast allen Boxkumpanen der Vater hätte sein können.
Ich begann mich wieder aufzurichten.
Der Junge von damals jedoch, der nicht nur auf das alte Kopfsteinpflaster und den Schmutz der Hinterhöfe spuckte, hatte keinen Respekt, vor nichts und niemandem.
Damals boxte ich ohne Handschuhe.
Wir waren Straßenkämpfer, ich der Anführer.
Bis zu diesem Tag im November 1974.
Wir alle quatschten noch immer über nichts anderes als Alis Titelgewinn gegen George Foreman.
Ich erinnere mich an den blassen Himmel an jenem Tag, die trübe Sonne, irgendwo zwischen den Dächern der Altstadt. Der kleine Bruder einer meiner Kumpels kam die Straße lang gerannt und rief uns schon von weitem etwas zu, das wir zuerst nicht verstanden.
Sie wollen angreifen, rief er, die Penner!
Ich ließ ihn Luft holen und wollte dann die ganze Geschichte wissen.
Die Jungs aus der Oberen Stadt wollten uns angreifen. Das hatten sie noch nie getan. Sonst ließ ich mir bei ähnlichen Gelegenheiten einen Plan einfallen, eine List, mit der ich die Gegner schlagen wollte, diesmal hatte ich eine andere Idee.
Ich teilte dem Kleinen meinen Vorschlag mit, schickte ihn erneut los, damit er ihn der Bande aus der Oberstadt überbringen konnte.
Eine Stunde später kamen sie geschlossen in unsere Straße. Meine Straße. Ihr Anführer vorneweg. Ich kannte ihn. Wir waren uns immer aus dem Weg gegangen. Er war ein Roma, größer als ich, breitere Schultern, größere Muskeln. Ich wusste, er war auch stärker als ich. Ich musste also schneller sein als er, und gemeiner.
Mein Plan war, dass wir beide gegeneinander kämpften und nicht alle Jungs. Ihm schien mein Vorschlag zu gefallen.
Wir zogen alle zu einem naheliegenden Parkplatz, die Jungs scharten sich in einem kleinen Kreis um uns. Ein Ring, der wirklich wie ein Ring um uns lag.
Einer der Burschen rief uns in die Mitte und mahnte uns ehrlich zu kämpfen, sagte, wir sollen uns die Hände reichen und schickte uns zurück in die Ringecke, die es nicht gab. Statt zurück zu gehen, um zum Kämpfen wieder in die Ringmitte zu kommen, blieb ich stehen. Mein Gegner schaute mich verdutzt an. Seine Augen waren dunkel wie Kastanien, aber nicht böse. Eher erstaunt. Genau in diesem Moment schlug ich ihm die Faust auf die Nase. Ich hatte getroffen. Er wankte zurück. Um uns herum wogte Gebrüll auf. Die Jungs schrien unsere Namen. Ich setzte nach. Mein zweiter Schlag traf noch einmal die Nase. Es knackste. Er schrie vor Schmerz auf und fasste sich mit beiden Händen ins Gesicht. Meine rechte Faust traf ihn im Magen, er sank auf die Knie und hustete. Ich wollte ein K.O. Also schlug ich noch einen rechten Haken zum Kopf, den er schon gar nicht mehr sah, weil er noch immer die Hände vor dem Gesicht hatte. Mein Schlag knallte ihm an die Schläfe, er kippte nach links und war ohnmächtig.
Alle rannten davon, auch ich.
Irgendwer hatte den Eltern gepetzt, Polizei wurde gerufen, ein Krankenwagen, bei uns zuhause klingelte das Telefon.
Das war mein letzter Kampf, für mehr als dreißig Jahre.
Heute kämpfe ich wieder, allerdings mit roten Handschuhen, Mundschutz und Sparringspartnern.
3
Mir ist danach zumute, das Taxi stehen zu lassen.
Heute, an Heilig Abend, nicht zu arbeiten, einfach zu Hause zu bleiben, ein paar DVDs auszuleihen, eine Tüte Chips aufzureißen und den Abend zu überstehen.
Zwei Jahre ist es nun her. Die Narbe brennt. Ich sollte vielleicht zuhause bleiben.
Malaika muss ihrerseits zuhause sein, Ehefrau spielen. Vielleicht sollte ich doch arbeiten gehen. Flüchten.
Heute Morgen hatte ich ein paar LPs aufgelegt, eine Kanne Kaffee dazu getrunken. Stevie Wonders „Innervision” und „Music of My Mind”.
Wie immer wurde es, wenn ich Stevie singen höre, ein wenig heller in mir.
Anschließend legte ich Barry White auf, danach Bobby Womack. Zum Schluss James Brown.
Das war so ein „Ich bleib zuhause und mach es mir gemütlich“-Gefühl. Fast hätte ich mir „Good Morning Vietnam“ in den DVD Spieler geschoben und wär daheim abgehangen.
„Good Morning Vietnam“ ist für mich so etwas wie für andere Leute die Rocky Horror Picture Show.
Robin Williams gibt den Radiomoderator Cronauer oscarreif. Ein musikverrückter Querdenker hinter dem Mischpult.
Ich vermute, dass mir eine von Barry Whites Liebesschnulzen doch zugesetzt hat, denn mir wird es plötzlich zu eng in meiner Bude.
Ich muss ans Steuer, fahren, in Bewegung kommen, fort aus diesem Stillstand.
Ich werde wütend auf Malaika, wütend auf Barry White. Wie kann man sich an einen anderen Menschen derart verlieren, dass man sich aufgeben möchte? Und wie kann man innig lieben und doch nichts an seinem Leben ändern und in alten Strukturen und Fesseln bleiben?
Eine halbe Ewigkeit führt sie nun schon ein Doppelleben, und ich mit ihr auf gewisse Weise, warte auf sie, warte darauf, dass sie abends nicht mehr nach Hause fährt, sondern einfach bleibt, bei mir, wo sie, wie sie sagt, auch sein möchte, aber es trotzdem nicht tut und mich jeden Abend wieder verlässt. Zeiten einhalten und um Erlaubnisse bitten muss, wenn sie etwas ohne ihren Mann unternehmen möchte und sich deshalb strengster Prüfungen und Fragen aussetzt.
Die Straße liegt schon fast im Dunkeln, als ich den Motor starte, eine Cassette ins Autoradio schiebe, meine Beleuchtung einschalte und losfahre. Ich drehe die Laustärke nach oben und trommle den Rhythmus aufs Lenkrad.
Auch so eine Gewohnheit, die ich mir im Laufe der Jahre zugelegt habe: erst einmal meine übliche Runde drehen. Da ich von außerhalb komme, fahre ich zuerst durch das Industriegebiet. Wenn ich dort keinen Fahrgast aufsammeln kann, nehme ich das kleine Stück Kraftfahrstraße, das halb mondförmig über die West- in die Nordstadt führt. Das hat immer etwas von einem Film Noir, wenn ich so durch die Nordstadt mit ihren Hochhäusern fahre. Tausende Fenster, hell erleuchtet oder stockdunkel, Leben, das nichts mit mir zu tun hat, solange nicht irgend ein Mensch von dort mich heranwinkt und mir vielleicht vom Leben dort erzählt, während ich ihn an seinen Zielort bringe.
Ich bewege mich im Strom der Gedanken, der Bilder, wenn ich so in die Dunkelheit fahre. Nichts bleibt lange genug, um mich zu fesseln, tiefere Emotionen auszulösen oder mich abzulenken. Nur die nächtliche Melancholie, die ich längst kenne. Und natürlich die Musik aus den Lautsprechern im Inneren meines Taxis. Heute wieder dieser geniale Motown Soul Sampler, den ich in meinem Lieblingsplattenladen besorgt habe.
Meistens fahre ich noch auf den Aussichtsparkplatz des Hausberges und schaue auf die Stadt. Der halbe Vogelblick tut gut. Du gehörst noch dazu, steckst aber nicht mittendrin. Was die Leute dort unten bewegt, kann dir dort oben kaum etwas anhaben.
Und doch nicht hoch genug, um enthoben zu sein, nichts mehr zu spüren als den Wind. Das ist so etwas wie eine kleine Insel über der Stadt. Ich brauche diesen Abstand ab und zu, diese zeitweilige Flucht aus dem Leben dort unten und meinem eigenen. Um weiter zu sehen, an einen Horizont, weiter als bis zum nächsten Stoppschild.
Dort unten mögen sie sich hassen, lieben, prügeln oder umarmen, vor Fernsehern vergammeln oder sich für hohe Ziele aufreiben, hier oben blicke ich darauf und nehme an nichts teil. Es ist angenehm in der Nähe dieser Menschen zu sein, das Rauschen der Stadt zu hören; aber mitten unter ihnen leben und damit zufrieden sein, das kann ich nicht.





























