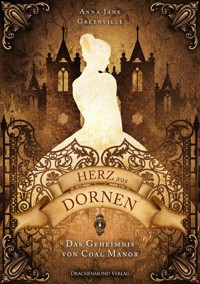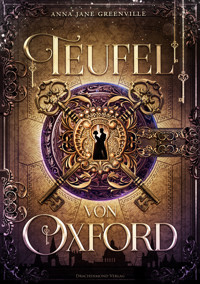
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
England, 1888 »Einst führte meine Familie die bekannteste Schlosserei Oxfords. Nun bin ich eine Diebin und knacke die Schlösser meiner Vorfahren. Schuld daran hat allein James Frederik Darvill. Der arrogante und attraktive Gentleman erpresst mich. Zu allem Übel geht es auf seinem Anwesen nicht mit rechten Dingen zu. Wenn ich seine finsteren Machenschaften nur aufdecken und beweisen könnte, würde ich meine Freiheit vielleicht wiedererlangen. Leider zieht mich seine mysteriöse Macht immer mehr in seinen gefährlichen Bann … « Susanna Copper Softcover mit Farbschnitt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teufel von Oxford
ANNA JANE GREENVILLE
Copyright © 2023 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Stephan R. Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan R. Bellem
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
Illustrationen Print : Anna Jane Greenville
Druck Printausgabe: Booksfactory
ISBN 978-3-95991-564-9
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
1. Eine finstere Spur
2. Eine Fährte der Verwirrung
3. Eine seltsame Deutung
4. Eine Fährte der Dunkelheit
5. Der Schatten von Kontrolle
6. Ein Schleier der Schuld
7. Ein Spiel mit Korruption
8. Ein Hauch von Wahnsinn
9. Ein Schwung Desaster
10. Ein Schimmer Hoffnung
11. Eine Priese Sympathie
12. Ein Flair von Arroganz
13. Ein Anflug Verzweiflung
14. Ein Stück Vertrauen
15. Der Schatten des Bösen
16. Ein Anzeichen von Verschwörung
17. Eine Spur der Rache
18. Ein Augenblick der Bestimmung
19. Ein Anflug von Angst
20. Ein Funke von Wunder
21. Ein Rest an Hass
22. Ein Andrang der Versuchung
23. Ein Hauch Überlegenheit
24. Ein Überbleibsel der Vergangenheit
Epilog
Drachenpost
Für Emma, Daisy, Elena, Laura, Christine, Evelyn,
Andrea, Matteo, Lisa, Bita, Astrid,
und alle, die tapfer gegen ihre Dämonen kämpfen
Eine finstere Spur
Der September nahte seinem Ende, und die Vorboten der grauen Wintermonate wurden spürbar in dem rauen Herbstwind, der eisig durch die Gassen heulte. Unnachgiebig säuselte er zwischen den alten Universitätsgebäuden, üppig verzierten Kapellen und dicht gedrängten Reihenhäusern. Oxford war erbaut für die Reichen und Talentierten. Hohe Wände und spitz zulaufende Zäune trennten Wissen und Kultur von den engen Straßen und engstirnigen Ansichten außerhalb ihrer Tore.
Verrußte Ziegel und verdrecktes Kopfsteinpflaster säumten den Weg des gemeinen Volkes, während den Einflussreichen die ganze Welt zu Füßen lag. Das war der Lauf der Welt im Jahr 1888. Manche genossen ein strahlendes Leben, während andere selbst die schwach flackernden Lichter der Straßenlampen mieden.
So wie ich.
Die anbrechende Nacht verscheuchte die Passanten von den sonst überfüllten Einkaufsstraßen. An ihrer statt krochen Nebelschwaden aus dunkeln Verstecken hervor und ließen ein Wahrzeichen nach dem anderen aus dem Panorama Oxfords verschwinden. Das war meine liebste Zeit.
Geübt darin, unbemerkt zu bleiben, huschte ich von einer dunklen Ecke zur nächsten und verschmolz mit den Schatten. Am Ende von Norham Gardens blieb ich stehen. Viktorianisch-gotische Villen und herrschaftliche Anwesen dominierten die elitäre Wohngegend. Die Pracht der Häuser raubte mir den Atem und zwang mich, vor Ehrfurcht zu erstarren. Zwischen mir und den Bewohnern der Anwesen lagen so viele Welten, dass ich noch nicht einmal eifersüchtig sein konnte. Ihr Leben war für mich so ungreifbar wie die Sterne.
Ein kalter Schauer lief mir über den gebeugten Rücken und bis in die Fingerspitzen, die ich tief in die Taschen des abgetragenen Mantels grub. Kälte stieg vom Pflaster durch meine dünnen Sohlen und biss mir in die Zehen. Ich spannte die Schultern an, um das Zittern zu unterbinden, und drückte den Rücken gegen eine raue Steinwand. Mit großen Augen und gespanntem Blick beobachtete ich die Straße, die in eine andere Welt führte. Eine Welt aus Bällen, Macht und Juwelen.
Das Rattern einer sich nähernden Kutsche ertönte in der Ferne. Ich schreckte auf. Wer war außer mir so spät noch unterwegs? Wie als Antwort auf meine Frage durchbrachen zwei schwarze Biester den Nebel. Ihre Hufe schallten laut über das Kopfsteinpflaster. Die rostigen Räder kamen unter quietschendem Protest zum Stehen und beleidigten mit diesem widerlichen Geräusch die Eleganz des monumentalen Anwesens, vor dem sie hielten. Die hohen Fenster, verziert mit Ornamenten um den massiven Sims, funkelten arrogant im schwachen Schein des bedeckten Mondes. Zwei eindrucksvolle Säulen ragten bis zum Dach des hohen Eingangstores, das von zwei Adlern aus Stein bewacht wurde. Die Statuen wirkten, als könnten sie jeden Moment zum Leben erwachen, um das Haus vor Eindringlingen zu schützen.
Ich huschte am Zaun vorbei und kroch durch die Hecke, die das Anwesen umgab. Von dort aus konnte ich die Kutsche im Licht der Laterne, die über dem Bock des Fahrers flackerte, besser sehen. Zwar war ich nicht ihretwegen gekommen, doch nun wollte ich wissen, was es mit der nächtlichen Ankunft auf sich hatte. Voyeurismus war schließlich keine Straftat.
Als ich die Blätter beiseiteschob, ging die Tür auf, noch bevor der Kutscher, ein schmächtiger Junge in geflicktem Jackett, diese erreichte. Ihm entgegen trat ein hochgewachsener Gentleman. Dramatisch schwang der tiefrote Mantel des Herrn in die Höhe, als er auf das Pflaster sprang. Der Größenunterschied zwischen den beiden war beachtlich und auch ihre Kleidung das genaue Gegenteil voneinander.
In einer Hand hielt der Hausherr Zylinder und Gehstock, die andere reichte er in Richtung der Kutsche. Eine in einen weißen Seidenhandschuh gehüllte Hand ergriff seine von pechschwarzem Leder umhüllten Finger. Galant half er seiner Gefährtin hinaus. Ihr üppiges Kleid war verziert mit echten Federn und erleuchtete mit bunten Farben die dunkle Straße.
Ich kroch noch näher heran, sodass ich ihr Gesicht im Schein der Laterne besser erkennen konnte. Besonders fielen ihre roten Lippen und die ausdrucksstarken dunklen Augen auf, die von schwarzen Locken gerahmt wurden. Die Lady flüsterte ihrem männlichen Begleiter etwas zu. Zusammen mit einem zarten Lächeln kamen weiche Grübchen auf den rosigen Wangen zum Vorschein. Wer solche Schönheit einmal zu Gesicht bekam, vergaß sie nicht wieder. Ihr Partner stand mit dem Rücken zu mir, sodass mir sein Gesicht verborgen blieb.
Der junge Kutscher verneigte sich vor seinem Herrn und nahm erneut Platz hinter den Pferden, während das Paar zum Hauseingang schritt. Dort hielt der Gentleman die Tür auf, und nachdem beide hineingetreten waren, fiel das Holz mit einem Knall ins Schloss. Das Geräusch war wie ein Startschuss für die Pferde, und sie zogen das schwarze Gefährt zurück in die Dunkelheit, aus der es gekommen war.
Die Stille hielt erneut Einzug, bis das sanfte Rascheln meiner Bewegung sie störte. Das Paar hatte etwas Ominöses an sich, bedingt durch die späte Ankunft. Deswegen beschloss ich, mehr über sie herauszufinden. Ich löste mich von der Hecke und schlich in ihrem Schatten zum hinteren Teil der Villa. Dort erklommen dicke Efeuranken die Wände und umrahmten die Fenster, welche über den wilden Garten wachten.
Ich lugte durchs Glas. Das Innere des Anwesens war nicht minder imposant als das Äußere, doch das schwache Licht des verschleierten Mondes ließ das grandiose Mobiliar unheimlich wirken. Die Holzverläufe auf den Kommoden wirkten wie Augen, die Kerzenständer darauf wie Hörner und das Gitter im Kamin glich den Zähnen eines Ungeheuers. Verstärkt wurde die Atmosphäre noch durch eine Vielzahl von Ölporträts, die die Seidentapeten zierten. Auch hier führte das mangelnde Licht dazu, dass sie bedrohlich erschienen. Die Gesichter waren kaum zu erkennen, doch ihre Blicke deutlich spürbar.
In die Mitte dieser optischen Kuriositäten trat das Paar. Sie waren zwei Schatten vor einem dunklen Hintergrund. Ich presste das Gesicht gegen die Scheibe, um sie besser zu erkennen.
Die Lady und der Gentleman schritten langsam, gebannt von ihrer Unterhaltung, entlang der großen Ölgemälde und hielten vor einer verhüllten Leinwand, die gegen einen Sessel lehnte. Über ihr war ein freier Platz. Ich wusste nicht viel über die Eigenarten der Wohlhabenden. Gehörte es sich, mitten in der Nacht Kunstobjekte zu betrachten?
Der Gentleman nahm eine Kerze vom Kaminsims und entfachte sie. Mit der Spitze seines Gehstocks hob er das Leinentuch an und brachte die Flamme näher heran. Sein breiter Rücken erlaubte mir nicht, das Bild zu erkennen.
Beim Betrachten gab die Dame ein so durchdringendes Quietschen von sich, dass sogar ich es hörte. Ihr Gegenüber lachte schallend.
Das Geräusch hatte etwas so Bedrohliches an sich, dass es mir einen Schauer über den Rücken jagte. Das schien auch die Dame so zu empfinden, denn sie wich zurück. Er ließ jedoch nicht zu, dass sich der Abstand zwischen ihnen erweiterte, und machte einen Satz vor.
Die Dame rannte los. Er hinterher. Ich sah bewegungslos zu. Mein Körper war vor Schreck wie eingefroren. Die Frau erreichte die Tür, doch der Mann packte sie am Arm. Dabei fiel ihm die Kerze zu Boden und erlosch. Ein Gerangel entbrannte, dann hob er seinen Gehstock in die Höhe und ein plötzliches blaues Licht hüllte das Paar ein. Es strahlte immer heller und blendete mich.
Was war das? Wovon wurde ich da Zeugin?
Das Licht verschwand so schnell, wie es erschienen war, und mit ihm die Dame. Zurück blieben tausend Fragen und das Gefühl akuter Gefahr. Mein Verstand raste.
Der Rücken des Mannes bebte vor Anstrengung, sein Gehstock war gebrochen. Langsam richtete er sich auf und wischte sich die zerzausten Haarsträhnen aus dem Gesicht. Sein Blick wanderte langsam und mit Bedacht durch den Raum, so als wäre ihm jetzt erst aufgefallen, wo er sich befand. Der Mond trat hinter den Wolken hervor, und ich erhaschte endlich einen Blick auf sein Gesicht.
Sein Gesicht! Wenn er sich weiter umdrehte, würde er mir direkt in die Augen sehen! Ich ließ mich zu Boden fallen und schob die Efeuranken wie einen Vorhang vor mir zu. Mein Herz hämmerte mit solcher Wucht, als würde es aus meinem Brustkorb fliehen wollen. Auf allen vieren kroch ich durch das Gebüsch. Ich musste hier weg.
Was auch immer er mit der Frau gemacht hatte, ich wollte nicht die nächste sein. Mich durchfuhr eine Eiseskälte. Er hatte mich nicht gesehen, oder? Ich drehte mich vorsichtig um, mein Körper war so verkrampft, dass es sich anfühlte, als würde mein Hals von der Bewegung brechen. Der Gentleman trat in dem Moment ans Fenster. Langsam ließ er den Blick über den dunklen Garten schweifen. Ich blieb vollkommen still. Das Gebüsch und die Dunkelheit waren meine schützenden Komplizen – ihnen musste ich vertrauen, auch wenn mich das Verlangen wegzurennen zu übermannen drohte. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, bis er endlich vom Fenster wegtrat und ich die Flucht ergriff.
Ich rannte den ganzen Weg zurück, bis Tausende Nadeln in meiner Lunge brannten. Der Nebel hatte sich verzogen, deswegen bemühte ich mich, innerhalb der Schatten zu bleiben. Immer wieder sah ich mich um, um sicherzugehen, dass mir niemand folgte. Jedes Mal war die Straße leer, doch das war nur ein geringer Trost. In mir war eine unbeschreibliche Unruhe. Ich konnte das Gesehene nicht deuten – es überstieg meine Vorstellungskraft.
Unweit der High Street öffnete sich eine enge Gasse in Richtung eines einsamen kleinen Ladens. Selbst tagsüber war es ein Leichtes, diesen zu übersehen, doch in der Nacht wirkte es so, als wäre er gänzlich von der Finsternis verschlungen. Das Einzige, was den Laden verriet, war das Aufprallen des Schildes gegen die klapprige Tür, wann immer der Wind es gebot. Die abgesplitterte Farbe und die ungepflegte Fensterfront deuteten darauf hin, dass das Geschäft von Mr Copper & Co’s Collection of Canes nicht sonderlich gut lief. Trotz geringer Nachfrage bot Mr Copper seine handgefertigten Gehstöcke weiter zum Verkauf an, so wie sein Vater vor ihm und dessen Vater davor es getan hatten.
Als der Wind zur Ruhe kam und das Schild aufhörte, hin und her zu schwingen, löste ich mich aus der Dunkelheit und ging auf den Laden zu. Die Hände hatte ich tief in die Taschen des zu großen Mantels gesteckt, dennoch hatte die Kälte ihnen sämtliches Gefühl entzogen. Das Ertasten des Schlüssels wurde dadurch zur Herausforderung, und erst nach langem Kramen umschloss ich seine filigrane Form und führte ihn in das Schloss. Es zu entriegeln erforderte erheblichen Kraftaufwand, da die Scharniere über die Jahre verrutscht waren – das leise hinzubekommen war eine Frage des Geschicks. Nach langem Ringen gab die Tür endlich nach. Auf Zehenspitzen trat ich ein und ließ das alte Holz sachte hinter mir zufallen.
Mit einem tonlosen Seufzer streifte ich den Mantel von den Schultern und lehnte mich gedankenverloren gegen die Wand. Noch immer raste mein Herz.
»Bist du erneut um die Anwesen der Reichen geschlichen?«, ertönte die vorwurfsvolle Stimme meines Onkels. Ich sprang auf vor Schreck. Meine Reaktion ließ ihn zurückweichen. Er war kaum mehr als eine Kontur zwischen dem Tresen und dem Regal, das bis zum Rand mit unterschiedlich großen Schachteln und Kartons zugestellt war. Seine Schultern waren seit Jahren in einer Haltung der permanenten Anspannung gefangen.
»Du bist noch auf?«, gab ich kleinlaut von mir.
»Dasselbe wollte ich dich fragen.«
Darauf fiel mir keine Antwort ein, denn was ich erlebt hatte, wirkte wie ein Albtraum. Überhaupt war mein Verstand leer oder, besser gesagt, er war so fixiert auf das blaue Licht und das Verschwinden der Frau, dass für eine Unterhaltung mit meinem Onkel keine Kapazität blieb.
»Was ist los, Susie? Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen.« Mein Onkel verfehlte die tadelnde Wirkung, die er erzielen wollte. Dafür war er in zu großer Sorge um mich, das erkannte ich an seiner Stimme. Normalerweise weckte das tiefe Schuldgefühle in mir, doch auch dazu war ich momentan nicht fähig.
Benommen musterte ich die Fliesen zu meinen Füßen. Diese waren einst quadratisch gewesen, doch über die Jahre in die verschiedensten Formen gesplittert.
»Warum bist du nur plötzlich so versessen darauf, diesen Leuten nachzustellen? Sie gehören einer anderen Klasse an als wir, Susie. Sie leben in einer anderen Welt und mögen es nicht, diese mit unserer in Berührung zu bringen.« Trotz der strengen Worte gelang es ihm nicht, die Wärme in seiner Stimme zu verstecken. »Hör bitte auf, dich in ihre Angelegenheiten einzumischen.«
»Ich mische mich nicht ein«, erwiderte ich endlich. Meine Stimme war rau von der nächtlichen Kälte. »Ich beobachte nur. Sonst nichts, Onkel.« Erneut spielte sich der Verlauf der Nacht in schnellen Bildern in meinem Gedächtnis ab. Ein einzelner Gedanke war so laut, dass ich ihn unwillkürlich aussprach: »Worauf bin ich da bloß gestoßen?«
Ich bemühte mich, sachlich nachzudenken, anstatt der Panik freien Lauf zu lassen, auch wenn Letzteres sehr verlockend war.
Welche möglichen Erklärungen gab es also? Als das blaue Licht erstrahlt war, konnte ich nichts sehen. Wäre es dann nicht möglich, dass die Frau entkommen war? Nein. Wäre es ihr gelungen zu fliehen, hätte sie der Mann sicherlich verfolgt, anstatt im Zimmer zu verweilen. Und hätte er sie … mir stockte der Atem … ermordet, so wäre ihr Körper zu Boden gegangen. Doch die Lady hatte sich plötzlich wie in Luft aufgelöst, ohne jegliche Spur.
Ich sah Hilfe suchend zu meinem Onkel, sein trauriger Blick war so belastend, dass ich stumm blieb. Über die Jahre war ich ihm schon oft zur Last gefallen, dabei wollte ich das Gegenteil. Schließlich hatte ich nur noch ihn.
Mr Copper schob seine Brille hoch in den wilden Mob grauer Haare und rieb sich die müden Augen. »Eifersucht ist eine Eigenschaft, die man nicht nähren sollte, Susie«, sprach er voller Verständnis. »Als jemand, dessen Geschäft trotz eiserner Arbeitsmoral wenig Einkommen erzielt, kann ich die dunklen Gefühle nachvollziehen, die beim Betrachten der Reichtümer anderer aufleben.«
Ich sah mit aufgerissenen Augen zu ihm auf. Mir war nur seine großzügige Seite bekannt; dass er auch Finsternis im Herzen trug, überraschte mich. Dennoch lag er falsch. Was mich motivierte, um die Häuser der Elite zu schleichen, war nicht Eifersucht.
»Eines Tages wird dich deine Faszination für die Oberschicht in große Schwierigkeiten bringen.«
»Nein«, widersprach ich, weil ich nicht ertragen konnte, dass er so über mich dachte. Die Wahrheit konnte … wollte ich ihm nicht sagen, aber ihn im Glauben zu lassen, dass ich aus niederen Beweggründen anderen nachstellte, noch viel weniger. »Um Faszination geht es nicht.«
Wie es wohl war, schöne Kleider zu tragen und in den eindrucksvollen Häusern zu wohnen, fragte ich mich schon, doch war es nicht das, was meine Gedanken beherrschte. Ich suchte Hinweise, und heute hatte ich mehr bekommen, als mir lieb war.
»Susie«, flüsterte er fürsorglich und verlor sogleich das bisschen Autorität, das er sich im Verlauf des Gesprächs mühsam erarbeitet hatte. Zu oft hatten wir Diskussionen dieser Art geführt. »Geh zu Bett, Kind.«
Mr Copper gab auf.
»Sehr wohl, Onkel«, erwiderte ich und senkte den Kopf. Ich wollte meinem verbliebenen Verwandten nicht so viel Kummer bereiten.
Der Mann schlurfte schweren Schrittes die knarrende Treppe hinauf. Unser Haus war ein Relikt aus längst vergangenen Tagen. Die Wände bestanden aus Lehm und Holz, die sich unter dem Gewicht des Dachs verbogen hatten und nun gegen das Nachbarhaus lehnten. Es wirkte von innen noch schmaler als von außen. Wie es unverändert durch die Jahrhunderte gekommen war, war mir ein Rätsel. Wahrscheinlich wurde es einfach übersehen – so klein und unscheinbar, wie es war.
Nachdem ich meinen Onkel die Tür zu seinem Schlafzimmer schließen hörte, blieb auch mir nichts anderes übrig, als zu Bett zu gehen. Ob es mir gelingen würde zu schlafen, war allerdings fraglich.
Bevor ich nach oben ging, warf ich einen Blick zum Fenster. Onkel stellte darin seine Gehstöcke aus und dekorierte sie sorgsam. Jede Woche wechselte er die Auslage, putzte aber nie das Fenster. Es war so verdreckt, dass man seine Kreationen kaum von außen erkannte. Ich trat näher heran und wischte mit dem Finger über das Glas. Es war schon wieder staubig, obwohl ich erst vor zwei Tagen gewischt hatte. In einem so alten Haus war es immer staubig, egal wie sehr man sich bemühte.
Aus dem Augenwinkel sah ich etwas am Fenster vorbeihuschen. Ich blickte auf, starrte in die Nacht. Mein Atem ging schneller. Konnte mir der Mann doch gefolgt sein? Allein bei dem Gedanken wurde mir schlecht.
Ich schluckte und begab mich zur Tür. Vorsichtig öffnete ich sie und lugte hinaus. Alles war still. Die Dunkelheit verbarg all jene, die ihre Gesellschaft suchten. Noch eine Weile ließ ich die Nachtluft meine Gedanken kühlen, musterte die Schatten um mich herum, bis mir eine eigenartige Form auffiel. Es sah so aus, als trug die Laterne, die schon seit Jahren nicht mehr brannte und auch nie repariert wurde, einen Zylinder. Mein Herz begann schneller zu schlagen.
»Ist da jemand?«, fragte ich mit zaghafter Stimme.
Ich blinzelte, um meine Augen zu fokussieren.
»Sie da mit dem Zylinder«, forderte ich den Schatten heraus, doch er rührte sich nicht.
»Susanna!«
Ich sprang vor Schreck mit dem Kopf gegen das Ladenschild. Dann ließ ich meinen Blick am Gebäude hochwandern. Im ersten Stock hatte sich Mr Copper aus seinem Fenster gelehnt.
»Geh endlich ins Bett«, mahnte er.
Ich sah nochmals zu dem Zylinder, doch fand den Schatten nicht wieder.
In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich nicht ein Auge zubekommen würde. Zu viele Fragen weckte das blaue Licht, zu hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass der düstere Gentleman mir gefolgt war. Wer war er, und was hatte er getan? Oder waren das alles nur die Hirngespinste einer Fantasie, die sich nach Abenteuern sehnte? Eine Fantasie, die sogar blaue Lichter heraufbeschwören konnte? So würde es mir sicher jeder auslegen, wenn ich meine Geschichte erzählen würde. Ich konnte es selbst kaum glauben, wie würde es also jemand anderes tun? Hätte ich doch niemals das Notizbuch meines Bruders gefunden, dann hätte ich nicht erneut angefangen, nach ihm zu suchen.
Eine Fährte der Verwirrung
Der anbrechende Tag nahm der Stadt ihren unheimlichen Schleier und tränkte die majestätischen Universitätsgebäude in gleißendes Licht. Selbst die einsame Gasse zu Mr Copper & Co’s Collection of Canes erschienen viel freundlicher. Ein einsamer Sonnenstrahl verirrte sich bis in den Laden und machte den tanzenden Staub sichtbar.
Trotz mangelnder Kundschaft stand Mr Copper auch heute so früh auf wie in all den achtzehn Jahren seiner Geschäftsführung und den zweiunddreißig davor, in denen sein Vater den Laden geführt hatte. Wie jeden Morgen positionierte er sich hinter dem Tresen und beobachtete voller Erwartung die Tür, als würden die Massen jeden Moment in den Laden strömen.
Hinten in der Vorratskammer mühte ich mich unterdessen mit der Organisation des engen Raumes ab. Ich hatte vier Tassen starken Tee getrunken, um der Müdigkeit zu entkommen, die mich nach einer schlaflosen Nacht plagte. Im Teein-Rausch stellte ich eifrig die schweren Kisten und Schachteln um, geleitet von der Überzeugung, dass eine neue Ordnung mehr Platz schaffen könnte. Doch das viele Gerümpel, von dem Onkel sich zu trennen weigerte, wollte sich nicht untergeben und attackierte mich mit Staubschwaden, Spinnweben und willkürlichen Gegenständen, die aus den Schachteln fielen. Warum Onkel darauf beharrte, die Stoff-, und Holzreste sowie diverse metallische Ornamente und Verzierungen zu behalten, war mir ein Rätsel. Wirklich verarbeiten konnte man die Dinge für Gehstöcke nicht mehr. Es war wohl Nostalgie, die Mr Copper an die Gegenstände band. Ich hatte noch nie verstanden, wie man nutzlosem Trödel so viel Wichtigkeit zusprechen konnte. Allerdings hatte ich auch nie viel besessen und konnte womöglich gar nicht einschätzen, welche Bedeutung simple Dinge haben konnten, wenn ihnen mehr innewohnte als materieller Wert.
Gerade hatte ich die letzte Schachtel auf den deckenhohen Turm abgelegt, da fing das Konstrukt an zu wackeln und brach in sich zusammen. Die Mühe der letzten Stunden war völlig umsonst gewesen, und der Lärm übertönte Onkels Stimme aus dem Nebenraum. Nun war meine Engelsgeduld am Ende. Sollte das blöde Chaos doch weiter vorherrschen!
Ich befreite mich unter Anstrengung aus dem Sumpf an Trödel und watete wie ein Reiher zur Tür.
»Ich konnte dich nicht verstehen, Onkel«, rief ich und nahm den Austausch als Vorwand, die Rumpelkammer zu verlassen, doch bevor ich es in die Freiheit schaffte, lugte sein grauer Wuschelkopf hinein.
»Ich kann bisher keinen Fortschritt entdecken«, gab Onkel mit einem Hauch Belustigung in seiner Stimme zu, als er die Unordnung musterte.
»Das gehört alles zum Prozess«, flunkerte ich, »es muss erst schlimmer werden, bevor es sich verbessern kann.«
Onkel hielt andächtig inne. »Wie dem auch sei … könntest du den Prozess unterbrechen, um für mich zur Post zu laufen?«
»Aber natürlich!«, erwiderte ich voller Eifer. Das war eine gute Gelegenheit, der unmöglichen Aufgabe, die ich mir selbst gestellt hatte, zu entfliehen. »Und keine Sorge, du wirst den Lagerraum kaum wiedererkennen, wenn ich damit fertig bin.«
Onkel nickte mit Bedacht und ließ seinen Blick über die umgefallenen Türme schweifen. »Das befürchte ich.«
Ich tat so, als hätte ich ihn nicht gehört, und nahm die Briefe, die er hochhielt. Einer war adressiert an eine entfernte Großtante, der er regelmäßig schrieb, obwohl die alte, strenge Frau bekanntermaßen die Gesellschaft anderer mied und nie antwortete. Mr Copper hielt es für seine Pflicht, eine Verbindung zu all seinen entfernten Verwandten aufrechtzuerhalten, auch wenn er nie Dank dafür zu erwarten hatte. So war er einfach, ganz gleich, ob es ums Geschäft oder Privates ging, und das schätzte ich sehr an ihm. Auf dem zweiten Kuvert stand die Anschrift seiner Bank. Wirklich interessant wirkte keiner von beiden. Der Mangel an Geheimnissen und Skandalen machte Onkel zu einer verlässlichen Konstanten in meinem Leben.
»Ich komme so schnell wie möglich wieder«, versprach ich und griff nach dem Mantel auf dem Weg hinaus.
Oxford war unvergleichlich schön zu dieser Tageszeit. Die sandig goldenen Universitätsgebäude mit ihren Türmen und burgähnlichen Fassaden regierten die Aussicht. Sie unterschieden sich architektonisch so stark voneinander, dass man sich vorkam wie auf einer Ausstellung von Märchenschlössern. Durch die vielen Studenten und staunenden Besucher waren die Straßen so lebhaft, dass es schwer vorstellbar war, wie sehr sich die Atmosphäre zur Nacht hin wandelte.
Ich kannte jede Ecke und noch so kleine Gasse, jeden Pub und jeden Laden. Selbst die meisten Menschen waren mir vertraut, auch wenn ich nie mit ihnen sprach. Da war zum Beispiel die ältere Dame, die jeden Nachmittag vor ihrer Haustür kehrte. Sie hatte stets Süßigkeiten in den Taschen für die Nachbarskinder, die auf der Straße spielten. Auf der anderen Seite lief die Dienstmagd, die in einem der eindrucksvollen Anwesen angestellt war. Sie trug zwei schwere Körbe, gefüllt mit Lebensmitteln vom Markt und machte dennoch einen Umweg durch die Innenstadt, um am Milchjungen vorbeizukommen und mit ihm einen verstohlenen Blick gegen ein schüchternes Lächeln auszutauschen. Dann war da noch der Bäcker, der seine mehlbedeckte Schürze ausklopfte und jeden Morgen das alte Brot an die Vögel verfütterte; die Mutter mit ihren drei zankenden Kindern, die unterwegs zum Park waren; der Student, dessen Gesicht selbst beim Laufen hinter Büchern versteckt war; der Zeitungsjunge, der den neuesten Skandal in die Straße hinausbrüllte.
Ich gab mir große Mühe, meine Umgebung und Mitmenschen wahrzunehmen und auf Details zu achten – auf diese Weise fühlte ich mich ihnen verbunden. Echte Bekanntschaften einzugehen fiel mir seit dem Verschwinden meines Bruders schwer. Auch wenn mein Gesicht nur selten jemand erkannte, so war der Copper-Skandal in ganz Oxford ein Begriff.
Der Nachname stand wie eine Wand zwischen mir und anderen. Sobald er ertönte, verlor ich meine Anonymität – plötzlich meinte jeder, mich zu kennen, dennoch blieb ich ihm treu und nannte ihn mit Stolz. Ganz gleich, welche Meinung andere hatten.
Ich bog in die Hauptstraße ein und verschmolz mit dem bunten Treiben. Eigentlich war mein Leben ziemlich unspektakulär. Wenn die vermeintlichen Exzesse meines Bruders in Vergessenheit geraten würden, wäre ich der langweiligste Mensch Englands.
Ein tiefes Rot blitzte in meinem Augenblickwinkel auf, und ich drehte instinktiv den Kopf dorthin. Mein Puls beschleunigte sich unwillkürlich und mein Herz raste. Eine Frau trat aus einem Blumenladen, sie war mir fremd, doch trug sie ein rotes Kleid. Es war so rot wie der Mantel des Herrn, der blaue Blitze heraufbeschwören und Menschen verschwinden lassen konnte. Seit letzter Nacht war mein Leben gar nicht mehr so unspektakulär, und sosehr ich auch versuchte vorzugeben, es wäre alles normal, die Erinnerungen ließen sich nicht unterdrücken. Ein Kleid genügte, um meine Gedanken zurück ins Chaos zu werfen.
Es war Erics Notizbuch gewesen, das mich vergangene Nacht um die Villen in Norham Gardens hatte schleichen lassen. Ich hatte es auf dem Dachboden gefunden, und sein Inhalt ließ mir keine Ruhe. Die Seiten waren gefüllt mit Porträts. Erst hatte ich angenommen, dass es womöglich nur ein Kunstprojekt meines Bruders war – nichts weiter als ein Zeitvertreib. Doch je öfter ich es betrachtete, desto mehr wirkten die Bleistiftskizzen wie eine Studie. An jedem der Bilder standen Uhrzeit, Datum und Ort. Das letzte Bild in dem Notizbuch zeigte einen Mann, und als Ortsangabe war Norham Gardens vermerkt. Zwar hatte ich nur einen kurzen Blick auf den Gentleman gestern erhascht, doch ähnelte er der Zeichnung. Die spitze Nase, der strenge Blick und die schwarzen langen Haare stimmten überein. Hätte ich ihn doch nur besser sehen können …
Gedankenverloren erreichte ich die Post, und wie so oft fand sich eine lange Schlange davor. Die Royal Mail war nicht gerade für ihre Schnelligkeit bekannt. Tief seufzend nahm ich meinen Platz ganz hinten ein. Vor mir stand ein Mann, der seine Nase in der aktuellen Ausgabe der Oxford Gazette vergrub. Auch ich hätte jetzt gern etwas zum Lesen gehabt, dann wäre ich meinen rasenden Gedanken nicht hilflos ausgeliefert.
Nach vierzehn Minuten, von denen ich jede einzelne auf der Uhr eines Kirchturms verfolgt hatte, wurde die Warterei unerträglich und ich lugte über die Schulter des Herrn vor mir, um in seiner Zeitung mitzulesen. Das schwarz-weiße Porträt einer feinen Dame zog mich sofort in seinen Bann. Ihre Frisur war wahnsinnig modisch. Die aufgetürmten Locken aus dunklem Seidenhaar wurden zusammengehalten von einem kleinen, seitlich sitzenden Hut. Der Blick der Dame wirkte sehr intensiv, obwohl es nur ein Abdruck auf billigem Zeitungspapier war. Die Lippen waren pechschwarz, was den Schluss zuließ, dass sie im wahren Leben tiefrot sein mussten. Sie waren zusammengeführt in einem sanften Lächeln, das Grübchen zum Vorschein brachte unter den definierten Wangenknochen.
Es war, als würde mich ein Blitz treffen! Ich hatte diese Frau schon einmal gesehen … womöglich war ich sogar die letzte, die das von sich behaupten konnte.
»Das gibt es doch nicht!«, murmelte ich, und der Mann vor mir drehte sich echauffiert um.
Ich hatte mich so weit vorgelehnt, dass mein Kinn nahezu auf seiner Schulter lag.
»Ja, sagen Sie mal!«, tönte es empört unter dem dichten Schnauzbart hervor, und der Mann faltete seine Zeitung zusammen, als würden die Worte verschwinden, wenn jemand anderes mitlas.
In dem Moment, als er die Zeitung wegdrehte, erblickte ich die Überschrift: Ratlosigkeit und Sorge am Parklane Anwesen: Lady Gwen Barlow ist verschwunden!
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Sir«, murmelte ich, während mich blankes Entsetzen überkam. Der Mann konnte nicht wissen, was in mir vorging, und nahm wahrscheinlich an, dass mir der Fauxpas aufrichtig leidtat. Zufrieden wandte er sich seiner Zeitung zu.
Die Gedankenspirale schickte mich auf eine Reise, von der mir schlecht wurde. Die Dame auf dem Bild war die Frau von gestern Nacht, und nur ich wusste, was geschehen war. Hätte ich doch nur das Gesicht des Täters richtig gesehen.
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Was, wenn die Frau noch gerettet werden konnte und Hilfe brauchte? Ich schluckte. Was, wenn sie tot war? Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken.
Mich schubste jemand, und mir blieb vor Schreck fast das Herz stehen.
»Kannst du bitte weitergehen? Dein Vordermann ist schon weit vorausgegangen«, meckerte die Frau hinter mir.
Ich nickte nur und stapfte dem Mann mit der Zeitung hinterher, ohne meinen Gedankenfluss zu unterbrechen … Hätte ich gestern Abend etwas tun sollen? Wenn ja, was? Ich hätte ja schlecht an der Tür des Mannes klopfen und ihn zur Rede stellen können. Dann hätte er mir bestimmt das Gleiche wie Lady Barlow angetan.
Ich schüttelte den Kopf. Nichts zu tun war feige gewesen! Doch konnte ich die Uhr nicht zurückdrehen und musste überlegen, was jetzt noch getan werden konnte.
Vor mir raschelte der Mann mit der Zeitung, als er die nächste Seite aufschlug. Ja, genau! Ich musste zur Oxford Gazette gehen und berichten, was ich gesehen hatte. Der Reporter des Artikels über Lady Barlow würde sicher etwas mit den Informationen anzufangen wissen. Ich durfte keine weitere Zeit verlieren!
Eine seltsame Deutung
Ich lief von der Hauptstraße in eine enge Seitengasse und kam heraus am Radcliffe Square. Obwohl ich mein ganzes Leben in Oxford verbracht hatte, verleitete der Platz mich dazu, andächtig innezuhalten, wann immer ich ihn passierte. In seiner Mitte war die Radcliffe Camera, eine zylinder-förmige Bibliothek in einem neoklassischen Gewölbe aus sandfarbenem Stein, umrundet von Säulen und einer Balustrade. Obenauf saß eine Kuppel, die die Farbe des Himmels reflektierte. Die eindrucksvolle Bibliothek war nicht nur das Herz des Platzes, sondern auch das der Universitäten und der ganzen Stadt. Der Eintritt wurde nur Studenten, Professoren und anderen Privilegierten gestattet – eine Parallelwelt, zu der ich nicht einmal in meinen kühnsten Träumen zählen würde. Auch wenn ich sie von innen nie gesehen hatte, so wusste ich genau, von wo aus man den besten Blick auf das Äußere hatte.
Neben der Radcliffe Camera befand sich die höchste Kirche Oxfords, benannt nach der Jungfrau Maria. Sie ragte bis hoch in die Wolken und war wie eine Mischung aus Palast und Kathedrale mit ihren Turmspitzen auf Turmspitzen, spitz zulaufenden Bogenfenstern, Gargoyles und Mauerzinnen. Wer sich ihr enges Treppengewölbe hinauftraute, überblickte vom Turm aus die Stadt und den gesamten Radcliffe Square. Auch über die hohe Mauer des All Saint College, das das architektonisch überwältigende Trio des Radcliffe Square abschloss.
Unter den neununddreißig Colleges war dieses so elitär, dass davon selbst die Elite ausgeschlossen wurde. Nur Absolventen einer der Universitäten Oxfords durften sich dort für einen der wenigen Plätze bewerben. Und das spiegelte sich in der Architektur wider. Eine hohe Steinmauer erschwerte den Einblick in diese exklusive Welt, der nur durch das Eisentor, in das vergoldete Blätter eingelassen waren, erhascht werden konnte. Mit seinen zwei Türmen, den Bogenfenstern und Dachzinnen hatte es Ähnlichkeit mit der Kirche, doch bot weniger Verzierungen – als hätte es ein Übermaß nicht nötig. Dafür war das viereckige Gebäude, das um eine runde Rasenfläche verlief, umso massiver und erhabener.
Diese Überlegenheit schüchterte mich sonst ebenso stark ein, wie sie mich faszinierte. Nur nicht heute. Heute war meine Mission bedeutender als die jedes Studenten, heute wusste ich mehr über das Verschwinden der Lady Barlow als jeder andere.
Ich überquerte den Radcliffe Square erhobenen Hauptes und schnellen Schrittes. Welcher University of Oxford-Student konnte schon von sich behaupten, gerade ein Leben retten zu gehen? Ich schluckte. Hoffentlich war es noch nicht zu spät! Als mich dieser Gedanke ereilte, beschleunigte ich das Tempo.
Die Pressestelle der Oxford Gazette war nicht weit vom Radcliffe Square in einem klassischen viktorianischen Gebäude aus rotem Ziegelstein mit weiß umrahmten Erkerfenstern. In einer anderen Stadt wäre so ein gepflegtes Gebäude bestimmt herausgestochen, aber im Vergleich zu den Universitätsbauten wirkte es blass. Dennoch konnte man es nicht verfehlen, dank der großen Gruppe an besonders enthusiastischen Zeitungsjungen, die die Schlagzeilen dramatisch hinausposaunten, um sie den Passanten schmackhaft zu machen. Sie waren dabei so erfolgreich, dass ihre brechenden Jungenstimmen musikalisch untermalt wurden vom Klimpern der Pennys der vielen Käufer.
Ich bannte mir einen Weg durch die Menschenmasse und lief ins Gebäude, ohne um Erlaubnis zu fragen, schließlich hatte ich wichtige Informationen, die nicht warten durften. Das verlieh meinem Gang das gleiche Selbstbewusstsein wie den Reportern, die dynamisch die Schwingtür passierten. Im Inneren hielt ich allerdings kurz an und musste mich neu orientieren.
Viel Zeit blieb nicht, bis jemand meine Anwesenheit hinterfragen würde. Als Frau stach ich in dem von Männern dominierten Umfeld heraus und musste handeln, ehe ich des Raumes verwiesen werden konnte. Ohne lange nachzudenken, steuerte ich auf die erste Tür zu, die ich entdeckte. Vielversprechenderweise war sie mit der Aufschrift Presse versehen.
Dahinter verbarg sich eine große Halle mit einem Meer an Schreibtischen, die allesamt eng beieinanderstanden. Dichter Qualm lag in der Luft, da viele der Reporter Pfeife rauchten. Sie liefen entweder wild umher oder saßen an ihren Plätzen und hämmerten auf ihren Schreibmaschinen. Im hinteren Bereich standen große schwarze Metallmonster, die bogenweise bedrucktes Papier ausspuckten. Das Rattern erfüllte den gesamten Raum.
Als ich das sah, schwand mein Mut. Die Geschwindigkeit, der Lärm, die rauen Gesichter und die stickige Luft waren so anders als Onkels ruhiger Laden, in dem die Zeit vor Jahren stehen geblieben zu sein schien. Der Rauch füllte die Lunge und stach in den Augen, er machte es zunehmend schwerer, sich auf das noble Vorhaben zu konzentrieren.
»Hast du dich verlaufen?«
Ein Mann packte mich am Arm. Er musterte mich argwöhnisch, nahm sich dann behutsam die Pfeife aus dem Mund und steckte sie in die Westentasche. Die Zeit war ungnädig zu seiner Weste gewesen, hatte ihren Stoff ausgeleiert und sie um die Hälfte ihrer Knöpfe erleichtert. Lose hing das Kleidungsstück von den Schultern des Trägers. Sein gelblich weißes Hemd war stellenweise von Druckertinte beschmiert. Alles in allem machte er einen rabiaten Eindruck und wirkte wie jemand, mit dem man sich nicht anlegen sollte.
Ich richtete mich auf und streckte die Brust raus, um das zunehmend dominierende Gefühl der Einschüchterung zu überspielen.
»Ich muss unbedingt mit dem Reporter sprechen, der den Artikel über Lady Barlow und ihr Verschwinden verfasst hat«, verkündete ich in einem Tonfall, der dringlich klingen sollte, nur leider ins Hysterische umschlug. Trotz der Bemühung, laut und deutlich zu sprechen, ging meine Stimme im Lärm der geschäftigen Druckerei unter.
Der Mann hob eine Augenbraue und musterte mich prüfend, dann verzog er die Lippen zu einem Grinsen. Er nahm die Pfeife wieder zur Hand und wies damit die Richtung.
»Folge mir«, sagte er mit einem Lachen in der Stimme.
Ich legte die Hände vor mir ineinander und schritt in ruhigem Tempo hinter ihm her. Wenn man aufgeregt war, sollte man seine Bewegungen besonders langsam und achtsam ausführen – das hatte Onkel mir beigebracht. Der Mitarbeiter führte mich an einen Schreibtisch, auf dem sich Berge von Papier und Zeitungen türmten. Er setzte sich auf den leeren Stuhl und begann umgehend, darauf zu kippeln.
»Richard Reeves, wie kann ich weiterhelfen?«
Ich betrachtete den Mann unsicher. Konnte jemand, der so wenig acht auf sein Äußeres gab, ein ernst zu nehmender Reporter sein? Onkel putzte sich jeden Tag heraus, rasierte sich und legte Wert, dass seine Kleidung sauber war und richtig saß. Der Herr vor mir schien das genaue Gegenteil zu praktizieren.
»Den Artikel haben Sie geschrieben?«, fragte ich, um ganz sicherzugehen, dass ich an die richtige Person geraten war.
»In der Tat.« Er nickte stolz.
Ich zögerte. Zwar hatte ich viel über die Geschehnisse nachgedacht, doch nicht überlegt, wie ich sie am besten wiedergeben sollte. Das blaue Licht sollte ich wahrscheinlich lieber nicht erwähnen.
»Ich glaube …«, gab ich stockend von mir. Das war kein besonders vielversprechender Anfang. Ich musste überzeugter und überzeugender klingen. »Ich bin mir sehr sicher, dass ich weiß, wer das Verschwinden der Lady zu verschulden hat.«
Der Reporter hörte auf zu kippeln und lehnte sich vor. Seine Ellenbogen stützte er auf dem Tisch ab und musterte mich eindringlich. Seine Lippen formten sich zu einer harten Linie unter dem dichten Schnauzbart, und die Augen begannen zu funkeln.
»Tust du das, ja?«
Ich nickte vorsichtig. »Ich habe sie gestern Abend in Begleitung eines Mannes gesehen. Sie sind gemeinsam aus einer Kutsche gestiegen und haben ein großes Anwesen betreten.«
Mr Reeves Augen wurden zu Schlitzen. Ich interpretierte das als brennendes Interesse, was dazu führte, dass die Worte aus meinem Mund zu einem Wasserfall zusammenliefen.
»Der Gentleman war groß gewachsen und hatte dunkelbraunes Haar. Er trug einen langen roten Mantel und Gehstock. Sein Anwesen befindet sich am Ende von Norham Gardens. Zwei Adlerstatuen flankieren den Eingang …«
Ein lauter Knall brachte mich zum Verstummen. Mr Reeves hatte mit der offenen Hand auf den Schreibtisch geschlagen. Es war laut genug um uns herum, dass außer mir niemand anderes auf das Geräusch reagierte.
»Könnte es sein, dass du Mr James Frederik Darvill von Westford Manor meinst?« Der zuvor noch so entspannte Reporter war plötzlich außer sich. Ich wusste nicht, ob er wütend auf mich war oder ob der Name, den ich mir sofort merkte, starke Emotionen in ihm weckte.
»Leider weiß ich nicht, wie er heißt, nur wo er wohnt«, gab ich vorsichtig zu. »Die Fassade seiner Villa weist allerlei Verzierungen auf. Und seine schwarze Clarence wird von einem sehr jungen Kutscher gefahren.« Ich hatte das Gefühl, dass sich das Fenster für Erklärungen schloss, daher wollte ich noch so viele Informationen wie möglich preisgeben.
Mr Reeves brach in lautes Gelächter aus. »Das ist bei Weitem der beste Verdächtige des Tages«, grölte er. »Hey, Martin, hör dir das mal an!«
Ein weiterer Mann, der keinen Schnauzer, aber dafür einen sehr ähnlichen Kleidungsstil wie Mr Reeves hatte, lugte hinter einem Stapel Zeitungen am Nebentisch hervor und ließ seinem Sitznachbarn die volle Aufmerksamkeit zuteilwerden.
»Laut der kleinen Möchtegerndetektivin hat Mr Darvill Lady Barlow entführt«, teilte er seinem Kollegen jauchzend vor Lachen mit. Der andere Mann schlug sich die Hand vor die Stirn und fing ebenfalls an zu lachen.
»Meine Güte«, rief Martin, »man kann keine Vermisstenanzeige abdrucken, ohne dass die halbe Stadt zu Sherlock wird.«
Meine Wangen glühten. Dass meine Geschichte möglicherweise niemand glauben würde, war mir in den Sinn gekommen. Dennoch war ich wütend, schließlich hatte ich die Wahrheit gesagt. Anstatt mich aufzuregen, versteckte ich die Hände in den Taschen des viel zu großen Mantels. Wenn ich doch nur das Gleiche mit meinen hochkochenden Gefühlen machen könnte.
»Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er sie entführt hat, aber sie waren ganz bestimmt zusammen letzte Nacht.« Ich wollte noch nicht aufgeben, doch mir war bewusst, dass ich nun auf keinen Fall die ganze Wahrheit erzählen konnte. Sonst würden sie mich nicht nur auslachen, sondern für verrückt erklären.
»Mein gut gemeinter Rat an dich«, sagte Mr Reeves mit herablassender Stimme, die heiser war vor Lachen. »Ich würde meine Vermutungen nicht so laut kundtun, wenn ich du wäre. Sogar wir machen einen großen Bogen um Mr Darvill. Er mag es gar nicht, wenn man sich in seine Angelegenheiten einmischt, und hat das Geld und den Einfluss, die Leute davon abzuhalten. Erst letzten Monat wurde der alte Arty gefeuert, nachdem er Mr Darvill um ein Interview zu dessen Kunstsammlung gebeten hat.« Er zuckte mit den Schultern, als ob das der ganz natürliche und richtige Lauf der Dinge war. »Die reichen Leute erachten es als unverschämt, wenn das gemeine Volk an sie herantritt. Und so kleine Dummchen wie du mit deinen absurden Anschuldigungen geben ihnen recht.«
Martin pflichtete seinem Kollegen mit einem Kopfnicken bei.
»Was heißt hier absurde Anschuldigungen?«, echauffierte ich mich, obwohl ich wusste, dass dieser Kampf verloren war. »Sie sind der Sache doch noch nicht einmal nachgegangen. Was für eine Art Reporter sind Sie eigentlich?«
»Einer, der seine Anstellung behalten und seine vier Kinder durch den Winter bringen möchte«, antwortete er. »Ich arbeite für eine Zeitung, nicht für die Metropolitan Police!«
Hilflos blickte ich mich um. Die Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe hatten ihre Aufgaben niedergelegt und lauschten dem Austausch. Grimmig und mit verschränkten Armen musterten sie mich. Zwei machten sogar einen Schritt auf mich zu. Es war, als müsste Mr Reeves nur das Kommando geben, und ein halbes Duzend Reporter würde sich auf mich stürzen, an Armen und Beinen packen und vor die Tür werfen wie eine Straßenkatze.
Ich öffnete den Mund, um zu sprechen, doch mir fiel nichts ein, was Mr Reeves umstimmen könnte. Einen Augenblick lang betrachtete ich sein selbstgefälliges Grinsen. Es machte mich wütend, dass die Faktenlage weniger wichtig war als mein sozialer Status. Eine junge Frau aus ärmeren Verhältnissen konnte ja nicht recht haben, wenn sie einen Gentleman belastete. Aber das war nicht das erste Mal, dass mir Voreingenommenheit begegnete. Kurz bevor mein Bruder verschwand, hatte ich die gleiche Erfahrung gemacht. Egal wie sehr ich ihn vor Gericht verteidigte, meine Aussage hatte kein Gewicht.
Schließlich richtete ich den Blick zu Boden und gab mich geschlagen.
»Danke für Ihre Zeit«, sagte ich kleinlaut und machte mich auf den Weg hinaus, dabei vermied ich sämtlichen Augenkontakt. Ich konnte die urteilsvollen Blicke trotzdem spüren. Sie waren unerträglich, schließlich wusste ich, dass die Wahrheit auf meiner Seite war, doch das änderte nichts an meiner Machtlosigkeit.
»Verzeihung«, durchbrach eine andere weibliche Stimme das laute Rumoren der Maschinen. Eine kleine ältere Dame kam zu der Tür herein, durch die ich gerade fliehen wollte. Schnurstracks lief sie auf Mr Reeves zu.
»Verzeihung«, wiederholte sie nun etwas lauter. Die Dame war einen ganzen Kopf kleiner als ich, dabei war ich selbst nicht groß, nichtsdestotrotz strotzte sie nur so vor Selbstbewusstsein.
»Ich weiß, wo Lady Barlow zu finden ist«, verkündete sie.
»Ich kann kaum erwarten, es zu hören«, rief Mr Reeves mokant. »Wo wurde die Gute diesmal gesichtet?«
Mit großen Augen sah ich ihr zu. Wenn die Dame durch einen Zufall meine Behauptung bestätigte, dann würde es für Mr Reeves viel schwerer sein, die Tatsachen zu ignorieren.
»Vor einigen Tagen, am Mittwoch, nein, ich meine, es war Donnerstag … oder doch nicht?« Die Dame verlor sich in Gedanken, und meine Hoffnung schwand, noch bevor sie richtig aufgeblüht war. »Jedenfalls habe ich diese Frau gesehen, als ich meinen Mr Dabbles, meine Französische Bulldogge, spazieren führte.« Sie zeigte auf das Bild in der Oxford Gazette, die sie selbst mitgebracht hatte. »Sie war in Begleitung der Königin Viktoria von England und einem Herrn, der Lord Wellington wie aus dem Gesicht geschnitten war. Vielleicht sein Zwillingsbruder? Sie grüßten mich alle drei ganz freundlich, und wir verabredeten uns zum Bridgespielen.«
Mal abgesehen davon, dass Lord Wellington längst verstorben war, keinen Zwillingsbruder gehabt hatte, und wenn doch, dieser hundertneunzehn Jahre alt wäre, hatte die Königin sicherlich Besseres zu tun, als mit dem gemeinen Volk Karten zu spielen, vor allem, da sie sich momentan gar nicht in Oxford aufhielt. Das hielt die Dame nicht davon ab, weiter ihre Geschichte zu spinnen – sehr zur Belustigung der Reporter. Ich hatte genug gehört und verließ schnellen Schrittes den stickigen Presseraum.
Draußen auf der Straße trat ich mit aller Kraft eine Eichel aus dem Weg, aber das linderte weder die Wut noch die Pein.
Wozu wurde die Vermisstenanzeige überhaupt aufgegeben, wenn niemand am Finden der Frau interessiert war? Ich rieb mir die Augen. War ich womöglich genauso verrückt wie die ältere Dame? Schließlich war es wahrscheinlicher, Königin Viktoria zu begegnen, als jemanden in einem blauen Lichtstrahl verschwinden zu sehen. Zudem war die Frau von ihrer Geschichte genauso überzeugt wie ich von meiner. Vielleicht hatte mein Verstand mir einen Streich gespielt. So oder so, täte ich wohl gut daran, das alles zu vergessen und mein ruhiges, langweiliges Leben weiterzuleben. Das alles war nicht mein Problem und brauchte mich nicht zu kümmern … oder?
Ich holte tief Luft, um hochkommende Gefühle daran zu hindern, die Überhand zu gewinnen und sich in verräterische Tränen zu verwandeln. Ich schloss die Lider, atmete langsam ein und aus. Wollte ich die Art von Mensch sein, der andere ihrem Schicksal überließ? Wenn Lady Barlow noch zu retten war und Hilfe brauchte, dann musste ich Pein und Wut überwinden und handeln. Die Familie der armen Lady sehnte sich bestimmt nach ihrer Wiederkehr – ein Gefühl, das mir vertraut war. Ich wusste besser als sonst jemand, wie es war, eine geliebte Person zu vermissen. Welche Rolle spielte es also, was eine Handvoll Reporter dachte? Eine Frau war in Not, da durfte ich nicht tatenlos bleiben.
Wenn die Zeitungsleute nutzlos waren, so musste ich an die nächste Instanz herantreten, und das war die Polizei. Nur der Gedanke daran bereitete mir Bauchschmerzen. Die Polizei hatte meinem Bruder unrecht getan und ihn zu drastischen Maßnahmen gezwungen. Es war ihre Schuld, dass Eric nicht mehr da war. Mein Vertrauen in die Staatsdiener war so sehr erschüttert, dass ich die Straßenseite wechselte, wenn sie mir entgegenkamen. Doch das spielte jetzt keine Rolle. Ich musste über meinen Schatten springen.
Widerwillig, aber voll neuer Hoffnung machte ich mich auf den Weg zur Wache. Diese war ein ganzes Stück von der Oxford Gazette entfernt, und das gab mir Zeit, die Gedanken zu ordnen und aufgewühlte Gefühle zu beruhigen.
Im Gegensatz zur Zeitung befand sich die Polizeistation in einem unauffälligen Gebäude aus grauem Ziegel, das sich über drei Stockwerke erstreckte. Davor lag eine breite und leere Straße, so als ob nicht nur ich, sondern ganz Oxford einen Bogen um die Staatsdiener machte.
Im Inneren ging es ruhig und geordnet zu. Auch die Atmosphäre war ganz anders als bei der Oxford Gazette. Grimmige Schwere hing in der Luft und sorgte für eine erschlagend ernste Atmosphäre. Von den grauen Wänden war bestimmt noch nie ein Lachen widergehallt.
Es gab viele Schreibtische, doch nur wenige Männer. Ihre Kollegen waren wohl auf Patrouille oder anderweitig beschäftigt. Wäre ich einer von Ihnen, ich würde auch alles tun, um diese Räumlichkeiten zu meiden. Die einzige Dekoration waren Kreidebeschriftungen und obskure Zeichnungen sowie Fotografien chaotischer Räume. Bei genauerem Hinsehen erkannte man darin hin und wieder leblose Körper. Ein Tresen mit einem Wachtmeister dahinter hinderte mich daran, näher an die abgebildeten Tatorte heranzutreten. Die Falten um seine Augen sowie der gezwirbelte Schnauzbart mit grauen Verläufen wiesen darauf hin, dass er auf die Pensionierung zuging.
»Sir«, begann ich höflich, »dürfte ich Sie kurz stören?«
Er hob seinen müden Blick, sah mich kurz an und widmete sich dann wieder seinem Papierkram. Erst nachdem er fertig geschrieben hatte, erhob er sich und kam näher zu mir heran.
»Was kann ich für Sie tun, Miss?«, fragte er und stützte die Ellenbogen auf dem Tresen ab.
Ich verlagerte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Die Anspannung packte mich an den Schultern. »In der Oxford Gazette wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben«, leitete ich vorsichtig ein. Nach dem Debakel bei der Zeitung wählte ich die Worte besonders bedacht.
»Bezüglich der Lady Barlow. Ich bin darüber im Bilde.« Der Mann kratzte sich am Hinterkopf. »Sehr tragisch, das Ganze.«
»Ich könnte eine Spur haben, falls es Sie interessiert«, warf ich ein wenig zu hastig ein. Die Polizeiwache wirkte wie der falsche Ort für große Emotionen und Übereifer.
Der Staatsdiener hielt kurz inne und musterte mich. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Die vielen Jahre im Dienst manifestierten sich in einem erfahrenen Blick, der die Rechtmäßigkeit des Sprechers festzustellen geübt war.
»Die wäre?«, forderte er professionell reserviert.
Das Blut pumpte schneller durch meine Adern. Jetzt zählte jedes Wort. »Auf meinem Spaziergang vergangene Nacht sah ich eine Dame, die der in der Oxford Gazette abgebildeten Person sehr ähnelt. Sie war in Begleitung eines Gentlemans.«
Der Polizist holte Bleistift und Schreibblock aus der Jackentasche seiner dunkelblauen Uniform hervor und blätterte zu einer leeren Seite. »Können Sie den Mann beschreiben?«
Die Einladung weckte neuen Enthusiasmus. »Er war groß und hatte dunkles Haar. Seine Kleidung, ein roter Mantel und seidener Zylinder, wirkte wohlhabend.« Die Worte kamen immer schneller, und der Beamte fing jedes einzelne auf Papier ein. »Das Paar war unterwegs in einer Kutsche und stieg an einem Anwesen aus. Ich glaube, es heißt Westford Manor, und der Hausherr ist ein Mr Darvill.«
Der Polizist schlug das Notizbuch plötzlich zu und sah missmutig zu mir auf. Sein Blick machte unmissverständlich klar, dass ich eine Grenze überschritten hatte.
»Jetzt hören Sie gut zu …«
Noch bevor ich den Rest hörte, erkannte ich am Tonfall, dass seine Rede Enttäuschung hervorrufen würde. Diesmal war es noch schlimmer als bei der Zeitung, weil mich der Polizist hatte einen Moment glauben lassen, dass er mich ernst nehmen würde.
»Mr Darvill ist, wie Sie ganz richtig angenommen haben, ein respektabler Gentleman.« Unter der professionellen Ruhe brodelte hörbar die Wut. »Ein einfaches Mädchen wie Sie sollte sich hüten, einen Mann wie ihn so dreist zu beschuldigen!«
Nun konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Der angestaute Frust entlud sich in einem Schwall aus Worten. »Es ist kein Verstoß gegen das Gesetz, zum ärmeren Teil der Gesellschaft zu gehören, und umgekehrt dürfen sich die Reichen nicht alles erlauben!«
Der Mann bellte ein Lachen. »Naives Wunschdenken!«
Ich holte zum Gegenschlag aus. »Wenn es so ist, dann ist das traurig«, erwiderte ich. »Würden nicht nur einfache Mädchen wie ich, sondern auch einfache Männer wie Sie den Status quo hinterfragen, dann wäre es anders.«
Seine Augen wurden zu Schlitzen, durch die er mich boshaft anfunkelte. Er schloss sie kurz und holte tief Luft.
»Ich weiß nicht, was Sie in der Nähe der Villa zu suchen hatten, aber mein Berufsinstinkt sagt mir, dass Sie und Ihr loses Mundwerk besser daran täten, sich von Mr Darvill fernzuhalten.« Die blasse Haut des Beamten nahm stark an Farbe zu. »Verleumdung kann üble Konsequenzen mit sich bringen.«
»Verleumdung?«, japste ich. »Welches Interesse hätte ich daran, den Namen eines mir fremden Mannes zu beschmutzen?«
»Das würde ich auch gern wissen.« Er musterte mich mit intensivem Blick, der unter die Haut ging. »Mr Darvill ist ein gut aussehender junger Mann. Vielleicht hoffen Sie, so seine Aufmerksamkeit zu gewinnen.«
»Wie bitte?« Das war nun wirklich zu viel des Guten. Mir nicht zu glauben war eine Sache, zu behaupten, dass ich mir alles ausdachte, weil ich wollte, dass dieser Kriminelle mich wahrnahm, eine ganz andere. »Das ergibt doch gar keinen Sinn!«
»Was in den Köpfen junger Frauen vorgeht, ergibt selten Sinn«, erwiderte er und musterte mich noch intensiver. »Sagen Sie einmal«, sagte er mit zusammengekniffenen Augen. »Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor … Habe ich Sie schon einmal festgenommen?«
»Nein«, erwiderte ich erschrocken. Nun suchte er auch noch nach einem Grund, mich zu verhaften?
»Wie lautet Ihr Name?« Er ließ nicht locker.
Ich spielte mit dem Gedanken, aus der Tür zu rennen, doch das würde so wirken, als stimmten seine Unterstellungen. Tapfer rührte ich mich nicht vom Fleck.
»Susanna Copper, Sir«, gestand ich widerwillig.
Der Polizist lehnte den Kopf zurück. »Ah«, hauchte er gedankenversunken. »Jetzt ergibt alles einen Sinn.«
Ich presste die Lippen zusammen und flehte innerlich, dass er nicht fortfahren würde.
»Du bist die Schwester von diesem Taschendieb, der dem Galgen entkommen ist.«
Das unbefugte Betreten eines Grundstücks nicht mitgezählt, hatte ich noch nie eine Straftat begangen. Doch allein die Assoziation mit Eric reichte, um mich verdächtig zu machen. Nun war es an mir, wütend zu werden.
»Er war kein Taschendieb«, presste ich mit schwindender Beherrschung hervor.
»Stimmt«, gab der Staatsdiener andächtig zu. »Es ist schon eine ganze Weile her, daher ist meine Erinnerung getrübt. Er hat Schlösser geknackt, nicht wahr?« Ein weiterer intensiver Blick folgte und erstach mich wie ein kalter Dolch. »Er hat die wohlhabende Elite unserer Gesellschaft bestohlen … ist das der Grund, warum du nun einen Gentleman wie Mr Darvill schamlos beschuldigst? Soll das eine Art Vergeltung sein?«
»Nein«, wetterte ich, »nichts dergleichen. Ich wollte bloß …« Welchen Sinn hatte es noch, zu argumentieren. Der Polizist wollte mir nicht glauben, und es gab nichts, was ich sagen konnte, um ihn umzustimmen. Zu groß waren die Vorurteile. Tränen der Wut stachen in meinen Augen, doch ich würde sie auf keinen Fall vor diesem Mann fallen lassen.
Der Beamte lehnte sich über den Tresen. »Lauschen Sie meinem großzügigen Angebot, Miss Copper.«
Ich ballte die Hände erneut zu Fäusten, wohl wissend, dass sein Angebot alles andere als großzügig sein würde.
»Ich werde vergessen, was Sie heute gesagt haben, und Sie werden sicherstellen, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Falls doch, so werde ich annehmen müssen, dass Sie nichts Gutes im Schilde führen, und mein Instinkt trügt mich nie.«
»Sie können denken, was Sie wollen, Sir«, sagte ich an dem letzten Rest von Selbstbeherrschung festhaltend. »Doch ich habe nichts als die Wahrheit gesagt.«
Mit diesen Worten machte ich auf dem Absatz kehrt und lief schnellen Schrittes aus der Tür. Hinter mir hörte ich ein spöttisches Schnaufen und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Mit beiden Händen versuchte ich sie zurück in die Augen zu reiben. Das Polizeigebäude und die ihm innewohnenden Beschuldigungen wollte ich so weit hinter mir lassen wie möglich. Blindlings rempelte ich dabei jemanden an.
»Entschuldigung«, murmelte ich und wischte mir das Gesicht trocken, um zu erkennen, wer da stand.
»Nein, gar nicht schlimm«, sagte die ältere Dame, der ich bei der Oxford Gazette begegnet war. Ihr silbernes Haar war in einem Haarnetz gefangen, und vor den müden Augen saßen runde Brillengläser, die sie wie Lupen vergrößerten. Sie ließ das große Tuch mit Blumenmuster von ihren Schultern gleiten und griff in die Tasche ihres ausgeblichenen braunen Rocks.
»Hier, bitte schön.« Die Fremde reichte mir ein Taschentuch. »Ich weiß, wie frustrierend es ist, wenn einem niemand Glauben schenken mag.«
Plötzlich brannte Schuld tief in meiner Brust, dafür, dass ich der älteren Frau mit denselben Vorurteilen begegnet war, die ich am eigenen Körper erfahren hatte. Hinter ihren wirren Geschichten steckte noch immer ein Mensch, der sich verletzt fühlte, wenn andere über ihn lachten. Das hatte ich für einen Moment vergessen.
Dankend nahm ich das Taschentuch entgegen.
»Die Leute halten an ihrem Glauben fest, denn sie haben nur selten den Mut, vom vertrauten Pfad abzuweichen und ihren Horizont zu erweitern. Dabei ist unsere Welt doch um vieles wundersamer, als wir es fassen können, und nur wer sich ihr öffnet, kann ihre Geheimnisse entdecken.«
Ich war überrascht von so klaren und tiefsinnigen Worten. Die ältere Dame schenkte mir ein warmes Lächeln und legte ihre knochigen Finger sanft auf meine Schulter.
»Ich werde bei der Polizei mein Glück versuchen, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass der Ausgang ein anderer sein wird. Schließlich kann ich nur weitersagen, was ich erlebt habe, dann kann niemand behaupten, ich hätte tatenlos zugesehen.«
Nach ihrer heroischen Ankündigung lief die Dame an mir vorbei in die Polizeistation.
Das Aufeinandertreffen hatte mich so verzaubert, dass ich ganz vergaß zu weinen.
Eine Fährte der Dunkelheit
Nicht doch!«, platzte es aus mir heraus, als ich an einem Teehaus vorbeiging, aus dem gerade zwei Damen traten. Mein plötzlicher Ausruf erschreckte die beiden, sodass sie fast ihre Einkaufstüten fallen ließen. In der ganzen Aufregung hatte ich doch tatsächlich vergessen, zur Post zurückzukehren und Onkels Briefe abzuschicken. Ich machte auf dem Absatz kehrt und rannte so abrupt los, dass mir die verdutzten Damen aus dem Weg sprangen.
Eine Uhr zierte den Kirchturm am Ende der Straße, ihre goldenen Zeiger mahnten, dass mir nur wenige Minuten blieben. Meine Beine überschlugen sich fast, als ich an den farbenfrohen Läden, wartenden Kutschen und duftenden Bäckereien vorbeihechtete. In dem Moment grummelte mein Magen. Ich hatte seit heute Morgen nichts gegessen – auch das hatte ich vergessen. Darum würde ich mich aber später kümmern.
Die Post war bereits in Sichtweite. Im Gegensatz zum Morgen stand nunmehr keine Schlange davor, und die Tür war verriegelt. Ich war zu spät.
Den ganzen Tag war ich umhergehetzt und hatte nichts erreicht. Mit dem schweren Gefühl des Versagens auf den Schultern trat ich den Heimweg an.
»Vor der Post standen so viele an, dass ich gar nicht mehr drangekommen bin. Mir wurde die Tür vor der Nase zugemacht.« Das war die armselige Ausrede, die ich Onkel auftischte. Im übertragenen Sinn hatten sich so einige Türen heute verschlossen, und so fühlte sich die Lüge fast wie die Wahrheit an.
»Nicht so schlimm, morgen ist ein neuer Tag.« Mr Copper trat dem Problem mit gewohntem Pragmatismus entgegen. Dass er mir einfach so glaubte, ohne die Geschichte zu hinterfragen, verschlechterte mein Gewissen. Ich genoss sein volles Vertrauen und nutzte es schamlos aus, um genau das zu tun, was er mich gebeten hatte zu unterlassen: Ich hatte mich in die Angelegenheiten anderer eingemischt und war in Schwierigkeiten geraten.
Auf mein Seufzen hin schenkte er mir ein warmes Lächeln.
»Es ist wirklich nicht so schlimm, wenn die Briefe erst morgen rausgehen, und du kannst ja nichts dafür, wenn die Schlange so lang war.«
Mir war elend zumute, und zu allem Übel grummelte genau in dem Moment mein Magen peinlich laut.
»Magst du etwas essen?«, fragte Onkel so fürsorglich, dass sich mein leerer Magen vor Schuldgefühlen nun auch noch drehte. »Es ist noch etwas von meinem Mittagessen übrig geblieben. Wenn du magst, mache ich es dir warm.«
Ich hatte Onkel gar nicht verdient.
»Das wäre toll«, gab ich kleinlaut von mir.