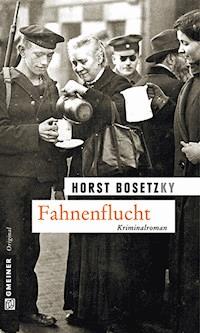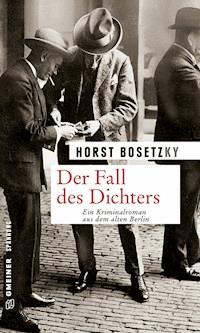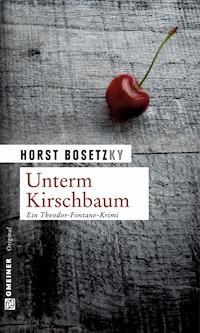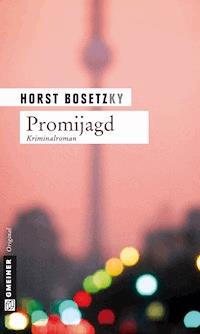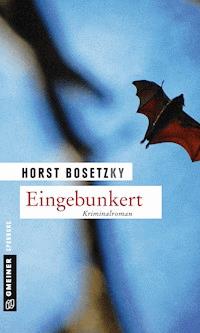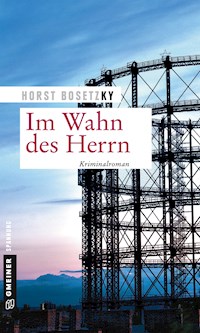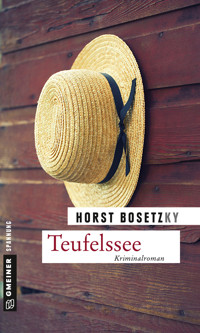
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Mannhardt und Schneeganß
- Sprache: Deutsch
Der Berliner Förster Thomas Wotzlaff macht sich mit seiner autoritären Art nicht gerade Freunde. Auch Forstlehrling Dietmar Menz hat die Nase voll von seinem Chef und erschießt ihn. Da alle Spuren im Sande verlaufen, schalten sich der pensionierte Kriminalhauptkommissar Hansjürgen Mannhardt und sein Enkel, der Jurastudent Orlando ein. Als auch sie nicht weiterkommen, verschlägt es sie durch Zufall in ein Amish Dorf in Ohio und der Fall nimmt eine überraschende Wendung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Teufelssee
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Daniel Thornberg / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5290-1
Zitat
Der Mensch ist eine Bestie und seiner Niedertracht muss mit Mitteln aus demselben Arsenal begegnet werden.
Theodor Fontane, aus einem Brief an Moritz Lazarus
TEIL I
EINS
Theodor Fontane liebte die Berliner Müggelberge und schreibt im Band Spreeland seiner Wanderungen durch die Mark Brandenburg über sie:
Diese Müggelberge repräsentieren ein höchst eigentümliches Stück Natur, abweichend von dem, was wir sonst wohl in unserem Sand- und Flachlande zu sehen gewohnt sind. Unsere märkischen Berge (wenn man uns diese stolze Bezeichnung gestatten will) sind entweder einfache Kegel oder Plateauabhänge. Nicht so die Müggelberge. Diese machen den Eindruck eines Gebirgsmodells, etwa als hab’ es die Natur in heiterer Laune versuchen wollen, ob nicht auch eine Urgebirgsform aus märkischem Sande herzustellen sei. Alles en miniature, aber doch nichts vergessen. Ein Stock des Gebirges, ein langgestreckter Grat, Ausläufer, Schluchten, Kulme, Kuppen, alles ist nach Art einer Reliefkarte vor die Tore Berlins gelegt, um die flachländische Residenzjugend hinausführen und ihr über Gebirgsformationen einiges ad oculos demonstrieren zu können.
Durch dieses Mittelgebirge en miniature wanderten nun im Jahre 2015 zwei junge Menschen, die, was mehr als erstaunlich war, diesen Text kannten: Svea, weil sie Deutschlehrerin werden wollte und dieses Fach »aufs Lehramt« studierte, und Finn, weil er Schauspieler war und sie in einem kleinen Off-Theater gerade das Stück »Fontane Reloaded«von Martin Nehmer spielten. Er kannte auch das dem Kapitel über die Müggelberge vorangestellte Gedicht und trug es professionell vor: »Es rührt kein Blatt sich, alles schläft und träumt, / Nur je zuweilen knisterts in den Föhren, / Die Nadel fällt, – es ruht der Wald.«
Auch bei ihm knisterte es, und zwar unten in der Hose, was ihn dazu bewog, keinen großen Dichter, sondern den Volksmund zu bemühen: »Ist der Mai warm und trocken, / kann man schon im Freien bocken.« Er war am Fuße der Müggelberge groß geworden, in Wendenschloss, und hatte schon als pubertierender Knabe davon geträumt, einmal mit einer tollen Frau im Freien zu – koitieren. Möglichst mit einer Stewardess, denn von denen hieß es ja: Gehen in die Luft. Vögeln gleich. Und Svea hatte ihr Studium finanziert, indem sie zwei Jahre lang als eine solche gearbeitet hatte. Er stellte sich vor, wie sie in ihrer hautengen blauen Uniform durch den Gang eines fast leeren Airbusses schritt, um nachzusehen, ob er sich auch angeschnallt hatte. Dabei bemerkte sie seine Erektion. Schnell war sein Reißverschluss geöffnet und ihr Rock hochgeschoben. Dann saß sie auf ihm und …
»Woran denkst du gerade?«, fragte ihn Svea.
»Daran!« Er umarmte sie stürmisch und ließ sie deutlich spüren, was rasant schnell hart geworden war.
»Nicht hier!«
»Doch hier!«
»Da hinten kommen Leute«, warnte sie ihn.
Er lachte. »Dann nehmen wir 20 Euro fürs Zusehen dürfen. Aber da rechts im Wald ist eine Kuhle, da habe ich schon als Kind immer drin gespielt.«
Vielleicht konnte er die Kontrolle über seine entgleiste Libido doch noch zurückgewinnen. Sie wollte versuchen, Zeit zu gewinnen, indem sie ihm intellektuelle Assoziationen verschaffte, etwa mit dem Satz: »Kuhle, ja, aber dann ›Kuhle Wampe‹. Ein fantastischer Film damals! Wer hat die männliche Hauptrolle gespielt?«
»Ernst Busch. Aber mich interessiert jetzt nur dein Busch.«
Damit fuhr seine Hand unter ihren Rock und tastete sich zu ihrem Schamhaar vor. Immer stürmischer drang er auf sie ein. »Svea, bitte! Ich hab’ auch Kondome mit.«
Langsam ließ sie sich vom Strom seiner Begierde mitreißen und fieberte sogar dem eigenen Orgasmus entgegen. In einer Kuhle im Sand …
Im FLOW kämpften sie sich durch Gras und Unterholz, und er nahm seinen Steifen als Kompassnadel, der ihnen den Weg zu seiner Kuhle weisen sollte.
Jetzt waren sie dort angekommen und …
… und nichts war mehr mit Rammeln und orgiastischen Schreien, denn in seiner Kuhle lag ein Toter.
*
Der Masterstudiengang »Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie« ist ein anwendungsorientierter Studiengang, der durch die Verbindung von Klinischer und Gesundheitspsychologie nationale und internationale gesundheitspolitische Entwicklungen und die damit einhergehenden Veränderungen auf dem europäischen Arbeitsmarkt berücksichtigt. In den Lehrinhalten werden explizit ökologische, soziale, kulturelle und institutionelle Bedingungen sowie der Einfluss der Geschlechtsrollenzugehörigkeit einbezogen.
Es wird eine fundierte Ausbildung in Methoden und Diagnostik gewährleistet. Die Vermittlung allgemeiner Methodenkompetenzen wird ergänzt durch fachspezifische Methodenseminare zur Versorgungs- und Interventionsforschung und zu spezifischen diagnostischen Verfahren sowie durch eine individualisierte Beratung bei der Planung und Durchführung der Masterarbeit. Weitere methodische Kompetenzen werden über die Mitarbeit an Forschungsprojekten der Klinischen Psychologie oder Gesundheitspsychologie erworben.
So hatte es Björn Görke auf dem Bildschirm stehen gehabt, als er im Internet das Studienangebot der FU Berlin durchgegangen war, und sofort gewusst, dass das sein Ding war. Man hatte seine Mutter mit einer schweren Depression in die Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik eingeliefert, als aus ihrem idyllischen Familienleben im West-Berliner Dörfchen Lübars ein einziger Horrortrip geworden war. Und er hatte in »Bonnies Ranch«, wie die KBoN im Volksmund hieß, so viele arme Teufel kennengelernt, dass er es als Aufgabe und Ziel seines Lebens ansah, sie zu verstehen und ihnen zu helfen. Ein bisschen stimmte es aber auch, wenn Freunde lästerten: »Mensch, Björn, du willst dich doch bloß besser selbst therapieren können!«
In der heutigen Vorlesung ging es um wahnhaftes Denken und um Wahnideen.
»Schon bei Eugen Bleuer finden wir drei Sätze, die alles auf den Punkt bringen«, begann die Dozentin: »Zum Wesen des Wahns gehört seine Unerschütterlichkeit. Er lässt sich weder an der eigenen Erfahrung noch durch Belehrung beeinflussen. Kurzum: Dem Wahnkranken fehlt die Kritikfähigkeit seinem Wahn gegenüber, in allen anderen Belangen kann sie erhalten sein.« Dann stellte sie die Wahnformen vor, auf die sie in den nächsten Sitzungen näher eingehen wollte: »Da sind der Größenwahn, von dem Sie alle schon einmal gehört haben werden, ebenso wie vom Verfolgungs- und Eifersuchtswahn, vergleichsweise neu aber werden Ihnen erscheinen: der Versündigungswahn, wo die Kranken glauben, schwerste Verbrechen begangen zu haben, der hypochondrische oder auch depressive Krankheitswahn und der Verneinungswahn. Fangen wir einmal mit diesem an, denn darüber habe ich geforscht und kann Ihnen ein paar Fallbeispiele vorführen. Die Franzosen kennen ihn unter dem Begriff délire des négations. Sie finden diesenwahnhaften Glauben an die eigene Nicht-Existenz in der Literatur aber auch unter dem Begriff Cotard-Syndrom, benannt nach dem Franzosen Jules Cotard (1840 – 1889). Die Kranken haben das Gefühl, dass alles um sie herum nicht mehr existiert: die Klinik, die Welt, ein Gott, sie selbst. Sie sind überzeugt, dass sie tot seien, überhaupt nicht mehr existierten. Sie meinen zu verwesen oder ihr Blut sowie ihre inneren Organe verloren zu haben. Ursachen können bipolare Störungen sein, aber auch Unfälle, bei denen der Temporallappen im Gehirn beschädigt worden ist, und die Nebenwirkungen bestimmter Medikamente.«
Björn Görke meldete sich. Das brachte Pluspunkte bei der Dozentin, und außerdem tat er das immer, wenn er einzuschlafen drohte. »Frau Dr. Nüsslein-Vögele, gehört zum nihilistischen Wahn auch die délire d’énormité?« Von der hatte er beim Klinikaufenthalt seiner Mutter gehört.
»Ja natürlich. Das klassische Beispiel dafür ist, dass ein Kranker es nicht wagt, auf die Toilette zu gehen, weil er fürchtet, mit seinen Fäkalien die ganze Stadt zu überschwemmen und alle Bewohner dadurch zu Tode kommen. Mit der délire d’énormité zusammenhängend, aber das genaue Gegenteil davon, ist die Mikromanie, bei der sich die Betroffenen körperlich ganz klein fühlen, so klein wie ein Maiskorn, das die Hühner wegpicken.«
»Diese Mikromanie wünsche ich Helmut Schmidt!«, kam es aus den hinteren Reihen, und es wurde noch eine sehr launige Lehrveranstaltung.
An deren Ende packte Björn Görke seinen Notizblock in seine Umhängetasche und machte sich von der Habelschwerdter Allee auf zum U-Bahnhof Thielplatz. Bis zum Boxhagener Platz, in dessen Nähe er in einer WG wohnte, brauchte er rund eine Stunde, also fast genauso lange, wie man mit dem ICE vom Bahnhof Berlin-Südkreuz bis zum Leipziger Hauptbahnhof unterwegs war. Krass! Wahnsinn! Seine »Weltreise« begann also am Thielplatz, den es eigentlich gar nicht gab, und die Uni forderte immer wieder, die Station »FU Berlin« zu nennen, doch die Bedenkenträger in den zuständigen Behörden hatten dies bislang immer abgelehnt. Einmal, weil sie sich in ihrer Trägheit gestört fühlten, zum Zweiten, weil ihnen dies nur irreführend zu sein schien, da einzelne Institute der Freien Universität in der Nähe ganz anderer Bahnhöfe lagen. Gleichviel, die U3 hielt am nicht vorhandenen Platz und brachte ihn zum Nollendorfplatz, wo bis zur Warschauer Straße in die U12 umzusteigen war. Weiter ging es mit der Metrotram M 10 und dem Bus 240. Da bei der BVG niemand streikte, gelangte er in der eingeplanten Zeit ans Ziel. Im angesagten Boxhagener Kiez hatten sie in einem ziemlich vergammelten Seitenflügel der Boxhagener Straße eine bezahlbare Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Toilette gefunden. Neben dem Klingelknopf klebte ein Zettel mit drei Namen: BJÖRN GÖRKE, PAULINE GROSSMANN und DIETMAR MENZ. Pauline, Lini, war Björns feste Freundin, mit der er sich auch das eine Zimmer teilte, während das andere von einem werdenden Förster belegt war, der schon lange vor ihnen hier eingezogen war. Bei ihnen hing an der Zimmertür das Schild BJÖRN & LINI und bei Menz ARGENTINISCHES ZIMMER. Das war keine Selbstironie, sondern Paulines Idee, die Lehrerin war, Sport und Englisch, und auf folgende Assoziationskette gekommen war: Ein Messie war eine Person mit einem schweren Defizit in der Fähigkeit, die eigene Wohnung ordentlich zu halten und die Alltagsaufgaben zu organisieren, Lionel Messi war argentinischer Nationalspieler und oftmals weltbester Fußballer des Jahres – das Zimmer eines Messies war also ein argentinisches Zimmer.
Björn Görke war zu sehr Psychologe, um nicht zu wissen, dass dem Messie-Syndrom zumeist ernsthafte seelische Störungen zugrunde lagen, und er hatte daher viel Verständnis für Menz, aber was der sich manchmal leistete, das ging ihm doch über die berühmte Hutschnur und löste gelinde Wutanfälle aus. Wie in dieser Sekunde, als er die gemeinschaftliche Toilette betrat und geradezu zurückprallte, so bestialisch stank es. Die Ursache war schnell gefunden: Menz hatte eine Kotsäule von elefantösen Ausmaßen in die Kotschüssel gesetzt, aber zu spülen vergessen. Ohne das nun selber zu tun und das Fenster aufzureißen, stürzte Björn Görke zum argentinischen Zimmer und hämmerte mit der Faust gegen die Tür.
»Dietmar, du Bundesobersau, kommst du mal bitte raus und spülst in der Toilette!«
Keine Reaktion, Stille.
Björn Görke erschrak. Sofort schossen ihm Horrorgedanken durch den Kopf: Herzinfarkt, Schlaganfall, bei Menz im Kopf ist ein Aneurysma geplatzt! Dann gewann der Verstand die Oberhand: Quatsch, der ist bloß nicht zu Hause! So einleuchtend das war, Björn Görke wäre dennoch ins Messie-Zimmer getreten und hätte nachgesehen, doch in diesem Augenblick wurde die Wohnungstür aufgeschlossen, und er zuckte zurück, denn er wusste, dass Dietmar Menz es nicht gern hatte, wenn man in seinem Zimmer herumstöberte.
Aber es war nicht der etwas eigenartige WG-Genosse, der in den Flur trat, sondern Pauline.
»Oh, I have you surprised at a burglary!«, rief sie.
Björn Görke sah sie fragend an, denn sein Englisch war very limited, wie er selbst von sich sagte.
»Burglary gleich Einbruch«, half sie ihm auf die Sprünge. »Görke, setzen! Fünf!«
»Danke, Frau Dr. Grossmann-Görke. Ich wollte nur nachsehen, ob mit Messie-Menz alles in Ordnung ist. Manchmal hat er einen etwas präsuizidalen Eindruck auf mich gemacht.«
Pauline lachte. »Ja, der Herr wird ihn heimgeholt haben mit dem Lasso?«
»Wie?«
»Na er wird sich aufgehängt haben!«
Björn Görke sah sie tadelnd an. »Damit spaßt man nicht.«
Sie hatte es nicht gern, wenn er versuchte, ihr Verhalten zu reglementieren, und so setzte sie noch einen drauf und sang: »Hang down your head, Tom Dooley …«
»Komm, es reicht! Wir müssen uns wirklich mehr um ihn kümmern, denn er ist ein armes Schwein.«
»Wer: Tom Dooley? Klar: Poor boy, you’re bound to die.«
»Quatsch, der Dietmar Menz. Das lässt mir keine Ruhe, ich seh’ jetzt doch mal nach.«
Damit drückte er dessen Zimmertür auf. Auf mancher Müllhalde sah es ordentlicher aus. Menz wohnte seit zwei Jahren hier und hatte in dieser Zeit nichts auf den Müll geworfen, was sich an alten Kleidungsstücken, Flyern, Wurfsendungen, Zeitungen, Verpackungsmaterialien und Krimskrams angehäuft hatte.
»Hier ist er aber nicht«, musste Björn Görke feststellen, nachdem er auch die Bettdecke hochgehoben hatte.
Da entdeckte Pauline auf dem kleinen runden Tisch inmitten der dort angehäuften Speisereste, Teller und Tassen einen DIN-A4-Bogen. Die etwas ungelenken Buchstaben deuteten darauf hin, dass Dietmar Menz ihn mit der Hand geschrieben hatte. Sie riss das Blatt hoch, und dann überflogen beide das, was ganz offensichtlich ein Abschiedsbrief war:
Hallo Björn & Pauline,
sucht nicht nach mir. Ich bin ein so kleines Licht und so ein loser, dass sich das nicht lohnt. Was soll ich auf dieser Welt, ich bin nur ein Irrtum und keiner braucht mich. Ich verurteile mich hiermit selbst zum Tode durch die Guillotine. Die Räder eines U-Bahnzuges werden mir den Kopf vom Rumpf trennen. Dietmar
Sie standen da, als agierten sie in einem Film und der Regisseur hätte »Freeze!« gerufen. Nur langsam lösten sie sich aus ihrer Schockstarre.
*
Der U-Bahnhof Samariterstraße, gelegen an der Strecke Alexanderplatz – Hönow, der U5 also, hatte eine ganz besondere Geschichte. Eröffnet 1930, war er zu DDR-Zeiten mit 18 großflächigen Gemälden geschmückt worden, auf denen die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und ihrer führenden Partei, der KPD bzw. SED, dargestellt war. Nach der Wende hatte man das alles entfernt und Kinder und Jugendliche die smaragdgrün gekachelten Wände neu gestalten lassen. Irgendwann stellte man den ganzen Bahnhof unter Denkmalschutz, und während alle anderen Stationen der U5 nach der Jahrtausendwende saniert und neu gestaltet worden waren, hatte man Samariterstraße weitestgehend in ihren Ursprungszustand zurück versetzt. Für die links-autonome Szene war die Station zur Pilgerstätte geworden, seit hier in der Vorhalle am 21. November 1992 der Antifaschist Silvio Meier von Neonazis ermordet worden war. Die an dieser Stelle angebrachte Gedenktafel war im Laufe der Zeit mehrmals gestohlen, aber immer wieder ersetzt worden.
Von der Boxhagener, Ecke Colbestraße zum U-Bahnhof Samariterstraße lief man auf direktem Wege keine zehn Minuten, aber Menz machte immer wieder Umwege, denn so fest er entschlossen war, sich dort vor den einfahrenden Zug zu werfen, so unsagbare Angst hatte er davor. Aber es gab für ihn keinen anderen Weg mehr. Wie in Trance eilte er durch die Straßen. Scharnweber-, Finow-, Oder-, Jung-, Weser-, Kinzigstraße, wieder die Scharnweberstraße, diesmal aber die andere Richtung entlang bis zur Mainzer Straße. Die führte zur Frankfurter Allee, und unter der lag der U-Bahnhof Samariterstraße. Menz blieb stehen. Er dachte daran, dass im Mittelalter diejenigen, die geköpft, gehängt oder gevierteilt werden sollten, von Bütteln und Knechten zur Richtstätte geschleift wurden, er aber musste sich aus eigener Kraft und eigenem Willen dorthin begeben. Und an beidem hatte es ihm sein Leben lang gefehlt. Er blieb stehen und begann, sich halblaut zu beschimpfen.
»Du Weichei! Du Affenarsch! Du Zombie! Du Waschlappen! Du Lutscher! Du Fickfehler!«
Er hasste sich selbst immer mehr und hatte schließlich nur noch den einen Wunsch, dass endlich alles vorbei sei.
»Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!«, rief er, als er den Eingang zum U-Bahnhof vor Augen hatte. »Auf zur Reise in die Ewigkeit!«
Er rannte zum Bahnsteig hinunter. Hoffentlich kam der nächste Zug schon in wenigen Sekunden. Ja, er sah seine Lichter schon hinten im Tunnel aufblitzen. Mit ein paar schnellen Schritten war er an der Bahnsteigkante angekommen. Niemand konnte etwas von seiner Absicht ahnen, niemand war da, ihn noch aufzuhalten. Das Letzte, was er las, war eine Aufforderung, die man vor Jahrzehnten mit schwarzen Lettern sauber an die grüne Wand geschrieben hatte:
Benutzen sie bitte auch die hinteren Wagen, denn sie sind schwächer besetzt!
Da war der Zug heran.
Und – Sprung!
*
Björn Görke und Pauline stiegen am Bahnhof Lichtenberg aus der U-Bahn, um über die Siegfried- zur Fanningerstraße zu gelangen. Dort lag das OZK, das Oskar-Ziethen-Krankenhaus.
»Wieso Oskar Zieten?«, fragte Björn Görke scheinbar verwundert. »Der Mann hieß doch Hans Joachim mit Vornamen, und außerdem war er adlig. Und warum benennt man ein Krankenhaus nach einem General? Wahrscheinlich, weil er dafür gesorgt hat, dass durch sein Wirken so viele Patienten angefallen sind, Tote und Verwundete, und dadurch Geld in die Kassen gekommen ist.«
Pauline gab sich als strenge Lehrerin. »Björn, du redest wirr. Oskar Ziethen war der erste Bürgermeister der Stadt Lichtenberg.« Weil sie ihren Freund kannte, hatte sie das vorher gegoogelt.
»Ich finde den anderen Zieten besser«, maulte Björn Görke. »Schließlich war er einer der berühmtesten Reitergeneräle und ein enger Vertrauter Friedrich des Großen.«
»Friedrich II. von Preußen«, korrigierte ihn Pauline, die aus der Ex-DDR kam, wo man großen Wert auf diesen kleinen Unterschied gelegt hatte.
Sie traten in die neue Empfangshalle des OKZ und fragten nach Dietmar Menz. Nach einem schnellen Blick auf den Bildschirm bekamen sie seine Zimmernummer genannt und machten sich auf den Weg durch die Stationen. Endlich standen sie an seinem Bett. An der linken Hand trug er einen dicken Verband, und an seiner Stirn war eine Platzwunde getackert und geklebt worden.
»Du Armer!«, rief Pauline und umarmte ihn.
Björn Görke mimte einen Jugendlichen mit Migrationshintergrund. »Ey, Alter, schwör mir, Wallah, dass du nie wieder gehst U-Bahn! Sonst isch mach dich Messer!«
Menz quittierte das mit einem gequälten Lächeln.
Pauline liebte das Sachliche und erklärte Menz, was geschehen war. »Wir haben deinen Abschiedsbrief gefunden, und da hat Björn geistesgegenwärtig die Leitstelle der U-Bahn angerufen, und die haben per Funk die U-Bahnfahrer angewiesen, ganz langsam in die Bahnhöfe einzufahren, die bei uns in der Nähe liegen. So konnte der Fahrer in dem Zug, vor den du dich geworfen hast, noch rechtzeitig abbremsen. Ja, du hast Björn dein Leben zu verdanken, weil er so schnell geschaltet hat. Hätte er bei der Polizei und der Feuerwehr angerufen, dann …«
Menz drehte sich weg. »Ich habe Björn nichts zu verdanken, ich verfluche ihn nur! Ich habe alles so satt!«
»Jaja«, sagte Björn Görke. »Shakespeare, 66. Sonnet: Tir’d with all these, for restful death I cry …«
Menz begann, deutlicher zu berlinern. »Watt heißt’n dit? Kannste det ooch uff Deutsch sajen?«
»Sicher: All dessen müd, nach Rast im Tod ich schrei.«
»Ja, da ist wat Wahret dran …«
»Klar, James Joyce sagt ja auch: Nur Gott ist größer als Shakespeare.«
Jetzt kam Menz ein wenig aus seiner depressiven Schleife heraus. »Ich würde noch Messie und Neymar dazu zählen.«
Björn Görke freute sich, den WG-Genossen ein wenig aufgeheitert zu haben. »Was singen sie immer: Fußball ist unser Leben! Da hast du’s.«
Pauline setzte sich auf die Bettkante und versuchte sich als Psychotherapeutin. »Dietmar, nun erzähl’ uns doch mal, warum du so verzweifelt warst.«
Menz tat es und hatte sein bisheriges Leben so deutlich vor Augen, als hätte jemand einen Dokumentarfilm darüber gedreht.
Beginn der RÜCKBLENDE.
ZWEI
Dietmar Menz war im Märkischen Viertel (MV) aufgewachsen, einer Trabantenstadt im Norden Berlins, Bezirk Reinickendorf. Im Volksmund hieß das MV »Merkwürdiges Viertel«, und er hatte oft den Verdacht, dass damit sein Leben irgendwie vorprogrammiert war. Vom Hochhaus am Senftenberger Ring hatte man einen weiten Blick auf die märkischen Wälder ringsum, und auch das musste ihn beeinflusst haben. Sein Vater hatte sich kurz nach seiner Geburt »verdünnisiert«, das heißt, er hatte sich scheiden lassen und war nach Kanada ausgewandert, wo es für ihn als gelerntem Forstwirt eine Menge zu tun gab. Monika Menz hatte sich als alleinerziehende Mutter und an einer Edeka-Kasse durchs Leben schlagen müssen, so lange jedenfalls, bis sie Wolfgang Gänsicke kennengelernt hatte, einen U-Bahnfahrer. Der war mit einem Sohn aus erster Ehe zu ihr ins MV gezogen, mit Jonas. So richtig vertragen hatten sich die vier eigentlich nie. Irgendwie aber hatte es Dietmar geschafft, sein Abitur zu machen, wenn auch nur mit einer Durchschnittsnote von 3,8. Ohne den Mitleidsfaktor bei seinen Lehrerinnen wäre er garantiert gescheitert. Mit dem Abitur aber hatte er geglaubt, sein Soll erfüllt zu haben, und die nächste Phase seines Lebens hatte darin bestanden, sich in der alternativen Szene umzuschauen, bei jeder Demo mitzumachen, egal, um was es ging, und ansonsten zu kiffen und zu chillen. Seiner Mutter und seinem Stief- und Ziehvater passte das natürlich nicht.
»So kann det uff ewij nich weitajehn!«, rief Wolfgang. »Sonst landeste unweigalich uff’m Abstelljleis.«
»Nimm dir ’n Beispiel an Jonas!«, fügte die Mutter hinzu. Der hatte seine Lehre als Bankkaufmann glanzvoll zu Ende gebracht und eilte nun jeden Morgen »jeschniejelt und jebüjelt«, wie sein Vater sagte, in die Filiale einer großen Bank.
Dietmar Menz verkniff sich jeden Kommentar, um die beiden nicht weiter gegen sich aufzubringen, aber dieser Jonas war für ihn ein fürchterlicher Spießer, ein Schwachstrulli, ein Zwirnscheißer und ein untertäniger Hinten-in-den-Chef-Reinkriecher, kurzum: ein großes Arschloch.
»Am besten isset, du fängst bei uns als Lehrling in’t Büro an«, fand seine Mutter. Da kannste dann mit dei’m Abi uffsteijen bis zum Fillialleita hoch und ooch weita noch.«
Menz sah in der Ferne die blaugrünen Wälder des Barnim und dachte an seinen Vater. Da war es nicht überraschend, dass sich ein ganz bestimmter Gedanke bei ihm einstellte.
»Nein, ich will nicht in den Einzelhandel und den ganzen Tag über im Büro sitzen, ich will meine Freiheit haben. Dann schon lieber das, was Vater macht.«
Seine Mutter fuhr auf. »Dein Vata sitzt hier am Tisch, der andre war nur dein Erzeuga – und ’n jroßet Schwein dazu. Wenn du ooch Första wirst, dann …«
Menz wusste nun, womit er seine Mutter und seinen Stiefvater ganz besonders ärgern konnte und setzte sich an den Computer, um zu sehen, wo sich Forstwirtschaft studieren ließ. So stieß er auch auf die Seite der FH Eberswalde.
Die Fachhochschule Eberswalde ist die grünste Hochschule Deutschlands. Sie wurde 1830 als Höhere Forstlehranstalt gegründet und hat sich der Lehre und nachhaltigen Forschung verschrieben. 1992 wurde der Studienbetrieb wiederaufgenommen und bildet nun in den Zukunftsbranchen aus. Zu diesen gehören das Regionalmanagement, Erneuerbare Energien, Naturschutz, Nachhaltiger Tourismus, Ökolandbau, Forstwirtschaft und Nachhaltige Wirtschaft. Das Internetportal Utopia hat der Hochschule 2009 den Titel grünste Hochschule Deutschlands verliehen. Zudem bekam sie 2010 den EMAS-Award für ihr vorbildliches Umweltmanagement.
Für forst- und naturwissenschaftlich Interessierte bietet das praxisnahe Studium der Forstwirtschaft (B.Sc.) ein zukunftsorientiertes Angebot mit guten Berufsaussichten.
Im Spannungsfeld zwischen den vielfältigen und stetig wachsenden ökonomischen, ökologischen wie auch sozio-ökonomischen Eigentümer- und Gesellschaftsansprüchen an das Ökosystem Wald befähigt der Studiengang verschiedene Zielsysteme und Entwicklungspfade nachhaltiger Waldbewirtschaftungs- und Entwicklungsstrategien gegeneinander abzuwägen und umzusetzen. Im Mittelpunkt steht der Erhalt der Funktionenvielfalt (Nutz-, Schutz, Erholungs- und Bildungsfunktion) auf ganzer Fläche.
Das gefiel ihm. Zwar wusste er nicht, was B.Sc. bedeuten sollte, sicherlich nicht Berliner Schlittschuhclub, denn den gab es ja schon längst nicht mehr. Sc. konnte was mit scientia, lateinisch: die Wissenschaft, zu tun haben, das wusste er noch aus dem Lateinunterricht, auch das Englische sience ließ darauf schließen, aber eine B-Wissenschaft, was war das? Etwas Zweitklassiges nur … Er sah bei Wikipedia nach: Ah, ja, das war der Bachelor of Science in Engineering (B.Sc. oder Bsc).
Eberswalde also … Er wusste nur, dass sie dort in der Kleinstadt noch einen O-Bus hatten, und dass es hier mit Amadeu Antonio Kiowa aus Angola das erste Todesopfer rassistisch motivierter Gewalt im wiedervereinigten Deutschland gegeben hatte. Noch heute regte er sich mit seinen Freunden darüber auf, dass die Täter nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge und nicht wegen Mord verurteilt worden waren.
»Bist du verrückt geworden!«, rief seine Freundin Vanessa, als sie von seinen Plänen erfahren hatte. »Ausgerechnet in Eberswalde aufzuschlagen! Da werden sie dich linke Zecke garantiert aus der Stadt jagen. Oder willst du dich da anpassen und in Schlips und Kragen rumlaufen?«
Er lachte. »Na sicher. Und wenn du zu Besuch kommst, dann singt der Chor der Forsteleven etwas aus’m Freischütz für dich: Wir winden dir den Jungfernkranz aus veilchenblauer Seide; wir führen dich zu Spiel und Tanz, zu Glück und Liebesfreude.«
Sie guckte mehr als skeptisch und überlegte kurz. »Glück und Liebesfreude … Von Berlin nach Eberswalde braucht man mit dem RE bestimmt eine Ewigkeit.«
»Von Berlin Hauptbahnhof bis Eberswalde Hauptbahnhof rund eine halbe Stunde«, klärte er sie auf. »Wenn dir das zu weit ist, mir nicht.«
»Ich werds mir überlegen.«
»Sehen wir uns heute Abend im ›White Trash Fast Food‹?« Das war ein derzeit sehr angesagter Club am Flutgraben in Treptow, unweit der Spree und der Arena Berlin, in dem es leckere asiatische Gerichte gab, man tanzen und auf einer kleinen Bühne abgedrehte Künstler bestaunen konnte.
»Ja klar«, antwortete Vanessa. »Zur gewohnten Zeit bin ich da.«
Das war 21 Uhr. Aber auch eine Stunde später konnte er sie nicht erblicken. Er ging zur Spree hinunter, wo er oft im Badeschiff mit ihr herumgetobt hatte, doch auch da war sie nicht. Er bedauerte, sehr gut schwimmen zu können, sonst … Eine Zeichnung von Heinrich Zille stand ihm vor Augen: Da strebt eine abgehärmte Frau mit ihrer kleinen Tochter vor der düsteren Kulisse Berlins einem Fluss entgegen, um sich dort mit ihrer Tochter zu ertränken. »Ins Wasser gehen« war ja damals eine oft angewandte Art des Selbstmords. Auch den Text hatte er noch im Kopf: »Mutter, is’s ooch nicht kalt? – »Sei ruhig – die Fische leben immer drin.«
Vanessa kam nicht mehr, sie schickte ihm nur eine SMS: Hallo Dieti! Es hat keinen Sinn mehr. Wir passen nicht zusammen. Ich will einmal in einem eigenen Haus leben und nicht als Pennerin in einem Zelt unter der Jannowitzbrücke. Danke und mach’s gut!
*
Ostbahnhof ab 8:49, mit der S7 bis Lichtenberg, an 8:58 und weiter 9:07 mit der RB24 nach Eberswalde, dort an 9:48 Hauptbahnhof, Gleis 2. Der Zug war vergleichsweise leer. Klar, welcher Idiot pendelte auch morgens von Berlin nach Eberswalde, jeder vernunftbegabte Mensch tat es andersherum. Dietmar Menz hatte noch immer das Gefühl, im falschen Film zu sein. Beim Nachdenken über seine Lage reimte er sogar: Förster sein, das ist nicht schwer, Förster werden umso mehr. Er verfiel wieder in seine inneren Dialoge.
»Du weißt doch, Dietmar, wie es um dich steht: Du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nie etwas sein.«
»Immerhin habe ich mein Abitur gemacht.«
»Ja, mit Ach und Krach und weil die Lehrer Mitleid mit dir hatten. Und eine Frau fürs Leben wirst du auch nie finden.«
»Ich war mit Vanessa zusammen …«
»Aber die ist sofort abgehauen, als sie erkannt hat, welche Null du bist.«
»Wenn ich meinen Job als Förster habe, dann …«
»Den wirst du nie bekommen, weil du völlig unfähig bist, dich irgendwo unterzuordnen.«
»Ja, schon. Aber ich bin doch kein Hund, der gehorcht, wenn irgendein Hirni brüllt ›Sitz!‹ oder ›Fass‹!«
»Du bist der aus dem Witz hier: Du kommst zum Arzt und sagst: ›Herr Doktor, ich leide darunter, dass ich nicht richtig wahrgenommen werde.‹ – Der Arzt: ›Der Nächste bitte!‹«
Schlimm für Menz war auch, dass ihm alle, die mit ihm im Zug saßen, erfolgreiche und glückliche Menschen zu sein schienen. Vor allem die in der Wandergruppe, die in Hohenschönhausen zugestiegen waren. Der eine, ein Herr mittleren Alters, war offensichtlich Professor an der FU und hielt einen kleinen Vortrag über Griechenland als Wiege der abendländischen Kultur. Sein Gegenüber musste Schauspieler sein, da er sich lauthals darüber beklagte, dass sie an seinem Theater noch nie Stücke von Aischylos, Euripides oder Sophokles gespielt hätten.
»Und am liebsten hätte ich ja was von Alexandros gehabt.«
»Ich von Vicky Leandros«, rief eine der mitreisenden Damen, die vorher schon erzählt hatte, dass ihr eine Boutique am Kudamm gehörte. Und sie begann, auch sofort zu singen. »Theo, wir fahrn nach Lodz! / Steh’ auf, du faules Murmeltier, / bevor ich die Geduld verlier’. / Theo, wir fahrn nach Lodz.«
Ihr Mann war, so schien es, Oberstudienrat für Erdkunde, denn er begann sofort, seine Mitwanderer zu belehren: »Łódź, die drittgrößte Stadt Polens. Textil- und Unterhaltungsindustrie, Universität, Filmhochschule …«
»War das nicht mal Lemberg?«, fragte die Boutiqueninhaberin.
»Setzen, Marilies, fünf! Lemberg, das ist Lwiw.«
»Und was ist nun mit Alexandros?«
»Alexandros Aitolos, geboren um 350 vor, war ein hochgeschätzter griechischer Dichter.«
»Ja, darum haben die Berliner ja auch ihren Alexandrosplatz nach ihm benannt«, warf einer aus der Wandergruppe ein, den Menz schon mehrfach auf dem Bildschirm gesehen hatte. Der Mann musste Schriftsteller, Kabarettist oder Comedian sein. »Ach Unsinn, der Platz ist ja nach Alex Sander benannt worden – Alex-Sander-Platz.«
»Ich kenne nur Otto Sander. Mit dem ich x-mal zusammen vor der Kamera gestanden habe.«
»Hinter der Kamera kann man auch eine Menge Geld verdienen«, sagte eine Frau, die Menz ebenfalls aus dem Fernsehen kannte und die für eine der großen Volksparteien im Bundestag saß und manchmal in einer dieser dämlichen Talkshows auftrat, und dann zählte sie alle bedeutenden Film- und Theaterregisseure auf, die ihr jemals die Hand gedrückt hatten. »Einmal auch Pier Paolo Pasolini.«
»Worauf der dann anschließend gestorben ist«, lästerte der Comedian.
»Das war doch schon vor Ewigkeiten«, sagte der, den Menz als einen ehemaligen Berliner Bezirksbürgermeister erkannt hatte. Gerade hatte er ein Buch über sein bewegtes Leben geschrieben und war von der Presse in den Bestsellerhimmel gehoben worden.
So viel an gemachter Karriere und Reputation war zum Kotzen. Menz wünschte sich, sie alle in die Luft zu sprengen oder nacheinander mit einer Smith & Wesson abzuknallen. Nein, Selbstmordattentäter zu sein, also sich und andere in die Luft zu sprengen, war besser, weil man dabei nicht mehr befürchten musste, anschließend lebenslänglich eingesperrt zu werden.
»Düdüdüdüdü-ühü«, erklang es aus dem Lautsprecher. »Wir erreichen jetzt den Bahnhof Bernau.«
Das löste bei dem Lehrer sofort ganz bestimmte Assoziationen aus: »Der Bernau’sche heiße Brei macht die Mark hussitenfrei!«
»Keine Diskriminierung anderer Religionen!«, rief der Comedian.
Der Menschenbelehrer ließ sich nicht beirren. »1432. Die Hussiten wollen Bernau erobern, da gießen die Bürger heißen Brei, den sie aus den zahlreichen Brauhäusern der Stadt geholt haben, von der Stadtmauer auf sie herab und vertreiben sie damit.«
»Ja, manchmal geht es eben nicht, nur um den heißen Brei herumzureden«, merkte die Politikerin an.
Menz litt weiter, zumal der Zug andauernd hielt, zuerst in Rüdnitz, dann in Biesenthal.
»Ah!«, rief der Comedian, der offensichtlich die letzte Weltmeisterschaft im Kalauern gewonnen hatte. »Hier in Oberbiesenthal soll doch die berühmte Sprungschanze stehen.«
»Mensch, das ist Oberwiesenthal!«
»Ach so, ich hab’ mich schon gewundert, dass hier gar keine Berge sind.«
»Doch«, wurde er belehrt. »Die haben den Pfefferberg. In der Grundschule da hat einmal ein Freund von mir unterrichtet.«
»Kann man auch oberrichten?«
»Ja, an aller Obergerichten.«
Der Jurist, den sie auch in der Wandergruppe hatten, stellte nun klar, dass in Berlin das Kammergericht das Oberlandesgericht war, und eine ehemalige Ärztin, die, wie Menz ihren Worten entnahm, gerade eine Berufung als Professorin für Kinderkrankheiten erhalten hatte, breitete sich über die Zunahme der Masernerkrankungen aus.
»Erwachsene mit angeborenen Defekten des zellulären Immunsystems, HIV-Infektionen und bösartigen Tumoren haben ein hohes Risiko, dass bei ihnen ein schwerer und langwieriger Verlauf der Masern letal endet.«
»Schlimmer ist aber noch, dass alle Fußballer, die etwas mit der Fifa zu tun haben, an den Blattern erkranken werden«, erklärte der Comedian.
»Düdüdüdüdü-ühü … Wir erreichen jetzt den Bahnhof Eberswalde …«
Eberswalde. Menz hatte eigentlich nie so richtig realisiert gehabt, dass es eine Kleinstadt dieses Namens überhaupt gab, und manchmal hatte er das Gefühl gehabt, dass es mit Eberswalde so war wie mit Bielefeld, von dem ja einige Spaßvögel behauptet hatten, es gäbe es in Wirklichkeit gar nicht und die Stadt sei nur ein Fantasieprodukt der Menschen und der Medien, das Ergebnis einer groß angelegten Verschwörung. Die Menschheit sollte vom Dasein einer Stadt überzeugt werden, die es gar nicht gab. Sicherheitshalber schaute Menz bei Wikipedia nach:
Eberswalde ist die Kreisstadt des Landkreises Barnim im Nordosten des Landes Brandenburg.
Die Stadt wird auch Waldstadt genannt, denn es gibt rings um die Stadt ausgedehnte Waldgebiete, südlich der Eberswalder Stadtforst mit etwa 1080 ha, nördlich das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin mit dem Totalreservat Plagefenn. ( … )
Bis zur Wende war der Charakter der Stadt durch vielfältige Industrie (Kran- und Rohrleitungsbau, Walzwerke und andere Großbetriebe) geprägt. Dies wird auch durch die Bezeichnung einiger Ortsteile wie Eisenspalterei, Kupferhammer und Messingwerk deutlich.
Also gab es Eberswalde in der Tat. Na schön. Aber gab es ihn, Dietmar Menz, wirklich oder existierte er nicht nur in der Fantasie eines Schriftstellers?
Menz sprang aus dem Zug und lief zur Bushaltestelle. Es war wie eine Flucht. Da gab es eine andere Welt, eine, die so fern für ihn war wie der Mars und in die er nie gelangen würde. Du hast nichts, du bist nichts und du wirst nie etwas werden. Es war eine Flucht.
Vom Hauptbahnhof bis zum Waldcampus der »Hochschule für nachhaltige Entwicklung« (HNE) waren es mit dem Bus der Linie 865 nur ein paar Minuten. An der Haltestelle mit dem merkwürdigen Namen »Wald-Solar-Heim« war auszusteigen.
Irgendwann saß er im Hörsaal und hatte das Gefühl, in Berlin »Beam me up, Scotty!« gerufen zu haben. Er hatte Mühe, sich an die Fahrt mit Bahn und Bus hierher zu erinnern. Ob er nicht doch einmal zu einem Neurologen gehen sollte, denn irgendetwas in seinem Kopf schien nicht zu stimmen. Keiner seiner Kommilitonen nahm ihn wahr, und auch er verspürte keinen Drang, einem von ihnen eine Unterhaltung aufzudrängen. Wenn er aber mit einer Pistole in der Hand in den Hörsaal gestürmt wäre und zu feuern begonnen hätte, dann …
Der Dozent betrat den Raum, Professor Ronald Scharnick. Menz zuckte zusammen und begann zu zittern. »Oh my God!«, stieß er hervor. Das war sein Vater! Aber wie kam der nach Eberswalde? Vielleicht, schoss es Menz durch den Kopf, war er in Kanada gestorben, aber ein Wiedergänger, ein Untoter oder gar ein Nachzehrer, einer der unter der Erde lag und den Lebenden die Lebenskraft absaugte. War sein Vater dabei, ihn zu vernichten? Vom Alter her konnte es stimmen.
Unsinn alles! Menz riss sich zusammen und gab sich alle Mühe, normal zu erscheinen und den Ausführungen seines Dozenten zu folgen, der neu zur HNE gekommen war. Er hatte eine schnarrende Stimme, die Menz gehörig nervte, gab sich wie ein Feldwebel und beschränkte sich in den ersten Minuten darauf, mehr oder minder das wiederzugeben, was bei Wikipedia zu finden war.