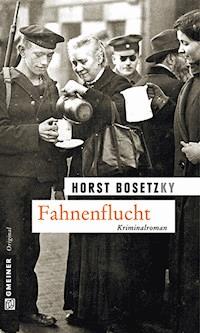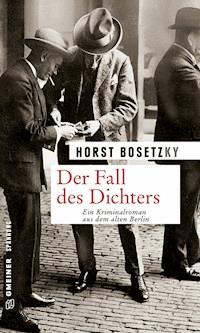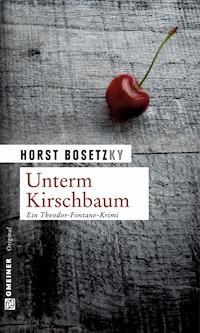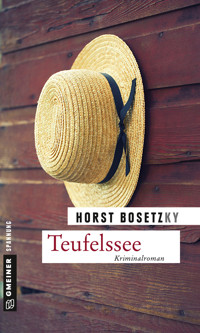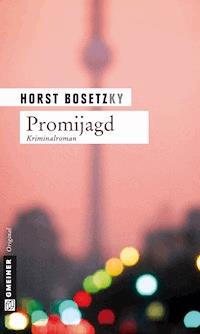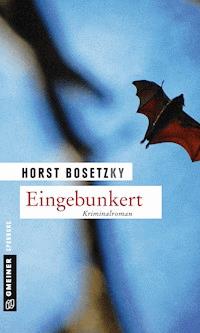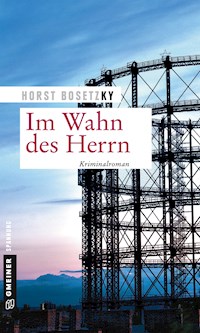Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Wahre Verbrechen im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Berlin 1926. Die bis dahin im Leben irgendwie gescheiterten Brüder Franz und Erich Sass kommen auf die geniale Idee, Banktresore mit Hilfe eines Schneidbrenners zu öffnen. Sie landen ihren ersten großen Coup, als sie durch einen Tunnel in die Stahlkammer einer Bank eindringen und 179 Schließfächer ausräumen. Kriminalsekretär Max Fabich kommt ihnen zwar auf die Spur, kann ihnen aber nichts Konkretes nachweisen. Als die Nazis an die Macht kommen, wird ihnen in Deutschland der Boden zu heiß und sie fliehen nach Dänemark. Als man sie schließlich ausliefert, werden sie bei der Überstellung ins KZ Sachsenhausen ermordet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Die Brüder Sass –geliebte Ganoven
Biografischer Kriminalroman
Zum Buch
Geldschrankknacker 1926 kommen die bis dahin im Leben irgendwie gescheiterten Brüder Franz und Erich Sass auf die ebenso innovative wie geniale Idee, Banktresore mit hilfe eines Schneidbrenners zu öffnen. Sie landen ihren ersten großen Coup, als sie durch einen Tunnel in die Stahlkammer einer Bank eindringen und 179 Schließfächer ausräumen. Als sie schließlich Robin Hood spielen und bedürftigen Berlinern Geldscheine in die Briefkästen stecken, werden sie endgültig zu Kultfiguren. Kriminalsekretär Max Fabich kommt ihnen auf die Spur, kann ihnen aber nichts Konkretes nachweisen. Als 1933 die Nazis an die Macht kommen, wird ihnen in Deutschland der Boden zu heiß und sie fliehen nach Kopenhagen, wo die dänische Polizei alsbald eine Serie von Einbrüchen und geknackten Tresoren zu Protokoll nehmen muss. Die Brüder Sass werden nach Deutschland ausgeliefert, zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt und am 27. März 1940 bei der Überstellung ins KZ Sachsenhausen ermordet.
Dr. Horst Bosetzky (ky) wurde 1938 in Berlin geboren. Der emeritierte Professor für Soziologie veröffentlichte neben etlichen belletristischen und wissenschaftlichen Arbeiten zahlreiche, zum Teil verfilmte und preisgekrönte Kriminalromane. 1992 erhielt er den Ehren-Glauser des SYNDIKATS für das Gesamtwerk und die Verdienste um den deutschsprachigen Kriminalroman. 2005 wurde ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Zehn Jahre lang war Horst Bosetzky Sprecher des SYNDIKATS und Gründungsmitglied von QUO VADIS. Besuchen Sie: www.horstbosetzky.de
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Teufelssee (2017)
Eingebunkert (2016)
Witwenverbrennung (2015)
Fahnenflucht (2013)
Der Fall des Dichters (2012)
Nichts ist so fein gesponnen (2011)
Promijagd (2010)
Unterm Kirschbaum (2009)
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
ISBN 978-3-8392-5446-2
Haftungsausschluss
Die Handlung basiert auf realen Begebenheiten, geht aber frei mit Personen, Daten und Ereignissen um.
Prolog
2015
»Wenn die Toten vom Schlaf erwacht, / leise aus ihren Gräbern steigen …« Martin Kruschin zitierte ein Gedicht, das er neulich per Zufall im Internet entdeckt hatte, von einem Poeten mit dem Pseudonym Nachtengel verfasst.
Seine Freundin Jessica lachte. »Wenn das man kein Nachzehrer ist, der uns die Lebenskraft absaugen will.« Als Ethnologin war sie sehr an Wiedergängern und Untoten interessiert.
Sie hatten ihren Kleinwagen am Wirtshaus Schildhorn geparkt und liefen nun auf einem schnurgeraden Weg zum Friedhof Grunewald-Forst, der weithin als »Selbstmörderfriedhof« bekannt war. Kruschin studierte Geschichte an der FU Berlin und wollte seine Master-Arbeit über diesen ganz besonderen Berliner Friedhof schreiben.
»Warum heißt der eigentlich so?«, wollte Jessica wissen.
»Na, weil wegen der Strömung der Havel Selbstmörder oft in der Bucht bei Schildhorn angespült wurden. Die hat man dann anfangs einfach hier im Wald verbuddelt, weil die Kirchen sie auf ihren Friedhöfen nicht haben wollten. Das war ein ›Schandacker‹ hier. Später machte die Stadt Berlin einen richtigen Friedhof daraus, und zuerst kamen auch andere Selbstmörder hierher, dann normale Gestorbene. Irgendwann soll er ›entwidmet‹ werden, wie das in der Amtssprache heißt, und dann ist die Natur hier wieder gänzlich pur.«
Sie traten durch das steinerne Eingangstor, dessen Flügel nur angelehnt waren. Am hinteren Ende des Friedhofs waren zwei Arbeiter dabei, eine Grube auszuheben. Offenbar gab es doch noch neue Beerdigungen. Martin Kruschin holte seinen Block hervor, um sich Notizen zu machen, seine Freundin zückte ihr iPhone, um die Grabkreuze und -steine, die für ihn wichtig waren, abzulichten. Zuerst stachen ihnen zwei merkwürdige Kreuze ins Auge. Martin Kruschin hatte sich schon kundig gemacht.
»Das sind Kreuze der russisch-orthodoxen Kirche – ein lateinisches Kreuz mit zwei zusätzlichen kurzen Querbalken. Hier sind nämlich fünf Russen begraben, die sich während der Oktoberrevolution in die Havel gestürzt hatten.«
»Damit könnte man doch auch heute noch Leute anlocken: Zum Selbstmord nach Berlin! Wir haben jede Menge Flüsse und Kanäle und S- und U-Bahn-Strecken.«
»Das ist makaber!«
»Du hast recht: Lieber Makeba als makaber.« Und sie begann Pata Pata zu singen.
»Hör auf: Störung der Totenruhe.«
»Vielleicht möchten die Toten gern gestört werden …«
Martin Kruschin lachte. »Ja, vor allem die Minna Braun.«
»Wer war Minna Braun?«
»Eine Krankenschwester, der das Schicksal schwer zugesetzt hatte: Die Eltern hatten sie verstoßen, der Verlobte hatte sie verlassen, der Arbeitgeber gefeuert. Da ging sie hier zum Havelufer, 1919 war das, und schluckte alles, was sie vorher an Tabletten gebunkert hatte. Forstarbeiter haben sie dann gefunden und hierher in die Aufbahrungshalle des ›Selbstmörderfriedhofs‹ gebracht. 14 Stunden später kommt ein Kriminalbeamter, um die Identität der Toten festzustellen. Er schreit auf, denn er sieht, wie sich der Kehlkopf der Scheintoten bewegt. Sie kommt ins Krankenhaus und überlebt. Ganz Berlin hat seither Angst davor Angst davor, scheintot begraben zu werden.«
Sie machten sich auf die Suche nach den Grabstellen anderer bekannter Persönlichkeiten.
»Wen hast du denn noch auf deiner Liste?«, wollte Jessica wissen.
»Clemens Laar, Schriftsteller.«
»Nie gehört …«
»Aber bestimmt den einen Satz gesprochen, mit dem er unsterblich geworden ist.«
»Keine Ahnung.«
»Na: …reitet für Deutschland. Das ist ein Romantitel, 1936 bezogen auf Carl-Friedrich Freiherr von Langen, zwei Goldmedaillen für Deutschland in der Dressur, Einzel und Mannschaft. Im Film war das Willy Birgel. Von dem haben damals alle so geschwärmt wie heute von George Clooney.«
Damit machten sie sich auf die Suche nach den fünf anderen Namen, die noch abzuhaken waren: Götz Clarén (1928 – 1997), Rundfunk- und Synchronsprecher, Horst Kudritzki (1911 – 1970), Komponist und Dirigent, Nico (1938 – 1988), Fotomodell und Sängerin der Rockband »The Velvet Underground« sowie die beiden Männer, die hier ihr Ehrengrab bekommen hatten, der Heimatforscher Willi Wohlberedt (1878 – 1950) und der Oberförster Willi Schulz (1881 – 1828).
»Wohlberedt müsste man heißen«, sagte Jessica. »Und dann zu jeder Talkshow eingeladen werden.«
»Das kann ich verstehen, Frau Kotenbeutel. Du kannst dich also nur verbessern, wenn du mich heiraten würdest. Ich wäre lieber ein anderer Willi Schulz, der von Schalke 04 und dem HSV, über 50 Länderspiele. Der hat mal gesagt …«
Weiter kam er nicht, denn in diesem Moment stießen die beiden Arbeiter, die in der hintersten Ecke des Friedhofs eine Grube aushoben, ekstatische Freudenschreie aus. Kruschin und seine Freundin liefen hin und sahen, wie beide Unmengen an Schmuckstücken nach oben beförderten, es regnete geradezu goldene Ketten, Ringe und Broschen. Eilig geputzte Brillanten funkelten in der Sonne.
»Wir sind reiche Leute!«, jubelte der jüngere der beiden Arbeiter.
»Das muss gemeldet werden«, sagte Jessica so laut, dass die beiden es hören konnten. »Ihnen steht nur die Hälfte des Wertes zu, die andere dem Eigentümer des Grundstückes hier, also der Stadt Berlin.«
»Da wär’n wa ja schön blöd, wenn wa det melden tun!«, rief der ältere der beiden Friedhofsarbeiter, der in Kruschins Augen so brutal und dümmlich aussah wie ein Terrorist mit Kalaschnikow. »Und wenn ihr wat sajen tut, kriejta wat uffs Maul!«
Martin Kruschin zweifelte keinen Augenblick daran, dass das ernst gemeint war, und überließ seiner Freundin das Argumentieren, denn dass die Friedhofsarbeiter sie attackieren würden, war weniger wahrscheinlich.
»Wenn ihr die Sachen zu Geld machen wollt, braucht ihr einen Hehler«, sagte Jessica dann auch. »Und der legt euch ganz sicher rein. Oder die Polizei beobachtet ihn – und dann seid ihr geliefert. Aber wenn wir jetzt die Polizei holen, dann ist euch mindestens die Hälfte des Erlöses sicher, und ihr landet nicht im Knast.«
Das klang überzeugend, und nachdem sie noch an die zehn Minuten diskutiert hatten, durfte Jessica ihr iPhone aus der Tasche ziehen und 110 anrufen.
Am nächsten Tag stand die Sache groß in den Zeitungen, und als Martin Kruschin am Nachmittag zum 80. Geburtstag seines Großvaters nach Spandau fuhr, hatte der zwei Bücher und eine Reihe Internet-Ausdrucke auf seinem Schreibtisch ausgebreitet.
»Das zu dem Fund auf deinem ›Selbstmörderfriedhof‹ …«
»Ekkehard Schwerk«, las Martin Kruschin, »Die Meisterdiebe von Berlin. Paul Gurk, Tresoreinbruch …«
»Gemeint sind die Brüder Sass, die gehörten ab 1929 zu den prominentesten Deutschen. Und als ich zur Kripo gekommen bin, hat man immer noch über die geredet, zumal ein großer Teil ihrer Beute noch immer nicht gefunden worden war.«
Martin Kruschin schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Jetzt verstehe ich, wo da der Zusammenhang ist!«
»Ja, was auf dem Friedhof bei Schildhorn gefunden worden ist, könnten die Brüder Sass da versteckt haben, denn …«, der Großvater deutete auf eine grün markierte Stelle in einem Artikel, wo DIE WELT über die Meisterdiebe aus Moabit berichtet hatte, »hier: ›Bis zu seinem Tod wird Max Fabich‹ – das war der federführende Kollege damals – ›fest davon überzeugt sein, dass die Brüder den größten Teil ihres unredlich erworbenen Millionenvermögens im Grunewald verscharrt haben. Aber wo? Er ist den Einbrechern einmal zufällig in einem Gartenrestaurant am Schildhorn begegnet und hatte daraus seine Schlüsse gezogen.‹ Die beiden hatten nämlich Spaten in der Hand. So steht es auch bei Schwerk auf der Seite 77.«
Der Enkel war neugierig geworden. »Erzähl mir doch bitte noch ein bisschen was von diesem Brüderpaar.«
Der Erste Kriminalhauptkommissar Richard Kruschin tat es gern und sehr ausführlich.
EINS
1925/26
Berlins Neuer Westen war ein Synonym für die »Goldenen Zwanziger Jahre« geworden. Wer um das KaDeWe herum zu Hause war, zählte weiß Gott nicht zum Proletariat. Auch in der Ansbacher Straße gab es einige Häuser mit prächtigen Fassaden, deren Mieter wohlhabende Ärzte, Geschäftsleute und Künstler waren. Dass die ständig mit irgendeiner Ware beliefert wurden, war selbstverständlich. So wunderte es niemanden, dass eines Vormittags zwei junge Männer, Max und Erich Sass, eine riesige hölzerne Kiste von einem Pferdefuhrwerk hoben und in das Haus Nummer 10 trugen. Dort stellten sie sie im zweiten Stock vor der Wohnung von Dr. Engelhardt ab. Dann entfernten sie sich wieder und fuhren davon. In der Kiste saß ihr Bruder Franz. Der klappte die Seite der Kiste, die zur Wohnungstür zeigte, nach innen und hatte nun alle Zeit der Welt, das Schloss zu knacken, in die Wohnung einzudringen und nach Goldschmuck und anderen Wertsachen zu suchen. Als seine Brüder nach gut einer Stunde die Kiste samt Franz und Beute wieder abholten, waren sie nicht gerade reiche Leute geworden, hatten aber in den nächsten Monaten mehr Geld zu Verfügung, als sie in einem ganzen Jahr mit ihrer Hände Arbeit verdient hätten.
»Köpfchen muss man haben«, fand Franz. »Daruff kommt et an!«
Da berlinerte er noch heftig, nicht aber, als er mit Erich zusammen das Geschäft von Bothmer & Dünzer betrat, bei denen noch immer »Hoflieferanten und Hofschneidermeister« an der Schaufensterscheibe stand. Hier hatte ihr Vater einmal gearbeitet, und es war ihr großer Traum, einmal einen Maßanzug und einen mit Seide gefütterten Paletot von Bothmer & Dünzer zu tragen.
Franz hatte schon in jungen Jahren begriffen, dass es für einen Fabrikarbeiter, Schlossergesellen oder Kaufmannsgehilfen ein Leben lang unmöglich gewesen wäre, sich solche Luxusgüter zuzulegen, da musste man andere Wege gehen, und der logischste war: Nimm denen etwas weg, die es reichlich haben.
»Wohin darf ich den Herren die Rechnung schicken?«, fragte einer der Schneider.
»Nach Charlottenburg in die Berliner Straße 36«, antwortete Franz, der eloquentere der beiden Brüder. Dort wohnte, das hatte er schon eruiert, ein Herr von Siemens in einer Villa. »Wir ziehen es aber vor, bar zu zahlen.«
»Aber die fertigen Kleidungsstücke gehen dorthin, Herr Schumann?«
»Nein, nein, die holen wir selber ab.«
Franz hatte es für klüger gehalten, hier unter einem Decknamen aufzutreten, denn Bruder Max hatte schon öfter mit der Polizei Bekanntschaft gemacht und eingesessen. Da wollte er kein Risiko eingehen. Und als Adresse Moabit, Birkenstraße 57 anzugeben, hätte die Leute bei Bothmer & Dünzer nur stutzig gemacht, denn wer dort wohnte, kaufte sich keinen Anzug Unter den Linden, sondern eher ein schon lange von anderen getragenes Stück beim Kleiderjuden im Scheunenviertel.
Moabit, umschlossen von der Spree und drei Kanälen, war zwar keine noble Adresse, stand aber auch nicht für einen Slum wie etwa die Mulackritze. Es gab ausgedehnte Arbeiterwohnviertel wie den Beusselkiez oder den Rostocker Kiez, aber auch Straßen mit Häusern aus der Gründerzeit, die mit reich dekorierten Stuckfassaden protzten, so etwa um die Stephanskirche herum. Bekannt war Moabit vor allem durch den Westhafen, sein Krankenhaus, das Kriminalgericht und das Gefängnis. Worauf der Name zurückzuführen war, blieb umstritten, die meisten meinten, dass es von den Hugenotten, die zuerst hier gesiedelt hatten, in Anlehnung an das Alte Testament »terre de Moab«genannt worden war.
Eine der ältesten Straßen Moabits war die Birkenstraße, und hier war in der Nr. 57 die Familie Sass zu Hause. Links von der Nr. 57 zog sich die breite und immer belebte Stromstraße in Nord-Süd-Richtung dahin und auf der anderen Seite die Lübecker Straße, deren Ruhm darin begründet war, dass hier im Hause Nr. 13 Kurt Tucholsky das Licht der Welt erblickt hatte. Das war am 9. Januar 1890 geschehen, inzwischen aber lebte »Tucho« zumeist im Ausland und kehrte nur gelegentlich nach Deutschland zurück. Der Familie Sass war er eh scheißegal, und man hätte sich eher tagelang einsperren lassen, als etwas von ihm zu lesen. Und wären sie Tucholsky bekannt gewesen, hätte er sicherlich nur gespottet, dass die Nähe zum Worte »Insasse« ihr Leben entscheidend geprägt habe.
Die Front des Hauses Birkenstraße 57 machte nach außen schon einiges her, aber die Sasses wohnten nur im Hinterhaus und hier vier Treppen hoch. Vom Treppenhaus kam man in einen kurzen Flur, von dem das Klosett abging, und danach in eine vergleichsweise geräumige Küche mit einem Fenster zum Innenhof. Von der Küche ging es in einen einzigen und nicht eben großen Raum, der allen zugleich als Wohn- und Schlafzimmer diente und mit diversen Betten, einem Ankleideschrank und einem Tisch vollgestellt war.
Die Familie Sass bestand aus dem Vater Andreas, der 1868 in Westpreußen geboren worden war, der Mutter Marie, die 1879 in der Nähe von Münster auf die Welt gekommen war, und den fünf Söhnen: Paul (* 1902), Max (* 1903), Franz (* 1904), Erich (* 1906) und Hans (* 1914).
Wenn es ans Schlafen ging, hatten es Franz und Erich am besten, da sie je ein Bett ihr Eigen nennen durften, während der Vater mit einem schnell aufzubauenden Feldbett vorliebnehmen musste. Die Mutter schlief mit dem jüngsten Sohn in der Küche. Paul war bald nach seiner Geburt zu einer Pflegemutter gekommen.
Der Vater arbeitete als Lohnschneider in einer Werkstatt Unter den Linden, die Mutter als Wäscherin im Krankenhaus Moabit. 1926 waren die beiden schon lange »kein glücklich liebend Paar« mehr, wie sich einem Schreiben entnehmen ließ, das Marie Sass an die Behörden gerichtet hatte:
Mit meinem Ehemann stehe ich nicht besonders. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass er seit Jahren äußerst eifersüchtig ist. Wir leben seit vielen Jahren getrennt (freilich auf engem Raum in der beschriebenen Moabiter Wohnung). Ich habe bereits einmal die Scheidung gegen meinen Mann eingereicht. Die Fortführung der Klage scheiterte daran, dass ich kein Armenattest erhielt; außerdem waren zu wenig Gründe vorhanden.
Von einer glücklichen Kindheit, die zudem dahin führte, dass die Söhne alle »nützliche Mitglieder der Gesellschaft« wurden, konnte also bei den Gebrüdern Sass nicht die Rede sein. Passend dazu war ein Bericht des Jugendamtes aus späteren Jahren:
Die Burschen stammen aus ungünstigen häuslichen Verhältnissen. Der Vater, der als Schneider Unter den Linden ausreichend verdient, bezahlt nur die Miete und lässt im Übrigen bereits seit Jahren seine Frau für alles in der Familie Notwendige aufkommen. Der dauernde Unfriede, der deshalb in der Familie herrschte, sowie die ständige Abwesenheit der Mutter, die außerhalb des Hauses schwer arbeiten musste, beeinflusste die Erziehung ungünstig. Frau Sass war fünf Jahre in Charlottenburg in einer Schuhputzfabrik tätig und wurde nur entlassen, weil der Mann Verdienst hatte. Die Kinder waren stets unbeaufsichtigt und sich selbst überlassen.� Die Mutter, trotz des besten Willens, war der Erziehung der schwierigen Burschen allein nicht gewachsen. So kamen von den fünf Brüdern Sass bereits die vier älteren auf die schiefe Bahn.
Paul Sass war ja nicht in der Birkenstraße aufgewachsen und hatte eigentlich nie Kontakt zu seiner Familie gehabt, beging aber dennoch in jungen Jahren eine Reihe von Diebstählen, fing sich jedoch wieder und wurde Hausdiener und Chauffeur.
Max Sass landete bald nach der Geschichte mit dem Einbruch in der Ansbacher Straße wegen anderer Delikte wieder im Knast und sollte erst 1928 entlassen werden.
Hans Sass lebte zwar die ganze Zeit über mit seinen delinquenten Brüdern zusammen in der engen Wohnung in der Birkenstraße, wusste wohl auch von ihren Straftaten, hielt aber der Polizei und den Vernehmungsrichtern gegenüber immer den Mund, besuchte mit Erfolg die Handelsschule und etablierte sich als Kaufmann. Am Ende hielt er es für klüger, einen anderen Namen anzunehmen.
Franz und Erich Sass setzten an, berühmte Männer zu werden. Erich maß 1,86 Meter und musste sich öfter den Altberliner Spruch anhören: »Langer, wie is’n die Luft da oben?« Er hatte dichtes dunkles Haar und braune Augen, wirkte aber auf Frauen eher abstoßend, da sie fanden, dass diese Augen einen stechenden Eindruck erweckten. Franz dagegen war mit seinen 1,68 Metern ein wenig zu klein geraten, um von Frauen umschwärmt zu werden, obwohl er blondes Haar und blaue Augen hatte und äußerst redegewandt war. Für beide galt, was Franz später einmal gegenüber der Polizei betonen sollte: »Frauenbekanntschaften habe ich gar nicht, ich rauche nicht und habe auch sonst keinerlei Leidenschaften.« Zu Hause unbeobachtet zu masturbieren, war ein Ding der Unmöglichkeit, und in Bordelle mochten sie nicht gehen, weil die ihrer Meinung nach zu stark von der Polizei beobachtet wurden, also blieb es im Wesentlichen bei nächtlichen Pollutionen, also den »feuchten Träumen«, und irgendwie hatte sie recht, wenn ihre Mutter gefragt wurde, ob die beiden denn schwul seien und die Antwort gab: »Nee, det nich, die schwitzen sich allet durch die Rippen.« Sie mochten Heinrich Zille, und besonders hatte es ihnen eine Zeichnung des wohl beliebtesten Berliners angetan, wo ein Betrunkener einer Schar von Jungen hinterherruft, die zu ihrer Schule eilen: »Kinda, lernt bloß nüscht, sonst müssta späta arbeeten.« Franz hatte sich das sehr zu Herzen genommen und sich lieber in der Stadt herumgetrieben, als in die Schule zu gehen und einen Beruf zu erlernen. Was man später als Fabrikarbeiter oder Kellner verdiente, war zu lächerlich, um sich durch Arbeit das ganze Leben zu versauen. Herumgetrieben und sich die Strafanstalten von innen angesehen hatte sich auch Erich, aber immerhin hatte er ein paar Monate versucht, Schlosser zu lernen und dann als Depeschenbote bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung gearbeitet.
Vielleicht wäre ihr Leben ganz anders verlaufen, wenn sie am 15. Januar 1926 nicht zum 15. Berliner Sechstagerennen in den Sportpalast gegangen wären. Der war wieder einmal ausverkauft, und sie fühlten sich in ihren teuren Maßanzügen im höllischen Gemisch aus Lärm, Schweiß, Hitze, Alkoholdunst und Bockwurstgerüchen auch ein wenig fehl am Platze, aber vielleicht ließ sich die Bekanntschaft attraktiver Damen machen, die auf neue Eroberungen aus waren und die man am Morgen nach Hause bringen und dabei um einigen Schmuck erleichtern konnte.
Sie kamen zunächst in der Nähe von »Krücke« zu sitzen, dem Invaliden Reinhold Habisch, der früher selbst einmal Radsportler gewesen war, dann aber unter eine Straßenbahn geraten und zum Krüppel geworden war. Als die Kapelle den Walzer »Wiener Praterleben« spielte, begann er zu pfeifen, und alle feierten ihn. Nur einer rief: »Du, pump mir mal dein’ Kopp, ick will meine Schwiejermutter erschrecken!«
Franz und Erich erhoben sich von ihren Plätzen und stiegen zum Umgang hinauf, um sich eine Bockwurst und ein Bier zu gönnen.
»Sekt haben Sie ja nicht?«, fragte Franz den Mann am Stand.
»Nee, aba wenn Se pinkeln jehn, ham Se Natursekt.«
Franz sah den Proleten tadelnd an. Dieser Blick wurde von einer Dame aufgefangen, die so aussah, als hätte sie eben noch auf der Bühne der Komischen Oper gestanden und bei einer Aufführung der Fledermaus mitgewirkt.
»Mein Herr«, sagte sie zu Franz Sass, »Sie können hier keine Bedienung wie im Adlon erwarten.«
Man verbeugte sich und stellte sich vor. »Gebrüder Schumann, Franz und Erich, Eisen- und Drahtverarbeitung.« Darauf war Franz gekommen, weil an vielen Drahtzäunen das Firmenschild »Carl Lerm & Gebrüder Ludewig« hing.
»Angenehm: Amélie von Laskowitz.«