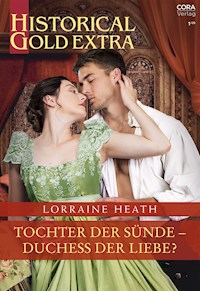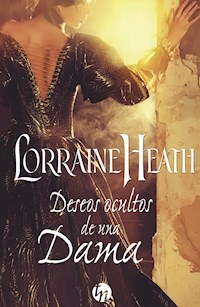4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Scoundrels of St. James
- Sprache: Deutsch
Wenn deine einzige Chance ein Pakt mit dem Teufel ist ...
Die Londoner Gesellschaft nennt Lucian Langdon den Teufelsherzog. In den Straßen der Stadt aufgewachsen, gilt er als skrupelloser Verführer und Mörder. Eine Lady riskiert mehr als nur ihren guten Ruf, wenn sie sich in die Nähe des ebenso sinnlichen wie gefährlichen Mannes begibt. Doch Catherine Mabry hat keine andere Wahl. Sie braucht seine Hilfe, um ihre beste Freundin zu retten. Dafür würde sie alles tun - sogar einen Pakt mit dem Teufel schließen ...
Ein attraktiver Held, dem man sofort verfällt, eine starke Lady, mit der man sofort mitfiebert, und eine Liebesgeschichte, die zu Herzen geht. "Teuflisch verführt" ist der packende Auftakt der historischen Liebesroman-Reihe "Scoundrels of St. James". Nächster Band: "Gefährlich zärtlich".
"Nur wenige Autorinnen fesseln Herz und Verstand ihrer Leserinnen auf so wunderbare Weise wie Lorraine Heath." Romantic Times
USA TODAY und NEW YORK TIMES BESTSELLER. Nominiert für einen ROMANTIC TIMES AWARD.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Die Scoundrels of St. James:
Band 2: Gefährlich zärtlich
Band 3: Verboten sündig
Band 4: Verzweifelt begehrt
Kurz-Novelle: Sinnlich berührt
Über dieses Buch
Wenn deine einzige Chance ein Pakt mit dem Teufel ist …
Die Londoner Gesellschaft nennt Lucian Langdon den Teufelsherzog. In den Straßen der Stadt aufgewachsen, gilt er als skrupelloser Verführer und Mörder. Eine Lady riskiert mehr als nur ihren guten Ruf, wenn sie sich in die Nähe des ebenso sinnlichen wie gefährlichen Mannes begibt. Doch Catherine Mabry hat keine andere Wahl. Sie braucht seine Hilfe, um ihre beste Freundin zu retten. Dafür würde sie alles tun – sogar einen Pakt mit dem Teufel schließen …
Ein attraktiver Held, dem man sofort verfällt, eine starke Lady, mit der man sofort mitfiebert, und eine Liebesgeschichte, die zu Herzen geht.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Lorraine Heath hat schon immer davon geträumt, Schriftstellerin zu werden. Nach ihrem Abschluss in Psychologie an der University of Texas schrieb sie im Rahmen ihrer Arbeit zunächst Handbücher und Pressemitteilungen. Als ihr 1990 ein Liebesroman in die Hände fiel, erkannte sie, dass sie ihre Zeit nicht weiter mit langweiligen Fakten, sondern mit Abenteuern, Leidenschaft und Romantik füllen wollte. Seitdem hat sie zahlreiche Romane veröffentlicht, wurde mehrmals für ihr Werk ausgezeichnet und erschien auf der Bestsellerliste der New York Times.
Homepage der Autorin: https://www.lorraineheath.com/.
Lorraine Heath
TeuflischVerführt
Aus dem amerikanischen Englischvon Susanne Kregeloh
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Jan Nowasky
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »In Bed with the Devil«
Originalverlag: Avon Books
Published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2014/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Kerstin Fricke
Titelillustration: Guter Punkt unter Verwendung eines Motivs von © Hotdamnstock
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0252-2
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Tante Jean
Danke, dass Du immer da bist.
Prolog
Aus den Aufzeichnungen des Lucian Langdon
Man sagt, dass meine Eltern in einer dunklen Gasse Londons von einer Bande von Straßenräubern ermordet wurden. Ich habe keine Erinnerung daran, auch wenn ich mir manches Mal sage, ich müsste mich daran erinnern.
Denn vermutlich habe ich den Mord mit angesehen – aber nur, wenn ich wirklich der bin, den alle Welt in mir zu sehen glaubt.
Der Earl of Claybourne.
Es ist nicht angenehm, stets die eigene Identität anzuzweifeln. Ich betrachte oft das Porträt meines Vaters, das über dem großen Kamin in der Bibliothek meiner Londoner Residenz hängt, und suche nach Ähnlichkeiten in unserem Äußeren.
Das Haar – schwarz wie der Ruß, der die Innenwand eines Schornsteins bedeckt.
Die Augen – so silbergrau wie der Zinn, für den die Hehler einen anständigen Preis zahlten.
Die Nase – von schmaler, scharfer Form wie eine feingeschliffene Klinge, und aristokratisch. Doch dass ich diese Ähnlichkeiten sehe, könnte auf meinem Wunschdenken beruhen. Es ist schwer zu sagen, ob unsere Nasen wirklich gleich aussehen, da mir meine in einem sehr frühen Alter gebrochen wurde – das Ergebnis einer Begegnung, die mich fast das Leben kostete. Ich habe mein Entkommen aus den Klauen des Todes immer Jack Dodger zugeschrieben, der sich als Zielscheibe für das geopfert hat, was mir zugedacht war. Die Dinge liefen schlecht für ihn. Nicht, dass wir je darüber gesprochen hätten.
Wenn man auf den Straßen Londons aufwächst, lernt man vieles, über das die Menschen niemals reden.
Es sind meine Augen, die den alten Herrn, der sich selbst mein Großvater nennt, überzeugt haben, dass ich sein Enkel bin.
»Du hast die typischen Claybourne-Augen«, hatte er voller Überzeugung gesagt.
Und ich gebe bereitwillig zu, dass ich durchaus das Gefühl hatte, mein Spiegelbild zu sehen, wenn ich in seine sah. Dennoch scheint mir diese Ähnlichkeit etwas viel zu Ungenügendes zu sein, um eine so weitreichende Entscheidung darauf zu stützen.
Ich war damals vierzehn und wartete auf meinen Prozess wegen Mordes. Ich muss gestehen, dass es ein unglaublicher Zufall war, der mich zu einem künftigen Lord des Königreiches machte, hatte doch die Justiz keine Scheu, junge Burschen, die man für lästig hielt, aufzuknüpfen. Ich hatte mir in dieser Hinsicht einen gewissen Ruf erworben. Wenn ich über die Umstände meiner Arretierung nachdenke, so habe ich keinen Zweifel, dass ich mich auf dem schnellen und direkten Weg nach Newgate und von dort zum Galgen befand. Da ich am Leben hing, war ich entschlossen, alles Nötige zu tun, um der Schlinge des Henkers zu entkommen.
Da ich unter der Obhut von Feagan aufwuchs, unserem Lehrmeister, der unsere ziemlich berüchtigte Schar von Diebeskindern anführte, war ich sehr geschickt darin, Leute zu betrügen. Mühelos konnte ich vorgeben, mich an Dinge zu erinnern, an die ich in Wahrheit gar keine Erinnerung hatte. Während einer sehr eingehenden Befragung, die von Inspektoren Scotland Yards überwacht wurde, war ich ganz der perfekte Schauspieler, und der alte Herr erklärte mich nicht nur zu seinem Enkel, sondern appellierte zudem an die Krone, die unglücklichen Umstände meine Lebens zu berücksichtigen und die allergrößte Nachsicht walten zu lassen. Schließlich sei ich Augenzeuge der Ermordung meiner Eltern gewesen, sei entführt und in die Sklaverei – zumindest eine Art davon – verkauft worden. Da sei es doch nachvollziehbar, dass ich ein gewisses Fehlverhalten an den Tag gelegt hätte. Würde ich seiner Obhut übergeben und in den Schoß der Familie zurückkehren, könnte er mich auf den rechten Pfad zurückführen und aus mir einen aufrechten Gentleman machen. Das hat er geschworen. Und seinem Ersuchen wurde entsprochen.
Und ich fand mich auf einem Weg wieder, den zu gehen sich als schwerer erwies, als ich erwartet hatte. Immer hielt ich nach Vertrautem Ausschau, suchte den Beweis dafür, dass ich wahrhaftig dorthin gehörte, wo ich nun zu Hause war. Als ich das Mannesalter erreicht hatte, war ich dem äußeren Anschein nach ein Aristokrat.
Aber hinter dieser Fassade … bin ich im Herzen ein Schurke geblieben.
Kapitel 1
London1851
Es ist allgemein üblich, nicht über den Teufel zu sprechen, aus Angst, durch ein unbedachtes Wort seine glühende Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Deshalb sprach man in der guten Gesellschaft so gut wie nie über Lucian Langdon, den Earl of Claybourne.
Während sich Lady Catherine Mabry nahe seinem Haus im dunklen Schatten der Mitternacht verbarg, konnte sie jedoch nicht umhin, sich einzugestehen, dass sie von diesem Teufels-Earl fasziniert war, seit er es gewagt hatte, ohne Einladung zu einem Ball zu erscheinen.
Er hatte mit niemandem getanzt. Er hatte mit niemandem gesprochen. Aber er war durch den Ballsaal geschritten, als hätte er von jedem und allem Maß genommen und jeden und alles für beklagenswert unzulänglich gehalten.
Sie hatte es als besonders peinlich empfunden, als sein Blick sich auf sie gerichtet und ein, zwei Sekunden länger als schicklich auf ihr geruht hatte. Sie hatte weder mit der Wimper gezuckt noch den Blick abgewandt – auch wenn sie beides am liebsten getan hätte –, doch mit all der unschuldigen Kühnheit, die eine junge Lady von siebzehn Jahren aufbringen konnte, hatte sie seinem Blick standgehalten.
Es hatte sie mit einer gewissen Genugtuung erfüllt, dass er als Erster fortgeschaut hatte – nachdem sich zuvor seine ungewöhnlich silberfarbenen Augen verdunkelt hatten, sodass es schien, als wären sie von den feurigen Tiefen der Hölle, die ihn vermutlich hervorgebracht hatte, zum Glühen gebracht worden.
Nur sehr wenige Adlige hielten ihn für den rechtmäßigen Claybourne-Erben, aber niemand wagte es, seinen Status infrage zu stellen. Schließlich war allgemein bekannt, dass er fähig war, einen Mord zu begehen. Er hatte nie bestritten, den Sohn und Erben des vorherigen Earls getötet zu haben.
An jenem Abend war es gewesen, als hätten alle Ballgäste den Atem angehalten und darauf gewartet, wohin Claybourne zielen und an wem er sein Missvergnügen auslassen würde, denn es war offensichtlich gewesen, dass er kein Mann war, der Fröhlichkeit versprühte. Es wurde vermutet, dass er in schändlicher Absicht gekommen war, denn er musste wissen, dass keine der anwesenden Ladys ihren Ruf durch einen Tanz mit ihm aufs Spiel setzen würde und dass keiner der Gentlemen es zulassen würde, sein Ansehen zu besudeln, indem er sich in aller Öffentlichkeit mit Claybourne unterhielt.
Dann war er aus dem Saal geschlendert, als habe er nach jemandem gesucht und ihn – oder sie – nicht gefunden und sei zu dem Schluss gekommen, dass der Rest von ihnen seiner Beachtung nicht wert war.
Und das hatte Catherine am meisten geärgert.
Zu ihrer großen Schande hatte sie sich zutiefst gewünscht, mit ihm zu tanzen, von seinen Armen gehalten zu werden und dabei noch einmal in jene glitzernden Augen zu sehen, die sie sogar jetzt noch, fünf Jahre nach diesem Ballabend, bis in ihre Träume verfolgten.
Als der Nebel dichter wurde, setzte sie sich die Kapuze ihrer Pelisse auf, um sich zu wärmen. Dann nahm sie das Haus des Earls genauer in Augenschein und suchte nach einem Hinweis, der ihr verriet, ob er daheim war. Sie war nicht sicher, ob ihre Faszination für ihn so ganz angebracht war; genau genommen ging sie eher vom Gegenteil aus.
Sie konnte nicht einmal sagen, was an ihm sie eigentlich anzog; sie wusste nur, dass sie diese unumstößliche Anziehungskraft spürte. Im Geheimen, ohne Wissen ihrer Familie, hatte sie es nach diesem ersten Zusammentreffen mit Claybourne sogar gewagt, ihm von einem vertrauenswürdigen Diener Einladungen zu Bällen und Dinners, die sie gab, überbringen zu lassen. Nicht dass er sich jemals die Mühe gemacht hatte, diese zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn, zu diesen Anlässen zu erscheinen.
Soweit Catherine wusste, hatte er abgesehen von diesem einen Abend niemals eine andere Soiree besucht. Da er in den führenden Häusern nicht mit offenen Armen willkommen geheißen wurde, hatte es sie durchaus gekränkt, dass er ihre Versuche ignorierte, ihn in ihr gesellschaftliches Leben einzubeziehen. Allerdings waren die Gründe für ihre Einladungen eher egoistischer und nicht ausschließlich honoriger Natur gewesen.
Doch jetzt konnte sie sich den Luxus, ihn mit goldgerahmten Einladungen lediglich zu locken, nicht länger leisten. Sie war mehr als entschlossen, mit ihm zu reden, und wenn das im Schutze eines gut besuchten Ballsaales nicht möglich war, dann würde sie es eben in der Privatheit seines Hauses tun.
Ein eisiger Schauer kroch ihr den Rücken hinunter, und sie versuchte, das Frösteln dem Nebel anzulasten und nicht ihrer Feigheit. Sie stand bereits eine ganze Weile im Dunkeln, und die Feuchtigkeit war ihr bis in die Knochen gedrungen. Wenn sie nicht bald ins Warme käme, würde sie wie ein zitterndes Bündel Elend aussehen, und das wäre ihrer Absicht kaum dienlich. Sie musste auftreten, als habe sie überhaupt keine Bedenken, sich ihm zu nähern, ansonsten würde sie seine Verachtung auf sich ziehen und ihr Vorhaben wäre zum Scheitern verurteilt.
Vorsichtig schaute Catherine sich um. Es war schon spät, und die Nacht war sehr still, fast unheilvoll.
Niemand würde es sehen, wenn sie jetzt an seine Tür klopfte, niemand würde Zeuge ihres skandalösen mitternächtlichen Besuches sein. Ihr Ruf würde makellos bleiben. Dennoch zögerte sie. Hatte sie den ersten Schritt auf diesem Weg getan, würde es keine Umkehr mehr geben. Doch sie wusste nicht, welche andere Wahl ihr blieb.
Mit neu gewonnener Entschlossenheit trat sie aus dem Schatten, ging auf das Haus zu und dachte dabei beklommen, dass ihr Ruf wohl das Einzige bleiben würde, das der teuflische Earl nicht anrührte.
Niemand würde je wagen zu behaupten, dass Lucian Langdon, Earl of Claybourne, ein Feigling sei. Doch er wusste es besser, als er jetzt am Spieltisch saß. Denn hier saß er nur, weil er nicht den Mut aufgebracht hatte, der reizenden Frannie Darling einen Antrag zu machen. Er war mit der festen Absicht in Dodger’s Salon gekommen, Frannie endlich um ihre Hand zu bitten, doch kaum hatte er vor der Tür zu dem Büro gestanden, in dem sie für Jack Dodgers die Bücher führte, hatte er es sich anders überlegt und den raschen Rückzug an den Spieltisch angetreten, nur um seinen Händen eine Gelegenheit zu geben, mit dem Zittern aufzuhören, und seinem Verstand die Chance, noch einmal die Worte zu wiederholen, die er auswendig gelernt hatte.
Das war vor sechs Stunden gewesen.
Er könnte sein Zögern der Tatsache zuschreiben, dass er am Gewinnen war. Aber er gewann ja immer.
Die nächsten Karten wurden ausgeteilt. Er warf einen flüchtigen Blick darauf. Es waren nicht so sehr die Karten, die er bekam, die seinen Sieg sicherten, sondern eher seine Fähigkeit, genau zu sagen, was für ein Blatt die anderen Herren hielten.
Die Augen des Earl of Chesney zuckten leicht, als würde ihn sein Glück überraschen, wenn er ein zusammenpassendes Kartenpaar erhielt. In dieser Runde blieben seine Augen bemerkenswert ruhig. Viscount Milner ordnete sein Blatt immer wieder neu, ohne jemals zufrieden zu sein. Der Earl of Canton trank stets einen Schluck aus seinem Brandyglas, wenn die Kartenauswahl ihn erfreute. Sein Glas blieb jetzt unangetastet. Der Duke of Avendale beugte sich vor, als sei er bereit, sich auf den Einsatz zu stürzen, wenn er glaubte, er würde bald ihm gehören, und er lehnte sich zurück, wenn der weitere Verlauf der Partie zweifelhaft war. In diesem Moment sah er aus, als würde er gleich von seinem Stuhl auf den Boden fallen. Er hatte vermutlich ein unglaublich schlechtes Blatt, schien jedoch zu glauben, er könne damit bluffen.
Das Spiel ging weiter, und jeder der Herren machte seinen Einsatz oder passte. Als diese Runde beendet war und die anderen Lords ächzten und stöhnten, strich Claybourne seinen Gewinn ein und fügte ihm dem Häufchen hölzerner Chips zu, das bereits vor ihm lag.
»Ich glaube, Gentlemen, dass ich für heute Schluss machen werde«, sagte er und erhob sich.
Ein junger Bursche, der die dunkelrote Livree trug, für die das Dodger’s bekannt war, kam mit einer Kupferschale herbeigeeilt und hielt sie an den Rand des Tisches, während Claybourne seine üppigen Gewinne hineinschob.
»Hören Sie, Claybourne«, sagte Avendale, »das ist nicht gerade fair. Sie sollten uns zumindest eine Gelegenheit geben, es zurückzugewinnen.«
Claybourne zog eine Crown aus seiner Tasche, nahm dem Angestellten die Schale aus der Hand und warf ihm gleichzeitig die Münze zu. Der Junge, der vermutlich nicht älter als acht Jahre war, hob dankend die Finger an seine Stirn und sauste davon.
»Ich habe Ihnen fast die ganze Nacht Gelegenheit dazu gegeben, Gentlemen. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, dass Sie weitaus besser davonkommen, wenn ich jetzt gehe.«
Die Gentlemen murrten noch ein wenig lauter, aber Claybourne wusste, dass es sie nicht schmerzte, ihn gehen zu sehen. Sie fühlten sich in seiner Gegenwart unwohl, allerdings nicht mehr als er sich in ihrer. Aber das war sein Geheimnis. Anders als sie erlaubte er es seinen Gefühlen und Gedanken niemals, an die Oberfläche zu treten, nicht einmal, wenn es um Frannie ging. Er bezweifelte, dass sie überhaupt eine Ahnung hatte, wie tief seine Gefühle für sie waren.
Er blieb am Wechselschalter stehen und ließ sich für seine Chips Münzen geben. Das Gewicht, das die Schale jetzt zusätzlich bekommen hatte, freute ihn.
Während er durch den Spielsalon ging, sagte er sich, dass Frannie sich für heute Abend zweifellos schon zurückgezogen hatte, weshalb er bis morgen damit warten musste, sich ihr zu erklären. Doch als er sich dem rückwärtigen Bereich des Salons näherte, sah er die Tür zu ihrem Büro offen stehen. Höchstwahrscheinlich würde er dort jetzt auf Jack treffen. Der Mann schlief noch weniger als Claybourne. Aber was, wenn es nicht Jack war? Dann könnte Claybourne diese leidige Angelegenheit hinter sich bringen. Also ging er den Flur hinunter und schaute in das Zimmer …
Und dort war Frannie. Die reizende Frannie. Das rote Haar war streng zurückgekämmt und zu einem korrekten Knoten frisiert, die Sommersprossen auf ihrer Nase und ihren Wangen waren im Schein der Lampe auf dem Schreibtisch, an dem sie saß, kaum zu erkennen. Sie war damit beschäftigt, Zahlenkolonnen sorgfältig zu kontrollieren und abzuhaken. Ihr Kleid hatte einen hohen Kragen, und jeder Knopf, bis hoch an ihr Kinn, saß unverrückbar an seinem Platz. Die langen Ärmel ließen nur ihre Hände sehen. Sie hatte ihre sonst so glatte Stirn gerunzelt. Wäre sie erst seine Frau, müsste sie keine Sorgen mehr haben.
Sie schaute auf und stieß einen leisen Schrei aus, während sie gleichzeitig zusammenschrak und eine Hand auf die Brust presste. »Du lieber Gott, Luke! Hast du mich erschreckt! Wie lange stehst du schon da und beobachtest mich?«
»Noch nicht lange genug«, entgegnete er lakonisch und betrat das Zimmer mit einem Selbstvertrauen, das er nicht empfand. Er stellte die Schale mit den Münzen auf den Tisch. »Für dich und dein Kinderheim.«
Frannie hoffte, das Heim in Bälde gründen zu können und Waisenkindern das Leben dadurch leichter zu machen. Sie sah ihn aus schmalen Augen an. »Sind das unrechtmäßig erworbene Gewinne?«
»Natürlich.«
Sie griff nach der Schale und lächelte ihn an. Ihr schelmisches Lächeln traf ihn wie immer wie ein kräftiger Schlag in die Magengrube. »Dann werde ich es gern annehmen und Gutes damit tun, um dich von deinen Sünden loszusprechen.«
In ihrer Stimme lag ein leicht neckender Ton, aber ihre Augen blickten traurig.
»Niemand kann mich von meinen Sünden lossprechen, Frannie, das weißt du doch.« Mit einer Handbewegung, die sie davon abhalten sollte, auch nur zu versuchen, diesen Punkt mit ihm zu diskutieren, nahm er auf dem dick gepolsterten Stuhl vor ihrem Schreibtisch Platz. »Du bist ziemlich spät dran.«
»Es ist unglaublich viel Arbeit nötig, um Jacks Finanzen im Auge zu behalten. Seine Profite sind erstaunlich.«
»Sein Wahlspruch lautet nicht umsonst ›Wenn du reich sterben willst, dann investiere in das Laster.‹«
»Nun, er wird zweifelsohne reich sterben, und irgendwie ist das ziemlich traurig. Er sollte das Geld für etwas ausgeben, das ihm Freude macht.«
»Ich denke, er hat seine Freude daran, reichen Kerlen ihre Kohle abzuknöpfen.« Sein Straßenjargon kam durch und verriet, wo er die ersten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Es fiel ihm immer sehr leicht, sich in Frannies Gegenwart zu entspannen, weil sie die gleiche Vergangenheit hatten.
»Aber ist er auch glücklich?«, fragte sie.
»Ist das denn einer von uns?«
Tränen stiegen ihr in die Augen …
»Verdammt, Frannie …«
Sie hob die Hand. »Schon gut. Ich habe nur wieder eine meiner sentimentalen Anwandlungen, und wenn ich auch nicht behaupten kann, glücklich zu sein, glaube ich doch, dass ich zufrieden bin.«
Jetzt war die perfekte Gelegenheit, Frannie nie endendes Glück zu versprechen, aber ihr Büro schien plötzlich ein so schrecklich prosaischer Ort zu sein. Was hatte er sich nur dabei gedacht, überhaupt in Erwägung zu ziehen, ihr den Antrag hier zu machen? Die Szenerie für einen Heiratsantrag sollte so unvergesslich sein wie der Antrag selbst.
Morgen. Er würde sie morgen fragen. Er räusperte sich und stand auf. »Nun, es ist schon recht spät. Ich geh jetzt wohl besser.«
Sie lächelte ihn wieder verschmitzt an. »Es war sehr nett von dir, vorbeizuschauen.« Sie berührte die Kupferschale, in der sein Gewinn lag. »Ich danke dir für deine Spende.«
»Ich würde dir mehr geben, legale Gelder, wenn du sie annehmen würdest.«
»Du hast mehr als genug für mich getan, Luke.«
Wieder schien es die perfekte Gelegenheit zu sein, ihr zu sagen, dass er nicht annähernd so viel getan hatte, wie er für sie zu tun gedachte, aber die Worte steckten in seiner Kehle fest. Warum war er in ihrer Nähe immer so verdammt wortkarg, wenn es darum ging, über seine Herzensangelegenheiten zu reden? Lag es daran, dass er, wie er befürchtete, kein Herz hatte? Dass da nur ein schwarzes Loch war, das die Finsternis seiner Seele widerspiegelte?
Ihr etwas zu sagen, sollte doch ganz leicht sein. Schließlich kannte jeder das Schlimmste vom anderen. Warum ließ sich das so viel leichter miteinander teilen als das, was das Beste sein sollte?
Er tat einen Schritt Richtung Tür. »Ich werde dich vermutlich morgen sehen.«
»Ich werde dir dann sagen, wie ich das Geld verwenden werde, das du mir gegeben hast.«
»Verwende es, wie du willst, Frannie. Es ist keine Bedingung daran geknüpft. Du schuldest mir keine Erklärungen.«
»Du bist nicht gern mit Waisenkindern zusammen, nicht wahr?«
»Worauf willst du hinaus? Meine engsten Freunde sind Waisen.«
»Feagans fröhliche kleine Schar von Taugenichtsen. Wir sind eine seltsame Mischung, nicht wahr?«
»Aber nur, weil wir die Widrigkeiten unserer Jugend überwunden haben und alle recht erfolgreich sind.«
»Wir haben es deinem Großvater zu verdanken, dass sich das Blatt für uns gewendet hat. Als er dich bei sich aufgenommen hat, hat er uns alle mit aus dem Sumpf gezogen.«
»Falls er mein Großvater war.«
»Wie kannst du das noch immer anzweifeln?«
Er hätte ihr fast die Wahrheit gesagt, aber er glaubte nicht, dass sie die Lüge billigen würde, die er zu leben glaubte. Er bedachte sie mit einem von seinen, wie er hoffte, charmanteren Lächeln. »Gute Nacht, Frannie. Süße Träume.«
Was ihn betraf, so hatte er nur Albträume, wenn er denn überhaupt schlafen konnte.
Er verließ das Zimmer, ehe sie ihn noch mehr löchern konnte. Sein früheres Leben war etwas, das er nicht noch einmal nacherleben wollte. Manchmal kam es ihm seltsam vor, dass er jemanden heiraten wollte, der mit seiner Vergangenheit so eng verbunden war. Mit Frannie an seiner Seite würde es ihm nie gelingen, der Vergangenheit zu entkommen, aber vielleicht gelänge es ihm dann besser, sich ihr zu stellen.
Er hatte fast die Haustür erreicht, als er die Worte hörte: »Du schuldest mir fünf Mäuse, Luke.«
Er blieb abrupt stehen, wandte sich um und sah, dass Jack Dodger mit einem selbstsicheren Grinsen auf dem zerklüfteten Gesicht auf ihn zustolzierte.
»Das weißt du doch gar nicht«, entgegnete Luke, als Jack vor ihm stehen blieb.
»Du hast Frannie also gebeten, dich zu heiraten?«
Mit einem Seufzen zog Luke seine Brieftasche aus der Innentasche seines Jacketts und überreichte Jack den verlangten Betrag. »Ich hätte dir niemals von meinen Plänen erzählen dürfen.«
»Nein, du hättest niemals die Wette annehmen sollen, dass du es wirklich tun wirst.« Jack steckte das Geld ein. »Willst du heute Abend eines meiner Mädchen mit nach Hause nehmen?« Er zwinkerte ihm zu. »Vielleicht, um dich ein wenig trösten zu lassen?«
Luke verfluchte Jack innerlich dafür, dass er ihn in Versuchung führte, und sich selbst, weil es ihm schwerfiel, dieser Versuchung zu widerstehen. Aber er hatte sich noch nie mit einem von Jacks Mädchen vergnügt.
»Ich werde es nicht so weit kommen lassen, dass Frannie mich mit einem deiner jungen Mädchen weggehen sieht.«
»Ich werde sie durch die Hintertür rausschicken. Frannie wird es nie erfahren.«
»Du meinst nicht, dass deine Mädchen reden?«
»Sie sind sehr diskret. Darauf bestehe ich.«
Luke dachte über das Angebot nach, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, ich werde es nicht riskieren, dass sie meine Zuneigung anzweifelt.«
»Willst du damit sagen, dass du während all dieser Jahre keusch gelebt hast?«
»Natürlich nicht, aber wie deine Mädchen bin auch ich sehr diskret.« Das Dodger’s war nicht das einzige Etablissement, das weibliche Begleitung anbot. Außerdem war es weniger wahrscheinlich, dass Frannie von Lukes Affären erfuhr, wenn er sie nicht hier, sondern anderswo suchte. Einige Jahre lang hatte er sogar eine Geliebte gehabt, aber ihre Wege hatten sich getrennt, als Luke beschlossen hatte, Frannie zu bitten, seine Frau zu werden.
»Um Himmels willen, Frannie arbeitet hier. Sie weiß, dass Männer Bedürfnisse haben.«
»Ich werde nicht zulassen, dass sie sich fragt, wie es um meine bestellt ist. Du würdest das verstehen, hättest du jemanden, der dir etwas bedeutet.«
»Ich ziehe es vor, mir meine Frauen zu kaufen. Auf diese Weise gibt es keine Missverständnisse.«
Aber auch keine Leidenschaft, zumindest nach Lukes Erfahrung.
»Wir werden also für morgen die übliche Wette abschließen?«, fragte Jack.
»Auf jeden Fall.«
»Es ist fast ein Jahr her, dass du den Plan gefasst hast. Mir gefällt es nicht besonders, an meinen Freunden zu verdienen, also bring die Sache morgen zu Ende, hörst du?«
»Wenn es dir nicht gefällt, dann hör mit den verdammten Wetten auf!«
»Du weißt, dass ich eine Schwäche für Wetten habe.« Er zog einen Mundwinkel nach oben. »Und beim Kartenspiel kann ich dich ja nur selten schlagen.«
»Dann also morgen. Ich werde sie morgen fragen«, versicherte Luke ihm mit neuer Überzeugung.
Jack schlug ihm auf die Schulter. »Bring auf jeden Fall wieder fünf Pfund mit.«
Luke musste sich zusammenreißen, um Jack das Grinsen nicht aus dem Gesicht zu schlagen. Aber genauso, wie Frannie Luke etwas schuldete, so schuldete er Jack etwas, das er niemals würde zurückzahlen können.
Luke verließ das Dodger’s und trat in die nebelverschleierte Nacht hinaus. Seine Knochen begannen sofort zu schmerzen – eine Erinnerung an zu viele Nächte, die er in der Kälte geschlafen hatte. Jetzt hielt er die Zimmer seiner Häuser fast unerträglich warm, einfach deshalb, weil er es sich leisten konnte. Hatte er seine Jugend ohne viele Bequemlichkeiten verbracht, so schwelgte er jetzt umso mehr darin. Er hatte sich den Ruf erworben, exzentrisch, extravagant und unvernünftig verschwenderisch zu sein. Aber er konnte es sich erlauben zu prassen, so viel es ihm verdammt noch mal gefiel. Seine Partnerschaft mit Jack sorgte dafür.
Ja, in die Laster zu investieren, zahlte sich außerordentlich gut aus.
Der Lakai in Livree öffnete mit einer leichten Verbeugung den Kutschenschlag, als sein Herr näherkam.
»Nach Hause, auf direktem Weg«, befahl Luke, während er einstieg.
»Aye, Mylord.«
Die Tür wurde geschlossen, und Luke lehnte sich zurück. Die gut gefederte Kutsche fuhr an. Luke sah aus dem Fenster, konnte jedoch außer grauem, umherwirbelndem Nebel kaum etwas erkennen. Das machte ihm jedoch nicht viel aus, da der Nebel ohnehin einen festen Platz in seinen Träumen hatte.
Nicht, dass er oft träumte. Um zu träumen, musste man schlafen, und Luke schlief selten eine längere Zeitspanne. Er war sich nicht sicher, ob irgendeiner von ihnen das tat. Feagans Kinder waren aneinander gebunden durch die Dinge, die sie getan hatten. Dinge, von denen die Damen und Herren des Adels niemals begreifen würden, wie man so verzweifelt sein konnte, um Derartiges zu tun.
Das war einer der vielen Gründe, aus denen er seine Stellung nie wirklich akzeptiert hatte. Kurz nach dem Ableben des alten Herrn hatte Luke einen Ball besucht, um seinen Rang als der neue Earl of Claybourne öffentlich klarzustellen, und alle Ballgäste hatten betreten geschwiegen, sobald er oben auf der Treppe angekündigt worden war. Er war durch den Saal geschlendert und hatte damit jeden provoziert, dem seine Anwesenheit zuwider war, doch es war niemand fähig gewesen, ihm in die Augen zu sehen.
Ein Bild flackerte am Rande seiner Erinnerung auf. Nur eine junge Lady hatte sich nicht nur getraut, seinen Blick zu erwidern, sondern ihn sogar herausgefordert. Er war sich nicht sicher, warum, aber er dachte manches Mal an sie. Sie war nicht wie Frannie. Sie hatte in ihrem eleganten Abendkleid dagestanden, jede Locke ihres blonden Haars perfekt an ihrem Platz, und verzogen und verwöhnt gewirkt. Es war einer der Gründe, warum er den Gedanken verabscheute, dass er jetzt Teil der Aristokratie war. Diese Leute wussten nicht, wie es war zu leiden. Sie wussten nichts von der Demütigung, um Brosamen betteln zu müssen. Sie waren nicht mit dem scharfen Biss des Spazierstockes vertraut, wenn das Betteln nicht genügend Geld oder das Hineingreifen in fremde Taschen nicht genügend Taschentücher eingebracht hatte. Sie kannten nicht die Angst davor, erwischt zu werden. Sogar Kinder wurden ins Gefängnis gesteckt, manches Mal auch auf den großen Schiffen nach Australien oder Neuseeland deportiert oder gar gehängt, wenngleich dies nur selten geschah.
Die Kutsche hielt, die Tür wurde geöffnet, und Luke stieg aus. Er fühlte sich stets ein wenig schuldig, wenn er sein Londoner Haus betrat. Zwei Dutzend Familien hätten genügend Platz, um hier bequem zu wohnen. Stattdessen lebte er hier mit zwei Dutzend Dienstboten. Natürlich würde sich das ändern, wenn Frannie und er erst einmal verheiratet waren. Dann würden Kinder durch die Flure toben. Sie würden ein sehr viel angenehmeres Leben haben, als ihre Eltern es gekannt hatten.
Die schwere Haustür wurde geöffnet. Der Butler war noch auf, wie Luke überrascht feststellte. Luke hatte keinen festen Tagesablauf, sondern kam und ging, wie und wann es ihm beliebte. Er erwartete nicht, dass seine Angestellten ihr Leben nach seiner Gewohnheit ausrichteten, lange aufzubleiben.
Fitzsimmons war schon lange, bevor Luke hergekommen war, um hier mit dem alten Herrn zu wohnen, in diesem Haus gewesen. Soweit Luke wusste, hatte der Butler, der dem vorigen Earl zutiefst ergeben gewesen war, nicht ein einziges Mal dessen Überzeugung angezweifelt, dass Luke sein Enkel war.
Nachdem die Tür geschlossen worden war, nahm Luke den Hut ab und reichte ihn dem Butler. »Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass Sie nicht aufbleiben müssen, bis ich nach Hause komme.«
»Ja, Mylord, aber heute Abend hielt ich es für angezeigt, es zu tun.«
»Und warum das?«, fragte Luke, während er sich die Handschuhe auszog.
»Sie haben Besuch von einer jungen Dame.«
Luke hielt inne. »Wer ist es?«
»Sie wollte es mir nicht sagen. Sie hat den Dienstboteneingang genommen und gesagt, es sei von höchster Wichtigkeit – ›es geht um Leben und Tod‹, waren ihre genauen Worte –, dass sie mit Ihnen spricht. Sie wartet seitdem in der Bibliothek.«
Luke schaute zum Korridor, der zur Bibliothek führte. »Und Sie haben keine Vermutung, wer sie ist?«
»Nein, Mylord, obwohl ich annehmen würde, dass sie eine hochgeborene Lady ist. Sie hat diese gewisse Art an sich.«
Im Laufe der Jahre hatten einige hochgeborene Ladys das Bett mit Luke geteilt. Er führte ein Leben voller Überfluss, an dem viele teilhaben wollten, aber er hatte immer deutlich gemacht, dass eine dauerhafte Beziehung mit ihm nicht zur Debatte stand. Manche hatten auch einfach nur eine Zeitlang mit dem Teufel spielen wollen. Aber keine von ihnen hatte je behauptet, dass es um Leben und Tod ginge, um mit ihm zu sprechen. Wie dramatisch. Der Rest dieser Nacht versprach, unterhaltsam zu werden.
Er gab Fitzsimmons seine Handschuhe. »Sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden.«
»Sehr wohl, Mylord.«
Die Neugier reizte Luke, als er den Korridor entlangging. Er sah keinen der Diener vor der Tür zur Bibliothek warten, da sie nicht damit rechneten, dass ihre Dienste zu dieser unchristlichen Stunde benötigt würden. Luke betrat die Bibliothek und schloss vernehmlich laut die Tür hinter sich – ein großer Auftritt, um seine Besucherin zu entwaffnen.
Die Frau, die am Fenster stand und in den Garten geschaut hatte, den Dunkelheit und Nebel verbargen, fuhr herum. Sie hatte ihre Pelisse nicht abgelegt, und deren Schließe verhinderte den freien Blick auf den Busen der Trägerin. Unter diesem Umhang würde sie etwas tragen, das ihn verführen sollte, und aus unerfindlichen Gründen war Luke plötzlich durchaus in der Stimmung, um sich verführen zu lassen.
»Lady Catherine Mabry, wenn ich mich recht erinnere«, sagte er gedehnt, während er näher schlenderte, bis er das exquisite Parfüm riechen konnte, das sie umhüllte wie der Duft einer wunderschönen Rose.
Ihre blauen Augen weiteten sich kaum merklich. »Ich hatte nicht angenommen, dass Sie wissen, wer ich bin.«
»Ich habe es mir zur Obliegenheit gemacht, immer zu wissen, wer wer ist.«
»Sie betrachten mich als Ihre Obliegenheit?«
»Oh ja, Lady Catherine. Ist es nicht das, was Sie wollten, als Sie mich an jenem Abend auf dem Ball herausgefordert haben?«
»Eigentlich nicht, nein«, murmelte sie.
Fasziniert beobachtete er, wie ihre zarte Kehle sich leicht bewegte, als sie schluckte – der einzige Hinweis darauf, dass sie darüber nachdachte, ob es richtig war, hierherzukommen. Sie war hübscher, als er sie in Erinnerung hatte – vielleicht lag es daran, dass sie erwachsener geworden war –, und sie besaß noch immer den Mut, seinem Blick standzuhalten. Oder vielleicht auch nicht. Einen Herzschlag lang wirkte sie unsicher, bis sie den Blick schließlich abwandte, während sie sich über die Lippen leckte. Eine Einladung zu etwas Intimerem.
Er fuhr mit dem Finger über die zarte Haut unter ihrem Kinn, und sofort sah sie ihn an. Er spürte, dass ihr Pulsschlag schneller wurde und flatterte wie eine kleine Motte, die sich getraut hatte, sich der Flamme zu nähern, und jetzt merkte, dass sie nicht mehr fliehen konnte. Es war offensichtlich, dass sie eine Novizin war, wenn es um die Kunst der Verführung ging, aber das war ihm egal. Er verfügte über genügend Erfahrung für sie beide.
»Ich weiß, warum Sie hier sind«, sagte er. Seine Stimme war tief, provozierend, und ihr Klang war das Vorspiel für ihr Zusammensein unter den seidenen Decken seines Bettes.
Sie zog die feine Stirn kraus. Ihre Gesichtszüge waren von höchster Vollkommenheit, von der Natur mit offensichtlicher Sorgfalt geschaffen, und noch nie waren sie von der Härte des wirklichen Lebens gezeichnet worden.
»Wie …«, begann sie.
»Glauben Sie nicht, Sie wären die Erste, die versucht, mich in den Hafen der Ehe zu locken. Ich bin nicht leicht einzufangen.« Er ließ den Finger über ihre Kehle gleiten, bis er die Schließe ihres Umhangs erreichte. »Ich gehe davon aus, dass Ihr Tugendwächter draußen vor dem Fenster steht und uns beobachtet, um den richtigen Moment abzuwarten und sich dann bemerkbar zu machen.« Mit geschickten Fingern öffnete er die Schließe und streifte ihr den Umhang behutsam von den Schultern, der an ihr herunterglitt und zu Boden fiel.
Sein Körper spannte sich an, als sich seinem Blick ungehindert darbot, was sie zu bieten hatte. Er hatte schon zu lange keine Frau mehr unter sich gespürt. Selbst wenn er sich in ihrer Falle verfing, würde er sich leicht daraus befreien können. Er legte die Hände um ihr Gesicht und beugte sich näher, bis sein Atem sich mit ihrem mischte. »Aber selbst wenn dieser Zeuge mit ansieht, wie ich Ihnen Ihre Kleider ausziehe, selbst wenn er sieht, dass Sie mich mit offenen Armen willkommen heißen und in Ekstase laut schreien, werde ich Sie nicht heiraten«, sagte er leise.
Er hörte, wie sie den Atem anhielt.
»Ich werde Ihren Ruf nicht retten, wenn er Schaden genommen hat.« Er strich mit den Lippen über ihren Mund. »Falls Sie ein Kind empfangen, werde ich Ihre Ehrbarkeit nicht wiederherstellen. Der Preis, den Sie dafür zahlen, mit dem Teufel zu tanzen, ist, dass Sie in der Hölle schmoren werden.«
Er legte seinen Mund fest auf ihren und war ganz und gar nicht überrascht, dass sie es duldete. Selbst wenn sie nicht gekommen war, um ihn in eine Falle zu locken, so wusste er doch, was er für sie war: die Befriedigung einer Neugierde, nicht mehr. Ein kleiner Fehltritt, ehe sie die respektable Ehe mit einem Lord einging, dessen Stammbaum niemals hinter dessen Rücken hinterfragt wurde.
Sie sträubte sich nicht, als er ihre Lippen auseinanderdrängte, sondern stöhnte, als er seine Zunge in ihren Mund stieß und nichts unerforscht ließ. Ihre Hände griffen nach den Aufschlägen seiner Jacke, und einen Moment lang glaubte Luke, dass sie schwankte. Er reagierte mit einem Verlangen, das so stark war, dass es ihn fast in die Knie zwang.
Noch während er diese Frau und seine Schwäche verfluchte, wurde ihm bewusst, dass er nicht den Wunsch verspürte, der Versuchung zu widerstehen. Er würde sie sich nehmen. Sie hatte sich in dem Moment darauf eingelassen, in dem sie an seine Tür gekommen war. Er war ein Mann, der stets eine Gelegenheit ausnutzte, die sich ihm bot, und sie bot ihm eine Gelegenheit zum Sex. Es war zu lange her, dass er seinen Bedürfnissen freien Lauf gelassen hatte. Sie würde von allem profitieren, was er heute Nacht zu bieten hatte, aber mehr als das würde es nicht geben. Am Morgen würde sie nichts als Erinnerungen mit sich nehmen.
Er löste den Mund von ihrem, nahm ihr Gesicht in die Hände und sah ihr in die Augen. »Ich hoffe, dass Sie das auch wirklich wollen, Mylady, denn es wird kein Zurück mehr geben, wenn es erst einmal geschehen ist.«
Ihr Atem ging keuchend, als sie den Kopf schüttelte. »Sie missverstehen den Anlass meines Besuches.«
»Tue ich das?«, fragte er spöttisch.
Sie nickte. »Ich will jemanden loswerden. Und ich habe gehört, dass Sie der richtige Mann dafür sind.«
Kapitel 2
Wäre Catherine ihm nicht so unglaublich nah gewesen, dass sie spüren konnte, wie ihre Herzen in dem gleichen verrückten Rhythmus schlugen, hätte sie auf den Gedanken kommen können, Claybourne sei brutal geschlagen worden. Doch er erholte sich sehr schnell wieder davon, während er sie losließ und zurücktrat, und sein Gesicht war erneut eine undurchdringliche Maske.
So unergründlich war seine Miene auch gewesen, als er die Bibliothek betreten hatte. Sein Butler musste ihn darüber informiert haben, dass eine Lady zu Besuch gekommen war, doch Claybourne schien nicht im Geringsten überrascht gewesen zu sein, dass sie es war, die auf ihn wartete. Erst als er sich von dem Kuss zurückzog, hatte sie eine Emotion bei ihm wahrgenommen, und sie hätte schwören können, dass es Verlangen gewesen war. Verlangen nach ihr? Wohl kaum. Es war zweifellos nicht mehr als entfesselte Lust gewesen, und welche Frau in dem Moment vor ihm gestanden hatte, war ohne Bedeutung.
Er war dafür berüchtigt, am Rande des Zulässigen zu flirten, und zweifelsohne daran gewöhnt, andere mit sich in den Abgrund zu ziehen. Aber zu ihrer großen Scham schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass das ein faszinierender Weg sein musste. In den geheimen Winkeln ihres Bewusstseins lauerte die Sündhaftigkeit, hatte sie doch davon geträumt, dass er sie küsste. Doch selbst in ihren wildesten Fantasien hatte sie sich nicht vorgestellt, dass seine Lippen so weich waren, sein Mund so heiß war und seine Zunge so entschlossen, sich ihren Weg zu bahnen. Was sie getan hatten, war höchst unanständig und schamlos gewesen. Sie hatte gewusst, dass sie zurückweichen, ihn abwehren, ihn schlagen sollte, aber sie hatte nur den Wunsch empfunden, diese Intimität zu vertiefen. Er schmeckte nach etwas, das sie nie zuvor gekostet hatte. Er war kühn in seinen Erkundungen und hatte sie dazu verlockt, alles zu vergessen, was sie über Anstand gelernt hatte.
Sein Mund hatte mit ihrem gespielt, und er hatte ihren Körper dazu gebracht, wie verrückt zu prickeln und wie nie zuvor vor Verlangen zu brennen. Sie geriet fast in Versuchung, ihm dorthin zu folgen, wohin er sie führte, aber es ging hier um mehr als die Befriedigung ihrer Sehnsüchte. Seine vorherigen Worte hatten Catherine davon überzeugt, dass er keinen Respekt für sie empfinden würde, wenn sie seinem Charme erlag, wie es ohne Zweifel viele Frauen vor ihr getan hatten, und zu diesem Zeitpunkt des Spiels musste sie die Oberhand behalten.
Er wandte ihr den Rücken zu und ging zu einem kleinen Tisch, auf dem eine Reihe von Dekantern stand. Er zog den Stopfen aus einem und goss eine bernsteinfarbene Flüssigkeit erst in ein Glas, dann in ein zweites.
»Loswerden? Welch harmloses Wort. Ich nehme an, Sie meinen damit, dass jemand getötet werden soll?«, konstatierte er ausdruckslos.
»Ja.« Sie hob ihren Umhang vom Boden auf und drückte ihn an sich, als besäße er die Macht, ihr Zittern zu unterdrücken. Du lieber Gott, sie wollte die Hand nach Claybourne ausstrecken, wollte mit den Händen über seinen Rücken streicheln, seine Schultern. Sie wollte mit den Fingern durch sein dichtes schwarzes Haar fahren. Sie wollte ihren Körper an seinen pressen. Mit dem Teufel einen Walzer tanzen. Mochte Gott ihr beistehen, aber sie wollte bei ihm liegen, mit ihm schlafen.
Er wandte sich vom Tisch ab und bot ihr ein Glas an. Catherine schluckte schwer und zwang sich, nicht preiszugeben, wie sehr sie innerlich bebte. Sie griff nach dem Glas, hielt aber inne, als ihr Blick auf seinen rechten Daumen fiel, dessen Innenseite von wulstigen Narben bedeckt war, als habe ihn jemand mehrmals geschnitten. Bei näherem Hinsehen erkannte sie, dass es nicht nur Schnitt-, sondern auch Brandwunden waren.
»Es anzustarren macht es nicht schöner«, sagte er.
Sie riss den Blick von seinem Daumen los und sah ihn an. »Ich bitte um Entschuldigung. Ich …« Sie konnte nichts sagen, um ihre Unhöflichkeit wiedergutzumachen, also nahm sie einfach das Glas entgegen, das er ihr anbot. »Danke.«
Er musterte sie abschätzend. Ihr blieb nur, den Kopf hoch erhoben zu halten, und das tat sie.
Er ging an ihr vorbei und ließ sich auf einen Stuhl fallen, lümmelte sich schon unverschämt darauf. Verschwunden war jeder Anschein, ein Gentleman zu sein, jeglicher Hinweis darauf, dass er sie als Lady sah. Eigentlich hatte er in dem Moment aufgehört, ein Gentleman zu sein, in dem seine Lippen ihre berührt hatten. Selbst jetzt noch wurde ihr warm, wenn sie daran dachte, wie sein Mund sie gedrängt hatte, sich ihm zu öffnen und den Stoß seiner Zunge willkommen zu heißen. Und sie hatte aufgehört, eine Lady zu sein, als sie ihn hatte gewähren lassen. Doch sie konnte ihre Fassung sehr leicht zurückgewinnen, indem sie auf ihre Erziehung zurückgriff.
Er trank einen großen Schluck, dann deutete er mit der Hand, in der er das Glas hielt, auf den Stuhl ihm gegenüber. Da sie sich nicht sicher war, ob ihre zitternden Beine sie noch lange tragen konnten, nahm Catherine anmutig Platz. Sie war jetzt ganz und gar entschlossen, eine Lady zu bleiben, selbst wenn er sich nicht länger wie ein Gentleman benahm. Seit jener Ballnacht hatte sie es sich mindestens tausend Mal ausgemalt, ihm nahe zu sein, aber es war nie so gewesen wie jetzt. Sie waren immer in einem Ballsaal gewesen, ihre Blicke hatten sich über die Menschen hinweg getroffen …
»Wen?«, fragte er.
Sein brüsker Ton brachte Catherine in die Wirklichkeit zurück. Sie schloss die Hände um ihr Glas. »Pardon?«
Er seufzte ungeduldig. »Wen wollen Sie töten lassen?«
»Ich werde es Ihnen nicht sagen, bis ich sicher weiß, dass Sie bereit sind, es zu tun.«
»Warum?«
»Weil ich nicht will, dass Sie ihn warnen, wenn Sie sich dieser Sache nicht annehmen werden …«
»Nein«, unterbrach er sie barsch.
Die Enttäuschung traf sie wie ein Schlag. Sie erwog, ihn anzuflehen, aber sie fühlte sich durch den Kuss und seine völlige Missachtung ihrer unangenehmen Lage wie vor den Kopf gestoßen. Voller Verachtung für die kleinen Schauder, die sie durchströmten, und entschlossen, sich so würdevoll wie möglich zu empfehlen, erhob sie sich. »Danke für Ihre Zeit.«
»Nein«, sagte er scharf. »Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht tun würde. Ich habe Nein gesagt, weil Sie die falsche Frage beantwortet haben.«
»Pardon?«
»Ich habe Sie nicht gefragt, warum Sie mir nicht sagen wollen, wer er ist. Ich habe nach dem Grund gefragt, aus dem Sie ihn töten lassen wollen.«
»Oh.« Sie setzte sich wieder. Die Hoffnung kehrte zurück wie ein flügger Vogel, der das Fliegen lernte. »Ich fürchte, ich kann Ihnen auch das nicht sagen.«
Er trank noch einen Schluck Brandy und betrachtete sie eine ganze Weile über den Rand seines Glases hinweg. Sie musste sich zwingen, nicht zusammenzuzucken. Er war kein klassisch schöner Mann. Seine Nase war leicht gebogen und unterhalb der Wurzel ein wenig uneben, als hätte sie einen Schlag abbekommen. Seltsamerweise fügte das seinem Gesicht die Strenge hinzu, ohne die es sonst vielleicht eine Spur zu glatt gewirkt hätte. Er brauchte eine Rasur, aber zu dieser späten Stunde brauchten das wohl die meisten Männer, vermutete Catherine. Sie konnte noch immer fühlen, wie seine dunklen Bartstoppeln bei ihrem Kuss sich an ihrem Kinn und ihren Wangen gerieben hatten.
Sie schloss die Augen und versuchte, diese intimen Bilder und die peinliche Reaktion ihres Körpers zu ignorieren. Ihre Lippen waren noch immer geschwollen und prickelten so sehr, dass Catherine sich fragte, ob sie sich je wieder normal anfühlen würden. Aus den Tiefen der Hölle gekommen zu sein, ließ offensichtlich alles an einem Mann extrem heiß wirken. Sie war überrascht, dass sie nicht zu einem Stück Holzkohle verglüht war.
»Wie viele Männer haben Sie schon geküsst?«, fragte er plötzlich.
Sie riss die Augen auf und – verdammt, verdammt! – zuckte zusammen. Erst erwog sie, zu lügen, aber was würde sie durch eine Täuschung gewinnen? Vermutlich hatte er seine Mitmenschen schon so oft getäuscht, dass es für sie beide reichte. »Heute Abend zum ersten Mal.«
Er trank noch einen großen Schluck, wobei er sie wieder musterte. Sie mochte es nicht, wenn er sie auf diese Weise ansah, es gefiel ihr ganz und gar nicht. Es erinnerte sie an jene Ballnacht, in der sie sich gefühlt hatte, als schätzte er ihren Wert ab – und hätte sie seiner Aufmerksamkeit nicht für wert befunden.
»Aber ich bin nicht hier, um über Küsse zu reden. Ich bin hier, um über …«
»Ja, ja, ob ich jemanden für Sie töten werde. Und Sie erwarten von mir, dass ich mich auf Ihr Wort verlasse, dass derjenige den Tod verdient, ohne mir zu verraten, was er verbrochen hat. Vielleicht hat er es ja einfach nur versäumt, Sie um einen Tanz zu bitten.«
»Sie denken doch wohl nicht wirklich, dass es um etwas so Banales geht?«
»Ich weiß nur wenig über Sie, Lady Catherine. Eigentlich weiß ich nur, dass Sie keine Skrupel haben, einem Gentleman mitten in der Nacht einen Besuch abzustatten. Vielleicht haben Sie ja auch diesen fraglichen Herrn aufgesucht, er hat Sie abblitzen lassen, und Sie wollen jetzt Rache nehmen.«
»Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, mitten in der Nacht Gentlemen zu besuchen.«
»Ihr Tun sagt etwas anderes.«
»Beurteilen Sie jeden nach seinem Handeln?«
»Taten sagen mehr als Worte.«
»Und Sie haben zweifellos große Erfahrung, was unaufrichtige Worte angeht.«
Er zog leicht einen Mundwinkel hoch, was wie die spöttische Imitation eines Lächelns wirkte. »Die meisten Frauen umschmeicheln einen Gentleman, wenn sie wollen, dass er nach ihrer Pfeife tanzt.«
Sie schaute auf das Glas in ihren Händen und fragte sich, ob sie ihren sinkenden Mut auf dessen Boden wiederfinden würde, wenn sie es austrank. »Ich wollte nicht beleidigend sein.«
»Wollten Sie nicht?«
Sie hob den Kopf und sah ihn an. »Doch, vermutlich wollte ich es.«
Seine Augen weiteten sich leicht. Diese ehrliche Antwort schien ihn zu überraschen.
»Was also hat der Gentleman getan, um bei Ihnen in Ungnade zu fallen? Hat er sich über Ihr Kleid lustig gemacht? Ist er Ihnen beim Walzer auf die Zehen getreten? Hat er Ihnen verwelkte Blumen geschenkt?«
»Meine Gründe gehen nur mich etwas an, Mylord. Sie werden mich nicht dazu verleiten, sie Ihnen zu nennen. Unser Arrangement wird nicht mehr umfassen als Ihre Zustimmung, sich um die Sache zu kümmern, und dann werde ich Ihnen sagen, um wen es dabei geht.«
»Warum sollte ich dem zustimmen? Was springt für mich dabei heraus?«
»Ich werde Sie für Ihre Dienste großzügig bezahlen.«
Sein hartes Lachen, das von den hohen Bücherregalen widerhallte, schien irgendwie hierher zu gehören. Als regierte hier die Männlichkeit, die Dingen freundlicherer Natur keinen Raum ließ. »Lady Catherine, Geld ist wahrlich etwas, woran ich absolut keinen Bedarf habe.«
Sie hatte befürchtet, dass das der Fall sein würde, wodurch ihre Verhandlungsposition geschwächt wäre. Was könnte sie ihm anbieten? Sie hatte genügend Gerüchte gehört, um zu wissen, dass er kein Mann war, der etwas tat, weil er ein mitfühlendes Herz besaß. »Woran haben Sie denn Bedarf, Mylord?«
»Von Ihnen – an nichts.«
»Sicherlich gibt es etwas, das Ihre derzeitigen Lebensumstände Ihnen nicht ermöglichen können.« Er stand auf. »Nichts, was mich veranlassen könnte, einen Mann zu töten, nur weil Sie seinen Tod wünschen. Sie haben Ihre Zeit mit Ihrem Besuch bei mir verschwendet. Bitte gehen Sie jetzt.« Mit diesen Worten war sie entlassen, und er ging zu dem kleinen Tisch, um sein Glas erneut zu füllen.
Catherine erhob sich. Sie würde nicht bitten, würde aber auch nicht so leicht aufgeben. »Gibt es denn nichts, das Sie so sehr wollen, dass Sie bereit sind, alles zu tun, es zu bekommen?«
»Wenn Sie so sehr auf den Tod dieses Mannes erpicht sind, dann töten Sie ihn doch selbst.«
»Ich fürchte, ich würde es verpfuschen. Ich nehme an, es bedarf eines gewissen Menschentyps, um einen solchen Akt auch auszuführen, wenn es so weit ist.«
»Einen Mann wie mich vielleicht? Einen kaltherzigen Bastard?«
»Haben Sie – haben Sie ihn getötet? Haben Sie Ihren Onkel getötet?« Sie konnte nicht glauben, dass sie diese unverschämte Frage gestellt hatte. Die Worte waren ihr über die Lippen gekommen, ehe sie sie hatte zurückhalten können.
Er stürzte die bernsteinfarbene Flüssigkeit herunter und schenkte sich noch ein Glas ein. »Welche Antwort würde Sie zufriedenstellen, Lady Catherine?«
»Eine ehrliche.«
Er drehte sich zu ihr um und erwiderte ihren Blick. »Nein, ich habe meinen Onkel nicht getötet.« Und trotz seiner Antwort, von der sein nicht wankender Blick sagte, dass es die absolute Wahrheit war,
stellten sich ihr die feinen Nackenhärchen hoch, und sie hatte plötzlich nicht mehr den Wunsch, noch länger in seiner Gegenwart zu verweilen. Sie war eine Närrin gewesen, hierherzukommen, aber schließlich gebar die Verzweiflung oft Narren.
»Es tut mir leid, Sie belästigt zu haben, Mylord.«
»Sie haben mich nicht belästigt, Lady Catherine. Der Kuss war die Störung meiner Abendruhe wert.«
Sie reckte hoheitsvoll das Kinn. »Wie schade, dass ich nicht das Gleiche behaupten kann.«
Sein dunkles Lachen begleitete sie aus der Bibliothek, und sie hatte keinen Zweifel daran, dass sie dieser Klang noch in ihre Träume verfolgen würde, ebenso wie die Erinnerung an seine Lippen, die sich auf ihre pressten. Dem Teufel einen Besuch zu machen war ein Fehler gewesen, und sie konnte nur beten, dass sich das, was sie getan hatte, nicht noch rächen würde.
Zum Teufel mit ihr. Zum Teufel.
Luke saß zusammengesunken auf dem gepolsterten, mit Brokat bezogenen Lehnstuhl und leerte den letzten Whisky aus der Flasche, bevor er sie gegen die Wand schleuderte. Er atmete schwer und ließ den Kopf in den Nacken sinken. Das Zimmer drehte sich um ihn, und die Dunkelheit senkte sich herab. Es war die dritte Flasche, die er geleert hatte. Noch eine mehr sollte ihn immun machen gegen die grausamen Bilder der verlorenen Unschuld, die auf ihn einstürmten, diese Bilder in die dunkelsten Winkel seines Bewusstseins zurückdrängen und alles vertreiben – die Reue, die Schuld, das Bedauern.
Während andere zu Gott gebetet hatten, hatte er seine Seele dem Teufel verschrieben, um die Kraft zu finden, zu tun, was getan werden musste. Und jetzt bat ein naives Mädchen ihn darum, das Gleiche noch einmal zu tun.
Zum Teufel mit ihr!
Sie hatte ihm Einladungen zu ihren dummen Bällen geschickt, als wären sie wichtig, als wäre ein Abend in ihrer Gesellschaft seine Zeit wert. Was wusste sie von der Qual? Was wusste sie von der Hölle? Ihr Angebot anzunehmen würde nur dazu dienen, sie hinab an diesen Ort zu ziehen, und dann gäbe es für sie kein Entkommen mehr. Er kannte die Wahrheit nur zu gut.
Luke griff nach einer weiteren Flasche aus der kleinen Reserve, die er auf dem Boden neben seinem Stuhl aufgereiht hatte. Er hatte zu viele Nächte wie diese erlebt, in denen man nicht wusste, wohin man sich um Trost wenden sollte, wenn keine Frau greifbar war.
Verdammt, er hätte doch eines von Jacks Mädchen mit nach Hause nehmen sollen. Nicht einmal Frannie wäre jetzt in der Lage gewesen, ihn aufzumuntern. Er würde niemals fähig sein, sie mit der Verzweiflung zu nehmen, die ihn jetzt vereinnahmte. Was er brauchte, war eine Frau, die stark genug war, um seine kraftvollen Stöße hinzunehmen, ohne zusammenzuzucken, eine Frau, die sich nicht vor ihm duckte, eine Frau, die dem Ungeheuer in ihm die Stirn bot und nicht die Absicht hatte, es zu zähmen.
Das Bild von Lady Catherine, die sich unter ihm wand, kam ihm in den Sinn, und er schleuderte die halb volle Flasche durch das Zimmer. Er verfluchte diese Frau noch einmal. Er hatte so hart darum gekämpft, zivilisiert zu bleiben, nicht zurückzukehren zu seinen Wurzeln, und sie hatte es geschafft, ihn völlig aus der Bahn zu werfen. Er hätte sie in sein Schlafzimmer tragen und sie nehmen sollen, er hätte ihr zeigen sollen, zu was er fähig war.
Mord? Du lieber Gott, er hatte bewiesen, dass er zu weit Schlimmerem in der Lage war.
Aus den Aufzeichnungen des Lucian Langdon
Ich kannte den Namen des Mannes nicht, den ich getötet habe. Ich wusste nicht, dass das Schicksal ihn dazu ausersehen hatte, der Erbe eines Titels zu sein.
Ich wusste nur, dass er Frannie wehgetan hatte – grausam und ohne Gnade. Deshalb habe ich es auf mich genommen, sein Richter zu sein, seine Jury und sein Henker.
Unglücklicherweise hatte ich in meiner Hast, Gerechtigkeit zu üben, keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen. Es gab einen Zeugen, und ich wurde sofort verhaftet.
Im Nachhinein erkenne ich, dass es überheblich von mir war zu glauben, dass ich allein das Recht hätte, über sein Schicksal zu bestimmen. Aber ich war mit dem Rechtssystem aufs Beste vertraut, nachdem ich im Alter von acht Jahren zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Ich trage das Zeichen meines Verbrechens auf meinem rechten Daumen. Ein D für Dieb, eingebrannt in mein Fleisch.
Ein Jahr nach meiner Einkerkerung wurde beschlossen, dass mit der Praxis, Kriminelle auf diese grausame Weise zu brandmarken, Schluss sein sollte. Und so geschah es.
Ich wusste, dass das Gefängnis kein angenehmer Ort war. Ich wusste, dass man Kriminelle auf großen Gefängnisschiffen aus England fortbrachte, aber ich kannte keine Einzelheiten und konnte deshalb nicht beurteilen, ob dies eine gerechte Strafe war.
Ich war bei ein oder zwei öffentlichen Hinrichtungen im Publikum. Aufgehängt zu werden schien eine besonders brutale Art des Hinscheidens zu sein.
Dennoch war ich nicht bereit zu riskieren, dass jener Mann, der Frannie wehgetan hatte, ungestraft davonkommen konnte oder dass seine Strafe seinem Verbrechen nicht angemessen sein würde. Deshalb habe ich ihn getötet.
Der Polizist, der mich festnahm, versicherte mir, dass ich mich bald im Wind baumelnd wiederfinden würde. Ich lauschte stoisch seinen ernsten Prophezeiungen, denn ich empfand keine Reue. Wenn jemand jemandem, den wir lieben, wehtut, müssen wir tun, was wir tun müssen. Und ich habe Frannie immer geliebt.
Ich wartete in einem Verhörzimmer in Whitehall, als sie einen alten Herrn hereinführten. Rachsucht brannte in seinen Augen, und ich wusste, ohne dass man es mir sagen musste, dass es sein Sohn gewesen war, den ich getötet hatte. An seiner Kleidung und seinen Manieren erkannte ich, dass er ein Mann war, der die Macht hatte, mich in die Hölle zu schicken.
Er starrte mich lange an, und ich starrte zurück. Seit ich arretiert worden war, hatte ich außer meinem Namen kein Wort mehr gesagt. Ich hatte das Verbrechen weder geleugnet noch gestanden.
»Haltet immer die Klappe«, hatte Feagan uns eingebläut, als es um die Frage gegangen war, was tun, wenn man erwischt worden war. »Ganz egal, was ihr denen sagt, Wahrheit oder Lüge, sie drehen euch das Wort so lange im Mund rum, bis es ihnen in den Kram passt.«
Ich hatte früh gelernt, dass man auf das hören sollte, was Feagan sagt. Er wusste, wovon er sprach.
Dann machte der alte Mann etwas ganz Seltsames. Er trat zu mir, legte seine behandschuhte Hand unter mein Kinn und drehte mein Gesicht erst zu der einen, dann zur anderen Seite. »Ich brauche mehr Licht«, sagte er.
Lampen wurden gebracht und auf den Tisch gestellt, bis ich mir wie ein Ausstellungsstück vorkam. Die Wut in den Augen des alten Mannes wich etwas Weicherem, einem Ausdruck, den ich nicht kannte.
»Was ist los, Mylord?«, fragte einer der Inspektoren.
»Ich denke, das ist mein Enkel«, sagte der Alte rau.
»Der, der vermisst wird?«
Der alte Mann nickte ein Mal, und ich sah einen Ausweg aus meiner misslichen Lage. Ich hatte bereits gelernt, wie man Menschen manipuliert. Ich wusste, was der alte Mann wollte. Mit meinen Antworten auf seine Fragen brachte ich ihn dann auch dazu zu glauben, ich wäre derjenige, den er suchte.
Als er überzeugt davon war, dass ich sein Enkel sei, bat er die Inspektoren, uns einen Moment allein zu lassen. Er setzte sich auf einen Stuhl mir gegenüber.
»Hast du meinen Sohn getötet?«, fragte er.
Ich nickte.
»Warum?«
Zum ersten Mal in jener Nacht sagte ich die Wahrheit. Am Ende war es diese Wahrheit, die den alten Mann davon überzeugte, dass ich auf den rechten Weg zurückgeführt werden könnte. Es würde allerdings einige Zeit dauern, bevor er mir völlig vergab.
Meine Erlösung und meine Strafe waren es, mein Leben als sein Enkelsohn zu leben.
Kapitel 3
Es ist so schrecklich schwer zu entscheiden«, sagte die Duchess of Avendale. »Ich weiß nicht, welches das beste ist.«
Sie sah Catherine an, die mit ihr an dem kleinen Tisch im Garten saß und peinlicherweise genau in diesem Moment gähnte, was die Duchess jedoch zu übersehen schien, und schob die Auswahl an Papiermustern über den Tisch. »Welches favorisierst du?«