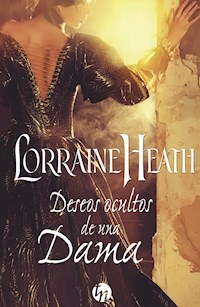4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Scoundrels of St. James
- Sprache: Deutsch
Ein berüchtigter Schurke. Eine tugendhafte Lady. Eine grenzenlose Leidenschaft.
Die feinen Damen der Londoner Gesellschaft wispern nur hinter vorgehaltener Hand über Jack Dodger, den Besitzer eines verruchten Gentlemen's Club. Es soll keine Sünde geben, die er noch nicht begangen, kein Vergnügen, das er noch nicht gekostet hat. Die tugendhafte Lady Olivia würde sich niemals mit jemandem wie ihm abgeben - bis Jack zum Vormund ihres Sohns bestimmt wird. Olivia ist entschlossen, diesen Schurken zum Teufel zu jagen. Doch ihre eisige Fassade bröckelt bald unter Jacks sündigem Charme ...
Dunkel, emotional und sinnlich. Ein Held mit tiefen seelischen Narben. Eine Heldin, die für ihren kleinen Sohn kämpft. Und eine Leidenschaft, die selbst die dunkelsten Schatten erhellt ...
"Das Setting, die Dialoge und die historischen Details bilden den perfekten Rahmen für diese unvergessliche Geschichte voller zügelloser Spannung und emotionaler Intensität." Romantic Times
Nächster Band der "Scoundrels of St. James": "Verboten sündig".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Die Scoundrels of St. James:
Band 1: Teuflisch verführt
Band 3: Verboten sündig
Band 4: Verzweifelt begehrt
Kurz-Novelle: Sinnlich berührt
Über dieses Buch
Ein berüchtigter Schurke. Eine tugendhafte Lady. Eine grenzenlose Leidenschaft.
Die feinen Damen der Londoner Gesellschaft wispern nur hinter vorgehaltener Hand über Jack Dodger, den Besitzer eines verruchten Gentlemen's Club. Es soll keine Sünde geben, die er noch nicht begangen, kein Vergnügen, das er noch nicht gekostet hat. Die tugendhafte Lady Olivia würde sich niemals mit jemandem wie ihm abgeben – bis Jack zum Vormund ihres Sohns bestimmt wird. Olivia ist entschlossen, diesen Schurken zum Teufel zu jagen. Doch ihre eisige Fassade bröckelt bald unter Jacks sündigem Charme …
Dunkel, emotional und sinnlich. Ein Held mit tiefen seelischen Narben. Eine Heldin, die für ihren kleinen Sohn kämpft. Und eine Leidenschaft, die selbst die dunkelsten Schatten erhellt …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Lorraine Heath hat schon immer davon geträumt, Schriftstellerin zu werden. Nach ihrem Abschluss in Psychologie an der University of Texas schrieb sie im Rahmen ihrer Arbeit zunächst Handbücher und Pressemitteilungen. Als ihr 1990 ein Liebesroman in die Hände fiel, erkannte sie, dass sie ihre Zeit nicht weiter mit langweiligen Fakten, sondern mit Abenteuern, Leidenschaft und Romantik füllen wollte. Seitdem hat sie zahlreiche Romane veröffentlicht, wurde mehrmals für ihr Werk ausgezeichnet und erschien auf der Bestsellerliste der New York Times.
Homepage der Autorin: https://www.lorraineheath.com/.
Lorraine Heath
Gefährlichzärtlich
Aus dem amerikanischen Englischvon Ulrike Moreno
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Jan Nowasky
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Between the Devil and Desire«
Originalverlag: Avon Books
Published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2015/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Kerstin Fricke
Titelillustration: © hotdamnstock
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0253-9
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Nathan.
Als wir zu jung waren, um es besser zu wissen,griffen wir nach den Sternen des anderenund setzten uns die gleichen Ziele.Im Scherz sagte ich dir immer,dass ich meine Schurken nach deinem Vorbild schuf.Aber du, mein Schatz,bist immer nur mein Held.
Prolog
Aus den Aufzeichnungen des Jack Dodger
Als ich fünf Jahre alt war, verkaufte mich meine Mum. Ich habe es ihr nie nachgetragen; selbst in solch zartem Alter verstand ich schon, dass Hunger und Furcht einen Menschen dazu bringen können, Dinge zu tun, die er sich selbst nie zugetraut hätte. In meiner neuen Lebenslage lernte ich schnell, dass der Teufel wie ein Gentleman gekleidet war, und so lief ich weg, überzeugt davon, dass ich auf der Straße besser dran sein würde als in einem prachtvollen Haus, in dem raffinierte Herren Anständigkeit vortäuschten.
Ich war noch nicht lange allein, als ich mich einer berüchtigten Kinderdiebesbande anschloss, die von einem schlauen alten Fuchs namens Feagan angeführt wurde. Unter seiner Anleitung lernte ich, dass sich alles stehlen ließ – mit der richtigen Vorbereitung. Meine eigenen Befähigungen, meine Entschlossenheit, voranzukommen und zu überleben, waren unübertroffen, und so stieg ich schon sehr bald in Feagans Achtung. Er nannte mich liebevoll »Dodger« oder Schlawiner, und bis zu meinem achten Lebensjahr verbrachte ich fast jeden Abend mit ihm vor einem gemütlichen Kohlenfeuer, wo ich meine Tonpfeife rauchte, Gin trank und die ungewöhnlichen Lebensweisheiten in mir aufnahm, die Feagan nur mit den wenigen teilte, denen er Respekt entgegenbrachte.
Aber meine Hände kribbelten schier unentwegt von dem Bedürfnis, mehr Geld in die Finger zu bekommen. Eines Tages bot mir ein gepflegt aussehender Herr einen Sixpence dafür, eine dreiköpfige, adlige Familie in eine Gasse zu locken. Ich schaffte es mit Krokodilstränen und der Behauptung, meine Mum läge im Sterben. Der Mann und seine Frau wurden auf der Stelle ermordet, aber der Sohn entkam. Entsetzt über meine Beteiligung an den tragischen Geschehnissen rannte ich dem Jungen hinterher, weil ich befürchtete, dass uns das gleiche Schicksal erwartete, das seinen Eltern widerfahren war. Ich folgte ihm in eine weitere Gasse, wo er weinend zusammenbrach und sich in eine Ecke kauerte. Aber für solchen Unsinn blieb uns keine Zeit. Zu meiner großen Erleichterung erkannte er mich nicht wieder, vermutlich aufgrund des Schocks. Ich beschmutzte seine Kleider, ihn selbst und überzeugte ihn, dass ich über die Mittel und Wege verfügte, um ihn zu retten.
Der Junge nannte sich Lucian, aber da das zu vornehm klang, stellte ich ihn den anderen als Luke vor. Feagan gab mir drei Pence für den neuen Rekruten, den ich ihm gebracht hatte. Keine schlechte Ausbeute für den Tag, auch wenn ich nicht gut schlief in jener Nacht.
Zu meinem andauernden Ärger fühlte ich mich verantwortlich für den Jungen, obwohl ich gerade mal zwei Jahre älter war. Als er beim Stehlen erwischt wurde, war ich dumm genug zu glauben, ich müsste ihm zu Hilfe eilen, woraufhin wir beide für drei Monate im Gefängnis landeten. Das Häftlings-Brandmal, das uns beide zeichnete, verstärkte unsere Freundschaft jedoch nur noch, sodass wir schließlich unzertrennlich wurden.
Bis zu der Nacht, in der er einen Menschen tötete.
Er war vierzehn und wartete gerade auf sein Strafverfahren, als der Earl of Claybourne bekannt gab, dass Luke sein lange verschollener Enkel war. Daraufhin wurde er in die Obhut des alten Herrn entlassen. Lukes Glück wurde schnell zu meinem, da der alte Herr auch mich aufnahm. Wir kamen jedoch nie gut miteinander aus. Der Earl versuchte, mich zu einem Gentleman zu machen, aber ich zog es vor, ein Spitzbube zu bleiben, daher erschien es mir anständiger, sein Haus zu verlassen.
Als ich neunzehn war, wurde mir von einem Anwalt mitgeteilt, dass ich einen anonymen Gönner hatte, der große Erwartungen in mich setzte und mir zehntausend Pfund zukommen lassen wollte, um auf diese Weise meine Zukunft abzusichern. Ich fragte nie nach dem Namen meines Gönners, da ich keinen Zweifel daran hegte, dass er Lukes Großvater war – der auf diese Weise versuchte, mich loszuwerden, ohne seinen Enkel zu enttäuschen. Ich hatte lange genug auf der Straße gelebt, um zu wissen, dass Geld dazu da war, in Laster investiert zu werden, deswegen erwarb ich ein Gebäude und machte einen exklusiven Herrenclub daraus.
Und so kam es, dass ich ein wohlhabender Mann wurde, mit einem Vermögen, das zweifelsohne alles überstieg, was mein Gönner – oder jeder andere – von mir erwartet hatte. Doch egal, wie viel Geld ich auch verdiente, es war nie genug. Ich war unersättlich, immer gierig nach mehr und bereit, alles, aber auch wirklich alles dafür zu tun.
Kapitel 1
London1851
Der Teufel war zu Besuch gekommen. Olivia Stanford, die Duchess of Lovingdon, saß neben ihm in ihrer Bibliothek und wusste nicht, ob sie entsetzt oder fasziniert sein sollte. Er war ein interessanter Mensch, und obwohl sie viele unerfreuliche Geschichten über ihn kannte, hatte sie ihn bis zu diesem Abend noch nie zu Gesicht bekommen.
Sein schwarzes Haar, das ihm in ungebändigten Locken auf die breiten Schultern fiel, zeugte von seiner Auflehnung gegen gesellschaftliche Zwänge. Seine harten Gesichtszüge waren von einem Leben der Dekadenz und der Ausschweifungen geprägt. Trotzdem war er auf eine raue, schroffe Art ein schöner Mann – so wie auch eine zerklüftete Küste im Morgengrauen einem mit ihrer Pracht den Atem rauben konnte.
Olivia zwang sich, den Blick von seinem Profil zu lösen, das sie schon von dem Moment an fesselte, in dem sie ihre Bibliothek betreten hatte und dem herrlich verruchten Jack Dodger begegnet war.
Seine Spielhölle bot vielen männlichen Adligen Unterhaltung. Schwestern, Ehefrauen und Mütter hörten so manche mit schwerer Zunge geäußerte Bemerkung über die Ausschweifungen in Jack Dodgers Etablissement, wenn ihre Brüder, Ehemänner oder Söhne in den frühen Morgenstunden torkelnd heimkehrten. Natürlich tauschten die Frauen beim Tee diskret Geschichten aus, und so war Dodgers zweifelhafter Ruf und der seines Spielcasinos auch unter anständigen Damen gewachsen, die von solch frivolen Dingen eigentlich gar nichts wissen dürften. Die Frauen hassten ihn, weil er den Männern in ihrem Leben die Möglichkeit bot, von allem abzuweichen, was gut und achtbar war, und trotzdem konnte keine der Damen ihre anhaltende Faszination für einen derart lasterhaften Mann bestreiten.
Olivia, die neben ihm saß, wurde sich auch immer mehr der unverhohlenen Sinnlichkeit bewusst, die von ihm ausging. Sie konnte sich gut vorstellen, dass Frauen ihm in sein Schlafzimmer folgten, ohne dass auch nur ein einziges Wort gesprochen wurde. Sie konnte den Tabak- und Whiskygeruch riechen, der ihn umgab, und stellte zu ihrer Beschämung fest, dass sie diesen ausgesprochen maskulinen Duft sehr reizvoll fand. Alles an ihm sprach von verbotenem Vergnügen.
Er war wahrhaftig das Werk des Teufels.
Er trug sogar das Mal des Teufels. Das Brandmal an der Innenseite seines rechten Daumens war deutlich zu sehen, weil er nicht den Anstand besaß, Handschuhe zu tragen, und seine langen Finger leicht gespreizt über der Sessellehne lagen. Obwohl das Kennzeichnen von Kriminellen nicht mehr üblich war, wusste Olivia, dass ihn das in seine Haut eingebrannte D als jemanden auswies, der wegen Diebstahls im Gefängnis gewesen war. Und sie hatte herzlich wenig Verständnis für diejenigen, die sich nahmen, was ihnen nicht gehörte.
Trotz seiner fragwürdigen Vergangenheit und Betätigung konnte Olivia an der Qualität seiner Bekleidung nichts bemängeln. Sie war offenbar vom besten Schneider Londons angefertigt worden; nur die rote Brokatweste unter seinem schwarzen Rock war völlig unangebracht für einen solch traurigen Anlass wie die Testamentseröffnung ihres verstorbenen Ehemannes.
Warum Lovingdon auf der Anwesenheit des berüchtigten Jack Dodger bestanden hatte, war ihr unbegreiflich. Woher hatte er diesen zwielichtigen Lebemann denn gekannt? Soweit sie wusste, war er nie im Dodger’s gewesen. Ihr Bruder, der verstorbene Duke of Avendale, war hingegen recht häufig dort zu Gast gewesen und hatte ihr dadurch die beneidenswerte Gelegenheit verschafft, sehr viel zu dem Repertoire an skandalösen Geschichten beizutragen, die unter den Damen die Runde machten.
Aber Lovingdon war außerordentlich puritanisch gewesen. Er hatte nicht einmal Alkohol im Haus gehabt, und soweit Olivia wusste, war auch nie ein Tropfen Wein über seine Lippen gekommen. Das Gleiche ließ sich von Jack Dodger nicht behaupten, wie sie gleichfalls wusste. Und apropos Lippen … Dodger hatte die sinnlichsten Lippen, die sie je bei einem Mann gesehen hatte, von einem sehr, sehr dunklen Rot, als wären sie in feinen Wein getaucht worden. Olivia konnte sich vorstellen, dass er damit schon alle Arten von Genüssen probiert hatte. Sein Mund war wie dazu geschaffen, selbst die tugendhaftesten Frauen zu verbotenen Freuden zu verführen. Warum sonst würde sie sich die völlig unpassende Frage stellen, wie es wohl wäre, von ihm geküsst zu werden? Sie hatte schon lange aufgehört, über die Freuden des Küssens nachzudenken – vielleicht, weil Lovingdon so strikt dagegen gewesen war. Und trotzdem saß sie hier und stellte sich vor, wie sich diese vollen Lippen auf ihre pressten und sie auf eine Art und Weise verführten, wie Lovingdon es nie getan hatte.
Wieder fragte sie sich, warum der Duke gewollt hatte, dass Jack Dodger bei der Verlesung seines Testaments zugegen war.
Mr. Beckwith, der Anwalt des Dukes, der jetzt seine Papiere auf dem Tisch ihr gegenüber ausbreitete, hatte jedoch neben ihrer auch auf Dodgers Anwesenheit bestanden. Und so war sie nun da und kam wie immer ihren Verpflichtungen nach, wie unangenehm sie ihr auch erscheinen mochten. Von dem Moment ihrer Geburt an war ihr Leben von Pflichtbewusstsein bestimmt gewesen. Dies war auch der Grund dafür, dass sie mit neunzehn einen Mann geheiratet hatte, der über fünfundzwanzig Jahre älter war als sie – ihr Vater hatte die Ehe arrangiert, und eine gehorsame Tochter widersetzte sich dem Vater nicht, ungeachtet ihrer eigenen Sehnsüchte und Wünsche.
Lovingdon war von Anfang an aufrichtig zu ihr gewesen. Mit fortschreitendem Alter brauchte er dringend einen Erben, und obwohl die Ehe mit ihm nicht das war, was sie sich erhofft hatte, war sie auch nicht so schlecht, wie sie es hätte sein können. Olivia hatte sich seinen Respekt erworben und herrschte uneingeschränkt über seinen Haushalt. Sie hatte ihm einen wunderbaren Sohn geschenkt, aber er war außerstande gewesen, ihr sein Herz zu schenken.
Olivia war sich ziemlich sicher, dass Henry als rechtmäßiger Erbe seines Vaters alles Wichtige erben würde. Sie hoffte nur, dass laut Testamentsverfügung das Londoner Stadthaus zur Witwenresidenz erklärt wurde, weil sie dieses Haus sehr liebte. Aber es war ziemlich groß, und für gewöhnlich wurde ein kleineres Anwesen als Witwenresidenz bestimmt. Lovingdon hatte jedoch nie andere Häuser in London erworben. Falls ihr dieses Haus nicht hinterlassen wurde, läge die Entscheidung darüber, wo sie in späteren Jahren residieren würde, bei ihrem Sohn – wenn er alt genug war, um sich mit solchen Dingen zu befassen. Im Moment war er erst fünf und nur daran interessiert, dass sie ihm vor dem Schlafengehen eine Geschichte vorlas.
Schließlich faltete der Anwalt die Hände über den Papieren und erhob den Blick zu dem aus nur zwei Personen bestehenden Publikum. Sein dunkles Haar war grau meliert, seine blauen Augen wirkten seiner dicken Brille wegen größer, und irgendwie hatte es den Anschein, als würde ihm diese Brille ermöglichen, sehr viel mehr zu sehen als der Durchschnittsmensch. »Mr. Dodger, ich möchte Ihnen danken, dass Sie, obwohl Sie so eingespannt sind, die Zeit gefunden haben, heute Abend bei uns zu sein«, begann er so feierlich, wie der Anlass es erforderte.
»Dann lassen Sie uns beginnen, ja? Ich muss wieder zurück in meinen Club.« Jack Dodgers Stimme war rau, als würde er den Großteil seiner Zeit schreien, bis seine Kehle wund war. Aber es schwang auch etwas Angenehmes darin mit, das Olivia nicht mit Worten erklären konnte. Sie konnte sich allerdings sehr gut vorstellen, wie er mit dieser Stimme einer Dame etwas zuflüsterte und sie zu ungehörigem Benehmen verleitete.
»Ja, natürlich«, sagte Mr. Beckwith und nahm ein großes Dokument zur Hand. »Das Testament enthält sehr viel Rechtsterminologie, auf deren Vorlesen ich mit Ihrer Erlaubnis verzichten werde.«
»Sagen Sie mir einfach, warum zum Teufel ich hier bin, damit ich wieder gehen kann.«
Olivia schnappte laut nach Luft. Jack Dodger warf ihr einen herablassenden Blick zu, den ersten überhaupt, seit sie einander vorgestellt worden waren und ihre Plätze eingenommen hatten.
»Du meine Güte, nun schauen Sie doch nicht so entsetzt!«
Angesichts des durchdringenden Blicks, mit dem er sie ganz unversehens musterte, beschlich Olivia das merkwürdige Bedürfnis, ihre Knöpfe zu überprüfen, um sicherzugehen, dass alle ordentlich geschlossen waren. »Vielleicht sollte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich in meinem Haus keine vulgäre Ausdrucksweise dulde«, erklärte sie. »Wenn Sie sich weiterhin einer solch derben Sprache bedienen, werde ich gehen.«
»Ich pfeife darauf, ob Sie bleiben oder nicht.«
»Mr. Dodger«, meinte Mr. Beckwith mit einer gewissen Schärfe, die verriet, dass auch er wahrscheinlich Vorbehalte gegen die derzeitige Gesellschaft hatte, »der Duke bestand nun mal auf Ihrer Anwesenheit während der Testamentseröffnung. Aber ich werde schnellstens zur Sache kommen, um Ihre Geduld nicht noch mehr zu strapazieren.« Dann räusperte er sich und begann vorzulesen: »Ich, Sidney Augustus Stanford, Duke of Lovingdon, Marquess of Ashleigh und Earl of Wyndmere, im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte, vermache meinem rechtmäßigen Sohn und Erben meiner Titel Henry Sidney Stanford mein gesamtes unveräußerliches Eigentum sowie auch die daraus erzielten Einkünfte und Vermögenswerte.«
Olivia nickte zufrieden. Sie hatte nichts anderes erwartet. Es war nur eine Formalität, es derart explizit in seinem Letzten Willen zu vermerken.
»Meiner treusorgenden Ehefrau Olivia Grace Stanford, Duchess of Lovingdon und Mutter meines Erben …«
Olivia blinzelte, um die Tränen zurückzuhalten, die in ihren Augen brannten, und wünschte, Jack Dodger sei beim Vorlesen dieses Abschnitts nicht zugegen. Die letzten Worte ihres Ehemannes an sie waren privat und sehr persönlich.
»… hinterlasse ich einen Treuhandfonds, der ihr bei angemessener Verwaltung für den Rest ihres Lebens zweitausend Pfund jährlich einbringen müsste. Mr. Jack Dodger …«
Olivia blieb kaum Zeit, ihrer Enttäuschung darüber, dass er ihr das Londoner Haus nicht hinterlassen hatte, Herr zu werden, bevor der Umstand, dass nun endlich der Grund für die absurde Vorladung dieses Jack Dodger zutage treten würde, ihre Aufmerksamkeit erforderte.
»… vermache ich den Rest meiner weltlichen Güter, mit Ausnahme von einem, unter der Bedingung, dass er als Vormund und Beschützer meines Erben fungieren wird, bis der Junge entweder seine Volljährigkeit erreicht oder meine Witwe wieder heiratet und ihr Ehemann diese Rolle übernimmt. Wenn eine dieser beiden Bedingungen erfüllt ist, wird Mr. Dodger den letzten Teil seiner Erbschaft erhalten – deren Wert unschätzbar ist.«
Wie aus weiter Ferne begann Olivia, ein Rauschen in den Ohren zu vernehmen, das sich wie die Flügelschläge von tausend Raben anhörte, die aus dem Londoner Tower flohen und damit Großbritanniens Untergang ankündigten. Nur schwach war sie sich des Knisterns von Papier bewusst, als Mr. Beckwith das Testament auf den Tisch zurücklegte. Sie konnte unmöglich richtig gehört haben! Ihre Schläfen pochten schon, seit ihr Mann die Treppe heruntergefallen war und sich dabei eine tödliche Wunde am Kopf zugezogen hatte. Der Kummer, den sie über den unerwarteten Verlust empfand, brachte sie anscheinend derart durcheinander, dass sie nun Worte verwechselte und deren wahre Bedeutung dadurch verloren ging. Während sie noch zu begreifen versuchte, wie das sein konnte, wie sie die Worte zwingen konnte, wieder das auszudrücken, was sie eigentlich bedeuten müssten, ergriff der Anwalt ein in schwarzes Leder gebundenes Buch und hielt es Mr. Dodger hin. »Dieses Bestandsbuch enthält eine Auflistung all der nicht dem Fideikommiss unterliegenden, also nicht unveräußerlichen Besitztümer, die …«
Während Olivia in ungläubigem Entsetzen zusah, riss Jack Dodger dem Anwalt das Buch aus der Hand, bevor er ausgesprochen hatte, schlug es auf und blätterte es rasch durch. Die Geräusche zerrten nur noch mehr an Olivias ohnehin geschwächten Nerven. Dann ergriff Mr. Beckwith ein weiteres Bestandsbuch, das er ihr hinhielt. »Zu Ihrer Durchsicht, Duchess, eine Auflistung der unveräußerlichen Besitztümer, die Ihrem Sohn zufallen.«
Olivia schüttelte den Kopf. »Ich bitte um Verzeihung, Mr. Beckwith, aber ich verstehe die Bedeutung von alldem nicht ganz.«
»Von dem Moment an, als die Titel auf ihn übergingen, hat Ihr Herr Gemahl sehr präzise Aufzeichnungen darüber geführt, welche Liegenschaften und andere Besitztümer Bestandteile des Fideikommiss, also der unveräußerlichen Vermögenswerte, waren …«
»Nein, nein, ich rede von dem Testament. Sie müssen etwas missverstanden haben, da Sie davon sprachen, dass Mr. Dodger als Vormund meines Sohnes agieren soll.«
»Ja, das war der Wunsch des Dukes.«
»Nein, das kann nicht sein, denn Henry ist mein Sohn, und sein Vormund bin natürlich ich.«
»Das Gesetz erkennt nur den Vater als Vormund an. Falls der Vater stirbt, bevor das Kind das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, muss der Vater in seinem Testament einen Vormund ernennen.« Ohne jegliche Gefühlsregung in seinen Zügen oder seiner Stimme klang er, als läse er etwas aus einer Parlamentsschrift vor. »Ich bedaure, Euer Gnaden, aber die Entscheidung Ihres Ehemannes ist unanfechtbar.«
»Unanfechtbar?« Olivia sprang so schnell auf, dass sie fast das Gleichgewicht verlor. Mr. Beckwith erhob sich ebenfalls, während Jack Dodger sitzen blieb und mit gierigen Augen weiterlas. Offensichtlich hatte der Mann keine Ahnung, wie man sich in Gegenwart einer Dame benahm, andererseits konnten die Frauen, die ihm normalerweise Gesellschaft leisteten, ja wohl kaum als Damen betrachtet werden. »Haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß nicht, wie, aber irgendwie müssen Sie die Absicht meines Gatten missverstanden haben. Er kann unmöglich gewollt haben, dass dieser Gauner hier …«
»Hier steht, dass dieser Wohnsitz und alles darin mir gehört«, verkündete Jack Dodger plötzlich, worauf Olivia fast vollständig die Contenance verlor. Nicht auch noch dieses Haus, nicht ausgerechnet diesen einen Ort, aus dem sie mit so viel Mühe und harter Arbeit ein Zuhause gemacht hatte!
Jack Dodger gab die lässige Haltung auf, in der er dagesessen hatte, warf das schwarze Buch laut polternd auf den Tisch und beugte sich mit unheilverheißendem Blick zu Mr. Beckwith vor. »Soll das hier irgendein dummer Streich sein?«
Es sprach für den Anwalt, dass er sich von dem drohenden Gebaren dieses Satans überhaupt nicht aus der Fassung bringen ließ. »Ich versichere Ihnen, Mr. Dodger, dass es sich hierbei um keinen Streich handelt.«
Dodger trommelte mit einer Fingerspitze auf das schwarze Buch. »Sie wollen mir ernsthaft weismachen, dass ein Mann, den ich kaum kannte, mir all das hier hinterlassen hat?«
»Sie kannten meinen Gatten?«, fragte Olivia verblüfft.
Jack Dodger erdreistete sich, abzuwinken, als sei sie völlig unmaßgeblich und könne genauso achtlos abgetan werden wie ein Bettler, der um ein Geldstück bat.
»Ja, Mr. Dodger, so scheint es in der Tat zu sein«, antwortete Mr. Beckwith.
»Und was ist mit seinen Schulden?«, wollte Dodger spöttisch wissen. »Ich nehme an, die erbe ich dann wohl auch.«
»Es gibt keine Schulden. Der Duke hielt nichts davon, Schulden zu machen. Er hat immer alles sofort bezahlt.«
Das schien Mr. Dodger zu denken zu geben, während er seine langen, schlanken Finger über dem Bestandsbuch spreizte. »Und das letzte Erbstück ist wertvoller als all das hier?«
»Wie im Testament beschrieben, ist sein Wert nicht zu ermessen.«
»Wissen Sie, was es ist?«
»Ja. Es soll in meinem Besitz verbleiben, bis die Zeit zur Übergabe kommt.«
»Er hat Ihnen etwas von unermesslichem Wert anvertraut?«
»Er hat mir alles anvertraut, Mr. Dodger.«
Dodger schien sich das durch den Kopf gehen zu lassen. »Ein Gegenstand, dessen Wert sich nicht ermessen lässt, könnte auch gar nichts wert sein.«
»Wenn ich seinen Wert bestimmen müsste, würde ich behaupten, dass es das Wertvollste ist, das der Duke je besessen hat.«
»Mein lieber Schwan!«, meinte Mr. Dodger mit seiner rauen Stimme. »Jetzt brauche ich einen Drink.«
Trotz der Absurdität der ganzen Situation konnte Olivia spüren, wie ihre untadelige Erziehung und ihr Bedürfnis, die perfekte Gastgeberin zu sein, sich in den Vordergrund drängten. »Soll ich einen Diener rufen und Ihnen eine Tasse Tee bringen lassen? Oder vielleicht lieber Limonade?«
Mr. Dodger warf ihr einen bösen Blick zu, und seine Augen waren so schwarz wie seine unrettbare Seele. »Ich dachte eher an Whisky, Gin oder Rum. Oder alles drei, falls Sie das da haben.«
»Wir haben keinen Alkohol im Haus«, gab Olivia, deren Empörung plötzlich wieder aufwallte, scharf zurück.
»Natürlich haben Sie keinen.«
»Ich schätze Ihren Ton nicht, Sir.«
»Als wenn es mir nicht völlig schnuppe wäre, was Sie schätzen oder nicht.«
Oh, er konnte einen zur Raserei treiben, dieser Kerl! Dann tat er etwas äußerst Seltsames. Langsam ging er durch den Raum und blickte sich um, als sei er drauf und dran, sich alles Mögliche zu schnappen und in seinen Taschen verschwinden zu lassen. Obwohl er das jetzt nicht mehr nötig hatte, nachdem ihm ohnehin alles auf einem Silbertablett serviert worden war.
Nach einigen schier endlosen Momenten kehrte er zum Schreibtisch zurück, um Mr. Beckwith mit einem durchdringenden Blick anzustarren. »Alles innerhalb dieses Hauses gehört mir?«
»Alles«, erwiderte Mr. Beckwith ernst, als spürte er, wie schwer sich dieses eine Wort auf Olivias Herz legte. »Unter der Bedingung, dass Sie …«
»Ja, ja, dass ich die Vormundschaft für den Jungen übernehme. Im Gegensatz zu der Duchess fällt es mir nicht schwer, die simpelsten Begriffe zu verstehen, wenn sie mir dargelegt werden.«
Diese Beleidigung konnte Olivia nicht durchgehen lassen, aber ihr fiel beim besten Willen nichts ein, womit sie ihn unmissverständlich in seine Schranken weisen konnte. Außerdem kam sie sich jetzt tatsächlich wie ein Dummkopf vor. Wie hatte Lovingdon ihr – und wichtiger noch – wie hatte er es ihrem Sohn antun können? Hatte es ihn denn überhaupt nicht interessiert, was für eine Art Mann aus Henry werden würde?
Jack Dodger drehte sich langsam im Kreis und sah sich alles noch einmal an, als weideten sich seine Augen an einem wundervollen Anblick. »War der Duke ein hochgradig gestörter Irrer?«
Das klatschende Geräusch, mit dem Olivias Hand Jack Dodgers Wange traf, schallte durch den Raum. Da sie in ihrem ganzen Leben noch nie jemanden geschlagen hatte, war ihr jedoch nicht bewusst gewesen, wie sehr ihre Handfläche danach brennen würde. Sie musste ihre ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht aufzuschreien oder sich auf irgendeine andere Art anmerken zu lassen, dass sie sich vermutlich mehr wehgetan hatte als ihm. »Mein Ehemann wurde erst kürzlich zu Grabe getragen, und Sie sprechen mit einer derartigen Respektlosigkeit von ihm? Was unterstehen Sie sich, Sir!«
Dodger bedachte sie mit einem abschätzenden Lächeln, bei dem ihr der Magen buchstäblich bis in die Kniekehlen rutschte. »Die Duchess hat Mumm. Wer hätte das gedacht?«
Am liebsten hätte sie ihn aus dem Haus geworfen, zurück auf die Straße, von der er gekommen war. Aber sie beherrschte sich und wandte sich an Mr. Beckwith. »Seine Ausdrucksweise ist vulgär, seine Manieren sind grauenhaft. Ich werde nicht zulassen, dass ein Mann wie er die Erziehung meines Sohnes übernimmt.«
»Dieses Problem lässt sich sehr leicht beheben, Duchess«, erklärte Jack Dodger gedehnt. »Suchen Sie sich einfach einen neuen Ehemann.«
»Es scheint Ihrer Aufmerksamkeit entgangen zu sein, dass ich in Trauer bin und keine Verehrer empfangen kann.«
»Tja, dann wollen Sie mich wohl nicht wirklich aus Ihrem Leben verbannen, Duchess. Glauben Sie mir – es gibt nichts, was ein Mensch nicht täte, wenn er etwas unbedingt will.«
Wann immer das Wort Duchess ihm so spöttisch über die Lippen kam, sträubten sich die feinen Härchen in Olivias Nacken, und es kribbelte sie in den Fingern, ihn erneut zu schlagen. Bevor sie diesem barbarischen Drang jedoch erliegen konnte, zwang sie sich, den Anwalt anzusehen. »Mr. Beckwith …«
»Ich bedaure, Euer Gnaden, aber es besteht keine Verhandlungsgrundlage in dieser Sache, falls Mr. Dodger zustimmt, als Vormund Ihres Sohnes zu agieren.«
»Können Sie mir wenigstens den Standpunkt meines Gatten in dieser Angelegenheit erklären?«
»Ich habe dem Duke viele Jahre lang gedient, Euer Gnaden, und es ist nie meine Aufgabe gewesen, seine Entscheidungen infrage zu stellen. Er hat mir seine Beweggründe nur selten dargelegt, sodass ich gar nicht wissen kann, was ihn bewegt hat, aber ich bin mir sicher, dass er in dieser Angelegenheit nur getan hat, was er für das Beste hielt.«
Wäre Olivia nicht zu einer Dame erzogen worden, die stets die Contenance bewahren musste, hätte sie vor Wut über diese Ungerechtigkeit aufgekreischt.
»Und was ist, wenn ich der Übernahme der Vormundschaft nicht zustimme?«, fragte Mr. Dodger.
Ein Anflug von Erleichterung schenkte Olivia wieder neue Hoffnung, dass dieser teuflische Albtraum vielleicht doch noch ein befriedigendes Ende finden würde. Offenbar war der Mann klug genug, bezüglich der Übernahme der ihm aufgebürdeten Verpflichtungen Bedenken zu haben.
»Damit wäre das erste Testament hinfällig und ein zweites tritt in Kraft«, sagte Mr. Beckwith.
Olivia wagte nicht zu fragen, aber sie musste es einfach wissen. Es erschien ihr äußerst unwahrscheinlich, dass ihr Ehemann eine noch schlechtere Wahl als Jack Dodger getroffen haben könnte, aber wenn er Lovingdons erste Wahl war, wer würde dann erst die zweite sein? Der Teufel höchstpersönlich? »Wer ist in diesem zweiten Testament als Vormund meines Sohnes vorgesehen?«
»Es ist mir nicht gestattet, darüber zu sprechen«, erklärte Mr. Beckwith ruhig. »Mr. Dodgers Entscheidung darf durch nichts beeinflusst werden.«
»Durch nichts beeinflusst? Und wie nennen Sie es, ihm alles zu überlassen? Wenn das keine Beeinflussung ist, was dann?«
»Ich meinte damit nur, dass Ihr Ehemann nicht wollte, dass die Person, die dann als Vormund dienen würde, Mr. Dodgers Entscheidung beeinflusst.«
»Aber es ist doch sicher jemand, der ein geeigneterer Kandidat ist. Jemand, der sich mit den gesellschaftlichen Strukturen auskennt. Was weiß Mr. Dodger schon über den Adel, unsere Aufgaben und Verbindlichkeiten?«
»Eine ganze Menge, Duchess«, erwiderte Mr. Dodger. »Immerhin bin ich ein langjähriger Freund des Earls of Claybourne.«
Bei der Erwähnung Lucian Langdons fuhr Olivia empört herum. »Ein weiterer Krimineller? Ein Mann, der einen Mord begangen hat? Wie in Herrgotts Namen soll mich das beruhigen? Sie können doch nicht wirklich glauben, Sie wären dazu geeignet, meinem Sohn den rechten Weg ins Mannesalter zu weisen!«
»Der richtige Weg hängt oftmals vom Standpunkt ab«, erwiderte Dodger kryptisch.
»Was wollen Sie denn damit sagen? Ihre Welt ist dekadent, Mr. Dodger. Sie …«
Doch ihr Protest erstarb in ihrer Kehle. Dodger war ihr plötzlich so nahe, viel zu nahe, und in seinen Augen loderte ein Feuer, das nur in der tiefsten Hölle entfacht worden sein konnte. Ein Feuer, das Olivia mit ungewollter Wärme durchflutete und ihr weiche Knie, feuchte Hände und einen trockenen Mund bescherte.
»Sie sollten mich irgendwann mal besuchen«, bemerkte er mit dunkler, rauer Stimme, wobei sein warmer, nach Whisky riechender Atem über ihre Wange strich.
»Wie bitte?«
»Sie sollten mich mal in meiner verderbten Welt besuchen. Ich würde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie gebührend zu empfangen. Vielleicht würden Sie ja sogar Gefallen daran finden.«
Seine Stimme war machtvoll wie ein Streicheln und weckte in ihr die Vorstellung, dass auch sein Mund und seine Hände bei diesem »gebührenden Empfang« im Spiel sein würden …
In seinem Blick war deutlich zu erkennen, welch sündhafte Dinge er mit ihr tun könnte, Dinge, die sie sich bei Lovingdon nicht einmal vorgestellt hatte. Dafür hätte Dodger eigentlich eine weitere Ohrfeige verdient, dennoch schien sie zu nichts anderem mehr imstande zu sein, als zu zittern vor … vor was? Gott steh ihr bei! War es etwa Verlangen, was sie empfand? Nein, das war unmöglich. Doch sie war schon sehr lange nicht mehr von einem Mann berührt worden. Kaum war Lovingdons Erbe geboren worden, hatte er deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er einen zweiten nicht für nötig hielt. Ein Sohn war alles, was er brauchte. In dieser Hinsicht hatten sie und Lovingdon sehr gut zusammengepasst, weil beiden die Pflicht über alles ging. Leider hatte Olivia überdies herausfinden müssen, dass die Pflicht ein einsamer und strenger Dienstherr war.
»Haben Sie je gesündigt, Duchess?«, fragte Jack Dodger mit dieser seltsam rauen Stimme, die auf nur mühsam im Zaum gehaltene Leidenschaft hinwies.
Nur in meinen Träumen, war die Antwort, die ihr auf der Zunge lag. Olivia fragte sich, ob Jack Dodger die Fantasien anderer Frauen erfüllt haben mochte. Sie hegte keinen Zweifel daran, dass er sehr wohl dazu imstande war …
Ein scharfes Räuspern ließ sie beide zusammenzucken. Olivia sah den Ausdruck der Verärgerung, der auf Jack Dodgers Gesicht erschien, als er zurücktrat und Mr. Beckwith irritiert musterte. Für die Dauer eines Herzschlags schien der Anwalt mit sich zu ringen, um nicht zurückzuweichen, aber dann räusperte er sich erneut, als schöpfte er Mut aus diesem Geräusch. »Ich finde, dass Ihr Verhalten der Duchess gegenüber keinesfalls gerechtfertigt ist, Mr. Dodger, und ganz sicher nicht das ist, was der Duke sich vorgestellt hat, als er Sie in seinem Testament bedachte.«
»Ich dachte, Sie wüssten nicht, was er sich vorstellt.«
»Ich weiß, dass er seiner Frau großen Respekt entgegenbrachte, Sir, und sehr enttäuscht wäre, wenn Sie es nicht auch täten.«
»Der Mann ist tot. Angesichts dessen halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass ihn überhaupt noch irgendwas enttäuschen könnte.«
»Und Sie, Sir, sind erbärmlich!«, fuhr Olivia ihn an, bevor Mr. Beckwith ihm die Meinung sagen konnte. »Haben Sie denn gar keinen Respekt vor meinem verstorbenen Mann?«
Daraufhin wandte er sich ihr wieder zu, und plötzlich wünschte sie sich, sie hätte den Mund gehalten. Sie wollte sich nicht mit ihm streiten, weil sie keine Ahnung hatte, wie sie die Auseinandersetzung gewinnen sollte. Bei ihm war das wahrscheinlich unmöglich, schätzte sie. Er würde es immer irgendwie schaffen, die Menschen um sich herum mit in den Schmutz zu ziehen.
»Ich respektiere nur diejenigen, die sich meinen Respekt verdient haben. Und das sind sehr wenige.«
»Ich kann mir gut vorstellen, was man tun muss, um sich Ihren Respekt zu verdienen.«
Irgendein undefinierbares Gefühl – Bedauern? Reue? – erschien in seinem Blick. »Nein, Duchess, ich bezweifle, dass Sie das können.« Und damit drehte er sich auf dem Absatz um und ging zur Tür.
Durfte sie zu hoffen wagen, dass er jetzt ging und damit dieses lächerliche erste Testament hinfällig machte?
»Wo gehen Sie hin?«, rief sie.
»Ich will mich hier mal umsehen, um festzustellen, was ich durch das Erdulden Ihrer Präsenz zu gewinnen habe«, antwortete er und stürmte ohne einen Blick zurück hinaus.
Mit einem empörten Ausruf eilte Olivia ihm nach. Dieses Haus war das ihre – ganz und gar das ihre –, bis er die Bedingungen des Testaments akzeptierte. Und bis dahin würde sie tun, was immer sie konnte, um ihn davon abzubringen, dem zuzustimmen. Sie würde ihm zeigen, wer bereit war, alles zu tun.
Auch wenn sie ihm zugestehen musste, dass er in einem Punkt ganz recht hatte: Irgendwie, ohne dass sie es bemerkt hatte, war ihr Ehemann komplett verrückt geworden.
***
Angesichts des schlechten Rufs, der Mr. Dodger vorauseilte, war Charles Beckwith geneigt, ihm und Olivia zu folgen, aber der Duke hatte strikte Anweisungen hinterlassen, dass er sich nicht einmischen sollte, wenn die beiden ihre Differenzen beilegten. Nur ein Narr hätte erwartet, dass die Duchess eine solch absurde Wahl des Vormunds widerspruchslos hinnehmen würde, und dem Duke war niemals nachgesagt worden, ein Narr zu sein.
Seufzend lehnte Beckwith sich in seinem Sessel zurück, um die Rückkehr der beiden abzuwarten, und begann, sich im Geiste auf die nächste Runde mit Jack Dodger vorzubereiten. Er wusste, dass sie sich als ausgesprochen anstrengend erweisen könnte, da er die Wünsche des Dukes erfüllen musste, ohne seine eigene Integrität zu gefährden.
Er hatte nicht die Angewohnheit, seinen Mandanten, die so großzügig für seine Dienste bezahlten, Fragen zu stellen, aber er überlegte nun doch, ob der Duke sich über die Folgen seiner Handlungsweise wirklich im Klaren gewesen war. In Charles Beckwiths Augen schien sie nur einem Zweck zu dienen: den Weg für Unheil und Desaster zu ebnen.
Kapitel 2
Ohne die Witwe zu beachten, die ihm mit schnellen Schritten folgte, marschierte Jack Dodger durch Flure und Zimmer, immer auf der Suche nach etwas Vertrautem, nach irgendetwas, das darauf schließen ließ, dass er schon einmal in diesem Haus gewesen war. Er hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass nichts im Leben leicht war, und diese ganze Situation hier erschien ihm viel zu leicht. Zumindest bis auf den Umgang mit der Witwe. Sie war in jeder Hinsicht genau der Typ Frau, dem er tunlichst aus dem Weg ging. Abgesehen davon, dass sie ihn mit selbstgerechter Entrüstung beurteilte, war sie auch noch so verdammt fanatisch hinsichtlich der Tatsache, dass er so unfassbar unwürdig war. Dass sie recht hatte, spielte dabei keine Rolle. Allein schon ihre Überzeugung, dass er als Vormund völlig ungeeignet war, machte ihn wütend genug, um den Teufel in ihm hervorzurufen. Obwohl es dazu nicht viel brauchte. Teuflisches Verhalten war der einzige Weg, um sicherzustellen, dass er nie wieder ausgenutzt oder verletzt wurde und nie wieder ein Leben voller Reue riskieren würde.
Die Duchess hatte die von dem Anwalt überbrachten Neuigkeiten nicht gut aufgenommen. Der feurige Zorn in ihren Augen hatte ihn getroffen wie ein Faustschlag in den Magen, und er hatte diesen Zorn in ein Feuer der Leidenschaft verwandeln wollen …
Verdammt!
Normalerweise schnauzte er keine Frauen an, und er wusste es besser, als irgendetwas über seine Gedanken oder Gefühle zu verraten. Aber irgendwie hatte die Witwe ihn dazu gebracht, jegliche Vorsicht außer Acht zu lassen. Er hatte begonnen, die Oberhand in diesem Spiel zu verlieren … in was für einem Spiel? Was in Herrgotts Namen ging hier vor?
Deshalb war er aus dem Zimmer gestürmt, denn er hatte gelernt, dass ein Rückzug bisweilen auch zum Sieg führen konnte. Manchmal erforderte eine wirksame Strategie ein Wiederaufstocken des Arsenals oder ein bisschen Raum zum Atmen, um wieder klar denken und sich einen Reim auf etwas machen zu können.
Was für eine Art von Irrer war Lovingdon gewesen, um ausgerechnet ihm irgendetwas zu vererben? Gewöhnlich waren Adlige so überfürsorglich mit ihren Erben, dass es einfach aberwitzig war, den Jungen in Jacks Obhut zu geben. Doch obwohl ihm das nur allzu gut bewusst war, ärgerte es ihn, dass die Witwe dermaßen entsetzt wirkte. Eigentlich müsste er die Bedingungen des Testaments allein schon deshalb akzeptieren, um sie noch mehr zu reizen. Aber er hatte seine Entscheidungen noch nie auf unmittelbare Reaktionen gestützt, sondern seine Vorgehensweise immer gut bedacht und die Dinge vorher stets von allen Seiten betrachtet. Allerdings war in dieser Situation die Erbschaft so verlockend groß, dass sie seine Vernunft zu überschatten drohte. Denn obwohl Jack im Laufe der Jahre ein recht beachtliches Vermögen angesammelt hatte, waren seine Truhen längst noch nicht so voll, dass er sein Geld für einen Palast wie diesen ausgeben würde. Das Haus war riesig groß und quoll schier über von Skulpturen und Statuetten, Kunstwerken, prachtvollen handgefertigten Möbelstücken und allen möglichen anderen Schätzen, die man sich nur vorstellen konnte.
In Gedanken hörte er Feagans gackerndes Gelächter. »Endlich haste es geschafft, Junge. ’n schickes Haus in St. James. Wer hätte das gedacht?«
Ganz bestimmt nicht Jack.
Er hatte ein geübtes Auge für Wertgegenstände, und was der gute Duke davon zusammengetragen hatte, war ein Vermögen wert. Es war auch offensichtlich, dass die Familie vom ersten bis zum letzten Duke sehr eingenommen von sich war. Warum hätten sie wohl sonst all diese Porträts aus verschiedenen Lebensabschnitten, von der Geburt bis ins hohe Alter, malen lassen? Ja, der Adel war schon ein seltsamer Verein! Zu glauben, es würde irgendjemanden interessieren, wie sie aussahen oder ausgesehen hatten! Nach der Anzahl der an sämtlichen Wänden hängenden Porträts zu urteilen interessierte es anscheinend wohl doch jemanden. Vielleicht konnte er die Bilder ja für ein hübsches Sümmchen an den Erben verkaufen?
Als erriete die Duchess, was er dachte, sagte sie steif: »Ich bin sicher, dass Mr. Beckwith, als er ›alles‹ sagte, nicht wirklich alle Dinge meinte. Die Porträts gehören ja ganz offensichtlich zu der unveräußerlichen Erbmasse.«
»Und wie kommen Sie zu diesem Schluss, Duchess?«
»Weil diese Bilder Porträts der Herzöge und ihrer Familien, also der Vorfahren meines Sohnes sind. Daher kann es keinen Zweifel daran geben, dass sie ein Bestandteil seines Erbes sind.«
»Wir werden sehen.« Ihr Einwand war vernünftig, aber Jack würde sich das Bestandsbuch genauer ansehen, um jeden Gegenstand zu erfassen und sich ihn ins Gedächtnis einzuprägen. Er würde ihr nichts überlassen, das für ihn bestimmt war – nicht ohne einen angemessenen Preis dafür zu verlangen. Er hatte nicht die Absicht, diese Leute zu übervorteilen, aber es entsprach auch nicht seiner Natur, karitativ zu sein.
»Ich frage mich, mit welchen Geldern Ihre Garderobe bezahlt wurde«, murmelte er.
»Wie bitte?«
Ein bisschen abrupt blieb er vor der Tür des dritten Speisezimmers stehen, das er bisher gesehen hatte, worauf die Duchess fast mit ihm zusammenstieß. Dabei stieg ihm wie schon zuvor in der Bibliothek ein Hauch ihres angenehmen Dufts in die Nase. Als er dort gesessen hatte, war er versucht gewesen, sich zu ihr zu beugen, um ihn noch tiefer in sich aufzunehmen. Es war ein dezenter Lavendelduft, nicht das süßlich-penetrante Moschusparfum, das Prostituierte benutzten, um den Geruch ihres Gewerbes und den anderer Männer zu überdecken.
Sie runzelte die Stirn und zog die Brauen über ihren ungewöhnlichen bernsteinfarbenen Augen besorgt zusammen. Von Anfang an hatte dieser Farbton – der fast so golden war wie die Geldstücke, die er bevorzugte – seine Aufmerksamkeit erregt.
Die Duchess reichte ihm nicht mal bis zur Schulter. Allerdings war sie auch noch furchtbar jung für eine Witwe. Sie musste noch ein halbes Kind gewesen sein, als sie den Duke geheiratet hatte. Bei dem Altersunterschied zwischen ihnen musste er ihr wie ein alter Mann erschienen sein. Ob sie ihn geliebt hatte? Oder war sie nur an dem Titel und allem, was damit einherging, interessiert gewesen?
»Ich versuchte nur, mich daran zu erinnern, ob Ihre Garderobe zu der unveräußerlichen Erbmasse gehört«, erwiderte er gedehnt.
Zorn flackerte in ihren Augen auf. »Meine Garderobe, Sir, gehört mir. Die werden Sie mir nicht nehmen.«
»Fordern Sie mich nicht heraus, Duchess, weil ich sonst nämlich versucht sein könnte zu beweisen, dass ich Ihnen diese Trauerkleidung ausziehen kann, bevor Sie auch nur Widerspruch erheben könnten.«
»Oh, was für ein aufgeblasener Strolch Sie sind!«
Jack wandte sich von ihr ab, weil er bemüht war, kein Vergnügen dabei zu empfinden, ihren Zorn noch weiter anzustacheln. Denn das war nicht das Verhalten eines Gentlemans, wie er sehr wohl wusste, aber er hatte auch nie von sich behauptet, einer zu sein. Er musste erst noch einen kennenlernen, der kein Heuchler war. Da gab man besser gleich zu, ein Schuft zu sein, denn das war ehrlicher. Er gab niemals vor, etwas zu sein, was er nicht war.
Ungeduldig eilte er den Weg zurück, den er gekommen war. Eins musste er dem Duke lassen: Er hatte sein Geld gut angelegt.
Im Stillen verfluchte er jedoch den Mann, den er kaum gekannt hatte, der ihn aber offensichtlich sehr gut einzuschätzen gewusst hatte. Alles, was Jack sah, wollte er haben. Er wollte es ansehen und wissen, dass es ihm gehörte. Er wollte die Mauern dieses Hauses einreißen und sie durch Glas ersetzen, um der Welt einen Blick auf Jack Dodgers Besitz zu erlauben. Er wollte sich damit brüsten. Er, der Sohn einer Hure, war von der Gesellschaft nicht in den Schmutz getreten worden, sondern ganz im Gegenteil über seine Herkunft weit hinausgewachsen und hatte London erobert.
Bei Gott, ja, genauso fühlte es sich an, diese prachtvollen Entrees und Flure mit ihren vergoldeten Zierleisten und bemalten Decken zu durchschreiten. All das konnte ihm gehören, gegen einen sehr geringen Preis.
Wie viel Mühe konnte es schon machen, als Vormund eines kleinen Jungen zu agieren? Aber die eigentliche Frage lautete, wie lästig der Umgang mit der gar nicht lustigen Witwe sein würde. Sie gehörte zu den Frauen, die ihm ein Gräuel waren. Selbstgerecht, voreingenommen und überzeugt davon, dass sie sehr viel besser waren als andere. Nichts würde er lieber tun, als dieser Duchess den einen oder anderen Dämpfer aufzusetzen. Vielleicht war das der Grund dafür, dass er das Thema Garderobe angesprochen hatte – gewiss nicht, weil er darüber nachgedacht hatte, wie es wohl wäre, sie ihr tatsächlich auszuziehen.
Ihr schwarzes Kleid hatte viel zu viele Knöpfe, um interessant für ihn zu sein. Sie verliefen von der Taille bis zum Kinn und von den Handgelenken bis zu den Ellbogen. Außerdem konnte er sich sehr gut vorstellen, dass ihre Kleidung nach Ablauf der Trauerzeit genauso langweilig sein würde. Sie erschien ihm wie jemand, der glaubte, dass Versuchungen letzten Endes in die Hölle führten und dass dieser Weg um keinen Preis beschritten werden durfte. Ihr tristes braunes Haar war aufgesteckt und größtenteils unter einer Witwenhaube verborgen, und er fragte sich, wie lang es wohl sein mochte. Aber dann verwünschte er sich dafür, dass er sich überhaupt mit dieser Frau befasste.
Sie war eine Duchess und vermutlich sogar auf die eine oder andere Weise mit der Königin verwandt. Waren das nicht alle Adligen? Auf jeden Fall benahmen sie sich so, als wären sie es. Sogar in seinem eigenen Club versuchten sie gelegentlich, ihn herumzukommandieren – aber dort hatte er eine Welt erschaffen, in der er der König und sein Wort Gesetz war. Seine Gäste zahlten einen jährlichen Beitrag, weil er Unterhaltung anbot und sie für Exzesse nicht verurteilte. Ganz anders als die Frau, die ihm noch immer folgte. Er hatte sofort die Kritik in ihrem Blick gesehen, als sie einander vorgestellt worden waren, die Missbilligung und Überzeugung, dass er weit unter ihr stand. Er hatte ihren Blick gespürt, nachdem sie Platz genommen hatten, und war sich nur allzu gut bewusst gewesen, dass sie ihn musterte, als wäre er eine Kuriosität, die auf der Weltausstellung zur Schau gestellt werden müsste. Daher hatte er es ganz bewusst vermieden, sie anzusehen, und sich stattdessen darauf konzentriert, das Zimmer zu betrachten, während der Anwalt mit entnervender Ruhe seine Vorbereitungen getroffen hatte.
Aus einem prachtvollen Korridor trat Jack in die nicht minder elegante Eingangshalle, die er jedoch rasch durchquerte, um die schwarze Marmortreppe hinaufzusteigen.
»Wo gehen Sie hin?«, fragte die Duchess hinter ihm.
»Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich mir alles ansehen will.«
»Aber dort oben sind nur Schlafzimmer.«
»Für einen Mann wie mich ist kein Raum wichtiger, wie Sie sich vielleicht denken können.«
Nur mühsam unterdrückte er ein Grinsen, als er hinter sich ihr ärgerliches Fauchen hörte. Herrgott, was mochte der Duke nur an ihr gefunden haben? Nach allem, was er bisher mitbekommen hatte, wusste sie nicht mal, was Humor war, sondern war steif wie ein Schüreisen. Auch wenn er ihren beherzten Kampf um das, was sie als ihr Eigentum betrachtete, bewundern musste. Diese zarte, gertenschlanke kleine Frau war zu einer regelrechten Löwin geworden bei dem Gedanken, ihren Welpen Jacks Obhut anvertrauen zu müssen. Wenn doch nur seine eigene Mutter so gewesen wäre, hätte er vielleicht eine weit weniger harte Jugend gehabt.
Am oberen Treppenabsatz wandte er sich nach links und öffnete die erste Tür, zu der er kam. Mit großen Schritten trat er ein, und sofort fiel sein Blick auf das mächtige Himmelbett in der Mitte des Zimmers, dessen Baldachin aus schwerem purpurrotem Samt war. Er hörte, wie die Duchess scharf die Luft einsog, als sie hinter ihm erschien, und für einen kurzen Moment fragte er sich, ob sie in diesem reich geschmückten Bett wohl auch so nach Atem gerungen haben mochte. Aber dann schüttelte er den Kopf, um diese abschweifenden Gedanken zu vertreiben. Was kümmerte es ihn, ob sie Befriedigung in diesem Bett gefunden hatte?
»Das Schlafzimmer des Dukes?«, erkundigte er sich und war überrascht über seinen heiseren Tonfall.
»Ja.«
Ein Buch lag auf dem Nachttisch, aus dem ein Seidenbändchen heraushing, als hätte der Duke erwartet, weiterlesen zu können. Bei dem Gedanken daran stieg Unbehagen in Jack auf. Er hatte den Mann zwar kaum gekannt, oder jedenfalls nicht gut genug, um sein Ableben aufrichtig zu bedauern, aber dennoch überkam ihn Trauer. Er fragte sich, was der Duke wohl sonst noch unvollendet zurückgelassen haben mochte.
Aber dann schüttelte Jack seine morbiden Grübeleien ab und wandte den Blick zur Seite und zu einer weiteren geschlossenen Tür, die sich hinter der Sitzecke befand. »Und dort geht es zu Ihrem?«
Er hörte, wie sie schluckte. »Ja.«
Also hatte der Duke sie in der Nähe haben wollen. Jack verstand nicht, wieso ihn das störte, aber so war es. Er drehte sich zu der Duchess um. »Was hat es eigentlich auf sich mit den Aristokraten und ihrer verrückten Vorstellung, dass Mann und Frau in getrennten Schlafzimmern nächtigen sollten?«
Er war sich nicht sicher, ob er je eine derart blasse Frau wie sie gesehen hatte, aber plötzlich überzogen ihre Wangen sich mit einer tiefen Röte, und Jack ertappte sich bei der Frage, ob sie auch im Bett des Dukes so rot geworden war. Warum musste er sie sich andauernd in diesem verdammten Bett vorstellen?
»Vermutlich tun sie es, weil sie es können«, sagte er lakonisch, weil er nicht wirklich eine Antwort von ihr erwartete. Wahrscheinlich ging sie von Kopf bis Fuß in etwas eingehüllt, das einem Leichentuch ähnelte, zu Bett. Er tat einen Schritt auf die Sitzecke zu …
»Gehen Sie bitte nicht in mein Schlafzimmer«, bat sie ihn leise.
Die Mattheit ihrer Stimme erschütterte und verwirrte ihn. Den ganzen Abend lang war sie fordernd, zornig, verletzt und aufgebracht gewesen. Dass sie sich jetzt plötzlich entschied, so sanft, ja fast schon unterwürfig zu sein, stand für Jack in krassem Widerspruch zu ihrem bisherigen Verhalten. Aber vielleicht war ihr ja klar geworden, dass Streitbarkeit seine Stimmung nicht zu beeinflussen vermochte. Mit hochgezogenem Mundwinkel drehte er sich zu ihr um. »Was ist denn, Duchess? Haben Sie alle möglichen Spielzeuge da drin versteckt, die dazu dienen, Ihnen sexuelle Lust zu verschaffen?«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
Er musterte sie einen Moment lang prüfend, ihr schwarzes Trauerkleid, ihre steife, immer etwas distanzierte Haltung … »Nein, bedauerlicherweise wissen Sie das vermutlich wirklich nicht.«
Unschuld hatte ihn noch nie gereizt. Ohne ein weiteres Wort ging er aus dem Zimmer und den langen Korridor hinunter.
»Die Schlafzimmer sind alle gleich«, meinte sie hinter ihm. »Ich verstehe nicht, warum Sie unbedingt …«
Er griff nach einer weiteren Türklinke.
»Ich verbiete Ihnen, dieses Zimmer zu betreten«, erklärte sie entschieden.
Jack warf einen Blick über die Schulter und zwinkerte ihr zu. »Verbieten Sie mir nichts, Duchess, weil Sie damit nur erreichen werden, dass ich es tue.«
Und damit stürmte er auch schon in das Zimmer. Eine junge Frau mit braunem Haar und braunen Augen, offensichtlich eine Dienstbotin, schnappte erschrocken nach Luft und sprang aus dem Sessel auf, in dem sie neben dem Bett gesessen hatte. Auch der kleine Junge im Bett setzte sich jäh auf, wobei ihm die Decken bis zur Taille hinunterrutschten. Sein blondes Haar war zerzaust, und er riss die goldfarbenen Augen weit auf.
Die Duchess drängte sich an Jack vorbei, setzte sich aufs Bett und nahm den Jungen beschützend in die Arme. Es ärgerte Jack ungeheuer, dass sie offenbar annahm, der Junge müsste vor ihm beschützt werden – oder zu erwarten schien, dass er dem Kleinen wehtat.
»Der Erbe?«, fragte Jack knapp.
Die Duchess nickte. »Ja.«
»Henry, nicht?«
»Ja.«
»Wie alt bist du, Henry?«
»Er ist fünf«, antwortete die Duchess.
»Ist er stumm?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Warum lassen Sie ihn dann nicht selbst sprechen? Ich habe ihn gefragt, nicht Sie.«
»Sie machen ihm Angst.«
»Tue ich das?« Er musterte den Jungen prüfend. Er hatte den gleichen schmalen Körperbau wie seine Mutter und war auch genauso blass. Seine Augen waren weit geöffnet, aber Jack sah mehr Neugierde als Furcht darin. »Hast du Angst vor mir, mein Junge?«
Henry blickte fragend zu seiner Mutter auf.
»Such die Antwort nicht bei deiner Mutter, Junge, sondern bei dir selbst.«
»Reden Sie nicht in diesem Ton mit ihm!«, fuhr ihn die Duchess an. »Noch sind Sie nicht sein Vormund.«
Jack wusste nicht, ob er den Jungen um die beschützende Art seiner Mutter beneiden sollte – um die Fürsorglichkeit, von der er wünschte, seine eigene Mutter hätte sie ihm zuteilwerden lassen –, oder ob er Henry bemitleiden sollte, weil die Duchess ihn zu einem Weichling großzog. Im Alter von sechs Jahren hatte Jack mit Schläue, Durchtriebenheit und geschickten Fingern schon ganz allein auf der Straße überleben können. Er hatte sich nie davor gefürchtet, etwas zu riskieren. Er hatte gelernt, allen zu entkommen, die ihn erwischen wollten. Er hatte flinke Füße, aber ein sogar noch schnelleres Denkvermögen gehabt.
»Geschicklichkeit wird dich nur ein Stück weit bringen, Junge, aber Köpfchen ist’s, was dich am Leben erhält«, hatte Feagan immer gesagt.
Die Tricks des Metiers zu erlernen hatte ihm Selbstvertrauen gegeben und zum Erfolg geführt, durch den er kühn und furchtlos geworden war. Er war nur so weit gekommen, weil er überlebt hatte. Bei dem kleinen Henry hingegen war er nicht mal sicher, ob der Junge sich allein die Nase putzen konnte. War das der Grund, aus dem der Duke den Jungen seiner Obhut anvertraute?
Jacks erste Begegnung mit Lovingdon hatte an einem Frühlingstag im Garten des Earls of Claybourne stattgefunden, wo Jack den Eindruck gewonnen hatte, dass der Duke ein freudloser und schwermütiger Mann war. Jahre später hatte der Duke ein paar Mal Jacks Club aufgesucht, aber nichts Denkwürdiges war bei diesen Gelegenheiten herausgekommen, zumindest von Jacks Standpunkt aus. Hatte der Duke an Jacks Verhalten etwas bemerkt, das darauf hinwies, dass er ein kompetenter Vormund für seinen Jungen sein könnte, der offensichtlich viel zu sehr verhätschelt wurde? Aber selbst in diesem Fall war es doch mehr als eigentümlich, dass er Jack alles hinterlassen hatte, was nicht zu seinem unveräußerlichen Besitz gehörte. Jack war von Natur aus misstrauisch, und in seinem Kopf schrillten sämtliche Alarmglocken und warnten ihn, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuging. Er konnte nur noch nicht erkennen, was genau es war.
Jack drehte sich auf dem Absatz um und ging auf die Treppe zu.
»Wo wollen Sie hin?«, wollte die Duchess wissen, deren leichte Schritte er wieder hinter sich vernahm.
Sie war aber auch wirklich schnell. Wenn er nicht so lange Beine hätte, wäre er wahrscheinlich gar nicht in der Lage, sie auch nur vorübergehend abzuhängen. »Nicht, dass es Sie etwas anginge, aber ich will mit Beckwith sprechen.«
Warum machte er sich überhaupt die Mühe, sich zu rechtfertigen? Er rechtfertigte sich doch sonst vor niemandem. Oder zumindest nicht mehr, seit er beschlossen hatte, die Straßen zu seinem Zuhause zu machen.
Die Duchess auf den Fersen wie einen lästigen Welpen, eilte er die Treppe hinunter und durchquerte die Eingangshalle, die randvoll mit Kostbarkeiten war, die zweifelsohne seit Generationen zusammengetragen worden waren. Ein livrierter Diener öffnete ihm die Tür zur Bibliothek. Jack ging hinein und fuhr schnell zu der Duchess herum, um ihr den Weg zu verstellen.
Schlitternd kam sie zu einem abrupten Halt und blickte ihn schwer atmend und völlig verblüfft an, die goldenen Augen aufgerissen, die vollen Lippen leicht geöffnet. Wenn sie nicht gerade die Lippen schürzte, als verbrächte sie ihre freie Zeit damit, Zitronen auszulutschen, hatte sie einen verdammt verführerischen Mund. Es irritierte Jack, dass er das bemerkte, aber was ihn sogar noch mehr ärgerte, war, dass er sich fragte, wie es wohl wäre, sie zu küssen.
»Unter vier Augen«, sagte er und schlug ihr die Tür vor der Nase zu. Ihr empörter Aufschrei durchdrang das massive Holz und erfüllte ihn mit einem kleinen Triumphgefühl. Da er sich jedoch nicht darauf verlassen konnte, dass sie seinem Wunsch entsprach, drehte er zur Sicherheit auch noch den Schlüssel um. Gut, dass der Duke ihn griffbereit gehalten hatte. Wahrscheinlich war er es gewohnt gewesen, den unerfreulichen Launen seiner Frau aus dem Weg zu gehen, indem er diesen Raum als seinen ganz privaten Zufluchtsort benutzte.
Jack schlenderte auf Beckwith zu, der scheinbar nichts ahnend und ohne etwas von Jacks innerem Aufruhr wahrzunehmen, am Schreibtisch saß. Entweder war der Mann ein Narr oder ein ebenso geschickter Kartenspieler, wie auch Jack es war. »Es ist etwas über vierzehn Jahre her, seit Sie mir die Nachricht überbrachten, dass ich einen anonymen Gönner hatte. Das ist der einzige Grund, warum ich heute Abend überhaupt hergekommen bin. War mein Gönner der Duke of Lovingdon?«
Obwohl diese Erklärung überhaupt keinen Sinn ergab, war sie die einzige, die Jack zu dieser aberwitzigen Geschichte einfiel.
»Ich stelle vielen adligen und sehr wohlhabenden Herren meine Dienste zur Verfügung, Mr. Dodger. Ihr Gönner wünschte anonym zu bleiben, und daran werde ich mich halten.«
»Soll das heißen, dass es nicht Lovingdon war?«
»Das soll heißen, dass ich mein Bestes tun werde, um sein Vertrauen nicht zu enttäuschen, solange mir nicht gestattet ist, seine Wünsche zu offenbaren.«
»Und wenn ich Ihnen die Seele aus dem Leib prügele, Beckwith? Dann werden Sie wahrscheinlich merken, dass Ihr Bestes nicht so gut ist, wie Sie denken.«
Beckwith besaß die Dreistigkeit zu grinsen, als amüsierte ihn das alles nur. Jack mochte es nicht, wenn man sich über ihn lustig machte oder, schlimmer noch, ihn auf die Probe stellte. Mit einem unterdrückten Fluch deutete er auf das Testament und das ledergebundene schwarze Buch. »Das ergibt doch alles keinen Sinn.«
»Ist es so wichtig, dass es das tut?«
»Es ist wichtig, dass ich verstehe, warum ein Mann, mit dem ich nur ein paar Mal gesprochen habe, es für richtig hielt, mir so viel für so wenig Aufwand meinerseits zu hinterlassen.«
»Der Vormund eines Lords zu sein ist eine schwere, ernste und wichtige Aufgabe, Mr. Dodger. Unterschätzen Sie nicht die Macht Ihres Einflusses oder den Arbeitsaufwand, den es erfordert, um zu gewährleisten, dass der junge Herr einmal zu einem Mann wird, der sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann.«
Jack lachte schroff. »Verdammt noch mal, Mann, genau das ist mein Punkt! Die Duchess hat recht. Ich bin der letzte Mensch, der ihrem Sohn als Vormund und Beschützer dienen sollte. Ich verabscheue die Aristokratie.«
»Das ist sehr bedauerlich, zumal Sie Ihren beispiellosen Erfolg weitgehend diesen Leuten zu verdanken haben. Der Duke dachte anders, was Ihre Eignung, seinen Sohn auf dem Weg ins Mannesalter zu begleiten, anbetraf. Ihm war jedoch auch bewusst, dass man Sie nicht zwingen kann, etwas zu tun, was Sie nicht wollen. Sie haben also vierundzwanzig Stunden Zeit, um mir Ihre Entscheidung mitzuteilen. Sollten Sie am Ende dieser Zeit den Regeln und Bedingungen des Testaments nicht zugestimmt haben, ist Ihre Chance, all das hier – und das allerletzte Erbteil – zu erlangen, erloschen, und das zweite Testament kommt ins Spiel.«
»Sie reden, als ob das Ganze hier ein ausgeklügeltes Spielchen wäre.«
Beckwith lächelte wissend. »Wer bin ich schon, um das zu beurteilen?«
Jack blickte sich im Zimmer um. Nur in Claybournes Bibliothek hatte er noch mehr Bücher gesehen als hier. Selbst wenn er sein Leben lang jeden Tag eins dieser Bücher läse, würde er sich niemals durch diese Bibliothek durcharbeiten können. Allein schon die ledergebundenen Bücher waren ein Vermögen wert.
Er wandte sich wieder dem Mann zu, der so gelassen am Schreibtisch saß, als ob ihn nichts aus der Ruhe bringen könnte. Aber offenbar war er ein Mann, der seine Macht aus denjenigen bezog, die er vertrat. »Was hinterlässt er seiner Witwe in dem zweiten Testament?«
»Es steht mir nicht frei, Ihnen das zu sagen.«
»Herrgott noch mal, Mann, dann sagen Sie mir wenigstens, ob es günstiger für sie ist als das erste.« Das Jack als jämmerliche Hinterlassenschaft für eine Ehefrau betrachtete, wenn er ganz ehrlich war. Selbst für dieses lästige kleine Weib, das ihm auf Schritt und Tritt hinterhermarschiert war.
»Was spielt das für eine Rolle?«, fragte Beckwith.
Jack rieb sich nachdenklich das Kinn. Er würde sich die Schlüssel zu einem weit größeren Königreich als den, was er selbst besaß, bestimmt nicht durch die Lappen gehen lassen. Dann griff er nach dem ledergebundenen Bestandsbuch, das Beckwith ihm vorher übergeben hatte, und bedachte den Mann mit dem spöttisch-anzüglichen Grinsen, für das Jack Dodger so bekannt war.
»Wie bringe ich zum Ausdruck, dass ich die Bedingungen des Testaments akzeptiere?«
Kapitel 3
Durch den aufwabernden Nebel ging Jack die stille Straße entlang. Zur Residenz des Dukes hatte er eine Droschke genommen, und er könnte auch eine andere rufen, die ihn nach Hause brachte, nur brauchte er sie jetzt nicht mehr. Er besaß jetzt selbst eine Kutsche und Pferde. Er hatte ein Stadtpalais, Dienstboten … und Bedenken. Mit einem unguten Gefühl im Bauch hatte er das Dokument unterzeichnet, das Beckwith ihm vorgelegt hatte. Trotz seiner Fragen und Versuche, sich eines anderen zu besinnen, hatte er schon vom Moment der Testamentsverlesung an gewusst, dass er nicht auf diese ganz erstaunliche Hinterlassenschaft verzichten würde.
Womit er nicht gerechnet hatte, war die Gelassenheit, mit der die Duchess auf die Nachricht reagierte, dass er das Erbe angenommen hatte. Überraschenderweise hatte sie Mr. Beckwith nur zugenickt und gesagt: »Ich werde die Dienstboten darüber informieren.«
Dann hatte sie alle in die Eingangshalle gerufen. Während Jack am Fuß am Treppe stand, hatte sie sich in der hoheitsvollen Haltung einer Königin einige Stufen über ihm postiert. Er glaubte jetzt zu wissen, wie ein Krieger aussah, wenn die erbitterte Schlacht sich nicht zu seinen Gunsten entwickelt hatte und er in die Augen jener schauen musste, die er auf das Schlachtfeld geschickt hatte, um ihnen klarzumachen, dass schon das bloße Überleben etwas Ehrenvolles war. Sie war Ehrfurcht gebietend und wortgewandt gewesen, als sie dem Personal erklärte, dass das Haus nun Jack gehörte und von nun an alle seine Anweisungen zu befolgen hatten.
Die Dienerschaft hatte keinen Ton gesagt, aber Jack konnte sich sehr gut vorstellen, dass sie eine Menge Fragen haben würde, sobald der erste Schock nachließ. Doch er hatte es dabei bewenden lassen und das Haus, das nun das seine war, verlassen, um allein und ungestört über diese Schicksalswende nachzudenken.
Obwohl er sich eingestand, dass auch er sich nicht für die beste Wahl hielt, um dem geliebten und überbehüteten Sohn des Dukes als Vormund zu dienen, konnte er sich Schlimmeres vorstellen. Vielleicht war der Duke ja selbst auch nicht besser dafür geeignet gewesen.
Jack ging oft Straßen mit eleganten Stadtpalais entlang und versuchte, sich etwas in Erinnerung zu rufen, wovon er geglaubt hatte, er würde es nie vergessen – das erste richtig vornehme Haus, in dem er gelebt hatte, als er gerade mal fünf gewesen war. Der Besitzer hatte seiner Mutter versprochen, gut für ihn zu sorgen, und sie wiederum schien ihn zu kennen und ihm zu vertrauen. Vielleicht war er ja einer ihrer Freier gewesen.
Das Einzige, woran Jack sich noch erinnerte, war, dass der Mann ihn gefüttert, gebadet und zu Bett gebracht hatte. Dass er zu ihm unter die Decken geschlüpft war … Dinge getan hatte …
Jack beschleunigte seine Schritte, als wäre er wieder fünf und liefe vor dem Mann davon.