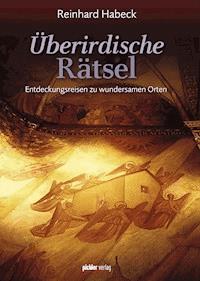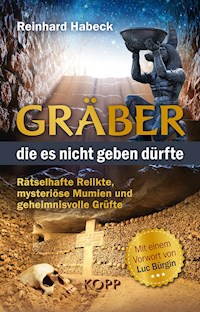4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mysteriöse Schriften und Botschaften aus aller Welt
Sie rütteln an unserem vertrauten Geschichtsbild. Rund um den Globus finden sich textliche Zeugnisse, die es eigentlich nicht geben dürfte: Schriften vor der »offiziellen« Erfindung der Schrift, die lange vor den ägyptischen Hieroglyphen und der mesopotamischen Keilschrift entstanden; außereuropäische Schriften, die Jahrhunderte vor Kolumbus transatlantische Kontakte zwischen den Urvölkern bestätigen; uralte Chroniken, die technische Apparaturen detailgetreu beschreiben, obwohl sie offiziell erst Jahrtausende später erfunden wurden; alchemistische Geheimcodes der Habsburger, die selbst von modernen Computerkryptografen nicht geknackt werden konnten; Inspirationen, Botschaften und Prophezeiungen, die der Übermittlung überirdischer Wesen zugeschrieben werden.
Solche »regelwidrigen« Entdeckungen zeigen, dass unser Geschichtsbild keineswegs vollständig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
1. Auflage September 2014 Copyright © 2016 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Stefanie Müller Coverfoto: Reinhard Habeck, Wien ISBN E-Book 978-3-86445-448-6 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Widmung
IN GEDENKEN AN
den Heimatdichter der Stadt Tulln:
Dr. Humbert Dell’mour (1881–1948)
Österreichischer Sprachwissenschaftler,
Philosoph, Autor und außerdem
mein Großvater
Peter Fiebag: Über das Geheimnis schweigsamer Texte
Über das Geheimnis schweigsamer Texte
Um unbekannte Schriften weht ein Hauch von Rätselhaftem (…)
Und entsprechend wird besonderer Ruhm demjenigen zuteil,
der als erster ihr Geheimnis lüftet.
Maurice Pope, Das Rätsel der alten Schriften, 1975
Als das Denken schreiben lernte, geschah etwas Ungeheuerliches: Der Mensch konnte zum ersten Mal in seiner langen Entwicklungsgeschichte sein Denken gewissermaßen konservieren. Er konnte dies so tun, dass ein völlig Unbekannter, der an einem fernliegenden Ort, in einer fernen Kultur, ja sogar in einer weit entfernten Zeit leben würde, erneut einzutauchen vermochte in den Kosmos des Schreibers, seine Gedanken und Fantasien. Der Schreibkompetenz des Autors musste allerdings die Kompetenz des Lesers begegnen, denn sonst erkannte der Textbetrachter im besten Fall zwar auf der Tontafel, unvergänglichem Granit oder einer gegerbten Lederhaut Symbole und Striche als eine Botschaft, nur konnte er die Information selbst eben nicht entziffern. Über Jahrtausende wurde dieser Zustand eigenartigerweise von babylonischen und ägyptischen Priestern, die die Schrift vor mehr als 5000 Jahren erfanden, geradezu gewollt. Denn lesen und schreiben zu können bedeutete für Priester und Könige, Macht zu besitzen: Macht über das Wort.
Im Zeitalter des Internets, in der wir die voluminöseste Entladung von geschriebenen Wörtern erleben, die es jemals gab, gilt es, sich nicht nur der Macht, sondern auch der magischen Gewalt der Wörter, des Wortzaubers wieder bewusst zu werden. Das Wort war ein Bote der Götter, ein Bote von Geistern und Menschen, das es zugleich zu beschwören und zu bannen, aber auch zu nutzen galt. Seltsam und unverständlich-magisch muss so mancher Text mit seinen eigenartigen Linien und Schnörkeln auf den Betrachter früherer Epochen gewirkt haben. Denn nicht nur die alten Ägypter glaubten an Wortmagie, wenn sie in ihren Hieroglyphen (sie nannten sie »Gottesworte«) ein kräftegeladenes Bild erkannten. So groß war ihre heilige Furcht z. B. vor dem Zeichen der Hornviper, die im Schriftsystem lediglich den Konsonanten f bezeichnet, dass sie dieses Symbol in den Gräbern verstümmelten, um dem Toten kein Unglück widerfahren zu lassen. Die jüdischen Kabbalisten des 13. Jahrhunderts lehrten, dass die Welt durch eine Verbindung Gottes mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets entstanden sei. Noch im 18. Jahrhundert fand das Magische Quadrat – es besteht aus einem kurzen Text aus fünf Wörtern, die sich vor- und rückwärts, ab- und aufwärts identisch lesen lassen – Anwendung gegen Seuchen und Feuer. All diese Texte, diese Worte eines Gottes, diese beschwörenden Formeln für das Dies- und Jenseits, die nicht für Millionen Ägyptentouristen gedacht waren, dürfte es streng genommen gar nicht geben.
Selbst der große Klassiker deutscher Sprache, Johann Wolfgang von Goethe, taucht noch hinab in diese mystische Seite der Sprache und Schrift, lässt seinen Faust das »geheimnisvolle Buch, von Nostradamus’ eigner Hand«, geschrieben in »heiligen Zeichen«, zum Schlüssel für das Tor zur Geisterwelt werden. Goethe wusste sehr gut, dass der Besitz solcher Bücher der Magie den Tod bedeuten konnte. Denn die »Heilige Inquisition« verteufelte jeden Text, der nicht als bibeladäquat galt und die Macht der Kirche bedrohte.
Verwundern hingegen muss uns, wenn im 21. Jahrhundert der Wiener Autor Reinhard Habeck ein Buch mit dem Titel »Texte, die es nicht geben dürfte« herausgibt. Welcher Art sind diese Texte, die es heute nicht geben darf? Keine ideologischen, politischen oder gesellschaftskritischen Texte, für deren Besitz in totalitären Staaten Menschen noch immer um ihr Leib und Leben fürchten müssen, sind gemeint, keine religionskritischen Texte, die sich auf dem Index des Vatikans befinden oder gegen die islamische Fundamentalisten hetzen, und auch keine Geheimdossiers, wie sie von WikiLeaks veröffentlicht werden. Reinhard Habeck spürt weit aufregenderen, ja wundersamen Texten nach.
Immer wieder bin ich verblüfft, mit welchem Spürsinn für das Ungewöhnliche und mit welcher Akribie und Fortune der Autor dieses Buches über viele Jahre den »Texten, die es nicht geben dürfte« nachgeforscht hat. Da ich mit meinem Autorenkollegen Reinhard Habeck seit jugendlichen Jahren befreundet bin, konnte ich das Privileg genießen, einige Nachforschungen gemeinsam mit ihm zu betreiben. Was übrigens stets auch ein Vergnügen ist, denn »Meister Habeck«, wie ihn der Kulturwissenschaftler Prof. Roland Girtler nennt, ist nicht nur ein hervorragender Kriminalist des Ungewöhnlichen, er ist zugleich ein äußerst humorvoller Zeitgenosse. Auf den Spuren des Heiligen Grals und des geheimnisumwitterten Templerordens begaben wir uns zusammen mit meinem Bruder, dem Schriftsteller Dr. Johannes Fiebag (1956–1999), mehr als ein Mal auf ungewöhnliche Pfade durch Österreich, durchstöberten alte Bibliotheken und Privatsammlungen, erforschten unterirdische Gänge und alte Klosterkirchen – immer auf der Suche nach verschollenen und verbotenen Texten. Als Germanist freilich weiß ich, dass neben Ausdauer mitunter nur der Zufall oder himmlische Fügung das Gesuchte finden lässt.
Reinhard Habeck erscheint mir dabei ein Kind des Glücks zu sein. Ihm öffnen sich Türen, die sonst verschlossen sind. Menschen erzählen und zeigen ihm Dinge, die sie sorgsam für sich bewahren. Ausgerechnet dort, wo in Innsbruck oder Wien täglich Tausende von Menschen unachtsam an geheimnisvollen Ensembles sprachlicher Zeichen vorbeischauen, ohne sie wahrzunehmen, findet der Wiener Autor Texte, die es in der Tat nicht geben dürfte. Er befragt die ungewöhnlichsten Manuskripte der jüngsten Jahrhunderte, der Renaissance, des Mittelalters, biblischer Zeiten, steigt hinunter in pharaonische Krypten oder hinauf auf Palastruinen versunkener Kulturen, ordnet rätselhafte, mitunter heftig umstrittene Texte historisch und kulturell ein, hinterfragt ihren Sinngehalt, analysiert ihren Wahrheitsanspruch und stellt aufregenden Fakten spannende Theorien gegenüber, die fesseln und zum Weiter- und Weiterlesen zwingen.
Staunend öffnet er die Gewölbekeller von Schrift und Text und zeigt uns, dass wir – trotz all unseres Wissens – nur partielle Alphabeten sind, die noch zahlreiche Geheimzeichen entschlüsseln müssen. So wird das vorliegende Buch zu einem Text, den es unbedingt geben muss! Allen Lesern wünsche ich somit etliche spannende Lesestunden.
Peter Fiebag
Vorweg gesagt: Wissen mit Ablaufdatum
Vorweg gesagt: Wissen mit Ablaufdatum
Nur einen Schmerz haben die Verleger:
Es geht noch immer nicht ohne Schriftsteller.
Peter Hille (1854–1903)
Etwas kann man uns Erdenbewohnern nicht absprechen. Wir leiden an chronischer Kurzsichtigkeit. Wir sind keine »Über-den-Tag-hinaus-Denker«, blicken nicht über den Tellerrand, machen uns kaum Gedanken über die Generationen nach uns. Wie wird die Welt in 10.000 Jahren aussehen? Werden intelligente Lebensformen, so wie wir sie kennen, dann überhaupt noch existieren? Selbst wenn der Homo sapiens allen Katastrophen trotzt, so ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die Welt in ferner Zukunft eine andere sein wird. Der Mensch wird dann entweder durch das Unvermögen seiner Vorfahren in die Steinzeit zurückversetzt worden sein – oder er hat sich weiterentwickelt, besitzt neue, uns heute noch fremde Technologien und hat längst das Sonnensystem besiedelt. Vielleicht würden wir, wenn wir gegenwärtig mit unverstandenem Hightech-Wissen der Zukunftsmenschen konfrontiert wären, dieses als Hokuspokus oder Fantasy bezeichnen. Doch wie könnte eine hypermoderne Spezies des Jahres 12.011 etwa davon abgehalten werden, Wüstengebiete mit vergrabenen radioaktiven Abfällen zu betreten, die ihnen Urahnen – also wir – als tödliches Erbe hinterlassen haben?
Ob dann noch jemand das Englisch unserer Tage verstehen wird? Es darf bezweifelt werden. Genauso fraglich ist, ob die Menschen von übermorgen wissen, was eine CD oder ein USB-Stick ist. Was wäre, wenn die Nachzeit-Archäologen Bruchstücke davon ausgraben würden? Wie würden die Superhirne die »prähistorischen« Funde deuten? Als Speichergerät? Oder doch eher als »Heiliges Amulett für kultische Zeremonien einer untergegangenen Plexiglasgesellschaft«? Selbst wenn der wahre Zweck erkannt würde, bliebe die Frage, wie die Informationen abgerufen werden könnten, wenn zugehörige und funktionstüchtige Abspielgeräte nicht mehr existieren. Das ist ja heutzutage schon ein Dilemma, wie jeder PC-Anwender weiß: Sobald ein neues Dateiformat auf den Markt kommt, was bekanntlich mindestens alle paar Jahre geschieht, können bisher gespeicherte Informationen gefährdet sein, weil sie von den Neuerungen nicht mehr gelesen werden können. Die Haltbarkeit digital gespeicherter Daten ist problematisch. Festplatten wird eine Lebensdauer von 30 Jahren eingeräumt.
Wie könnte man Menschen in 10.000 Jahren etwas Wichtiges mitteilen, etwa die Warnung vor einem atomaren Endlager? Nach fürchterlichen Reaktorunfällen wie 1957 in Kyschtym (Russland) und Sellafield (Großbritannien), 1979 in Three Mile Island bei Harrisburg (USA), 1986 in Tschernobyl (Ukraine) oder zuletzt 2011 mit der Unfallserie in Fukushima (Japan) ist die Sorge berechtigt. Eine Lösung für das Problem gibt es nicht, trotzdem wird gefährlicher Atommüll für zukünftige Generationen als »Erbschaft« angereichert. Nach dem Motto: Nach uns die Sintflut. Ein digitales Vermächtnis als Warnung eignet sich jedenfalls nicht, das wäre bis dahin zerbröselt. Da waren unsere Urahnen mit der »primitiven« Methode, ihren gesammelten Wissensschatz in Stein zu meißeln und somit über Jahrtausende zu erhalten, doch schlauer.
Der amerikanische Sprachwissenschaftler Thomas Sebeok verfasste bereits 1984 eine Studie zum Thema »Communication Measures to Bridge Ten Millennia« und kam zu dem Schluss, dass sich die Sprachentwicklung nicht Jahrtausende voraussagen lässt, dass es keine Formen nonverbaler Kommunikation gibt, deren Bedeutung unwandelbar ist und auch keine Datenträger, bei denen mit Sicherheit angegeben werden kann, dass sie so lange Zeitspannen überstehen können. Wie also sollten bedeutende Informationen der Nachwelt mitgeteilt werden? Woher wüsste sie von der über Jahrtausende wirkenden Strahlengefahr am Beispiel atomaren Mülls? Man kann sie weder schmecken noch riechen noch sehen. Seboek dachte daran, soziale Traditionen zu etablieren, die jede Generation verpflichten würden, die Warnhinweise für die Nachkommen neu zu formulieren. Doch wer könnte dafür garantieren, dass die Botschaft in 10.000 Jahren noch verstanden würde? Darüber dachte der Linguist nach und kam schließlich auf die Idee, dass man eine Priesterkaste gründen müsste, die das Wissen um die Gefahren in Form von Mythen bewahren und weitergeben würde. Nur mit Legenden, die immer wieder neu erzählt und interpretiert würden, so glaubt der Sprachforscher, ließe sich der Respekt vor radioaktiver Strahlung lange Zeit erhalten.
Damit sind wir mitten in der Bewertung sonderbarer Überlieferungen wie den versunkenen Königreichen Atlantis und Lemuria, der Beschreibung vorsintflutlicher Hinterlassenschaften in arabischen Büchern, der Urerinnerung an eine weltumspannende Flutkatastrophe, den Berichten über unverstandene magische Rituale und Zaubersprüche sowie den alten Mythen über außerirdische Kulturbringer, die den Legenden zufolge vor Jahrtausenden von den Sternen zur Erde herabgestiegen waren, um den Menschen ihr profundes Wissen zu vermitteln.
In diese Richtung können auch arabische Texte interpretiert werden, die mehrfach begründen, dass die Pyramiden von Gizeh vor der großen Flut als Wissensspeicher für die Nachwelt erbaut worden sind. Bedenkt man, was allein an mathematischen und astronomischen Daten von der Cheopspyramide abgeleitet werden kann – vom Lehrsatz des Pythagoras bis zur Umlaufbahn der Erde –, so mutet diese Behauptung nicht weniger verrückt an als die amtliche Version vom leeren Grabmal für König Cheops. Die Errichtung einer Zeitkapsel oder eines Datenbunkers für zukünftige Generationen ist zudem ein recht vernünftiger Gedanke, der gerade in unserer verletzbaren hypermodernen Informationsgesellschaft mehr denn je Gültigkeit besitzt.
Wer den Spuren solcher Thesen und Überlieferungen folgt, muss sich von einigen Koryphäen der streitbaren Skeptikerbewegung gefallen lassen, als »Pyramidiot« bezeichnet zu werden. Alles, was auch nur den Anschein erweckt, gängige Lehrmeinungen kritisch zu hinterfragen, andere Sichtweisen aufzuzeigen oder gar Zweifel an bestehenden Dogmen zu äußern, wird abwertend als »pseudoarchäologische Esoterikspinnerei« verunglimpft.
Enthusiasten können sich natürlich in eine Idee verrennen. Das hat es immer wieder gegeben, gilt aber für beide Lager – auch Wissenschaftler sind nicht vor Irrtümern gefeit. Meine Vorstellung von einem skeptischen Zeitgenossen ist: differenziert zu einer Fragestellung stehen, kritisch, aber nicht gehässig sein, eine ergebnisoffene Grundhaltung zu einer kontroversen Debatte einnehmen und die gegensätzlichen Argumente nach ihrer Glaubwürdigkeit hinterfragen. Ein angenehmer Charakterzug, den manche selbst ernannten Wissenschaftspolizisten auf entsprechenden Internetforen vermissen lassen.
Schon vor drei Jahrzehnten wies der deutsche Parapsychologe Professor Hans Bender (1907–1991) darauf hin, dass begeisterte Okkultgläubige und militante Skeptiker die gleiche Persönlichkeitsstruktur besitzen: Beide Gruppen mit fanatischer Ausprägung sind rationalen Argumenten gegenüber nicht zugänglich, weil sie überzeugte Gläubige sind, wenn auch jeweils mit unterschiedlichem Vorzeichen. Gegen konstruktive Kritik, die mit guten Sachargumenten und logischen Gegenbeweisen überzeugen will, wird es keine Einwände geben. Ideologisch geprägte Rationalisten, die vieles nicht genau, aber alles besser wissen und letztlich nur ihre persönliche Weltanschauung als einzige Wahrheit akzeptieren können, sind dagegen weder hilfreich noch ernst zu nehmen.
Es darf keine Denkverbote geben. Faktum ist, dass z. B. eine ganze Reihe arabischer Dokumente über den prädynastischen Ursprung der Pyramiden von Gizeh berichtet. Es ist legitim, diese Legenden als »Märchen aus Tausendundeiner Nacht« abzutun. Das ist bestimmt der bequemere Standpunkt. Doch ebenso legitim ist es, den orientalischen Mythen die Chance zu geben, vielleicht doch wahr zu sein.
Auf den folgenden Seiten präsentiere ich fantastische und ungelöste Schriftpassagen von der Steinzeit bis zur Gegenwart, die eines gemeinsam haben: Sie sind unglaublich, aber wahr! Zweifler können die Originalquellen prüfen und sich ihren Reim darauf machen – oder das Staunen lernen!
Reinhard Habeck
P.S.: Um gewitzten Kritikern vorzubeugen: Nein, mit »Texte, die es nicht geben dürfte« sind freilich nicht die Werke des Autors gemeint.
Verlorenes Wissen
Es gibt zwei schöne Dinge auf der Welt: Erinnern und Vergessen.
Und zwei hässliche: Erinnern und Vergessen.
Sándor Rosenfeld (»Roda Roda«) (1872–1945), österreichischer Humorist
Unlesbare Schriften und weltumspannende Kulturkontakte im Altertum
Am Anfang war das Wort, so lautet eines der bekanntesten Bibelzitate. Aber wann genau war dieser Anfang? Warum haben unsere Urahnen einst begonnen, miteinander zu reden?
Dies sind nicht irgendwelche Fragen, es sind die Schlüsselfragen der Evolution, die uns Menschen von allen anderen Erdgeschöpfen unterscheidet. Bis heute ist es immer noch ein Rätsel, wie aus primitiven Grunzlauten die ersten sinnvollen Wörter entstanden sind und sich in der Folge eine komplexe Sprache entwickelt hat. Waren es zunächst einfache Töne und imitierte Tierlaute, wie der britische Naturforscher Charles Darwin (1809–1882) glaubte, die dann mit Bedeutungen belegt wurden? Oder verständigten sich die Urmenschen anfangs mit einer Art Gebärdensprache, bevor sie zur Lautsprache wechselten? Oder war es so wie die amerikanische Anthropologin Dean Falk vermutet, dass Mütter die ersten Stimmen erfanden, um ihre Säuglinge zu beruhigen? Aber wie konnten sich daraus später die verschiedenen Sprachsysteme der Welt entwickeln?
Die Fähigkeit des Menschen, mit Gleichgesinnten zu kommunizieren, führt zum Frühmenschen, zum Homo erectus. Diese Spezies lebte bereits vor zwei Millionen Jahren und war die erste, die Afrika verließ, Feuer machte, Behausungen baute, das Knüpfen von Knoten beherrschte und seefahrend unterwegs war. Für diese kulturelle Evolution muss der Homo erectus bereits eine Sprachform genutzt haben, anders wären seine Eroberungen nicht erklärbar. Trotz seiner Vielseitigkeit gelang es dem Urahn aber nicht, sich in die Neuzeit hinüberzuretten. Als vor rund 150.000 Jahren der »vernunftbegabte« Homo sapiens die Weltbühne betrat, verdrängte er sämtliche Konkurrenten für immer. Letztes Opfer war der robuste, aber keineswegs einfältige Neandertaler. Jüngsten Studien zufolge könnte dieser Menschentyp als kleine Population noch vor 12.000 Jahren in Mitteleuropa gelebt haben. Würde man heute ein lebendes Exemplar in einen klassischen Herrenanzug stecken, ihm eine adrette Krawatte um den Hals binden und zum Hairstylisten schicken, dann wäre der dicke Steinzeitler im hektischen Großstadtdschungel von betriebsamen Geschäftsleuten nicht zu unterscheiden.
Der Zeitpunkt seines endgültigen Verschwindens fällt etwa mit dem Ende der letzten Eiszeit zusammen. Das Klima auf der Nordhalbkugel des Globus wurde wärmer, die Gletscher schmolzen und die modernen Jetztmenschen begannen sesshaft zu werden, gründeten größere Siedlungen und entdeckten die Landwirtschaft. Der Klimawandel förderte eine Veränderung bisheriger Lebensweisen, aus Jägern und Sammlern wurden Bauern.
Das Bergheiligtum von Göbekli Tepe im Südosten der Türkei irritiert Archäologen: Die Anlage entstand vor rund 12.000 Jahren und enthält auf Riesenmonolithen »heilige Schriftzeichen«. (Bild:www.templestudy.com)
In dieser revolutionären Epoche entwickelten sich nicht nur Viehzucht und Ackerbau, es entstanden ebenso gewaltige Monumentalbauten, wie die südanatolischen Pfeilerkolosse von Göbekli Tepe beweisen. Sie sind mit ausdrucksstarken Piktogrammen übersät, die so angeordnet sind, dass sie nicht nur der Verzierung gedient haben können. Verblüffte Archäologen sind überzeugt davon, dass die abstrakten Zeichen eine steinzeitliche Botschaft enthalten, die für uns unergründlich bleibt. Wir wissen auch nicht mit Sicherheit, wann, wo und durch welchen Geistesblitz Sprache erstmals fixiert wurde.
Eines aber ist unbestreitbar: Der prähistorische Erfinder der ersten Schriftzeichen muss ein Superhirn gewesen sein. War es ein Ägypter? Ein Sumerer? Oder keiner von beiden? Laut traditioneller Lehrmeinung bilden die vor über 5000 Jahren entstandene mesopotamische Keilschrift und die etwa zeitgleich entstandenen ägyptischen Hieroglyphen den Beginn sprachlich gestützter Schrift. Wenn das stimmt, wieso lassen sich dann schriftartige Zeichen auf Knochen und Felsen, die offenbar der Information und Verständigung gedient haben, bereits aus Jahrtausenden vorher aufspüren?
Wissenschaftler wollen rund 7000 Sprachen ermittelt haben, die sich heute auf alle Kontinente verteilen. Sind sie wirklich unabhängig voneinander entstanden? Oder wäre es ebenso gut möglich, dass die erste sprachliche Verständigung und die daraus entfalteten ältesten Schriftzeichen einer gemeinsamen, global verbreiteten »Ur-Mutter-Sprache« entsprungen sind? Wieso zeigen steinzeitliche Felsgravuren in geografisch weit auseinander liegenden Erdteilen auffallende Übereinstimmungen? Nur universelle Zufälligkeiten und archetypische Erinnerungen aus dem kollektiven Unbewussten aller Menschen? Oder gab es bereits einen frühen kulturellen Informationsaustausch über die Weltmeere hinweg, von dem wir heute nichts mehr wissen?
Vergessenes Kulturerbe
Was verraten uns mysteriöse Zeichen und farbenfrohe Symbole, die Menschen der Eiszeit an Höhlenwände pinselten, die aussehen, als wären es Bilder von Picasso? Das globale Phänomen ist besonders in der Region Südeuropas verbreitet. Die ältesten Kunstwerke sind 36.000 Jahre alt. In der 1994 entdeckten Chauvet-Grotte, nahe der südfranzösischen Kleinstadt Vallon-Pont-d’Arc, befinden sich die spektakulärsten Bildmotive.
Während der eiszeitlichen Periode kam es zu genialen Erneuerungen: erstaunlich genaue Mondkalender, ausgeklügelte Zahlensysteme, perfekte Musikinstrumente, raffinierte Werkzeuge und vollplastische Statuetten wie die berühmten Venusfigurinen sind nur einige der vielen großartigen Errungenschafen. Doch woher kam der »göttliche Funke«, der den Wendepunkt in den altsteinzeitlichen Kulturen bedeutete? Wir wissen es nicht. Belegt ist aber, dass bereits viele Jahrtausende früher rätselhafte Felszeichnungen im freien Gelände entstanden sind, die geritzte, gehauene oder gemalte Petroglyphen enthalten. Manchmal lassen sich diese Markierungen auf tierischen Überresten finden, so etwa auf Knochen, Muscheln oder Schnecken. Die ältesten anerkannten Ornamente stammen aus der südafrikanischen Blombos-Höhle (vor 75.000 Jahren) und der Skhul-Höhle (vor 100.000 Jahren) in Israel. Die Entdeckungen belegen, dass bereits in grauer Vorzeit die abstrakte Ausdruckskraft hoch entwickelt war. Die Zeichen sind keinesfalls zufällig entstanden, sondern folgen einem strengen Schema.
Wie sind die meist als »primitiv« bezeichneten Symbole zu interpretieren? Die Fachwelt konnte bislang keine allgemeingültige These dazu anbieten. Wurden sie als Beschäftigungstherapie oder aus Langeweile geschaffen? Haben die prähistorischen Wunder lediglich Dekorationscharakter und sind Ausdruck natürlicher Triebe? Stehen die Zeichen und Bilder in Beziehung zu schamanistischem Jagdzauber und übernatürlichen Vorstellungen? Waren es Beschwörungsformeln, entstanden in Trance? Oder haben wir es mit magischen Bildern für Initialriten zu tun? In Bezug auf große Höhlengemälde mag diese Überlegung vielleicht zutreffen. Was aber ist von den vielen kleinen geometrischen Mustern zu halten? Sie sind häufig eher unscheinbar neben Darstellungen von Tieren, seltener neben Menschen und Mischwesen verewigt worden, darunter Halbkreise, gerade Linien, Zickzacklinien, Kreuze, Pfeile, Spiralen oder einfache Punkte in abwechselnder Vielfalt. Originell sind gerade Linien mit einer aufgesetzten Kuppel, die in unterschiedlicher Größe und Anordnung wie fliegende Untertassen zwischen Tierbildern zu schweben scheinen. Am Deckengewölbe der Grotte von Altamira und anderen nordspanischen Höhlen sind diese »UFO-Bilder« besonders zahlreich angebracht worden. Ein anderes häufig wiederkehrendes Motiv sind Handzeichen mit unterschiedlicher Fingeranzahl.
Versuche einer ersten Sprachfixierung? Vorstufen der Schrift? Prähistoriker können das nicht so recht glauben, hieße es doch, dass der Beginn der »kreativen Explosion«, der den Aufstieg zur Zivilisation ermöglichte, Zehntausende Jahre weiter in die Vergangenheit zurückverlegt werden müsste. Und doch spricht vieles dafür, dass den Markierungen ein logisches Informationssystem zugrunde liegt, das dem Gebrauch von Schrift ziemlich nahe kommt. Diese Theorie fand neue Unterstützung durch ein Projekt der kanadischen University of Victoria in British Columbia. Die Altsteinzeit-Forscherinnen Genevive von Petzinger und April Nowell legten 2010 eine Studie vor, die sämtliche sonderbare Zeichen von 146 französischen Fundstätten in einer Datenbank miteinander verglichen hat. Die Entstehung der Steinzeit-Graffitis umfasst das Zeitfenster zwischen 35.000 bis 10.000 Jahren v. Chr.
Die Überraschung: 26 Zeichen, alle im selben Stil gemalt, erscheinen immer wieder an verschiedenen Kultplätzen. Eine neue Einsicht, die gar nicht so neu ist. Schon in den 1960er- und 1970er-Jahren hatten Mysterienforscher wie Marcel Homet, Erich von Däniken, Peter Kolosimo oder Robert Charraux darauf aufmerksam gemacht. Die Querdenker wurden von der etablierten Gelehrtenwelt ignoriert und belächelt. Nun wird die These eines geschriebenen Höhlen-Codes auch vermehrt in akademischen Archäologenkreisen diskutiert. Offenbar haben Eiszeitkünstler eine Bildsprache entwickelt und genutzt, die allen prähistorischen Stämmen im heutigen Frankreich (und wahrscheinlich ebenso in noch weiter entfernt liegenden Gebieten) verständlich war.
Manche Bildwerke sind paarweise angebracht, was wiederum als Indiz für eine frühe piktografische Schrift angesehen werden kann. Von Petzinger und Nowell wiesen überdies darauf hin, dass weltweit auf Felswänden identische Merkmale zu finden sind, allerdings sind diejenigen in Europa die ältesten.
Es gibt noch andere ungeklärte Indizien, die für eine Höhlenschrift – Jahrtausende vor der eigentlichen Erfindung der Schrift – sprechen. Dazu zählen Kieselsteine aus der südfranzösischen Höhle von Mas d’Azil. Sie sind mit farbigen Punkten und geometrischen Linien bemalt, die verblüffend an Buchstaben des phönizischen, griechischen und lateinischen Alphabets erinnern. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn die Kieselsymbole entstanden vor 14.000 Jahren. Solche Kalksteinplättchen wurden inzwischen an vielen europäischen Orten entdeckt, in Birseck bei Basel in der Schweiz genauso wie in der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg oder in der Klausenhöhle in Bayern.
Die skurrilsten Funde stammen aus der La Marche-Höhle in Südfrankreich: Hunderte gravierte Kalksteintäfelchen mit Karikaturen von Menschen und Tieren! Wie es vor rund 16.000 Jahren möglich war, dass jemand diese Porträtgalerie auf Stein bannen konnte, ist ein ungelöstes Rätsel. In Fachkreisen schwebt deshalb der Fälschervorwurf im Raum. Damit sind Wissenschaftler immer schnell bei der Hand, wenn außergewöhnliche Artefakte nicht ins vertraute Schema passen wollen. Der Archäologe Nicolas Mélard ist dennoch von der Echtheit der komischen Relikte überzeugt. Er hat sie jahrelang untersucht und versichert: »Sie sind hundertprozentig keine Fälschung, auch wenn einige Stücke sehr überraschende Motive aufweisen.«
Eine andere anonyme Hinterlassenschaft ist in der Höhle von La Pasiega im nordspanischen Kantabrien erhalten. Die 400 Meter lange Grotte ist in vier Abschnitte unterteilt, die aufgrund ungleicher Bildmotive jeweils eine unterschiedliche Funktion gehabt haben dürften. Die für die Öffentlichkeit gesperrte Höhle besitzt die meisten Malereien der iberischen Halbinsel. Neben 291 Tierzeichnungen und 134 anderen figürlichen Motiven gibt es jede Menge unverstandener Symbole und Markierungen, die bildschriftliche Eigenarten aufweisen, besonders deutlich auf der linken Seite einer Felswand, wo sich der Durchgang zur Haupthöhle verengt. Die komplexe Anordnung der Zeichen ist so bestimmend an der Pforte angebracht, dass sie als Warnung für ungebetene Eindringlinge verstanden werden kann. Sinngemäß könnte der Text lauten: »Unbefugten ist der Zutritt in den heiligen Bezirk verboten!«
Ob die »Inschrift« tatsächlich so »gelesen« werden darf, bleibt freilich Spekulation. Keine noch so kluge Koryphäe, die die Wurzeln der Zivilisation erforscht hat, war vor 14.000 Jahren persönlich dabei, als die Symbole am Zugang zur Grottenpforte aufgemalt wurden.
Beim Betrachten dieser und all der anderen eiszeitlichen Aufzeichnungen drängt sich auch immer wieder der Gedanke auf, dass uns die bunten Bildwerke packende Geschichten erzählen wollen. Der Wunsch, etwas festzuhalten und Ausgesprochenes bewusst in einer bilderschriftähnlichen Form zu fixieren, existierte offenbar schon damals. Warum also sollte die Steinzeitkunst nicht tatsächlich textliche Botschaften enthalten, die dazu geschaffen wurden, erste dauerhafte Informationen an spätere Generationen weiterzugeben? Ob man der These folgen möchte oder nicht, eine Schlüsselfrage provoziert Forscher beharrlich in aller Welt: Was bedeuten die vielen Kerben, Striche, Punkte und Kreise, die scheinbar geplant und durchdacht auf Felswänden angebracht worden sind?
Nun, es bedeutet, dass wir in einer Sackgasse sind. Denn um die Nachrichten aus der Altsteinzeit zu verstehen, müssten wir neben den Bildsymbolen auch das Gesprochene kennen oder einen urzeitlichen Stein von Rosetta besitzen, der uns die unverstandenen Werke dechiffriert. Dazu fehlt aber leider jeder Anhaltspunkt. Die verlorene Symbolwelt und der rituelle Nachlass der Eiszeitsuperhirne bleibt eines der großen ungelösten Rätsel der Menschheit.
Wird es Prähistorikern, Felsbildarchäologen und Sprachforschern irgendwann gelingen, die aufgemalten und eingeritzten Erinnerungen unserer Urahnen zu entschlüsseln? Das ist trotz redlicher Bemühungen nicht sehr wahrscheinlich. Die Problematik des Wissensverlustes und der Sprachlosigkeit ist allgegenwärtig. Verliert ein Volk seine Sprache, ist auch sein kulturelles Erbe bedroht. Was bleibt, sind irgendwann bestenfalls mythologische Erzählungen einer versunkenen Epoche. Selbst wenn Gegenstände oder andere Spuren der Existenz erhalten geblieben sind, nützt das herzlich wenig, wenn wir ihren eigentlichen Sinn nicht begreifen können.
Wissenschaftler schätzen, dass weltweit alle vier Wochen eine Sprache ausstirbt. Das liegt an der Anzahl der Personen, die eine Sprache aktiv sprechen und kann sehr stark abweichen. Fast eine Milliarde Asiaten sprechen Mandarin-Chinesisch. Anders ist die Situation bei Naturvölkern, wo nur mehr ein paar Tausend Einheimische ihre Muttersprache beherrschen. Hier ist das kulturelle Gedächtnis der Ahnen gefährdet. Das wissen auch die Pygmäen im zentralafrikanischen Gabun. Sie geben einen poetischen Vergleich, der haargenau ins Schwarze trifft: »Wenn bei uns ein alter Mann stirbt, sagen wir, eine Bibliothek ist abgebrannt.«
Besonders dramatisch ist die Situation in Lateinamerika. Seit der Eroberung der Spanier im 16. Jahrhundert sind 141 indigene Sprachen und Dialekte in Mexiko ausgestorben. 36 noch existierende könnte demnächst das gleiche Schicksal ereilen, so z. B. Mocoritisch, Zacatekisch, Potlapigu oder Guazapar. Tragisch ist der Fall von Ayapaneco. Diese akut vom Aussterben bedrohte Sprache wird 2011 nur mehr von zwei Mexikanern fließend gesprochen. In der eigenen indigenen Sprache wird sie »Nuumte Oote« genannt und bedeutet übersetzt »Wahre Stimme«. Forscher der Universität Indiana sind verzweifelt. Denn obwohl der 75-jährige Manuel Segovia und der 69-jährige Isidro Velazquez nur einen halben Kilometer voneinander entfernt in Ayapa im Bundesstaat Tabasco leben, wechseln sie kein Wort miteinander. Velazques ist im Gegensatz zu Segovia stoisch ruhig und verlässt sein Haus überhaupt nicht. Der Eigenbrötler spricht mit den Wissenschaftlern nur, wenn er Lust dazu hat.
Umgekehrt, wenn auch viel seltener, können ebenso unbekannte Sprachen entdeckt werden. Der jüngste Fall stammt aus dem Jahre 2010. Damals stießen amerikanische Forscher in einer abgelegenen Gebirgsregion des nordindischen Staates Arunachal Pradesh auf eine ihnen unbekannte Sprache namens Koro. Sie zählt zur tibetisch-birmanischen Sprachfamilie und wird noch von etwa 1000 Menschen gesprochen. In den Dörfern, in denen Koro entdeckt wurde, ist eigentlich Aka die dominierende Sprache, die jedoch völlig anders ist. Sie war die Sprache der Sklavenhändler. Ethnologen vermuten daher, dass Koro der geheimen Verständigung der Sklaven untereinander diente.
Wie lange wird es noch dauern, bis wieder ein Kulturerbe verloren gegangen ist? Wie wird es mit unserer Zivilisation weitergehen? Was wird von der überdigitalisierten Informationsgesellschaft in ferner Zukunft an gescheiten Wortgefügen erhalten bleiben? Wenn man den römischen Kaiser Marc Aurel (121–180 n. Chr.) zu Rate zieht, wird nichts erhalten bleiben, prophezeite er doch spöttisch: »Bald – und du hast alles vergessen. Bald – und alles hat dich vergessen.«
Alteuropäischer Schriftgebrauch vor der Erfindung der Schrift
Wann sind schriftartige Symbole Ausdruck einer echten Schrift? Im engeren Sinne dann, wenn ein System festgelegter Zeichen verschiedene Informationen enthält, die in Beziehung mit ausgesprochenen Silben, Wörtern und Satzbegriffen stehen. Das soll erstmals in Südmesopotamien (heute Gebiete im Irak) geschehen sein, als um 3600 v. Chr. die ersten Stadtstaaten entstanden. Damit einhergehend benötigten Menschen ein Medium zur Verwaltung von Waren und Steuern. Aus Zählsteinen für Schafe und Weinamphoren, so die verbreitete These, entstand um 3200 v. Chr. die Keilschrift, bei der mit einem Binsenrohr Bildzeichen in Tontafeln gedrückt wurden. Erst um 2600 v. Chr. sei aus der ersten Bilderschrift eine Silbenschrift entstanden, in der die Zeichen Lautwerte bekamen. Mit dieser grandiosen Idee war es nun möglich, Sprache, Gedanken und Nachrichten über Raum und Zeit zu übermitteln. Dass die Sumerer wirklich die Ersten waren, die eine sprachlich gestützte Schrift erfunden haben und als Kommunikationssystem nutzten, wird heute vielfach angezweifelt. Hieroglyphen aus Abydos in Ägypten, die nachweislich Sprache wiedergeben, sind ein paar Jahrhunderte älter. Die Erkenntnisse führten zu einem Meinungsdisput unter Ägyptologen, Altorientalisten und Philologen, der seit Jahrzehnten anhält. Halten wir zunächst fest: Die ältesten wissenschaftlich anerkannten Schriftsysteme sind mehr als 5000 Jahre alt.
Doch abgesehen von den ägyptischen Hieroglyphen und der Keilschrift existieren außergewöhnliche Funde untergegangener Reiche, die teilweise älter sind, aus anderen Regionen stammen und bereits schriftartigen Charakter aufweisen. Die Fachwelt bestreitet nicht, dass diese Zeichen eine Botschaft enthalten. Aber ist wirklich eine Sprache beschrieben und abgebildet worden? Wenn ja, sind es Logogramme, Silbenzeichen oder bereits alphabetische Buchstaben? Wie nicht anders zu erwarten, sind sich die Spezialisten in dieser Frage uneins. Das Dilemma bei der Analyse ist dasselbe wie beim Steinzeit-Code der Höhlenkünstler: Da die Sprachen der vergangenen Kulturen unbekannt sind, können auch ihre hinterlassenen Schriftzeichen nicht gelesen werden.
Die 1908 entdeckte alteuropäische Vinča-Kultur ist ein solcher Streitfall. Sie wurde nach dem kleinen Ort Vinča in Serbien benannt, der rund 14 km östlich von Belgrad liegt. Der Einfluss dieser ureuropäischen Zivilisation, deren Anfänge ins 7. Jahrtausend vor unserer Zeit zurückreichen, umfasst Gebiete in den heutigen Staaten Ungarn, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Nordgriechenland. Bei den Ausgrabungsstätten wurden zahlreiche Scherben, Tontafeln, Spindeln (runde Plättchen mit einem Loch in der Mitte) und Keramikfiguren gefunden. Das Ungewöhnliche daran ist, dass alle Artefakte fremdartige Inschriften tragen. Skeptiker halten sie für Besitzzeichen oder Töpfermarken. Dagegen spricht: Neben Markierungen, die man als Zahlenwerte und Maßeinheiten deuten könnte, gibt es mehr als 200 unterschiedliche Zeichen, die in Kombination mehrfache Verwendung fanden.
Die meisten Beschriftungen sind kurz und enthalten nur wenige Symbole. Man könnte sie für eine Vorläuferschrift mit fixierten Wörtern halten, wären da nicht ebenso Kunstwerke mit vielen Gravuren vorhanden. Es sind Einzelstücke, aber es gibt sie. Ein solches Beispiel liefern wenige Zentimeter große Tontafeln aus der rumänischen Ausgrabungsstätte Tartaria in der Grafschaft Alba. Die darauf gravierten Inschriften erinnern stark an frühe Piktogramme aus Mesopotamien. Eine Zeit lang herrschte unter Gelehrten deshalb der Verdacht, Einwanderer aus dem Nahen Osten könnten den Alteuropäern die Schreibkunst übermittelt haben. Inzwischen wissen wir, dass die meisten Vinča-Zeichen bereits wesentlich früher und aller Wahrscheinlichkeit nach ohne fremden Einfluss entstanden sind. Ein Großteil der beschrifteten Relikte stammt aus Vinča selbst. Sie werden ins 6. Jahrtausend v. Chr. datiert.
Votivtafeln aus Tartaria in Rumänien, die um 5300 v. Chr. entstanden sind. Die älteste Schrift der Welt? (Bild: Marija Gimbutas)
Für die litauische Prähistorikerin Marija Gimbutas (1921–1994) und andere Sprachexperten sind die Gravuren einwandfrei als Anmerkungen eines logisch aufgebauten Schriftsystems zu deuten. Sie müssen einem sakralen Zweck gedient haben, denn alle beschrifteten Objekte wurden außerhalb der Siedlungsgebiete an Kultplätzen und Begräbnisstätten gefunden. Doch weshalb wurden die Tafeln und Statuetten mit Texten versehen?
»Das Schreiben stand im Zusammenhang mit religiösen Zeremonien, so mit der Anrufung einer Gottheit, mit Fruchtbarkeitsritualen, mit Opferhandlungen, Bestattungsriten und dem Ahnenkult«, vermutet der deutsche Sprach- und Kulturwissenschaftler Harald Haarmann. Eine Sakralschrift, die von Eingeweihten nur zu dem Zweck entwickelt wurde, mit Göttern in Kontakt zu treten? Was war die Veranlassung dafür? Welchem überirdischen Wesen wurde gehuldigt?
Marija Gimbutas erblickte in den Fundsachen Gemeinsamkeiten mit der griechischen Mythologie und den Glaubensvorstellungen von Muttergottheiten in Anatolien. Eine feminine Fährte, die sich mit der These des amerikanischen Universitätsprofessors Toby Griffen deckt. Er will einige »Wortfetzen« der Vinča-Sprache entziffert haben. Der Sprachforscher untersuchte, in welchem Zusammenhang die einzelnen Zeichen auftreten. Dabei stellte er fest, dass diverse Bildsymbole auf runden Spindelköpfen und Tonfigürchen mehrmals vorkommen: Bären, Vögel oder Menschen mit Bären- und Vogelmasken sowie ein wiederkehrendes Zeichen, das Griffen als »Göttin« deutet. Es muss eine wichtige Bedeutung gehabt haben, denn auf einigen Utensilien ist es umrahmt. So entstand eine Wortfolge, die als »Bär – Göttin – Vogel – Göttin – Bär – Göttin – Göttin« gelesen werden kann. Griffen bildetet daraus den Satz »Die Bärengöttin und die Vogelgöttin sind wirklich die Bärengöttin«, anders formuliert: »Die Bärengöttin und die Vogelgöttin sind eine Göttin, nämlich die Bärengöttin.«
Dies scheint zunächst keinen Sinn zu ergeben, für Toby Griffen jedoch sehr wohl. Der Linguist erkennt eine Übereinstimmung mit der Mythologie der Griechen. Dort erfahren wir, dass die Jagdgöttin Artemis (bei den Etruskern heißt sie Artumes, später bei den Römern Diana) aus älteren Jagd- und Vogelgottheiten hervorgegangen sein soll. Erzählt wird, ihr Bärenwesen habe dominiert und ihr Vogelwesen habe schließlich an Bedeutung verloren. Antike Überlieferungen wissen außerdem, dass Artemis bei Initialriten eine Rolle spielte, wobei junge Frauen als Bärinnen auftraten. Die Göttin wurde als Ernährerin aller Lebewesen verehrt und galt als Hüterin der Frauen und Kinder. Ihre Spuren lassen sich bis zur Gründung der antiken Stadt Ephesos vor fünf Jahrtausenden zurückverfolgen. Die der Göttin zugeschriebene Fruchtbarkeitssymbolik findet sich vielfach auch in den Zeichen der Vinča-Schrift nebeneinander abgebildet: Bärentatze und Vulva.
Ist es reiner Zufall oder könnte der Artemis-Kult im alten Europa seinen Anfang genommen haben?
Es gibt einen weiteren Hinweis, der von Belang sein könnte: Das geheimnisvolle Urvolk der Kelten, das in der Eisenzeit mit der Hallstatt-Kultur seine Hochblüte erlebte, kannte ebenfalls eine Bärengöttin. Ihr Name ist jenem der Artemis nicht unähnlich und lautet Artio, abgeleitet von Artos, dem gallischen Wort für »Bär«. Im französischen Département Drôme fanden sich außerdem mehrere Inschriften der Göttin Andarta. Übersetzt bedeutet ihr Name »Große Bärin«. Nun passt das zeitlich und geografisch nicht ganz mit der Vinča-Kultur zusammen. Andererseits: Ursprung und Herkunft der Kelten sind noch nicht ermittelt. Was war vor dieser zentraleuropäischen Hochkultur?
Donaugötter, Granitbälle und Pyramidenrätsel
Siedlungsgebiete der Kelten waren in der Antike weit verbreitet, auch am gesamten Balkan und sogar bis nach Anatolien. Das war im 4. Jahrhundert v. Chr. Folgt man dem bekannten Geschichtsbild, so waren die Vinča Jahrtausende vor den Kelten am Balkan. Aber sollte man von einem schriftkundigen Steinzeitvolk nicht erwarten dürfen, dass es noch ganz andere Schätze seiner Zivilisation hinterlassen hat als ein paar Tausend Scherben mit unverständlichen Zeichen? Es gibt in der Region einige spektakuläre Entdeckungen, die mit einer Vor-Zivilisation in Südosteuropa verbunden werden. Dazu gehören die Funde von Lepenski Vir in der serbischen Gemeinde Majdanpek im Grenzgebiet zu Rumänien. Als 1965 bei Regulierungsarbeiten eines Dammes bemalte Keramiken, Steinplatten mit eingeritzten Jagdszenen und gravierte Gewandnadeln aus Knochen zutage gefördert wurden, waren sich Archäologen noch nicht über die wahre Bedeutung der Funde im Klaren. Erst gezielte Ausgrabungen in den Folgejahren brachten Gewissheit: Man war auf uralte Siedlungsspuren einer unbekannten Kultur gestoßen, die in der Epoche von 7300 bis 4800 v. Chr. am Donauufer angesiedelt war. Das recht fortschrittliche Steinzeitvolk muss bereits ferne Handelsbeziehungen gepflegt haben, denn etliche Artefakte, darunter Schmucksteine, Perlen und Muschelschalen, stammen ursprünglich aus dem Norden Ungarns, dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer.
Die seltsamste Entdeckung waren Steinskulpturen, die himmelwärts zu den Sternen blicken. Ihre Bedeutung ist nach wie vor ungeklärt, auch wenn einige Archäologen »anthropomorphe Abbilder von Donaugottheiten« darin erkennen wollen. Inzwischen wurden vor allem auf rumänischer Seite zahlreiche Häuserfundamente und Bestattungsplätze freigelegt. Sie liegen auf terrassenförmig angelegten Ebenen und haben eine verblüffende Architektur: Heime, Altäre und Gräber sind in ihren trigonometrischen Grundrissen so angeordnet, dass sie exakten Trapezmustern und gleichschenkligen Dreiecken entsprechen. Die bedeutende Sammlung kann sowohl im Lepenski Vir Museum vor Ort (15 km entfernt von Donji Milanovac nahe der Straße Richtung Pozareva) besichtigt werden als auch im Nationalmuseum von Belgrad und im Archäologischen Museum Djerdap in Kladovo. Mit neuen Erkenntnissen darf gerechnet werden, denn: »Es sind bei Weitem nicht alle Siedlungen der Lepenski-Vir-Kultur in ihrer Gänze erforscht, geschweige denn publiziert«, weiß die deutsche Donau-Archäologin Valeska Becker.
Dies führt zu einem anderen Steinrätsel, über das aufmerksame Wanderer in Serbien und Bosnien-Herzegowina gelegentlich stolpern können: Geglättete Steinkugeln in unterschiedlicher Größe – von der eines Medizinballes bis zu zwei Metern Durchmesser – und mit einem Gewicht bis zu mehreren Tonnen. Sie liegen verstreut in der Landschaft herum oder am Ufer von Flussbetten. Man mag vermuten, dass die perfekten Kugeln über Jahrmillionen durch natürliche Auswaschungen entstanden oder im Zuge von Gletscherverschiebungen weitertransportiert und nach der Eisschmelze an ihren heutigen Plätzen »abgelegt« wurden. Solche Findlinge gibt es freilich, jedoch sind sie nicht gemeint. Die Steine des Anstoßes müssen anders entstanden sein. Sie wurden einwandfrei mit Werkzeugen bearbeitet, und zwar so vollkommen rund geschliffen, dass man annehmen könnte, sie kommen soeben aus der Kugelmühle.
Das Phänomen der mysteriösen Granitbälle ist aus etlichen Regionen der Erde bekannt, wird aber besonders mit dem Karibikstaat Costa Rica verbunden. Dort konnten etwa 400 Fundplätze lokalisiert werden, ohne dass jemand erklären kann, woher die Dinger stammen. Das genaue Alter zu ermitteln ist nicht möglich, es wird aber ein prähistorischer Ursprung angenommen. Einige Exponate sind mit bizarren Gravuren verziert, die Archäoastronomen mit Sternbildern und einem astrologischen Kalender in Beziehung setzen. Ob die fantastische These eines prähistorischen Sternenkultes zutrifft und die Kugeln gezielt an topografisch bedeutsamen Plätzen positioniert worden sind, lässt sich nicht belegen. Wenige Stücke befinden sich noch am ursprünglichen Standort. Viele wurden beschädigt oder sind zu Dekorationszwecken entwendet worden.
In Costa Rica gibt es Hunderte perfekt geschliffene Steinkugeln, manche bis zu 2 m Durchmesser. In den letzten Jahren sind ähnlich mysteriöse Granitbälle in Serbien und Bosnien-Herzegowina aufgetaucht. Woher die im Gelände verstreuten Felsobjekte kommen, weiß trotz zahlreicher Spekulationen niemand. (Bild: Archiv R. H., Quelle: wikipedia)
Im alten Siedlungsgebiet der Vinča-Menschen ist die Situation nicht viel anders. In der Republik Bosnien-Herzegowina, die einst die westliche Grenze dieser südosteuropäischen Steinzeitkultur war, sind mehr als 40 polierte Riesenkugeln aus Stein entdeckt worden. Der Großteil der Funde konzentriert sich im Umfeld der Stadt Visoko, nordwestlich von Sarajewo. Hier erhebt sich ein auffälliger, 220 m hoher Berg, genannt Visočica, der eine pyramidenartige Symmetrie aufweist. Im Jahre 2005 sorgte der bosnische Unternehmer und Forscher Semir Osmanagić mit einer provokanten These für weltweites Aufsehen. Seiner Ansicht nach verbirgt sich unter der dichten Vegetationsschicht ein künstlich errichtetes Bauwerk, das von prähistorischen Meisterarchitekten geschaffen wurde. Die europäische Monumentalpyramide wäre damit bei Weitem höher als die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Für die traditionelle Archäologie ist diese Möglichkeit unvorstellbar. Doch Osmanagić kann auf Grabungsbefunde, Vermessungsresultate und seismische Anomalien verweisen, die gegen eine natürliche Hügelform sprechen: Die Seiten des pyramidenförmigen Berges haben einen Neigungswinkel von 45 Grad und sind exakt nach Nord-Süd und Ost-West ausgerichtet, so wie viele große Pyramidenbauten. Das Zugangsplateau besteht aus bearbeiteten, stufenförmigen Platten, ähnlich den Pyramiden in Mexiko. Satellitenbilder und topografische Luftaufnahmen haben drei weitere »verdächtige« Hügelstrukturen aufgespürt, die in geodätischer Beziehung zur Hauptpyramide stehen.