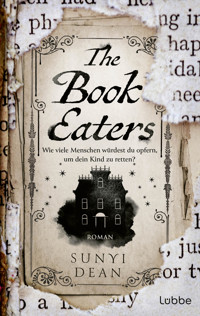
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In den Mooren Yorkshires lebt eine geheime Gruppe von Menschen, für die Bücher Nahrung sind, die alles verschlingen, was darin steht. Devon gehört dazu - bis ihr Sohn mit einer dunkleren Art von Hunger geboren wird: nicht nach den Geschichten in Büchern, sondern nach denen in den Köpfen der Menschen. Er ist ein 'Seelenfresser', eine 'Abart', die meist schon bei der Geburt gnadenlos getötet wird. Doch Devon schwört ihn zu retten und flieht mit ihm in die Welt der Menschen, verfolgt vom eigenen Clan und seinen schrecklichen Handlangern, den ‘Rittern’. Um zu überleben, ist sie gezwungen, schlimme Dinge zu tun. Hoffnung verspricht nur ein mysteriöser zweiter Clan. Doch die Hoffnung trügt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungAkt 1 - Abenddämmerung1234567Akt 2 - Mitternacht891011121314Akt 3 - Geisterstunde15161718192021Akt 4 - Morgendämmerung22232425262728Akt 5 - Zwölf Uhr mittags29303132333435DankÜber dieses Buch
In den Mooren Yorkshires lebt eine geheime Gruppe von Menschen, für die Bücher Nahrung sind, die alles verschlingen, was darin steht. Devon gehört dazu - bis ihr Sohn mit einer dunkleren Art von Hunger geboren wird: nicht nach den Geschichten in Büchern, sondern nach denen in den Köpfen der Menschen. Er ist ein ›Seelenfresser‹, eine ›Abart‹, die meist schon bei der Geburt gnadenlos getötet wird. Doch Devon schwört ihn zu retten und flieht mit ihm in die Welt der Menschen, verfolgt vom eigenen Clan und seinen schrecklichen Handlangern, den ›Rittern‹. Um zu überleben, ist sie gezwungen, schlimme Dinge zu tun. Hoffnung verspricht nur ein mysteriöser zweiter Clan. Doch die Hoffnung trügt …
Über die Autorin
Sunyi Dean ist eine mehrfach preisgekrönte Autorin, die im ländlichen Texas geboren wurde, in Hongkong aufwuchs und heute in Nordengland lebt. Sunyi schreibt genreübergreifende spekulative Fiktion mit einer ganz eigenen Note. Ihr Debütroman THE BOOK EATERS kletterte sofort auf Platz 2 der SUNDAY TIMES Bestsellerliste und wurde für den Goodreads Best Fantasy Choice Award nominiert.
SUNYI DEAN
Wie viele Menschen würdest du opfern,um dein Kind zu retten?
Roman
Übersetzung aus dem Englischen von Axel Franken
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischen Originalausgabe:»The Book Eaters«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2022 by Sunyi Dean
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Friedel Wahren, München
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer, Kölnunter Verwendung eines Designs von Holly Macdonald © HarperCollinsPublishers Ltd 2022
Umschlagmotiv: © shutterstock.com
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-8396-5
luebbe.de
lesejury.de
Für meine Mutter,die ihr Leben lang eine Naturgewalt war;und für meinen lieben Freund John O’Toole,in dem selbst ein Jarrow steckte.
Akt 1Abenddämmerung
1
Devon bei Tag
Heutiger Tag
*
Wir haben gerade erst begonnen, uns in einer seltsamen Gegend zurechtzufinden; wir müssen damit rechnen, seltsamen Abenteuern, seltsamen Gefahren zu begegnen.
Arthur Machen, Der Schrecken
In diesen Tagen kaufte Devon nur drei Dinge in den Läden: Bücher, Schnaps und Sensitive-Care-Hautcreme. Die Bücher aß sie, der Schnaps hielt sie bei Verstand, und die Lotion war für Cai, ihren Sohn, bestimmt. Er litt gelegentlich unter Ekzemen, besonders im Winter.
In diesem Minimarkt gab es keine Bücher, nur Reihen greller Illustrierter. Nicht nach ihrem Geschmack, und außerdem hatte sie zu Hause genug Bücher zum Essen. Ihr Blick schweifte über die Softpornos, Elektrowerkzeuge und Wohnzeitschriften hinunter in die unterste Reihe, wo pink und gelb die Kinderzeitschriften glänzten.
Mit kurzen, rissigen Fingernägeln fuhr Devon über die Titelseiten. Sie überlegte, ob sie eine Zeitschrift für Cai kaufen sollte, weil er so etwas derzeit gern zu lesen schien, entschied sich aber dagegen. Nach heute Nacht mochten sich seine Vorlieben ändern.
Sie ging zum Ende des Gangs, wobei das Linoleum unter den Absätzen ihrer Stiefel quietschte, und stellte ihren Korb an der Kasse ab. Vier Flaschen Wodka und ein Tiegel Hautcreme.
Der Kassierer linste in den Korb und dann wieder auf sie. »Ham S’ ’n Ausweis?«
»Wie bitte?«
»Haben – Sie – einen – Ausweis?«, wiederholte er langsam, als spräche er mit einer Schwerhörigen.
Sie starrte ihn an. »Ich bin neunundzwanzig, um Himmels willen!« Und jedes Jahr war ihr anzusehen.
Er zuckte die Schultern und verschränkte die Arme. Wartete. Er war selbst kaum mehr als ein Kind, höchstens achtzehn oder neunzehn, das wahrscheinlich im Familienbetrieb arbeitete und alle Regeln befolgen wollte.
Verständlich, aber sie konnte ihm den Gefallen nicht tun. Devon hatte keinen Ausweis. Keine Geburtsurkunde, keinen Reisepass, keinen Führerschein; nichts. Offiziell existierte sie nicht.
»Vergessen Sie’s!« Devon schob ihm den Korb so heftig zu, dass die Flaschen klirrten. »Ich hole mir woanders einen Drink.«
Aus der Fassung gebracht und verärgert stolzierte sie hinaus. Horden von Teenagern kauften ständig Schnaps in anderen Tante-Emma-Läden. Das war in dieser Gegend ein alltägliches Ereignis. Dass jemand ausgerechnet von ihr, die so eindeutig erwachsen war, einen Ausweis sehen wollte, kam ihr lächerlich vor.
Erst als sie die schlecht beleuchtete Straße überquert hatte, bemerkte sie, dass sie gegangen war, ohne die Hautcreme zu kaufen. Es war ein kleines Versäumnis, die Lotion zu vergessen, aber sie enttäuschte Cai so regelmäßig auf so viele verschiedene, unzählige Arten, dass selbst dieser winzige Fehler ausreichte, dass frische Wut in ihr hochkochte.
Sie überlegte, ob sie zurückgehen sollte, sah dann auf die Uhr: Es ging auf acht zu. Sie riskierte jetzt schon, zu spät zu kommen.
Außerdem war ein Ekzem nichts im Vergleich zu seinem Hunger. Es war viel wichtiger, ihn zu füttern.
Newcastle-upon-Tyne war eine recht hübsche Stadt, wenn auch ein wenig zu laut für Devons Geschmack. Zu dieser Jahreszeit ging die Sonne um vier Uhr nachmittags unter; der Himmel war schon völlig dunkel, und alle Lampen brannten. Das Fehlen von Umgebungslicht kam ihrer Stimmung entgegen. Zwanghaft checkte sie ihr Handy mit der kurzen Liste ihrer Kontakte. Keine SMS. Keine Anrufe.
Sie schlich an einer Reihe verfallener Reihenhäuser vorbei. Passanten trieben auf dem Bürgersteig auf und ab. Vor einem der Häuser drängten sich Menschen, die tranken und rauchten. Durch vorhanglose Fenster drang Musik nach draußen. Devon bog links von der Hauptstraße ab, um der Ansammlung aus dem Weg zu gehen.
Es gab so vieles, woran sie denken musste, wenn sie draußen und unter Menschen war. Zu tun, als ob ihr kalt wäre, gehörte dazu. Als es ihr bewusst wurde, zog sie den Mantel fester um den Körper, als würde ihr die Kälte zusetzen. Beim Gehen Geräusche zu machen war eine andere Notwendigkeit. Bewusst unbeholfen schlurfte sie dahin und ließ Kies und Schmutz unter den Absätzen knirschen. Große Stiefel halfen beim Stapfen, machten sie schwerfällig und tollpatschig wie ein Kleinkind in Gummistiefeln für Erwachsene.
Ihr Sehvermögen im Dunkeln war ebenfalls verfänglich. Sie musste daran denken, die Augen zusammenzukneifen und sich zögernd den Weg über den abfallübersäten Bürgersteig zu suchen, den sie ganz deutlich sehen konnte, musste eine Angst vortäuschen, die sie nie verspürte, von der sie aber hätte beherrscht sein müssen. Einsame Menschenfrauen bewegten sich mit Vorsicht durch die Nacht.
Kurz gesagt, Devon musste sich immer wie Beute verhalten und nicht wie die Beutegreiferin, zu der sie geworden war.
Sie beschleunigte ihre Schritte, weil sie unbedingt nach Hause wollte. Die Wohnung, die sie gemietet hatte (nur Bargeld, keine Fragen), befand sich in dem verkommenen Geschoss über einem Reifengeschäft. Tagsüber war es laut, es stank nach Öl, und man hörte die Gespräche der Kunden. Abends wurde es ruhiger, auch wenn es nicht weniger stank.
Durch die Gasse, die Treppe hoch zum Hintereingang. Es gab keine Tür zur Straße hin, und das war gut so. Es bedeutete, dass sie durch dunkle Seitengassen kommen und gehen konnte, unbeobachtet von neugierigen Blicken. Das konnten auch ihre Besucher, wenn sie solche erwartete. Ungestörtheit war von größter Wichtigkeit.
Devon fischte nach einem Schlüsselbund, der ihr an einer Schnur um den Hals hing. Die Schnur war mit einem Messingkompass an einer Stahlkette verflochten. Sie schüttelte die Schnur frei, steckte den Schlüssel ins Schloss und kämpfte kurz mit der Tür, bevor sie eintrat.
Da weder sie noch ihr Sohn Licht brauchten, lag die Wohnung in ständiger Dunkelheit. Das sparte Energie und erinnerte ein wenig an zu Hause, an damals, als ihr Zuhause noch einladend gewesen war: die kühle, unbeleuchtete Stille von Fairweather Manor mit seinen schattigen Fluren und dämmrigen Bibliotheken.
Sie erwartete allerdings menschliche Gesellschaft und schaltete alle Lichter ein. Billige Glühbirnen erwachten flackernd zu kraftloser Helligkeit. Die Wohnung bestand lediglich aus einem klaustrophobischen Wohnbereich, einer kleinen Küchenzeile mit ausklappbarem Tisch, einem Badezimmer, das nach links abging, sowie einem abgeschlossenen Schlafzimmer zur Rechten, in dem ihr Sohn einen Großteil jeden Tages verbrachte. Sie stellte ihre Tasche im Eingang ab, hängte den Mantel an einen Haken und stapfte gut hörbar auf sein Zimmer zu.
»Cai? Bist du wach?«
Stille, dann ein kaum hörbares Schlurfen aus dem Innern.
»Keine Lotion, tut mir leid«, sagte sie. »Sie war aus. Ich besorge morgen welche, ja?«
Das Schlurfen hörte auf.
Sie war immer versucht, hineinzugehen und ihm irgendwie Trost zu spenden. In spätestens drei Wochen würde der Hunger ihn bis auf die Knochen abgezehrt haben und sein Leiden sich zu unerträglichen Qualen hochwinden, wenn sein Körper Giftstoffe produzierte. Der Wahnsinn nagte jetzt schon an seinem Verstand, unheilbar außer durch die nächste Fütterung, und selbst nach der Fütterung würde das Verlangen allgegenwärtig bleiben. Entweder würde er zusammengekauert in einer Ecke sitzen und nicht ansprechbar sein, oder er würde sie schäumend vor Wut angreifen.
Unmöglich zu sagen, welche Reaktion sie erwarten sollte, und so überprüfte sie mit zitternden Fingern sorgfältig die Riegel, statt hineinzugehen. Einer oben und einer unten, beides solide Teile, die sie selbst angebracht hatte, und ein normales Schloss, für das sie einen Schlüssel benötigte. Das Zimmer hatte kein Fenster, was an seiner ungünstigen Lage im Verhältnis zum Laden lag; dort war also keine zusätzliche Sicherung nötig. Ausnahmsweise.
Jemand klopfte an ihre Wohnungstür. Sie zuckte zusammen, ärgerte sich und sah auf die Uhr. Zehn nach acht; pünktlich auf die Minute. Gut, dass sie wegen der Lotion nicht in den Laden zurückgekehrt war.
Devon ging, um ihren Besucher hereinzulassen. Er hatte einen Namen, aber sie erlaubte sich nicht, an ihn zu denken. Es war besser, nur seine Rolle, seinen Beruf zu betrachten: der örtliche Vikar. Er brauchte nicht mehr und nicht weniger zu sein.
Nervös wartete der Vikar auf der Türschwelle. Er trug einen schwarzen und senffarbenen Mantel, der vor vierzig Jahren modern gewesen sein mochte. Er hatte freundliche Augen, ein ruhiges Auftreten und beeindruckende Geduld mit seiner zänkischen Kirchengemeinde. Er suchte keinen Körperkontakt zu Kindern, und auch nach zwei Wochen intensiven Stalkings hatte sie keine ernsthaften persönlichen Probleme gefunden. Jeder hatte kleine Laster und kleine Probleme, immer, aber das war eine Gegebenheit, und mit dem Kleinkram kam sie zurecht. Es waren ja schließlich nur Menschen.
»Danke, dass Sie gekommen sind.« Devon machte sich kleiner. Sei unruhig, zögere, und vor allem, sei verletzlich. Die todsichere Masche, auf die sie jedes Mal hereinfielen. »Ich habe nicht daran geglaubt.«
»Nicht doch!« Er schenkte ihr ein Lächeln. »Wie ich Ihnen schon am Sonntag sagte, macht es mir keine Umstände.«
Devon erwiderte nichts, schaute verlegen drein und befingerte den Kompass um ihren Hals. Sie hatte dieses Gespräch oder eine Abwandlung davon schon so oft geführt, alle möglichen Varianten ausprobiert und festgestellt, dass es besser war, ihnen die Initiative zu überlassen. Wahrscheinlich hätte sie etwas Weiblicheres anziehen sollen, um noch harmloser zu wirken, aber sie verachtete Röcke.
»Darf ich hineinkommen?«, fragte er vorsichtig, und sie tat so, als wäre sie wegen ihrer Unhöflichkeit verlegen, und trat zur Seite.
Sein Blick ruhte auf der maroden Inneneinrichtung. Devon konnte es ihm nicht verdenken. Wie üblich entschuldigte sie sich umständlich für den Zustand der Wohnung, während er mit den üblichen Beschwichtigungen aufwartete.
Nachdem dieses Ritual beendet war, sagte sie: »Meinem Sohn geht es schlecht. Vorhin habe ich ihn angesprochen, aber er hat nicht geantwortet. Ich fürchte, Sie haben nicht viel Glück.«
Der Vikar nickte, die Lippen vor Sorge geschürzt. »Wenn ich es versuchen soll, will ich mich bemühen, mit ihm zu reden.«
Devon biss die Zähne zusammen, um ein verächtliches Lachen zu unterdrücken. Als ob Reden Probleme wie dieses hätte lösen können! Es war nicht die Schuld des Vikars, sie war es gewesen, die vorgegeben hatte, dass Cai an Depressionen litt, aber die Hysterie pirschte sich trotzdem an sie heran.
Der Vikar wartete immer noch auf eine Antwort. Sie nickte knapp, in der Hoffnung, dass er ihre Emotionen einfach als widersprüchlich deutete, und führte ihn zu der verschlossenen Tür.
»Sie schließen Ihren Sohn in seinem Zimmer ein?« Er klang schockiert, und sie spürte die Härte seines Urteils, als sie die beiden Riegel öffnete. Zweifellos dachte er, dass sie etwas mit Cais derzeitigem Geisteszustand zu tun hatte.
Wenn er nur gewusst hätte!
»Es ist kompliziert.« Devon drehte den Schlüssel um und zögerte, als sie merkte, dass ihr Herz raste. »Ich muss Sie etwas fragen.«
»Was denn?« Der Vikar war wachsam, seine Sinne auf eine Gefahr eingestellt, die seine Augen nicht wahrnahmen.
Es spielte keine Rolle. Er war in dem Moment verloren gewesen, als er hereingekommen war.
Sie sah ihm in die Augen. »Sind Sie ein guter Mensch?« Die Frage, die sie quälte, jedes Mal. Bei jedem Opfer. »Sind Sie gütig?«
Er runzelte die Stirn und dachte über ihre Worte nach. Versuchte zu verstehen, welche Vergewisserung sie suchte, obwohl er nicht den Hauch einer Chance hatte, es zu erraten. Dennoch lag in seinem Zögern selbst eine Vergewisserung. Die Bösen logen, schnell und glattzüngig. Oder schlimmer noch, sie taten es ab, manchmal mit Humor. Nur diejenigen, die ein Gewissen hatten, zögerten und überdachten ihre Frage.
»Niemand von uns ist wirklich gut«, erklärte der Vikar schließlich. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter, so sanft, so gütig, und sie hätte sich fast auf der Stelle übergeben. »Wir können nichts anderes tun, als mit dem Licht zu leben, das uns gegeben ist.«
»Einige von uns haben kein Licht«, widersprach Devon. »Wie sollen wir dann leben?«
Er musterte sie verständnislos. »Ich …«
Devon packte sein Handgelenk, riss die Tür auf und stieß ihn vorwärts. Der Vikar war nicht schwach, aber Devon war viel stärker, als sie aussah, und hatte das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Er stolperte vorwärts, überrascht und nach Luft ringend, in die Dunkelheit von Cais Zimmer hinein. Devon zerrte die Tür zu und hielt sie mit aller Kraft fest.
»Es tut mir so leid«, sagte sie durchs Schlüsselloch. »Ich tue bloß mein Bestes.«
Der Vikar antwortete nicht. Er schrie bereits und schlug um sich.
Wirklich, es war sinnlos, sich zu entschuldigen. Opfer wollten keine Beteuerungen der Anteilnahme, wenn man ihnen wehtat. Sie wollten, dass es aufhörte. Dem aber konnte Devon nicht nachkommen, und in diesen Tagen hatte sie nicht mehr als Entschuldigungen parat. Entschuldigungen und Schnaps.
Das gedämpfte Geräusch des kämpfenden Vikars verklang nach höchstens einer Minute. Sie konnte sich nicht entscheiden, was schlimmer war: das Wimmern oder die Stille. Vielleicht war beides gleich schlimm. Nach einem Moment des Zauderns ließ sie den Türknauf los. Abzuschließen hatte keinen Sinn. Cai würde nicht gefährlich sein, nicht mehr, und sie wollte ihm ermöglichen, dass er sein Zimmer verlassen konnte, wenn ihm danach war.
Die Wohnung erdrückte sie, die schimmeligen Wände zermanschten ihren Geist. Nach so vielen Tagen des Heißhungers musste ihr Sohn seine Fütterung ausschlafen. In der Zwischenzeit wollte sie einen Drink, aber es gab keinen Wodka im Haus.
Halt, Moment! Sie hatte noch eine halbe Flasche Whiskey, zurückgelassen vom Besucher vor dem Vikar. Devon mochte keinen Whiskey, aber im Moment war sie noch weniger gern nüchtern. Ein paar Minuten Schränkedurchwühlen brachten den verirrten Alkohol zum Vorschein.
Mit der Flasche in der Hand schloss sich Devon in dem winzigen, schäbigen Badezimmer ein und trank sich ins Vergessen.
2
Eine Prinzessin aus der Zauberlinie
Zweiundzwanzig Jahre zuvor
*
Sie war eine Prinzessin aus der Zauberlinie. Zu ihrer Taufe hatten die Götter ihre Schatten geschickt.
Lord Dunsany, Die Königstochter aus Elfenland
Devon war acht Jahre alt, als sie ihrem ersten Menschen begegnete, obwohl sie damals noch nicht wusste, was er war. Oder besser gesagt, sie wusste nicht, was sie war.
Als sie aufwuchs, hatte es nur die Sechs Familien gegeben, verstreut über verschiedene Gegenden Großbritanniens. Devons Familie waren die Fairweathers, deren Anwesen in Nord-Yorkshire zwischen niedrigen Hügeln und wildem Heideland eingezwängt war. Onkel Aike war der Patriarch des Herrenhauses, weil er der Weiseste war, wenn auch nicht der Älteste. Unter ihm gab es eine Reihe weiterer Tanten und Onkel, die von kaum erwachsen bis hin zu dezent steinalt waren.
Und unter ihnen gab es die sieben Fairweather-Kinder, von denen alle außer Devon Jungen waren. Es gab nur sehr wenige Frauen, denn weibliche Kinder waren selten in den Familien. Die Onkel waren in der Überzahl, genauso wie die Brüder in der Überzahl waren, und es lebten zu jener Zeit keine Bräute in der Familie. Devons eigene Mutter war ein Gesicht, an das sie sich nicht mehr erinnerte, da sie schon vor langer Zeit einen anderen Ehevertrag eingegangen war.
»Du bist die einzige Prinzessin in unserem kleinen Schloss«, pflegte Onkel Aike augenzwinkernd zu sagen. Groß und grauhaarig genoss er es, seine schlaksige Gestalt in bequeme Sessel zu falten und Unmengen von Tintentee zu trinken. »Du darfst Prinzessin Devon sein. Genau wie in den Märchen, hörst du?« Er machte eine kleine Geste mit seinen Händen, und ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
Und Devon lachte dann, setzte sich eine Krone aus geflochtenen Gänseblümchen auf und rannte in ihrem zerschlissenen Spitzenkleid über den Hof und rief Ich bin eine Prinzessin! Manchmal versuchte sie, mit den Tanten zu spielen, denn wenn sie eine Prinzessin war, mussten sie Königinnen sein. Aber immer zogen sich die älteren Frauen mit beklommenen Blicken vor ihr zurück und verließen nur selten ihre eigenen Schlafzimmer. Devon beschloss schließlich, dass sie langweilig waren, und ließ sie in Ruhe.
Das Haus selbst war ein dreistöckiges Gebäude mit zehn Schlafzimmern. Es hätte üblich für Herrenhäuser dieser Art sein können, wäre da nicht die planlose Ansammlung von Brüstungen, Anbauten, Ziegeldächern und gotischen Schnörkeln gewesen. (»Das haben wir deinem Großonkel Bolton zu verdanken«, hatte Onkel Aike einmal gesagt. »Architektur war sein, äh, geschätzter Zeitvertreib.«)
Unter dem Boden erstreckten sich weitere Stockwerke mit herrlich verwinkelten Gängen. Devon kannte jede Ecke und jede Nische, von den dunklen Hallen in den Untergeschossen bis hin zu den sonnendurchfluteten Musikzimmern in den oberen Stockwerken.
Und die Bibliotheken! Wie die anderen Familien wiesen auch die Bibliotheken der Fairweathers eine ganz eigene Note auf. Alte Bücher, gebunden in Leder – je dunkler, desto besser –, das man liebevoll hatte altern lassen, mit gemusterten, geprägten Buchdeckeln. Schlug man sie auf, bröselten die braun geränderten Seiten, die schwach nach Märzregen rochen, in weichen, trockenen Flocken ab. Ein Biss, und Devons Buchzähne bohrten sich sogleich durch die Buchdeckel und die zähen Fäden des Einbands. Auf ihrer Zunge prickelte der säuerliche Geschmack tintengetränkten Papiers.
»Biblichor«, sagte Onkel Aike gern und ließ dabei das Wort im Mund rollen. »Das ist ein Wort, das den Geruch von sehr alten Büchern bezeichnet. Wir lieben Biblichor. Und andere alte Überbleibsel.«
»Alles im Haus ist alt«, kicherte Devon. Wie die Gemälde im Esszimmer im Erdgeschoss, anscheinend vierhundert Jahre alt. »Ich glaube, du bist sehr alt!«
Onkel Aike lachte immer, war nie beleidigt. »Vielleicht bin ich das, Prinzessin, aber mit deiner losen Zunge wirst du nie mein Alter erreichen.«
Mit deiner losen Zunge. Viele kommentierten Devons Zunge. Manchmal streckte sie sie heraus und begutachtete sie im Spiegel. Es war nichts Besonderes an ihrer Zunge, was ihr aufgefallen wäre, und sie war auch fest in ihrem Mund verwurzelt.
Das Land, auf dem sie lebten, erstreckte sich weit in den Augen eines Kindes. Felsige Hügel säumten Heideland, voller Senken und Torfmoore. Im Sommer, wenn das Heidekraut lila blühte, jagte Devon Kaninchen und Moorhühner. Zweimal entdeckte sie Otter, deren kleine Reißzähne wie ihre eigenen wachsenden Buchzähne aussahen. Im Winter trocknete das Gras aus und wurde vom Frost spröde. Sie baute mit ihren Brüdern Schneemänner, und sie rannten gemeinsam, immer barfuß, über die Hügel und durch die Wälder des Tals.
Und dann, eines Morgens im Januar, machte sich die achtjährige Devon auf eigene Faust auf die Suche nach Schneeammern und Rotfuchsweibchen. Nachts hörte sie die Füchse bellen und hoffte, einen Blick auf einen zu erhaschen, wie er über den Schnee huschte, wie eine Flamme über Papier.
Sie hatte kaum dreihundert Meter zurückgelegt und war dabei in den kleinen Wald hinter dem Haus gelangt, als ein ungewohntes Geräusch ihre Aufmerksamkeit erregte. Jemand polterte mit lauten, unbeholfenen Schritten zwischen den Bäumen hindurch in knirschendem, festem Schnee. Niemand in Fairweather Manor bewegte sich so schwerfällig, und Devon, neugierig geworden, ging der Sache nach.
Ein Mann, den sie nicht kannte, mühte sich nun stapfend durch frisch gefallenen Neuschnee. Er war von unbestimmbarem Erwachsenenalter, hatte dunkles Haar, warme braune Haut und ein bärtiges Kinn. Ein gelockter schwarzer Schnurrbart säumte seine Nase. Seltsamerweise trug er schwere Stiefel, eine lange Hose, komische Strickdinger an den Händen und bizarre, aufgebauschte Kleidung, die bis zum Kinn zugeknöpft war. Ein weiteres Strickding saß auf seinem Kopf.
Devon brauchte eine Weile, um zu erkennen, dass es sich bei seiner Ausrüstung um Handschuhe, Mantel und Hut handelte. Dies waren Dinge, die sie aus Geschichten kannte, aber noch nie an einer echten Person gesehen hatte. Er wirkte ganz anders als die Erwachsenen auf dem Anwesen, die eher blasser waren und meist staubige alte Anzüge trugen. Sie fragte sich, ob er vielleicht ein Ritter der Sechs Familien war, aber Ritter reisten gewöhnlich zu zweit, auf Motorrädern und mit einem Drachen im Schlepptau. Er hatte keinen Partner oder Drachen und eindeutig kein Motorrad.
Sie schlug einen Bogen um ihn und tippte ihm von hinten auf die Schulter.
»Hallo!«, sagte sie und kicherte, als er vor Schreck fast umfiel. Wie hatte er sie nur nicht bemerken können? Der viele Stoff musste seine Sinne vernebelt haben.
»Heilige …!« Er riss sich zusammen und atmete tief durch. Reif bestäubte seine dunklen Koteletten, und die Säume seiner Hose waren vom geschmolzenen Schnee durchnässt. »Woher kommst du, Kleine?«
Devon war hocherfreut. Es war mindestens zwei Jahre her, dass sie es geschafft hatte, sich an jemanden heranzuschleichen. »Bist du einer meiner Vetter?« Sie hüpfte im Kreis um ihn herum. »Ich habe dich noch nie gesehen. Warum kommst du nicht in einem Auto? Ich dachte, alle Cousins kommen in Autos!«
»Cousin? Nein, ich glaube nicht.« Aus irgendeinem Grund blickte er immer wieder auf ihre nackten Füße und Knie und ihr ärmelloses Leinenkleid. »Ist dir nicht kalt, Liebes?«
Verblüfft blieb sie stehen. »Was meinst du?«
Sie wusste über Kälte Bescheid, weil sie alle richtigen Bücher gegessen hatte. Kälte war es, die Schnee statt Regen entstehen ließ, genau wie in der Geschichte der Schneekönigin.
Es schneite jetzt, leichte Flocken landeten auf ihren Armen und füllten ihre Fußabdrücke. Und es fühlte sich anders an als Hitze: sanft statt stachelig. Aber Kälte war ein Teil der Welt und ihrer Jahreszeiten, eine von Reaktion losgelöste Empfindung. Nichts, wogegen sie etwas tun musste.
»Zähes Kind«, sagte er mit hochgezogenen Augenbrauen. »Um deine Frage zu beantworten: Ich bin kein Cousin. Vermutlich bin ich ein Gast.«
Das verstand Devon jetzt. »Dann bist du sehr unhöflich«, sagte sie, die Hände in die Hüften gestemmt. »Wenn du wirklich ein Gast dieses Hauses bist, solltest du mir sagen, wer du bist und woher du kommst.«
Sie wusste, dass in der Welt Nicht-Cousin-Leute existierten: Menschen, die Tierfleisch und schmutzige, aus der Erde gepflückte Pflanzen aßen. Aber Gast oder nicht, Familie oder nicht, jeder musste das zeigen, was Onkel Aike Grundlegende Höflichkeit nannte.
»Ist das so?« Ein zaghaftes Lächeln. »Nun gut, ich bitte um Entschuldigung. Ich bin Amarinder Patel oder kurz Mani. Ich bin ein Journalist aus London. Kennst du London?«
Devon nickte. Jeder kannte London. Dort lebten die Gladstones, weit unten im Süden. Sie waren die größte, reichste und mächtigste der Familien. Sie hatte einmal einige ihrer Cousins kennengelernt, als sie zu Besuch waren.
»Und du bist?« Manis Lächeln vertiefte sich, wurde aufrichtiger.
»Ich bin Devon Fairweather von den Sechs Familien«, erklärte sie ihm. »Dieses ganze Land gehört zu Fairweather Manor.«
»Die sechs Familien?«, echote er.
Devon gab es auf, höflich zu sein. »Was ist ein Schurna… Schurnaliss?« Wenn er nicht die richtigen Worte benutzen wollte, dann würde sie es auch nicht.
»Jour…na…list«, betonte er langsam. »Von der investigativen Sorte. Das heißt, ich recherchiere und gehe auf die Jagd nach seltsamen Geschichten. Manchmal kommen die Dinge, die ich entdecke, sogar ins Fernsehen. Ist das nicht aufregend?«
»Was ist das Fernsehen?«
Wieder eine Pause, diesmal kürzer. Er lernte, seine Überraschung zu verbergen. »Devon … interessanter Name übrigens … Eigentlich bin ich auf der Suche nach deiner Familie gekommen. Es gibt Gerüchte über einen fernen Clan, der in den Mooren lebt. Ich hatte gehofft, ich könnte eine Geschichte schreiben …«
»Eine Geschichte? Etwa eine neue?« Devon war sofort interessiert. »Können alle Jour…na…listen Geschichten schreiben?«
»Nun …«
»Schreibst du eine Geschichte nur für mich?« Die Fragen sprudelten nur so aus ihr heraus. »Darf ich sie essen, wenn du fertig bist? Für mich hat noch nie jemand eine Geschichte geschrieben, die ich essen durfte.«
Das Lächeln glitt ihm aus dem Gesicht wie schmelzender Schnee von einem Dach. »Sie essen?«
»Werden Geschichten so gemacht? Das habe ich mich schon immer gefragt. Onkel Aike aber meinte, er würde es mir erzählen, wenn ich älter bin. Wie schreibt man eine Geschichte? Ich kann keine Geschichte schreiben. Wird es ein Buch sein, wenn du fertig bist? Werden alle Geschichten zu Büchern?«
»Du kannst nicht schreiben?«, fragte er verblüfft.
»Hä? Natürlich nicht!« Sie starrte ihn an. »Wie sollten wir schreiben können?« Wenn Buchesser schreiben könnten, bräuchten sie nicht die Bücher anderer Leute. Die Onkel hatten ihr das gesagt.
Mani atmete langsam aus. »Ich verstehe.« Er schlug den Mantelkragen hoch. »Hast du eine Mama oder einen Papa?« Als sie ihn verwirrt ansah, fügte er mit verzogenen Lippen hinzu: »Jemanden, der sich um dich kümmert. Einen Erwachsenen.«
»Ah! Du meinst Onkel Aike?«, fragte Devon und versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Onkel Aike kriegte immer alle Besucher. »Ich schätze, ich könnte dich zu ihm bringen.« Sie wusste, dass der Fremde bestimmt nicht die Tanten besuchen wollte, denn niemand wollte jemals die Tanten besuchen.
»Klar«, murmelte Mani geheimnisvoll. »Lernen wir deinen Onkel Aike kennen!«
Devon hüpfte durch die Schneeverwehungen, und die Enttäuschung wich der Selbsttröstung. Was war schon dabei, wenn der Besucher Onkel Aike sehen wollte? Sie hatte ihn zuerst gefunden. Ramsey würde so neidisch sein! Ihre anderen Brüder auch, aber die mochte sie nicht so sehr wie Ramsey; die meisten waren viel älter, total langweilig und spielten nicht so viel mit ihr. Jedenfalls würde sie es Ramsey die ganze Woche lang unter die Nase reiben. Vielleicht zwei Wochen lang!
Der Wald lichtete sich rasch zu felsigen Hügeln, deren harte Kanten vom Raureif weichgezeichnet wurden. Langsam kam das Haus in Sicht und erweckte die Illusion eines Aufklappbuchs für Kinder. Unbehaglich schoben sich die uralten Brüstungen ins schwindende Winterlicht. Einige von Devons Brüdern spielten in den wilden, überwucherten Gärten vor dem Haus mit einem Ball. Keiner von ihnen beachtete sie, außer Ramsey, der bass erstaunt zu ihr herübersah. Selbstgefällig amüsierte sich Devon über seine Reaktion.
»Keine Stromquelle, kein Feldbau, keine angemessene Kleidung für die Kinder. Haus in baufälligem Zustand, und das Gelände sieht ungepflegt aus. Dennoch stehen moderne Autos in der Einfahrt.« Mani murmelte in ein kleines schwarzes Gerät mit rotem Blinklicht. »Kann nicht umhin, mich zu fragen, was sie essen. Abgeschottet und isoliert, so oder so. Könnten die Leute die Quelle dieser lokalen alten Legenden sein?« Er sah, wie sie ihn anstarrte, und lächelte entwaffnend.
»Folge mir!«, rief Devon und zog ihn, der sich seltsam widerstrebend verhielt, unter dem gähnenden Torbogen hindurch in die dahinterliegende Eingangshalle.
Ein einst prächtiger Teppich lag zerschlissen und platt auf einem grob behauenen Steinboden. Kristalline Lampeninstallationen hingen dunkel und makellos da, bar jeder Kerze oder Glühbirne. Falls sie jemals angezündet gewesen waren, so hatte Devon dies nie gesehen. In den Räumen, an denen sie vorbeikamen, standen niedrige Sofas oder polierte Holztische, und auch hier waren die Kronleuchter und Lampen erblindet. Wände waren dicht verstellt mit Regalen, unendlichen Regalen. Der Geruch nach alten Büchern, nach Biblichor, durchdrang alles.
Am Ende des Flurs bog sie scharf links ab und sprang ins Gesellschaftszimmer, Mani dicht hinter ihr. Mehrere ihrer Onkel waren um einen besonders großen Eichentisch versammelt, spielten Bridge und tranken Tintentee. In dem Moment, als Devon und ihr toller Gast eintraten, verstummten die Gespräche. Alle Köpfe drehten sich in ihre Richtung.
»Onkel!«, sagte Devon. »Ich habe einen Gast gefunden.«
»Ja, tatsächlich.« Onkel Aike legte seinen Kartenfächer auf den Tisch. »Wer sind Sie, Sir?«
»Amarinder Patel, freischaffender Journalist«, stellte sich Mani vor und streckte die Hand aus. »Ich habe nach …«
»Dies ist Privatbesitz.« Onkel Aike erhob sich langsam. Wenn er keinen Buckel machte, war er über eins achtzig groß. »Sie haben hier nichts zu suchen. Insbesondere Journalisten sind nicht willkommen.«
Verwirrt schaute Devon zu. Noch nie hatte sie ihren Lieblingsonkel so unwitzig erlebt. Mit solchem Mangel an grundlegender Höflichkeit.
Mani ließ die Hand sinken. »Es tut mir leid, ich hätte ja vorher angerufen. Aber ich war mir nicht einmal sicher, ob Sie und Ihre Familie hier wohnen. Es gibt keine Telefonnummer beim Grundbuchamt, keine Namen im Wählerverzeichnis …«
»Ganz recht.« Onkel Aike beugte sich vor, die Fingerknöchel auf den Tisch gestützt. »Ist Ihnen in den Sinn gekommen, Mister Patel, dass wir vielleicht gar nicht kontaktiert werden wollen? Schon gar nicht von einem Journalisten! Privatpersonen haben ein Recht auf Privatleben.«
Die Luft schien dicker zu werden und Devons Fragen zu ersticken. Irgendetwas geschah hier, das sie nicht verstand, auch wenn niemand böse auf sie zu sein schien.
Mani rückte seine Brille zurecht. »Na schön, ich finde allein hinaus.«
Onkel Aike aber wies auf einen leeren Platz und sagte: »Unsinn! Die Milch ist verschüttet, und Sie sind ja nun mal hier. Nehmen Sie Platz, bitte!« Ein Muskel zuckte in seiner Wange. »Deswegen sind Sie doch gekommen, oder? Um die Mitglieder meiner Familie zu finden? Nun, dann kommen Sie und sprechen Sie mit uns, und wir werden uns wie Erwachsene unterhalten.«
»Ich …« Mani fummelte an seinem kleinen schwarzen Gerät herum, drehte es in den Händen hin und her. Aus der Sicht dieses vollständig menschlichen Mannes hatte er einen dunklen und düsteren Raum betreten, der mit zerbröckelnden Büchern ausgekleidet war und in dem stattliche, bleichgesichtige Gestalten in altmodischen Anzügen saßen. Keine Situation für schwache Nerven.
Doch nach einem Moment gewannen seine Professionalität und seine Vernunft die Oberhand. Mani ging zu einem Stuhl und setzte sich, eingequetscht zwischen Onkel Bury und Onkel Romford.
»Devon, Liebes!« Onkel Aike wandte seinen Blick nicht von dem Journalisten ab. »Geh spielen, ja? Wir werden uns ein Weilchen mit Mister Patel unterhalten.«
»Aber …« Devons trauriger Blick schweifte über den Tisch, an dem ihr Gast in steifer Haltung saß. Immer musste sie gehen, wenn die Erwachsenen redeten, und das war immer ungerecht.
Onkel Aike richtete seinen Blick auf Devon, seine Schultern entspannten sich, und sein Gesicht wurde ein wenig weicher. »Ich sage dir etwas: Geh hoch in mein Zimmer, kleine Prinzessin, und such dir eins der Märchen aus! Eins von den Sonderausgaben. Aber aus dem untersten Regal, wohlgemerkt! Nichts Unanständiges, aye?«
»Oh! Das mach ich, das mach ich!« Aufgeregt huschte Devon aus dem Zimmer. Obwohl sie immer nur Märchen aß, waren einige besser als andere, und die besonderen im Arbeitszimmer ihres Onkels schmeckten exquisit: die knackigen Goldeinbände, die Bücher mit Lesebändchen, die leuchtenden Illustrationen mit bunten Tinten. Eine Explosion von Farben und Funkeln, Wörter, die am Gaumen baumelten und nachklangen.
Das Letzte, was sie hörte, bevor sie die Treppe hochflitzte, war die Aufforderung ihres Onkels, der sagte: »Romford, bitte schließ die Tür!«
Als sie oben an der Treppe ankam, hatte sie die Worte schon wieder vergessen. Das Arbeitszimmer von Onkel Aike befand sich in einem kleinen Raum im Ostflügel, und das war ihr Ziel.
Geräuschlos schlüpfte sie hinein. An den Wänden hingen Renaissancegemälde und eine bunte Auswahl an Instrumenten, darunter eine chinesische Laute, auf der Devon ihren Onkel noch nie hatte spielen hören. Geschenke von Essern aus anderen Ländern, damals, als das Reisen ins Ausland noch einfacher gewesen war. Zu viel Papierkram heutzutage.
Ein Schreibtisch und einige Stühle bildeten eine gemütliche Sitzecke, den größten Teil des verbleibenden Platzes nahm ein Doppelbett ein. Die Fenster waren schon vor langer Zeit von innen mit Brettern vernagelt und mit weiteren Regalen ausgestattet worden. Das in Devons Reichweite enthielt mannigfaltige Exemplare verschiedener Artuslegenden, die sonst ihren Brüdern geschenkt wurden. Voller Geschichten, die Mädchen nicht zu kennen brauchten.
Darunter stand eine Reihe von Märchen. Die Schöne unddas Biest, Aschenputtel, Dornröschen und Schneewittchen. Verschiedene andere. Alles Geschichten über Mädchen, die die Liebe suchten und fanden oder die von zu Hause flohen und den Tod fanden. Fast konnte sie hören, wie ihr Onkel sagte: Die Lektion liegt in der Geschichte, Liebes. Dies war das Regal, das ihr Onkel für sie bestimmt hatte.
Devon hatte andere Vorstellungen.
Sie zog den kleinen Holzschemel hervor, den ihr Onkel unter dem Bett aufbewahrte, und schleppte ihn hinüber. Wenn sie sich auf Zehenspitzen stellte, erreichte sie gerade noch das oberste Regal, was viel spannender war.
Von hier aus konnte sie zwar nicht sehen, welche Bücher dort standen, aber das war unwichtig. Alle diese Bücher waren verboten und damit begehrenswert. Selbst die gewissenhaftesten Kinder wurden des immer gleichen Essens überdrüssig. Sie wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, etwas anderes zu probieren.
Ihre Finger schlossen sich um den Rand eines papiergebundenen Buchrückens, und sie zog das Buch heraus, verlor dabei aber fast das Gleichgewicht. Ihr Onkel wäre böse, wenn er es herausfand, und sie würde vielleicht eine ganze Woche lang nichts anderes als langweilige Wörterbücher zu essen bekommen. Aber die Aufregung durch etwas Verbotenes schien das Risiko wert zu sein.
Sie setzte sich auf den Hocker und begutachtete ihre Ausbeute. Jane Eyre war in nachlässiger Schrift auf den Einband gestempelt. Der rote Ledereinband war mit der Illustration einer jungen Frau inmitten von Blumen geprägt. Das Druckdatum bedeutete, dass die Autorin schon lange tot war. Ein Schauer überlief Devon. Immer wieder fand sie es erstaunlich, dass Worte noch lange nach dem Tod des ursprünglichen Verfassers neu gedruckt wurden. Wahllos schlug sie das Buch auf.
Zum ersten Mal hatte ich die Süßigkeit der Rache empfunden; aromatischer Wein dünkte sie mich, der während des Trinkens süß und feurig ist; sein Nachgeschmack aber ist herbe und metallisch – so hatte ich das Gefühl, als ob ich vergiftet sei.
Wie herrlich unanständig, wie unmädchenhaft und wenig prinzessinnenhaft! Die Vorstellung, dass Rache wie ein besonders spannendes Buch schmecken könnte, war zutiefst faszinierend. Dieser Roman, was auch immer er war, würde sicher viel interessanter sein als das übliche Märchen.
Sie öffnete den Mund, entblößte die Zähne – und hielt inne. Ein seltsames Verlangen überkam sie, das Buch gar nicht zu essen, sondern es einfach einzustecken. Um es zu lesen nämlich, was auch möglich, wenngleich eher falsch war.
Lesen konnte eine schändliche Sache sein. »Wir konsumieren geschriebenes Wissen«, hatten ihre Tanten und Onkel oft gesagt. »Wir konsumieren, speichern und sammeln alle Formen von Papierfleisch, wozu uns der Sammler geschaffen hat, gekleidet in die Haut der Menschheit. Aber wir lesen nicht, und wir können nicht schreiben.«
Was an und für sich ja in Ordnung war, nur wusste jeder, dass der Sammler nie zurückkommen würde. Die Buchesser würden leben und sterben, ohne jemals ihre gesammelten Informationen an die verborgenen Datentresore des Sammlers weiterzugeben. Devon konnte nicht erkennen, welchen Zweck sie damit verfolgten.
Außerdem war es schon falsch, überhaupt ein Buch aus dem obersten Regal zu nehmen. Es täte nicht weh, noch ein bisschen falscher zu handeln.
Eine Sünde brachte die andere hervor; die Entscheidung war im Handumdrehen getroffen. Devon stopfte das Buch in ihr Hemd, um es in ihr eigenes Zimmer zu bringen, drüben im Westflügel. Sie schlug den Weg über den Dachboden zur anderen Seite des Herrenhauses ein, kletterte hinunter und schlüpfte in ihr Zimmer. Bis sie ein Kapitel gelesen und das gestohlene Exemplar von Jane Eyre unter ihrer Matratze versteckt hatte, war fast eine Stunde vergangen.
Sie trat wieder auf den Flur, richtete ihr Kleid und versuchte, nicht wie eine Verbrecherin auszusehen. Es war sehr ruhig im Herrenhaus, selbst für einen winterlichen Nachmittag. Die Tanten hatten sich wahrscheinlich in ihren Quartieren verbarrikadiert, aus denen sie nur selten hervorkamen. Die einzigen Geräusche waren die Rufe und das wilde Geschrei ihrer Brüder, die sich draußen tummelten. Aber selbst das wirkte leise und gedämpfter als zu dem Zeitpunkt, als sie Mani hergebracht hatte.
Sie fuhr zusammen. Der Journalist! Wie hatte sie ihren Gast vergessen können? Sie rannte zurück ins Gesellschaftszimmer und nahm dabei immer zwei Stufen auf einmal.
Aber ihr Gast war schon weg. Tatsächlich war das Gesellschaftszimmer leer, mit Ausnahme von Onkel Aike, der am Kamin saß und die Füße auf einen Hocker gelegt hatte. Er sah auf, als Devon eintrat, und winkte sie zu sich. »Komm herein, Liebes! Setz dich!«
Sie kuschelte sich in den Sessel neben ihrem Onkel. »Wo ist der Jour...na…list?«
»Mister Patel ruht sich aus, in einem Kellerraum.« Onkel Aike hatte die sanftesten Hände, die kein einziges Mal rissen oder zerrten, als er Devons zerzauste Haare mit den Fingern durchkämmte. »Morgen früh werden Ritter kommen und ihn fortbringen.«
»Fort?« Sie war erst einmal Rittern begegnet. Sie waren ernst und furchterregend, überhaupt nicht nett oder lustig wie ihr Onkel. »Wohin?«
»Nach Ravenscar Manor«, erwiderte er nach einem kurzen Zögern. »Das liegt in Küstenähe, viele Meilen von hier entfernt. Der Patriarch dort hat eine Verwendung für Menschen.«
»Oh«, machte Devon niedergeschlagen, weil ein anderes Haus ihr den Gast wegnehmen würde. »Ich wollte, dass er bleibt.«
»Es tut mir leid, Prinzessin. Ich weiß, dass du das wolltest. Aber ich fürchte, Mister Patel war kein freundlicher Mann. Er wollte anderen Leuten Geschichten über uns erzählen.«
»Geschichten sind doch was Gutes. Oder?«
»Nicht alle Geschichten sind etwas Gutes, nein.« Onkel Aike küsste sie auf eine Schläfe. »Du hast in diesem Haus nur die richtigen Bücher zu essen, weil wir dir nur die richtigen Geschichten geben, die für eine kleine Prinzessin geeignet sind. Es gibt aber durchaus auch schlechte Geschichten, und dein armer Mister Patel hätte ganz schlechte Geschichten geschrieben.«
Devon dachte nach. »Heißt das, er war ein kaputter Schriftsteller?«
»Sozusagen.« Der Onkel schien sich über ihre Worte zu amüsieren. »Ja, das ist eine ganz gute Beschreibung.«
»Ah, ich verstehe! Werden die Ravenscars ihn reparieren?«
»Das werden sie bestimmt, Liebes«, sagte ihr Onkel und blickte ins Feuer. »Das werden sie bestimmt.«
3
Devon bei Nacht
Heutiger Tag
*
Aber woher kamen die Buchesser? Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sie eine Mutation der Evolution sind, und die Menschheit hat Tausende von Jahren gebraucht, um die Technologie der Papierherstellung zu entwickeln.
Die Buchesser selbst erzählen bizarre, unglaubliche Legenden über den Sammler, ein außerirdisches Wesen, das sie mit humanoidem Aussehen erschaffen und auf die Erde gesetzt hat, um Wissen zu sammeln (Bücher zu essen) und menschliche Erfahrungen zu sammeln (Gedanken zu essen).
Aber der Sammler, so ihre fantastische Geschichte, kehrte nie zurück. Somit blieben die Esser zurück, Relikte eines aufgegebenen außerirdischen Wissenschaftsprojekts.
Amarinder Patel, Papier und Fleisch: Eine geheime Geschichte
Devon träumte von der Hölle, wie es ihr häufig in diesen Tagen widerfuhr.
Manche Menschen hatten in ihren nächtlichen Visionen sexuelle Fantasien oder Albträume, nackt zu Vorstellungsgesprächen zu gehen. Ihr Traum war weder das eine noch das andere, obwohl er Elemente von beidem enthielt.
Es begann immer damit, dass sich der Boden unter ihren Füßen zu einem breiten, lavadurchzogenen Tunnel öffnete. Wie aus einem Cartoon. Ohne Widerstand oder Überraschung stürzte sie und landete auf den Knien in einer unterirdischen Grube, die Dantes Inferno würdig gewesen wäre, einem Buch, das sie einmal hatte essen wollen, aber wieder ausgespuckt hatte, weil es nach Schwefel und Galle schmeckte. Sie hatte noch nie einen besonderen Gaumen für Klassiker gehabt.
Aus der Schwärze sprach eine Stimme, die ihr höflich mitteilte, dass sie für ihre Sünden leiden werde, und sie lachte vor Erleichterung, bis sie weinte. Eine Peitsche knallte lustig und landete auf ihren Schultern, und sie erwachte jäh mit brennenden Rückenschmerzen. Mit verdrehtem Kopf und einem hartnäckigen Schmerz im Hals lag sie auf dem Badezimmerboden. Als sie auf ihr Handy blickte, zeigte es 00:04 Uhr.
Devon kam auf die Füße und erbrach einen Magen voller Whiskey in die Toilette. Menschliches Essen war mehr als widerlich und klebrig, aber sie war neugierig genug gewesen, es ein paarmal zu probieren. Alkohol allerdings rann ihr leichter durch die Kehle. Vor allem Wein. Wundervoller, köstlicher Wein.
Nachdem sie das Gift ausgestoßen hatte, kroch Devon zum Waschbecken und stemmte sich hoch. Aus dem verzogenen Badezimmerspiegel blickte ihr ein ausgezehrtes, faltiges Gesicht entgegen, das unter jedem Auge von müden Ringen gezeichnet war. Diese Mischung aus Gesichtszügen und Merkmalen, die sie ihrer komplizierten Herkunft verdankte. Abgebrochene Nägel, spröde Lippen und ein Nirvana-Shirt mit mehr Falten als Nähten vervollständigten das verwahrloste Erscheinungsbild einer unfreiwilligen Goth nach einer üblen Nacht unterwegs.
»Ich war mal eine Prinzessin, musst du wissen.« Ihr Spiegelbild runzelte zweifelnd die Stirn. Die Prinzessinnen in den Büchern, die sie gelesen hatte, waren hübsche, zarte Geschöpfe, und die wenigsten von ihnen waren eins fünfundachtzig große Mörderinnen mit einer Vorliebe für kurz geschorenes Haar und Lederjacken. Merkwürdig war das.
Devon zeigte sich selbst den Stinkefinger und begann mit dem Zähneputzen. Beide Gebisse, denn auch ihre Buchzähne mussten gereinigt werden. Als ihr Atem nicht mehr nach Erbrochenem stank, machte sie sich auf die Suche nach ihrem Sohn.
Cai war aus seinem Zimmer aufs Sofa umgezogen und auf den Polstern eng zusammengerollt eingeschlafen. So klein, so schmerzlich dünn. Devon brachte es nicht übers Herz, ihn in sein Bett zurückzubringen. Er hätte dabei aufwachen können, und außerdem hasste er es, in diesem beengten Raum eingepfercht zu sein.
Nicht, dass sie es ihm verübelt hätte. Die Art, wie er lebte, wäre für jedes Kind ein Elend gewesen. In seinem Alter hatte sie mehr Zeit draußen als drinnen verbracht. Aber Devons Kindheit war nicht von einem Hunger beherrscht worden, der sie dazu trieb, die Hirnmasse von Menschen mit der Zunge auszuschaufeln, wie es bei Cai der Fall war.
Wenn ihr Sohn irgendeine Hoffnung auf ein sinnvolles Leben haben sollte, brauchte er Erlösung. Nicht die religiöse, sondern die chemische Art: eine von der Familie hergestellte Droge gleichen Namens, die speziell für Gedankenesser entwickelt worden war. Bei regelmäßiger Einnahme wäre er in der Lage gewesen, Papier zu essen, so wie sie es tat.
Die Kunst bestand darin, die Droge in die Finger zu bekommen.
Auf der Küchenarbeitsplatte surrte ihr Handy. Sie ging hin, ergriff es und klappte es auf.
CHRIShab sie gefunden. hab gesagt, was du mir aufgetragen hast.treffen und unterhalten? crows nest pub, morgen abend um 8. kommst du??
Devon tippte mit den Daumen auf die billigen Plastiktasten.
Nur eine der Familien, die Ravenscars, hatte jemals Erlösung hergestellt. Die Ravenscar-Patriarchen hatten die Zutaten und das Verfahren streng geheim gehalten, was ihnen finanzielle Vorteile und eine Machtposition gegenüber den anderen Familien verschaffte.
All das änderte sich, als die Ravenscars vor Jahren plötzlich in sich zusammenfielen. Einige der erwachsenen Kinder des Patriarchen hatten versucht, sich von ihrer Familie zu lösen, was Devon sehr gut nachempfinden konnte. Es kam zu einem blutigen Kampf, der mit Dutzenden von Toten endete. Auch der Patriarch selbst starb. In der Zwischenzeit verschwanden die überlebenden Ravenscar-Geschwister und nahmen ihre Vorräte an Erlösung mit.
Schön für sie, nicht so schön für ihren Sohn. Cai war mit Erlösung aufgezogen worden, wie die meisten Gedankenesserkinder. Nach dem Ravenscar-Putsch war der Zugang zu der Droge fast über Nacht versiegt. Alle verbliebenen Dosen befanden sich bei den Rittern und waren für deren erwachsene Drachen reserviert.
Cai sah nur drei Möglichkeiten für seine Zukunft: Menschen zu konsumieren, zu verhungern oder von den Familien eingeschläfert zu werden.
Devon hatte nicht vor, ihren Sohn verhungern zu lassen, und sie würde auch nicht zulassen, dass ihn jemand tötete. Die Ravenscars waren noch am Leben, irgendwo, und das bedeutete, dass es eine Chance gab, von ihnen Hilfe zu bekommen. Sofern Devon sie davon überzeugen konnte, dass es sich für sie lohnte.
Aber zuerst musste sie sie finden.
Aus Gründen, die Devon nicht nachvollziehen konnte, fabrizierten die Ravenscars, soweit sie es beurteilen konnte, offenbar weiterhin Erlösung. Sinn schien das nicht zu ergeben, denn unter ihnen lebten keine Gedankenesser, die sie füttern mussten.
Was ihre Beweggründe auch sein mochten, es erleichterte Devons Nachforschungen. Im vergangenen Jahr hatte sie das Land durchquert und versucht, die Ravenscars über ihre Chemikalienlieferanten aufzuspüren.
In der Zwischenzeit fütterte sie ihren Sohn mit Menschen, um ihn am Leben zu erhalten.
Nach monatelanger Suche erhielt sie endlich eine Antwort. Ein Mann, ein Arzneimitteldealer, gab zu, dass er den Ravenscars noch immer bestimmte Substanzen verkaufte. Er behauptete auch, Devon einen Kontakt zu ihnen vermitteln zu können. Wenn er die Wahrheit sagte, war dies der Durchbruch, auf den sie gehofft hatte.
Ein Stöhnen unterbrach ihre Träumerei. Der Vikar bewegte sich geistlos in Cais Zimmer.
Widerstrebend klappte sie das Handy zu. Mit dem Antworten wollte sie warten, bis sie zurückkam und Cai wach war. Er konnte ihr beim Tippen helfen.
Der Vikar lag zusammengerollt auf der Seite am Boden von Cais Zimmer. Ein winziges Rinnsal stockenden Bluts lief ihm aus dem Ohr. Er war noch am Leben; er atmete, er blinzelte, und sein Herz schlug noch. Ab und zu grunzte er. Sein Überleben überraschte sie. Viele von Cais Opfern starben an einem Schock oder an inneren Schädelblutungen. Einen Brocken des eigenen Gehirns verflüssigt und ausgesaugt zu bekommen war nicht angenehm.
Aber in jeder praktischen Hinsicht hätte er genauso gut sterben können. Seine Erinnerungen, seine Persönlichkeit und alles, was er je gewesen war, gehörten nun ihrem Sohn. Jedenfalls bis zur nächsten Mahlzeit, bei der vieles davon neu überschrieben würde.
Devon durchsuchte die abgenutzten Taschen des Opfers. Vikare besaßen in der Regel nicht viel Geld, und er war da keine Ausnahme. Sie nahm alle Ausweise heraus, ließ die Brieftasche aber ansonsten unversehrt. Es gab nichts, was des Stehlens wert gewesen wäre. Nicht im Vergleich zu den rund zwanzig Riesen, die sie in einer Tüte aufbewahrte.
Immerhin hatte er eine Bibel. Devon mochte Bibeln. Sie entblößte ihre Buchzähne und biss sich durch den Buchrücken. Abgenutztes Leder, liebende Hände, Schweiß, Messwein. Worte flossen ihr über die Zunge, Psalmen vermengten sich mit Geboten, geweihte Neugeborene mischten sich mit Krieg und Schändung. Hauchdünnes Papierfleisch knitterte zart bei jeder Kaubewegung.
Gebrauchte Bücher waren nie so knackig wie neue, aber jeder Band hatte einen Geschmack, der seinem Besitzer eigen war und den Devon, wie jeder Abkömmling der Familie Fairweather, gern entdeckte. Zwölf Bissen, um das Buch zu beenden. Sie wischte sich die Tinte vom Kinn, den Bauch angenehm gefüllt, auch wenn ihr der Kopf von archaischen Versen und alten Prophezeiungen schwirrte. Das Essen besserte ihre Laune, und das vom Alkohol verursachte anhaltende Übelkeitsgefühl ließ nach.
Devon zog den Vikar bis auf die Boxershorts aus. Er hatte sich in die Hose gemacht; das geschah meistens. Aus einem Sack im Schrank kramte sie eine Auswahl an zerfledderter, schmuddeliger Kleidung hervor, die sie in Wohltätigkeitsläden gesammelt hatte. Sie zog dem Vikar Hose, Hemd und einen übel riechenden Mantel an. Dann steckte sie die leere Scotchflasche in ihre Tasche und hängte sie über die Schulter.
»Hoch mit dir!« Devon schob einen Arm unter die Schultern des Vikars. Er wog um die neunzig Kilo, schätzte sie, aber Buchesser waren stark. Sie hielt ihn mit Leichtigkeit aufrecht und führte seine schlurfende Gestalt zur Tür. Von denen, die noch lebten, konnten einige gehen, andere nicht. Er konnte es. Umso besser für sie.
Devon sah auf ihre Uhr: Es war fast halb zwei nachts. Sie lenkte ihren Schützling die Treppe hinunter, in Richtung des zur Gasse gelegenen Ausgangs. Die Nacht war mondlos und dunkel und wurde in halbwegs regelmäßigen Abständen von verrosteten Lampen durchbrochen.
»Ich bin froh, dass du nicht verheiratet bist«, sagte sie leise zu ihm, als sie in eine Pfütze aus Laternenlicht traten. »Es macht mich fertig, wenn ich Verheiratete aussuche. Weißt du das? Es ist ungerecht den Kindern gegenüber. Oder den Partnern.«
Der Vikar gab keine Antwort. Er hatte keine Worte mehr zu bieten; seine Seiten waren leer.
Devon umging die Hauptstraßen, hielt sich an Gassen und weniger bevölkerte Gegenden und durchquerte den örtlichen unbeleuchteten Park, um ein belebtes Viertel zu vermeiden. In der Dunkelheit und aus der Ferne sahen sie aus wie zwei Verliebte, die einen Abendspaziergang unternahmen, oder wie zwei betrunkene Freunde, die sich gegenseitig nach Hause führten.
Den Vikar loszuwerden war eine ihrer größten Hürden. Ethisch schwierig, weil sie mit der Schuld kämpfte, aber auch logistisch schwierig: der düstere praktische Aspekt des Versteckens von Leichen. Selbst wenn die Opfer überlebten, konnte sie sie nicht bei sich behalten, inkontinent und nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Und sie einfach in einem Krankenhaus zurückzulassen wäre verdächtig gewesen. Medizinische Untersuchungen hätten die Eigenartigkeit der Verletzungen möglicherweise ans Licht gebracht.
Zu Devons Glück gab es in der menschlichen Gesellschaft bereits eine ganze Unterschicht von Leuten, die faktisch unsichtbar waren.
Das Obdachlosenheim kam in Sicht, als Devon und der Vikar sich näherten. Genau wie die Menschen, denen es diente, hatte auch das Gebäude schon bessere Tage gesehen. Jemand hatte eine Reihe von Ladenfronten umgestaltet, indem er die Wände durchbrochen und die Glasfenster durch Metallgitter ersetzt hatte. Betonstufen führten hinauf zu einer dreifach verriegelten Tür. In einigen Unterkünften gab es Überwachungskameras, was die Sache heikel machte. Aus früherer Erfahrung wusste Devon, dass dies hier nicht der Fall war.
Sie setzte den Vikar auf die Treppe. Er sackte seitlich zusammen. Devon richtete ihn so aus, dass er es bequemer hatte, und neigte seinen Kopf in einen besseren Winkel. Das absolut Mindeste, was sie tun konnte. Dann nahm sie die inzwischen leere Scotchflasche aus ihrer Tasche und steckte sie in seine Armbeuge.
Nachdem dies erledigt war, widmete sie ihrer Umgebung einen letzten Blick. Leere Straße, ein Himmel wie vergossene Tinte, niemand in der Nähe. Sie winkte dem Vikar zum Abschied kurz zu. Er starrte sie mit leeren Augen an, eine unwissende und verlorene Seele.
»Tschüss«, sagte Devon und ging. Sie sah nicht zurück, weil sie irrationalerweise Angst hatte, sie könnte sich in eine Salzsäule verwandeln. Die Bibel, die sie gegessen hatte, färbte ihre Ängste mit einer religiösen Schattierung.
Am Morgen würde jemand den Vikar finden und ihn ins Haus holen. Nur eine weitere arme Sau auf der Straße, die einen Zusammenbruch hatte, einen Schlaganfall, irgendetwas. Man würde zwar misstrauisch sein, aber solange man kein MRT machte, erführe niemand jemals, was ihm fehlte.
Die Straßen ringsum waren tot und still, als ob die Stadt den kollektiven Atem anhielt, und sie passte sich dieser Stille instinktiv mit ihrem eigenen dahintreibenden, fließenden Gang an. Unheimliche Ruhe verdickte die Luft.
Etwas Reflektierendes glitzerte im Licht der Straßenlaterne, und sie blieb stehen und drückte sich in den nächsten verschlossenen Hauseingang. Er lag tief genug zurück, um die Konturen ihres Körpers zu verbergen, und von diesem Aussichtspunkt aus überprüfte sie die Straßen.
Zwei Blocks weiter stand ein einzelner Mann in der Mitte einer Kreuzung. Ein cremefarbener Anzug mit einem 1980er-Jahre-Flair umhüllte seinen massigen Körper. Trotz der Minustemperaturen trug er weder Schal noch Mantel oder Handschuhe. Eine Tätowierung überzog seinen Hals, sichtbar unter dem aufgeknöpften Hemdkragen.
Ein anderer Mann ging auf ihn zu, die Schritte unheimlich leise. Marineblauer Nadelstreifenanzug und die gleiche Tätowierung auf der Haut: die einer hungrige Schlange, die den eigenen Schwanz frisst.
Devon schlang die Arme um die Brust und presste sie an den Körper, obwohl ihr nicht kalt war. Diese Männer waren Drachen. Keine echten mythologischen Tiere, sondern erwachsene Gedankenesser, so genannt wegen der stilisierten Tätowierungen, die sich um ihre Hälse wanden.
Das Symbol, das sie trugen, war so alt wie die Familien selbst: ein Uroboros-Drache, der sich immerwährend selbst verzehrte. Gedankenesser zerstörten sich selbst durch ihren eigenen Hunger, denn der Prozess des Essens zehrte sie auf, während er sie fütterte. Ein Uroboros war die perfekte Darstellung dieses trostlosen Konzepts. Selbst wenn man den Gedankenessern Erlösung verabreichte, was ihnen ermöglichte, sich stattdessen an Büchern gütlich zu tun, verschwand das Verlangen nach Gedankenessen nie.
Irgendwann in ihrer Kindheit musste ein Ritter diese Tattoos gestochen haben, wie sie es bei allen ihren Schützlingen taten. Ritter waren einst kaum mehr als verstoßene Söhne gewesen, die nur die Aufgabe hatten, lasch den Frieden zwischen den Familien zu erzwingen und Bräute zwischen den Häusern zu eskortieren.
Mit dem Aufkommen von Erlösung fungierten sie nun als Hüter der Monster und hielten den Drachenhunger in Schach. Zumindest sollte es so funktionieren. In der Praxis neigten sie dazu, ihre gezähmten Drachen zum eigenen Vorteil und Gewinn einzusetzen.
Sie riskierte einen weiteren Blick. Die beiden Männer standen sich gegenüber, so dicht, dass sich ihre Stirnen fast berührten. Falls sie miteinander sprachen, musste es leise sein, denn Devon hörte keine Worte, obwohl sie angestrengt lauschte. Die Ampel schaltete von Grün auf Rot, und noch immer standen die Drachen reglos auf der leeren Straße.
Früher hatte sie befürchtet, dass das Leben als Drache Cais Schicksal wäre, mit Tattoo und allem Drum und Dran. Mittlerweile gab es dringlichere Probleme. Wie die Sorge, ob ihr Sohn verrückt würde, bevor er verhungerte, oder ob er verhungern würde, bevor er verrückt würde.
Wie viel Erlösung die Ritter wohl noch auf Lager hatten? Bestimmt wurden ihre Drachen schnell unbeherrschbar. Wie Devon mussten sie unbedingt die Ravenscars ausfindig machen. Anders als sie suchten sie Erlösung, um ihre gesellschaftliche Macht zurückzuerlangen. Devon wollte nur Cai retten.
Ihre Knie schmerzten, weil sie unbequem in die Hocke gegangen war, und ihre Sicht wurde durch Haarsträhnen beeinträchtigt, die sie nicht wegzustreichen wagte. Konzentration und Selbstbeherrschung! Im Augenblick leben! Wenn Drachen umherstreiften, waren Ritter nicht weit entfernt, und das bedeutete, dass sie die Stadt verlassen musste.
Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ein großer Volkswagen mit getönten Scheiben aus der entgegengesetzten Richtung heranrollte. Angespannt und still beobachtete sie, wie der Wagen an der Kreuzung abbremste und die Türen sich öffneten. Der Fahrer war nicht zu sehen. Beide Drachen stiegen ein. Der Volkswagen vollführte eine vorschriftswidrige Kehrtwende und steuerte in die Richtung, aus der er gekommen war.
Devon atmete tief durch und zog ihre Jacke fest um sich, als wäre sie eine Rüstung, die sie vor Gefahren schützen konnte. Sie trat aus dem Eingang und lief mit unhörbaren Schritten nach Hause.
*
Als sie zurückkam, war Cai wach und hatte einen Game Boy auf dem Schoß.
»Du bist wieder zu Hause«, stellte er fest, und sie unterdrückte ein Zusammenzucken. Er sprach mit dem Tonfall des Vikars, benutzte die gleichen lang gezogenen Vokale. Diese kleinen Veränderungen brachten sie jedes Mal aus der Fassung. Bei jedem Opfer. »Hast du gesagt, dass Hautcreme da ist? Mich juckt’s.«
»Nein, tut mir leid.« Sie zog die Schuhe aus und fühlte sich peinlich berührt und schuldig. »Der Kerl an der Kasse wollte meinen Ausweis sehen, weil ich Wodka kaufen wollte, und ich bin rausgegangen wie eine Bekloppte. Ich bringe dir bald welche, versprochen.« Immer machte sie ihm Versprechungen. Eines Tages würde sie sie einhalten.
»Schon okay«, sagte er, immer noch in Marios endlose Suche vertieft. Äußerlich sah ihr Sohn aus wie jeder andere Fünfjährige: klein, ein wenig hager, dunkelhaarig. Ihre Augen und ihre Gesichtszüge. Die außergewöhnlich lange Zunge, die zusammengerollt in seinem Mund lag, verursachte ein weichliches Lispeln, das Devon liebenswert fand.
Aber kein Fünfjähriger, den Devon je kennengelernt hatte, verhielt sich so sicher oder so erwachsen. Er war viel zu intelligent für sein Alter. Natürlich verzehrten die meisten Fünfjährigen nicht den Verstand anderer Menschen, um sich zu ernähren. Das machte den großen Unterschied.
An den meisten Tagen war sie sich nicht sicher, wie viel von Cai übrig blieb und wie viel von ihm durch eine andere Person überschrieben wurde. Ihre Erinnerungen, Gedanken und Moralvorstellungen, die seinen Geist mit ihren eigenen überfluteten. Sie fürchtete sich davor, dass er sich erinnerte, und sie fürchtete sich davor, dass er keine Selbstwahrnehmung hatte. Das Elend lag auf beiden Pfaden.
Devon setzte sich neben ihn. »Wie geht es dir?« Die Couch sackte unter ihrem gemeinsamen Gewicht ein, und die Federn quietschten, als sie nach einer bequemeren Sitzposition suchte.
»Besser, denke ich.«
»Du denkst?«, wiederholte sie und strich ihrem Sohn mit den Fingern die Haare aus der Stirn. Sie mussten mal wieder geschnitten werden.
Cai umklammerte den Game Boy. »Ich bin immer noch hungrig.«
»Oh!«
»Tut mir leid.« Er errötete.
»Nein, nein. Muss es nicht.« Devon legte den Arm um Cais Schultern und zog ihn an sich, damit sie ihm nicht ins Gesicht sehen musste. »Du kannst nichts dafür. Lass dies meine Sorge sein! Du machst dein Ding.« Sie fügte hinzu: »Alles wird guat, aye?« Das hatte eine Tante einmal zu ihr gesagt, und sie fand es seltsam tröstlich, diesen Satz zu wiederholen.
Cai nickte stumpfsinnig. Seine Schultern waren dünn unter ihren Fingern, und die Knochen seiner Wirbelsäule drückten in ihren Arm. Sonst führten Hungerkuren bei Jungen zu einem solchen Zustand.
Sein Hunger wurde mit zunehmendem Alter immer größer, und dies war der dritte Monat in Folge, in dem er innerhalb von dreißig Tagen mehr als eine Mahlzeit brauchte. Eigentlich brauchte er viel mehr als das, aber Devon konnte es nicht ertragen, jede Woche zu jagen, und es war auch logistisch schwierig. Sie bewegte sich auf dem schmalen Grat zwischen der Vernichtung möglichst weniger Leben und dem Zwang für ihren Sohn, in ständigem Hunger zu leben. Wie es jetzt um ihn stand, war er den größten Teil des Monats zu schwach, um sein Zimmer zu verlassen.
Wie die Besonderheiten von Hunger und Nahrungsaufnahme tatsächlich funktionierten, wusste Devon nicht. In ein paar Bissen Hirnmasse konnten ja nicht so viele Kalorien stecken, doch ohne Nahrungsaufnahme würde der Wahnsinn einsetzen und an Cais zerbrechlicher Psyche nagen. Schließlich würde er auch an Gewicht verlieren, Giftstoffe würden sein System überschwemmen, die Organe langsam versagen. Stets getrieben vom Bedürfnis und der Notwendigkeit zu konsumieren, wie es der biologische Entwurf des Sammlers vorsah.
Cai versuchte, von ihr abzurücken, offensichtlich fand er ihre Umarmung inzwischen lästig.
Sie ließ ihn los. »Auf dem Rückweg habe ich Drachen auf der Straße gesehen. Wir müssen bald hier weg.«
Er starrte schmollend auf die Konsole und schwieg. Mario war an einem Pilz gestorben, während sie abgelenkt waren.
»Tut mir leid. Ich weiß, wie sehr du das Reisen hasst.«
»Wo geht es diesmal hin?« Er klang so teilnahmslos.
»Das ist meine gute Nachricht des Abends. Ich treffe mich mit der Ravenscar-Kontaktperson.« Sie winkte mit dem Telefon. Erst dieses Treffen mit Chris, die Kontaktdaten ergattern, die er ihr angeboten hatte, und dann den Bus erwischen und wegfahren. Knappes Timing, aber machbar. »Wenn das gut läuft und sie mir ihr Heilmittel verkaufen, fahren wir vielleicht schon bald nach Irland.« Endlich. Zu guter Letzt.
Sein Schulterzucken wirkte mürrisch. »Kann ich was essen, bevor wir gehen? Ich bin echt hungrig.« Die lange Zunge in seinem Mund rollte sich auseinander und wieder zusammen.
»Wenn ich eine geeignete Person finde«, wich sie aus, und es schmerzte sie, seine Reaktion zu sehen. In den letzten paar Monaten hatte er so viel Hoffnung verloren. Sie konnte schwerlich erwarten, dass er sich einer weiteren Enttäuschung aussetzte. »Ich tue mein Bestes. Aber ich habe keine Zeit, jemanden richtig zu stalken.«
»Ich mach mich auch nicht verrückt.« Cai beugte sich vor, schaltete den Fernseher ein und zappte träge durch die Programme, bevor er sich für eine Folge von Red Dwarf entschied.
Devon saß eine Weile da und sah gegen ihren Willen zu. Lister, Cat und Rimmer ritten auf Pferden, verstrickt in irgendein Wildwestszenario. Lachkonserven wurden in den passenden Momenten eingespielt.
»Ich dachte, das wäre eine Science-Fiction-Sendung.« Devon sah nicht viel fern, obwohl sie ab und zu ein paar Programmzeitschriften gegessen hatte. Es lohnte sich, ein Minimum an Popkultur aufzusaugen, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollte, sich in die Gesellschaft einzufügen.
»Sie stecken in einer künstlichen Simulation fest«, erklärte Cai, ohne die Blicke vom Bildschirm abzuwenden. »Im Kopf von Kryten. Das ist der Robotertyp.«
Devon lächelte. »Wusste gar nicht, dass du ein Fan bist.«
»Oh ja!«, antwortete er mit einer Intonation, die die des Vikars perfekt widerspiegelte, und mit einer Spur echter Begeisterung. »Als Red Dwarf zum ersten Mal herauskam, gab es nichts Vergleichbares im Fernsehen. Eine bahnbrechende Sendung.«
Ihr Lächeln erstarb; sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie in eine so offensichtliche Gefühlsfalle getappt war. Red Dwarf war erstmals vor vierzehn Jahren ausgestrahlt worden. Lange bevor ihr Sohn gezeugt oder geboren worden war. Der Vikar allerdings mochte es miterlebt haben.
Ein bitteres Gefühl braute sich in ihrem Innern zusammen. Eins nach dem anderen, sagte sie sich. Konzentrier dichdarauf, was du beherrschen kannst!
»Hey.« Sie berührte seine Schulter. »Kannst du eine SMS für mich schreiben?« Die ewige Frustration, nicht schreiben zu können, nicht einmal elektronisch.
»Noch eine





























