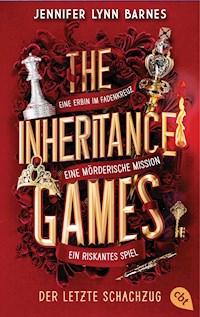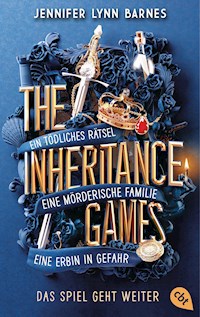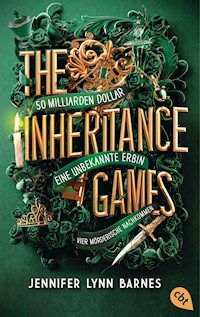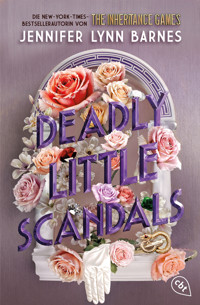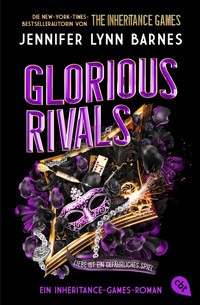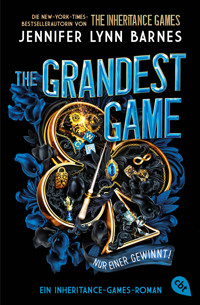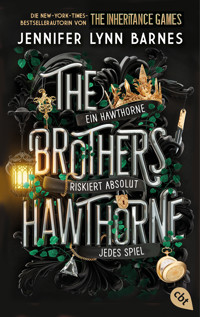
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die THE-INHERITANCE-GAMES-Reihe
- Sprache: Deutsch
Vier Brüder – Zwei Missionen – Das atemberaubende Abenteuer geht weiter
***Je nach Verfügbarkeit wird das Buch mit oder ohne Farbschnitt geliefert. Der gestaltete Buchschnitt ist auf eine limitierte Stückzahl begrenzt.***
Grayson Hawthorne ist als Kronprinz des milliardenschweren Familienunternehmens herangewachsen, doch der Patriarch ist verstorben, die Familie enterbt, das Vermögen dahin. Und so hat er es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Schaden von Avery, der Erbin, fernzuhalten. Als Ermittlungen zum Tod seines Vaters aufgenommen werden, bringt sie das allerdings in höchste Gefahr. Jameson Hawthorne ist abenteuerlustig und eine echte Spielernatur. Als sich plötzlich sein verschollener Vater bei ihm meldet und einen riskanten Gefallen erbittet, kann Jameson nicht widerstehen. Beide Hawthorne-Nachkommen werden vor schier unlösbare Aufgaben gestellt, doch an ihrer Seite stehen dabei ihre Brüder und Avery.
Die geniale Fortsetzung der New-York-Times-Bestseller-Trilogie »The Inheritance Games«.
Bis »The Brothers Hawthorne« erscheinen, können alle Fans der Autorin sich die Wartezeit mit dem ersten Band ihrer großartigen Thriller-Serie »Cold Case Academy« vertreiben.
Die »The Inheritance Games«-Reihe:
Inheritance Games (Band 1)
Inheritance Games – Das Spiel geht weiter (Band 2)
Inheritance Games – Der letzte Schachzug (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Jennifer Lynn Barnes
THE
BROTHERS
HAWTHORNE
Aus dem Amerikanischen von Ivana Marinović
Wir reduzieren und vermeiden die Emissionen, die an unseren Produkten entstehen fortlaufend und gleichen die verbliebenen Emissionen über ein Klimaschutzprojekt aus. Weitere Informationen zu dem Projekt: www.ClimatePartner.com/14044-1912-1001
FÜR JUDY ESHELMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2023 Jennifer Lynn Barnes
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »The Brothers Hawthorne« bei Little, Brown and Company, einem Verlag der Verlagsgruppe Hachette, New York
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ivana Marinović
Lektorat: Katja Hildebrandt
Covergestaltung: Carolin Liepins, München unter Verwendung des Originalumschlags: © 2023 Hachette Book Group, Inc.,
Illustration © Katt Phatt, Gestaltung: © Karina Granda
MP · Herstellung: AW
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30806-3V005
www.cbj-verlag.de
Zwölfeinhalb Jahre zuvor
Grayson und Jameson Hawthorne kannten die Regeln. Man konnte Regeln nicht umgehen, wenn man sie nicht kannte. Am Weihnachtsmorgen setzt ihr keinen Fuß vor euer Zimmer, bis die Uhr sieben schlägt.
Unter seiner Bettdecke hob Jameson das Armee-Walkie-Talkie an den Mund. »Du hast die Uhren vorgestellt?« Er war sieben, sein Bruder acht – beide alt genug, um Schlupflöcher zu finden.
Das nämlich war der Trick. Die Herausforderung. Das Spiel.
»Hab ich«, bestätigte Grayson.
Jameson zögerte. »Was, wenn der alte Herr sie zurückgestellt hat, nachdem wir ins Bett sind?«
»Dann müssen wir zu Plan B übergehen.«
Hawthornes hatten immer einen Plan B. Doch diesmal erwies er sich als unnötig. Hawthorne House verfügte über fünf Standuhren, und sie alle schlugen zur exakt selben Uhrzeit sieben: um 06:25 Uhr.
Sieg! Jameson warf sein Walkie-Talkie beiseite, schleuderte die Bettdecke weg und sauste los – durch die Tür, den Gang entlang, zweimal links, einmal rechts, quer über den Flur zur großen Treppe. Jameson flog. Aber Grayson war ein Jahr älter und größer … und hatte es aus seinem Flügel bereits halb die Treppe runtergeschafft.
Zwei Stufen auf einmal nehmend, bewältigte Jameson siebzig Prozent der Strecke, bevor er sich kurzerhand über das Geländer schwang. Er segelte ins Erdgeschoss und landete auf Grayson. Beide gingen zu Boden, ein Wirrwarr aus Armen, Beinen und weihnachtlichem Irrsinn. Dann rappelten sie sich auf, flitzten Kopf an Kopf los und erreichten zu exakt derselben Zeit den Großen Salon – nur um festzustellen, dass ihr fünfjähriger Bruder ihnen zuvorgekommen war.
Xander lag zusammengerollt wie ein Welpe auf dem Boden vor den Flügeltüren. Gähnend öffnete er die Augen und blinzelte zu ihnen hoch. »Ist schon Weihnachten?«
»Was tust du da, Xan?«, fragte Grayson stirnrunzelnd. »Hast du hier unten geschlafen? Die Regel besagt …«
»Keinen Fuß raussetzen«, fiel ihm Xander ins Wort und stemmte sich hoch. »Hab ich nicht. Ich bin gerollt.« Freimütig demonstrierte Xander es unter den baffen Blicken seiner Brüder.
»Du hast dich von deinem Zimmer hierher gewälzt, den ganzen Weg?« Jameson war ehrlich beeindruckt.
»Ganz ohne Füße.« Xander grinste. »Ich hab gewonnen!«
»Der Knirps ist uns voraus.« Der vierzehnjährige Nash kam zu ihnen rübergeschlendert und hob Xander auf seine Schultern. »Bereit?«
Die viereinhalb Meter hohen Türen zum Großen Salon wurden nur einmal im Jahr abgeschlossen, und zwar von Heiligabend um Mitternacht, bis die Jungs am Weihnachtsmorgen runterkamen. Jameson malte sich die Wunder aus, die auf der anderen Seite warteten.
Weihnachten auf Hawthorne House war magisch.
»Nimm du diese Seite der Tür, Nash«, befahl Grayson. »Jamie, du hilfst mir mit der.«
Grinsend schloss Jameson seine Finger neben denen seines Bruders um den goldenen Ring. »Ein, zwei, drei … zieht!«
Die majestätischen Türen teilten sich und enthüllten … nichts.
»Es ist weg.« Grayson wurde unnatürlich still.
»Was denn?«, fragte Xander, der seinen Hals reckte, um etwas zu sehen.
»Weihnachten«, wisperte Jameson. Keine Strümpfe am Kamin. Keine Geschenke. Keine Wunder oder Überraschungen. Selbst der Weihnachtsschmuck war fort – alles, bis auf den Baum, und selbst dem fehlten Kugeln und Kerzen.
Grayson schluckte. »Vielleicht wollte der alte Herr diesmal nicht, dass wir die Regeln brechen.«
Das war die Sache mit den Spielen: Manchmal verlor man.
»Kein Weihnachten?« Xanders Stimme zitterte. »Aber ich bin gerollt.«
Nash setzte Xander ab. »Ich kümmere mich darum«, versicherte er mit leiser Stimme. »Versprochen.«
»Nein.« Jameson schüttelte den Kopf; in seiner Brust und seinen Augen brannte es. »Wir haben was übersehen.« Er zwang sich, jedes Detail des Raumes in Augenschein zu nehmen. »Da!« Er deutete zu einer Stelle ganz oben an der Tannenbaumspitze, wo ein einsamer Baumschmuck zwischen den Zweigen hing.
Das war kein Zufall. Auf Hawthorne House gab es keine Zufälle.
Nash durchquerte den Raum, schnappte sich das Ding und hielt es hoch. Eine Kugel aus durchsichtigem Plastik an einem roten Band. Die Plastikhülle hatte eine sichtbare Naht.
Im Inneren steckte etwas.
Grayson nahm die Kugel und brach sie mit der Präzision eines Neurochirurgen auf. Ein einzelnes weißes Puzzleteil fiel heraus. Jameson stürzte sich drauf. Er drehte das Teil herum und sah auf der Rückseite die Handschrift seines Großvaters: 1/6.
»Eins von sechs«, sagte er laut, dann weiteten sich seine Augen. »Die anderen Bäume!«
Es gab sechs Weihnachtsbäume auf Hawthorne House. Der in der Eingangshalle streckte sich knapp sechs Meter in die Höhe, die Zweige von oben bis unten mit Lichterketten umwickelt. Der Baum im Speisezimmer war mit Perlenschnüren behangen, der im Teesalon mit Kristallen geschmückt. Üppig gewundene Samtbänder tanzten durch die Äste einer riesigen Tanne auf dem Treppenabsatz im ersten Stock, und ein weißer Baum, ganz in Gold gehüllt, thronte im zweiten.
Nash, Grayson, Jameson und Xander suchten sie alle ab, wobei sie fünf weitere Anhänger einsammelten, vier davon mit Puzzleteilen im Inneren. So konnten sie ein Quadrat zusammensetzen – ein leeres Quadrat.
Jameson und Grayson griffen gleichzeitig nach dem letzten Anhänger. »Ich hab den ersten Hinweis gefunden«, beharrte Jameson erbittert. »Ich wusste, dass es ein Spiel gibt.«
Grayson zögerte einen ausgedehnten Moment lang, dann ließ er los. In null Komma nichts hatte Jameson die Kugel geöffnet. Im Inneren fand er einen winzigen Metallschlüssel an einem kleinen Taschenlampenanhänger.
»Probier die Lampe auf dem Puzzle aus, Jamie.« Nicht einmal Nash konnte der Verlockung dieses Spiels widerstehen.
Jameson schaltete die Minitaschenlampe ein und richtete den Strahl auf das zusammengesetzte Puzzle. Worte tauchten auf: SÜDWESTLICHE ECKE DES ANWESENS.
»Wie lange laufen wir bis dahin?«, fragte Xander dramatisch. »Stunden?«
Das Hawthorne’sche Anwesen verfügte genau wie Hawthorne House selbst über beträchtliche Ausmaße.
Nash kniete sich neben Xander. »Falsche Frage, kleiner Mann.« Er schaute zu den anderen beiden hoch. »Will mir einer von euch vielleicht die richtige verraten?«
Jamesons Blick zuckte zum Schlüsselanhänger, doch Grayson kam ihm mit der Antwort zuvor. »Wofür genau ist der Schlüssel?«
Die Antwort war: für einen Golfcart. Nash fuhr. Als der südwestliche Winkel des Anwesens in Sicht kam, verfielen die vier Brüder beim Anblick dessen, was sich vor ihnen befand, in ehrfürchtiges Schweigen.
Dieses Geschenk hätte definitiv nicht in den Großen Salon gepasst.
Ein Quartett uralter gewaltiger Eichen, die nun das kunstvollste Baumhaus beherbergten, das irgendeiner von ihnen – und wahrscheinlich irgendwer auf der Welt – je gesehen hatte. Das mehrstöckige Wunderwerk sah aus wie einem Märchen entsprungen, als wäre es durch Magie aus den Eichen selbst heraufbeschworen worden, als würde es dorthin gehören. Jameson zählte neun Holzstege, die sich zwischen den Bäumen spannten. Das Haus verfügte über zwei Türme. Sechs Wendelrutschen. Leitern, Seile, Stufen, die in der Luft zu schweben schienen.
Das war das Baumhaus, das allen Baumhäusern die Krone aufsetzte.
Und vor dem Gebilde stand ihr Großvater, die Arme vor der Brust verschränkt, die Spur eines Lächelns auf dem Gesicht. »Wisst ihr, Jungs«, rief der große Tobias Hawthorne, als der Golfcart anhielt und der Wind zwischen den Ästen pfiff, »ich dachte, ihr wärt schneller hier.«
Kapitel 1
Grayson
Schneller. Grayson Hawthorne war schiere Kraft und Kontrolle. Seine Haltung war tadellos. Vor langer Zeit schon hatte er die Kunst perfektioniert, seinen Gegner zu visualisieren, jeden kommenden Hieb zu spüren, den fokussierten Schwung seines Körpers in jeden Block, jeden Angriff zu legen.
Aber man konnte immer noch schneller sein.
Nach dem zehnten Durchgang der Bewegungsabfolge hielt Grayson inne, wobei der Schweiß ihm über die nackte Brust rann. Die Atmung ruhig und beherrscht, kniete er sich vor das hin, was vom Baumhaus ihrer Kindheit übrig war, rollte sein Bündel aus und begutachtete die Auswahl: drei Dolche, zwei mit verziertem Griff, der dritte ganz schlicht und glatt. Grayson entschied sich für die letzte Klinge.
Mit dem Messer in der Hand richtete Grayson sich auf, die Arme locker an den Seiten ausgestreckt. Der Geist klar. Der Körper frei von Anspannung. Los. Es gab viele Messerkampfstile, und in seinem dreizehnten Lebensjahr hatte Grayson sie alle studiert. Aber natürlich hatten Tobias Hawthornes Enkelsöhne nie etwas bloß studiert. Sobald sie sich eine Fähigkeit ausgesucht hatten, wurde von ihnen erwartet, diese zu leben, sie zu atmen, sie zu meistern.
Und das war es, was Grayson in jenem Jahr gelernt hatte: Haltung ist alles. Du bewegst nicht die Klinge. Du bewegst dich – und mit dir die Klinge. Schneller. Schneller. Es muss sich ganz natürlich anfühlen. Es muss natürlich sein. In dem Moment, in dem deine Muskeln sich verspannen, in dem du aufhörst zu atmen, in dem du die Haltung verlierst, statt geschmeidig von einer in die nächste zu fließen, hast du verloren.
Und Hawthornes verloren nie.
»Als ich sagte, du sollst dir ein Hobby zulegen, meinte ich nicht so was.«
Grayson ignorierte Xanders Anwesenheit so lange, wie er brauchte, um die Sequenz zu beenden – und bis er den Dolch mit absoluter Genauigkeit in einen niedrig hängenden Ast zwei Meter entfernt geschleudert hatte. »Hawthornes haben keine Hobbys«, erklärte er seinem kleinen Bruder, während er rüberging, um die Klinge herauszuziehen. »Wir haben Spezialgebiete. Fachkenntnisse.«
»Alles, was wert ist, getan zu werden, ist wert, es gut zu tun«, zitierte Xanders mit wackelnden Augenbrauen – eine von ihnen war nach einem schiefgegangenen Experiment gerade erst dabei, wieder nachzuwachsen. »Und alles, was gut getan wurde, geht noch besser.«
Warum sollte ein Hawthorne sich mit besser begnügen, flüsterte eine Stimme in Graysons Hinterkopf, wenn er auch der Beste sein könnte?
Grayson schloss die Finger um das Heft seines Dolchs und zog. »Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen.«
»Du bist ein wahrlich Besessener«, erklärte Xander.
Grayson sicherte den Dolch in seiner Halterung, bevor er das Bündel wieder zusammenrollte und zuband. »Ich habe achtundzwanzig Milliarden Gründe, besessen zu sein.«
Avery hatte sich – und ihnen – eine unmögliche Aufgabe gestellt: fünf Jahre, um gut achtundzwanzig Milliarden Dollar zu verschenken. Das war der Großteil des Hawthorne’schen Vermögens. Die letzten sieben Monate hatten sie allein damit zugebracht, den Stiftungsvorstand und Beratungsausschuss zusammenzustellen.
»Uns bleiben fünf Monate, um die ersten drei Milliarden an Spenden festzulegen«, erklärte Grayson knapp, »und ich habe Avery versprochen, dass ich bei jedem Schritt dabei sein werde.«
Versprechen waren Grayson Hawthorne wichtig – genauso wie Avery Kylie Grambs. Das Mädchen, das das Vermögen ihres Großvaters geerbt hatte. Die Fremde, die zu einer von ihnen geworden war.
»Als jemand mit Freunden, einer Freundin und einer kleinen Armee von Robotern möchte ich lediglich anmerken, dass du etwas mehr Ausgleich in deinem Leben gebrauchen könntest«, merkte Xander an. »Ein richtiges Hobby. Was zum Entspannen?«
Grayson bedachte ihn mit einem vielsagenden Blick. »Xan, du hast seit Beginn der Sommerferien im letzten Monat drei Patente angemeldet.«
Er zuckte die Achseln. »Das sind Erholungspatente.«
Grayson schnaubte, dann musterte er seinen Bruder. »Wie geht’s eigentlich Isaiah?«, fragte er sanft.
Als Kinder hatte keiner der vier Hawthorne-Brüder die Identität ihres jeweiligen Vaters gekannt – bis Grayson herausfand, dass seiner Sheffield Grayson war. Nashs war ein Mann namens Jake Nash. Und Xanders war Isaiah Alexander. Von den drei Männern verdiente tatsächlich nur Isaiah die Bezeichnung Vater. Er und Xander, beide passionierte Tüftler und Erfinder, reichten diese »Erholungspatente« gemeinsam ein.
»Wir wollten hier gerade über dich reden«, erwiderte Xander unbeirrt.
»Ich sollte zurück an die Arbeit«, entgegnete Grayson und schlug dabei einen Ton an, der sehr wirksam war, um jeden in seine Schranken zu weisen – jeden bis auf seine Brüder. »Und ganz gleich, was Avery und Jameson zu glauben scheinen, ich benötige keinen Babysitter.«
»Nein, du benötigst keinen Babysitter«, pflichtete Xander ihm fröhlich bei, »und ich schreibe gerade auch ganz bestimmt keinen Ratgeber mit dem Titel Pflege und Ernährung deines grüblerischen zwanzigjährigen Bruders.«
Graysons Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Ich darf dir versichern«, verkündete Xander mit großem Ernst, »dass es über keine Abbildungen verfügt.«
Bevor Grayson mit einer passenden Drohung kontern konnte, vibrierte sein Handy. In der Annahme, dass es sich um die Zahlen handelte, die er angefordert hatte, zog Grayson es hervor, nur um eine SMS von Nash vorzufinden. Er hob den Blick zu Xander und wusste sofort, dass sein jüngster Bruder die gleiche Nachricht empfangen hatte.
Grayson war es, der den unheilvollen Notfall-Code vorlas: »911.«
Kapitel 2
Jameson
Das Tosen der Fälle. Der Sprühnebel in der Luft. Das Gefühl von Averys Rücken an seiner Brust. Jameson Winchester Hawthorne war hungrig – nach dem hier, nach ihr, nach allem und jedem, nach mehr.
Die Iguazú-Wasserfälle bildeten das größte Wasserfallsystem der Welt. Der Steg, auf dem Avery und er standen, führte sie unmittelbar an den Rand eines unfassbaren Abgrunds. Während er auf die Wasserfälle hinausblickte, verspürte Jameson die Verlockung des Mehr. Er beäugte das Geländer. »Na, forderst du mich heraus?«, murmelte er an Averys Hinterkopf.
Sie hob die Hand nach hinten, um seinen Kiefer zu berühren. »Definitiv nicht.«
Jamesons Mundwinkel verzogen sich – ein neckisches Lächeln, ein verschlagenes. »Du hast wahrscheinlich recht, Erbin.«
Sie drehte den Kopf zur Seite und sah ihm in die Augen. »Wahrscheinlich?«
Jamesons Blick schweifte erneut zu den Fällen. Unaufhaltbar. Absolut verboten. Tödlich. »Wahrscheinlich.«
Sie übernachteten in einem auf Pfosten errichteten Pavillon, umgeben vom Dschungel, meilenweit kein Mensch in Sicht, nur sie beide, Averys Security-Team und die in der Ferne brüllenden Jaguare.
Jameson spürte Avery näher kommen, bevor er sie hörte.
»Kopf oder Zahl?« Sie lehnte sich gegen das Geländer, wobei sie eine silbern-bronzene Münze zückte. Das braune Haar löste sich aus ihrem Pferdeschwanz, ihr langärmliges Shirt war immer noch feucht von den Wasserfällen.
Jameson hob seine Hand an ihr Haargummi und zog es sanft und gemächlich runter. Kopf oder Zahl war eine Einladung. Eine Herausforderung. Küss du mich, oder ich küsse dich. »Wahl des Gebers, Erbin.«
»Wenn ich der Geber bin …« Avery legte eine flache Hand auf seine Brust, wobei ihre Augen ihn herausforderten, etwas mit diesem nassen Shirt von ihr anzustellen. »… werden wir Karten brauchen.«
Die Dinge, die wir tun könnten, überlegte Jameson, mit nur einem Kartendeck. Doch bevor er einige der verlockenderen Möglichkeiten äußern konnte, vibrierte das Satellitentelefon. Nur fünf Menschen hatten diese Nummer: seine Brüder, Averys Schwester und Averys Rechtsanwältin. Jameson stöhnte.
Die SMS war von Nash. Neun Sekunden später klingelte das Satellitentelefon und Jameson ging ran. »Erquickliches Timing, Gray, wie immer.«
»Ich nehme an, du hast Nashs Nachricht bekommen?«
»Wir wurden einbestellt«, verkündete Jameson. »Hast du wieder vor zu schwänzen?«
Jeder Hawthorne-Bruder hatte das Anrecht auf einen 911-Ruf pro Jahr. Der Code bedeutete weniger Notfall als Ich will euch alle bei mir haben, aber wenn ein Bruder ihn losschickte, kamen die anderen, ohne Fragen zu stellen. Die 911 zu ignorieren … hatte Konsequenzen zur Folge.
»Wenn du auch nur ein Wort über Lederhosen verlierst«, stieß Grayson aus, »dann werde ich …«
»Hast du gerade ›Lederhosen‹ gesagt?« Jameson genoss das hier viel zu sehr. »Du wirst ja langsam richtig locker, Gray. Bittest du mich etwa, dir ein Foto der unfassbar engen Lederhose zu schicken, die du das eine Mal tragen musstest, als du einen 911-Ruf ignoriert hast?«
»Du schickst mir kein Foto …«
»Ein Video?«, fragte Jameson laut. »Du willst ein Video, wie du in der Lederhose Karaoke singst?«
Avery nahm ihm das Telefon aus der Hand. Sie wusste genauso gut wie Jameson, dass Nashs Nachricht nicht ignoriert werden würde, und sie pflegte die schlechte Angewohnheit, seine Brüder nicht auf die Folter zu spannen.
»Grayson, ich bin’s.« Avery las sich Nashs Nachricht selbst durch. »Wir sehen uns in London.«
Kapitel 3
Jameson
In tiefster Nacht, an Bord eines Privatjets, blickte Jameson aus dem Fenster. Avery schlief mit dem Kopf auf seiner Brust. Weiter vorne im Flieger, wo Oren und der Rest des Security-Teams saßen, war es ebenfalls ruhig.
Ruhe setzte Jameson immer genauso sehr zu wie Stille. Skye hatte ihnen mal erzählt, dass sie nicht für Trägheit geschaffen war, und sosehr Jameson es hasste, irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen sich und seiner verwöhnten, zuweilen mörderisch veranlagten Mutter zu erkennen, wusste er, was sie damit meinte.
Die letzten Wochen war es immer schlimmer geworden. Seit Prag. Jameson schob die unerwünschte Erinnerung von sich, doch nachts, wenn da nichts war, was ihn ablenkte, konnte er dem Drang kaum noch widerstehen – dem Drang, sich zu erinnern, nachzudenken, dem Sirenengesang des Risikos und eines zu lösenden Geheimnisses nachzugeben.
»Du hast diesen Ausdruck im Gesicht.«
Jameson strich mit der Hand über Averys Haar. Ihr Kopf lag immer noch auf seiner Brust, doch ihre Augen waren offen. »Welchen Ausdruck?«, fragte er leise.
»Unseren Ausdruck.«
Averys Hirn war ebenso auf Rätsel gepolt wie seines. Genau das war der Grund, warum Jameson es nicht riskieren konnte, das Schweigen und die Stille hereinzulassen, warum er sich ständig beschäftigen musste. Denn wenn er es sich gestattete, ernsthaft über Prag nachzudenken, würde er es ihr erzählen wollen; und wenn er es ihr erzählte, wäre es real. Und sobald es real wäre, fürchtete er, dass keine noch so große Ablenkung in der Lage wäre, ihn zurückzuhalten, ganz gleich wie leichtsinnig und gefährlich es wäre, dem nachzugehen.
Jameson vertraute Avery mit allem, was er hatte, und allem, was er war, aber er konnte sich selbst nicht immer trauen, das Richtige zu tun. Das Vernünftige. Das Sichere.
Erzähl es ihr nicht. Jameson zwang seine Aufmerksamkeit, eine andere Richtung einzuschlagen, verbannte sämtliche Gedanken an Prag. »Erwischt, Erbin.« Die einzige Möglichkeit, etwas vor Avery zu verbergen, bestand für ihn darin, ihr etwas anderes zu zeigen. Etwas Wahres. Als Irreführung. »Mein freies Jahr ist beinahe vorbei.«
»Du bist unruhig.« Avery hob den Kopf von seiner Brust. »Schon seit Monaten. Bei dieser Reise hier war es nicht so spürbar, aber bei den anderen, wenn ich arbeite …«
»Ich will …« Jameson schloss die Augen, stellte sich vor, wie er an den Wasserfällen stand, das Tosen hörte … das Geländer taxierte. »Ich weiß nicht, was ich will. Irgendwas.« Er richtete den Blick wieder nach draußen, in die Schwärze. »Großartige Dinge vollbringen.«
Denn das war der Anspruch, der immer auf einem Hawthorne lastete – und zwar großartig nicht im Sinne von sehr gut, sondern großartig im Sinne von gewaltig, bleibend und unglaublich. So großartig wie die Wasserfälle.
»Wir tun doch großartige Dinge«, erwiderte Avery. Für sie bestand dieses Tun darin, die Milliarden seines Großvaters zu verschenken. Sie würde die Welt verändern. Und ich bin hier, bei ihr. Ich höre das Tosen des Wassers. Spüre den Sprühnebel. Doch Jameson wurde das nagende Gefühl nicht los, dass er dabei immer hinter der Absperrung stand.
Er tat keine großartigen Dinge. Nicht so wie sie. Nicht mal so wie Grayson.
»Das ist unser erstes Mal zurück in Europa«, sagte Avery leise, wobei sie sich vorbeugte, um wie er in die Schwärze hinauszublicken. »Seit Prag.«
Überaus scharfsichtig, Avery Kylie Grambs.
Es lag eine Kunst in seinem unbekümmerten Lächeln. »Ich hab’s dir doch gesagt, Erbin, du musst dir wegen Prag keine Sorgen machen.«
»Ich mache mir keine Sorgen, Hawthorne. Ich bin neugierig. Warum willst du mir nicht sagen, was in jener Nacht passiert ist?« Avery wusste, wie sie das Schweigen zu ihrem Vorteil nutzen konnte – indem sie jede Pause so einsetzte, dass sie damit seine volle Aufmerksamkeit einforderte, indem sie ihn ihr Schweigen spüren ließ wie einen Atemhauch auf seiner Haut. »Du bist in der Morgendämmerung heimgekommen. Du hast nach Feuer und Asche gerochen. Und du hattest einen Schnitt …« Sie hob die Hand an die Mulde seines Schlüsselbeines direkt an seinem Halsansatz. »… hier.«
Hätte Avery ihn zwingen wollen, es ihr zu erzählen, hätte sie es tun können. Ein kleines Wort nur – Tahiti –, und seine Geheimnisse wären ihre gewesen. Aber sie würde es nicht erzwingen, und Jameson wusste das, und es brachte ihn um. Alles an ihr brachte ihn um, und das auf die bestmögliche Art überhaupt.
Erzähl es ihr nicht. Denk nicht daran. Widerstehe.
Jameson senkte seine Lippen, bis sie nur ein paar Zentimeter von ihren entfernt waren. »Wenn du willst, Mystery-Girl«, murmelte er, wobei die Hitze zwischen ihnen anstieg, der Name ein Relikt aus anderen Zeiten, »darfst du mich ab sofort Mystery-Boy nennen.«
Kapitel 4
Grayson
Es war Jahre her, dass Grayson einen Fuß auf Londoner Boden gesetzt hatte, doch die Wohnung sah aus wie immer: dieselbe historische Fassade und moderne Inneneinrichtung, dieselbe weitläufige Terrasse und exquisite Aussicht.
Dieselben vier Brüder, die diese Aussicht genossen.
Jameson, der neben Grayson stand, hob eine Augenbraue in Nashs Richtung. »Wie ist die Lage, Cowboy?« Genau das hatte sich Grayson auch gefragt, denn Nash nutzte beinahe nie seinen jährlichen 911-Ruf.
»So.« Ihr ältester Bruder warf eine samtbezogene Schachtel auf den Glastisch. Eine Schatulle. Grayson vergaß zu blinzeln, als Nash den Deckel aufklappte, um ein bemerkenswertes Schmuckstück zu enthüllen: ein von komplizierten diamantenen Blättchen umrankter und in Platin gefasster schwarzer Opal. Die Farbnuancen in dem Edelstein waren elektrisierend, ein Meisterwerk ohnegleichen. »Den hat Nan mir gegeben. Er gehörte unserer Großmutter.«
Nash war der Einzige, der noch Erinnerungen an Alice Hawthorne hatte, die gestorben war, bevor die anderen Brüder das Licht der Welt erblickten.
»Es war weder ihr Hochzeits- noch ihr Verlobungsring«, erklärte Nash mit seinem gedehnten texanischen Akzent. »Aber Nan meinte, er würde gut zu Lib passen.« Nash neigte leicht den Kopf. »Zu eben diesem Zweck.«
Lib wie Libby Grambs, Nashs Lebensgefährtin, Averys Schwester.
Grayson spürte, wie ihm der Atem stockte.
»Nan, unsere Urgroßmutter, hat dir einen Familienring für Libby gegeben«, rekapitulierte Xander. »Und das ist ein Problem?«
»Ganz genau«, bestätigte Nash.
Grayson stieß den Atem aus. »Weil du noch nicht bereit bist.«
Nash hob den Blick und ließ ein langsames, verschmitztes Grinsen sehen. »Weil ich ihr schon einen gekauft habe.« Er ließ eine zweite Schatulle auf den Tisch fallen.
Mit jeder Sekunde, die verstrich, zogen sich die Muskeln über Graysons Brustkorb enger zusammen, dabei wusste er noch nicht mal, warum.
Jameson, der ungewöhnlich still geworden war, seitdem er den ersten Ring gesehen hatte, riss sich aus der Starre und klappte die zweite Schatulle auf. Sie war leer.
Nash hat ihr schon einen Antrag gemacht. Er und Libby sind bereits verlobt. Die Erkenntnis traf Grayson mit ungeahnter Wucht. Alles ändert sich. Was tatsächlich ein reichlich überflüssiger Gedanke war. Ihr Großvater war tot. Sie waren alle enterbt worden. Es hatte sich bereits alles geändert. Nash war schon mit Libby zusammen. Jameson mit Avery. Selbst Xander hatte Max.
»Nash Westbrook Hawthorne«, tönte Xander, »mach dich bereit für eine kräftige, freudvolle Umarmung höchst männlicher Art!«
Xander gab Nash keineswegs die Zeit, sich vorzubereiten, als er ihn auch schon anfiel – ihn umarmte, quetschte, niederrang, versuchte, ihn in die Luft zu heben, alles auf einmal. Jameson stürzte sich ins Gemenge, und Grayson zwang alle anderen Gedanken beiseite, um Nash auf die Schulter zu klopfen … und ihn dann nach hinten zu zerren.
Drei gegen einen. Nash hatte keine Chance.
»Spontane Junggesellenparty!«, rief Jameson, als sich die vier endlich voneinander lösten. »Gebt mir eine Stunde.«
»Halt.« Nash hielt eine Hand hoch, bevor er seinem ersten Wer-ist-hier-der-Älteste?-Befehl einen zweiten folgen ließ. »Hiergeblieben.« Jameson gehorchte und Nash fixierte ihn mit einem Blick. »Hast du vor, irgendwelche Gesetze zu brechen, Jamie? Denn du warst in letzter Zeit ziemlich wild unterwegs.«
Soweit Grayson wusste, hatte es da einen Vorfall in Monaco gegeben, einen weiteren in Belize …
Jameson zuckte lapidar mit den Schultern. »Du weißt doch, wie es heißt: Wo kein Kläger, da kein Richter.«
»Ach, heißt das so?«, erwiderte Nash mit täuschender Milde. Und dann, aus unerklärlichem Grund, war es Grayson, auf den sich Nashs Blick richtete.
Was habe ich getan? Grayson verengte die Augen zu Schlitzen. »Du hast uns nicht um deinetwillen hergerufen.«
Nash lehnte sich zurück. »Unterstellst du mir etwa, eine Mutterglucke zu sein, Gray?«
»Oh, eine Kampfansage«, sagte Xander vergnügt und überhaupt viel zu angetan von der Aussicht.
Nash bedachte Grayson mit einem letzten Blick, bevor er sich wieder Jameson zuwandte. »Spontane Junggesellenparty«, stimmte er zu. »Aber Gray und Xan helfen dir bei der Planung … außerdem gilt die Baumhaus-Regel.«
Was im Baumhaus geschieht, bleibt im Baumhaus.
Kapitel 5
Grayson
Ihre Nacht endete um drei Uhr morgens. »Eisklettern, Skywalken, Rennboote, Mopeds …« Jameson hörte sich sehr selbstzufrieden an. »Von den Clubs ganz zu schweigen.«
»Ich finde ja, die mittelalterliche Krypta hatte was«, fügte Xander hinzu.
Grayson zog eine Augenbraue hoch. »Ich nehme an, Nash hätte es auch ohne Panzerklebeband-Fesselung gut gefallen.«
Der Mann der Stunde nahm seinen Cowboyhut ab und lehnte sich gegen die Wand. »Was im Baumhaus geschieht, bleibt im Baumhaus«, wiederholte er, und sein leiser Tonfall erinnerte Grayson daran, dass Avery und Libby oben schon schliefen.
Ein Kloß machte sich in seiner Kehle breit. »Glückwunsch«, sagte er zu seinem Bruder. Und das meinte er auch so. Leben bedeutete Veränderung. Die Menschen mussten weitermachen, auch wenn er selbst es nicht konnte.
Jameson und Xander torkelten müde ins Bett, doch Nash hielt Grayson zurück. Als sie allein waren, legte sein großer Bruder ihm etwas in die Hand. Die Schmuckschatulle. Mit dem schwarzen Opalring ihrer Großmutter.
»Wie wär’s, wenn du den an dich nimmst?«, sagte Nash.
Grayson schluckte, seine Kehle zog sich zusammen. »Warum ich?« Jameson wäre die naheliegendere Wahl gewesen, aus ziemlich offensichtlichen Gründen.
»Warum nicht du, Gray?« Nash beugte sich vor, sodass sein Blick auf Höhe von Graysons war. »Eines Tages, mit irgendwem – warum nicht du?«
Als Grayson Stunden später aufwachte, lag der Ring immer noch in seiner Schatulle auf dem Nachttisch. Warum nicht du?
Er hievte sich aus dem Bett und schob die Schatulle rasch in ein Geheimfach in seinem Koffer. Wenn Nash das Familienerbstück sicher verwahrt haben wollte, würde Grayson dafür sorgen. Bedeutende Dinge zu beschützen, war das, was er gemeinhin tat, auch wenn er selbst es sich nicht leisten konnte, dass sie ihm zu viel bedeuteten.
Draußen auf der Terrasse saß bereits Avery und ließ sich ein beeindruckendes Frühstück schmecken. »Ich habe gehört, gestern Nacht war legendär.« Sie reichte ihm eine Tasse Kaffee, schwarz, heiß und bis zum Rand gefüllt.
»Jamie hat eine große Klappe«, erwiderte Grayson. Der Becher wärmte seine Hände.
»Vertrau mir«, murmelte Avery. »Jameson weiß ganz gut, wie man ein Geheimnis hütet.«
Grayson musterte sie auf eine Art, wie er es sich vor Monaten nicht gestattet hätte. Es schmerzte nicht ganz so sehr, wie es das damals getan hätte. »Dreht er ab?«
»Nein.« Avery schüttete den Kopf, wobei ihr das Haar ins Gesicht fiel. »Er sucht nur nach etwas … oder versucht, nicht danach zu suchen. Oder beides.« Sie hielt inne. »Was ist mit dir, Gray?«
»Mir geht’s gut.« Die Antwort kam automatisch, einstudiert und duldete keinen Widerspruch. Doch bei ihr konnte er es nie dabei belassen. »Und nur fürs Protokoll: Falls Xander dir ein ›Buch‹ zeigt, an dem er gerade schreibt, wirst du es zerstören, oder es gibt Konsequenzen.«
»Konsequenzen!« Xander kam auf die Terrasse geflitzt, quetschte sich zwischen sie und schnappte sich ein Schokocroissant. »Die liebe ich ja!«
»Wer von uns liebt nicht den Geschmack von Konsequenzen am frühen Morgen?« Jameson kam herausgeschlendert, nahm sich ebenfalls ein Croissant und wedelte damit in Graysons Richtung. »Hat Avery dir schon von ihrem neuen Terminplan erzählt? Von den ganzen Meetings? London weiß offiziell, dass die Hawthorne-Erbin in der Stadt ist.«
»Meetings?« Grayson griff nach seinem Handy. »Um wie viel Uhr?« Es klingelte, bevor Avery antworten konnte. Grayson stand abrupt auf, als er sah, wer ihn anrief. »Da muss ich ran.« Mit großen Schritten ging er hinein, schloss die Tür und vergewisserte sich, dass niemand ihm gefolgt war, bevor er sich meldete.
»Ich nehme an, wir haben ein Problem.«
Kapitel 6
Jameson
Faszinierend.« Jameson blickte in die Richtung, in die Grayson verschwunden war. »War das etwa eine Spur echter menschlicher Emotion auf seinem Gesicht?«
Avery bedachte ihn mit einem fragenden Blick. »Besorgt? Oder neugierig?«
»Ich? Wegen Grayson?«, erwiderte er. Beides. »Weder noch. Wahrscheinlich ist es sein Schneider, der anruft, um ihn damit aufzuziehen, dass er ein Zwanzigjähriger ist, der einen Schneider hat.«
Xander grinste. »Soll ich mich reinschleichen und mal lauschen?«
»Willst du damit andeuten, dass du auch nur annähernd in der Lage wärst, dich unauffällig zu verhalten?«, gab Jameson zurück.
»Klar bin ich das!«, beharrte Xander. »Offenbar bist du immer noch voller Groll darüber, in welchem Ausmaß meine legendären Tanz-Moves gestern Nacht alle im Club von den Socken gehauen haben.«
Jameson ging nicht weiter darauf ein, sondern schaute zu Oren, der sich zu ihnen auf die Terrasse gesellt hatte. »Apropos gestern Nacht«, sagte er. »Wie schlimm ist die Paparazzi-Situation heute früh?«
»Britische Klatschpresse.« Orens Augen verengten sich zu Schlitzen. Averys Security-Chef war ehemaliger Soldat und geradezu beängstigend kompetent. Dass er seine Augen überhaupt zusammenkniff, verriet Jameson, dass die Paparazzi-Situation nicht gut war. »Ich lasse draußen zwei Männer patrouillieren.«
»Und ich habe Meetings«, erwiderte Avery bestimmt. Offenbar hatte sie nicht vor, ihre Pläne wegen der Paparazzi zu ändern. Oren war klug genug, sie nicht darum zu bitten.
»Ich könnte sie ablenken«, schlug Jameson verschmitzt vor. Für Ärger sorgen war seine Spezialität.
»Ich weiß das Angebot zu schätzen«, murmelte Avery und blieb stehen, um ihre Lippen leicht auf seine zu pressen. »Aber nein.«
Der Kuss war kurz. Zu kurz. Jameson sah ihr nach. Oren folgte ihr. Schließlich stand auch Xander auf, um duschen zu gehen. Jameson blieb auf der Terrasse, genoss die Aussicht und ließ das dekadent-buttrige Croissant auf seiner Zunge zergehen, Happen für Happen, während er versuchte, nicht darüber nachzudenken, wie ruhig es war, wie still.
Und dann kam Grayson wieder heraus, in der Terrassentür stand sein Koffer. »Ich muss weg.«
»Wohin weg?«, erwiderte Jameson sofort. Herausforderungen waren gut für Graysons Gottkomplex, und ihn herauszufordern war selten langweilig. »Und warum?«
»Ich habe ein paar Privatangelegenheiten zu erledigen.«
»Seit wann hast du so was wie private Angelegenheiten?« Jetzt war Jameson offiziell neugierig.
Grayson würdigte die Frage mit keiner Antwort, sondern drehte sich einfach um und ging durch die Wohnung davon. Jameson machte Anstalten, ihm zu folgen, doch da vibrierte sein Handy: Oren.
Er ist bei Avery. Jameson blieb stehen und ging ran. »Probleme?«
»Nicht bei mir. Avery geht es gut. Aber einer meiner Männer hat gerade den Portier abgefangen.« Während Oren berichtete, verschwand Graysons Gestalt aus Jamesons Blickfeld. »Wie es scheint, hat er eine Lieferung. Für dich.«
Im Flur hielt der Portier ihm ein silbernes Tablett hin. Darauf lag eine einzelne Karte.
Jameson neigte den Kopf zur Seite. »Was ist das?«
Die Augen des Portiers waren hell. »Es scheint eine Karte zu sein, Sir. Eine Visitenkarte.«
Jamesons Neugier war entfacht, und so angelte er sich die Karte, wobei er sie zwischen Mittel- und Zeigefinger klemmte – der Griff eines Zauberers, als würde er sie verschwinden lassen. In dem Moment, als sein Blick auf die in die Karte geprägten Worte fiel, verblasste alles um ihn herum.
Ein Name und eine Adresse. Ian Johnstone-Jameson. 9 King’s Gate Terrace. Jameson drehte die Karte um, doch da war keine Nachricht notiert, nur eine Zeitangabe: 14 Uhr.
Kapitel 7
Jameson
Stunden später stahl Jameson sich aus der Wohnung, ohne dass Nash, Xander oder das Security-Team davon Wind bekamen. Und was die britischen Paparazzi anging – sie waren nicht darauf gepolt, Hawthornes zu verfolgen. Jameson traf also mit standesgemäßer Verspätung allein in der 9 King’s Gate Terrace ein.
Wenn du spielen willst, Ian Johnstone-Jameson, werde ich spielen. Nicht weil er einen Vater brauchte, sich einen wünschte oder sich nach einem sehnte, so wie er es als Kind getan hatte. Sondern weil irgendwas zu tun, um seine Gedanken beschäftigt zu halten, weniger gefährlich schien, als gar nichts zu tun. Das weiße Gebäude war imposant; es erhob sich fünf Stockwerke in die Höhe und erstreckte sich über die gesamte Länge der Straße. Ein Luxusappartement neben dem anderen, zwischendrin ein, zwei Botschaften. Die Gegend war vornehm. Exklusiv. Bevor Jameson den Klingelknopf drücken könnte, kam ein Security-Typ auf ihn zu. Eine Wache für mehrere Einheiten.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?« Der Tonfall verriet, dass er das keineswegs könne.
Aber Jameson war nicht umsonst ein Hawthorne. »Ich werde erwartet. Nummer neun.«
»Ich wüsste nicht, dass er im Hause ist.« Die Antwort des Mannes war glatt, sein Blick scharf. Jameson zückte die Visitenkarte. »Ah«, sagte der Mann und nahm sie entgegen. »Verstehe.«
Zwei Minuten später stand Jameson im Eingangsbereich eines Appartements, neben der die Hawthorne’sche Londoner Bleibe eher bescheiden rüberkam. Ein weißer Marmorboden mit einem eingelassenen schwarz glänzenden B markierte ein Foyer, das sich endlos durch die gesamte Wohnung zu erstrecken schien. Gläserne Türen eröffneten den unverstellten Blick auf die ausgewählten Kunstwerke, welche den weißen Flur über die gesamte Länge säumten.
Ian Johnstone-Jameson schob eine der gläsernen Türen auf.
Diese Familie ist so prominent, hörte Jameson seine Mutter sagen, dass jeder meiner Liebhaber in einer Höhle gelebt haben muss, um nicht mitzubekommen, dass er einen Sohn hat.
Der Mann, der nun auf ihn zukam, war Mitte vierzig; das dichte braune Haar exakt so lang, dass man ihn nicht mit einem typischen Manager oder Politiker verwechseln konnte. Etwas an seinen Zügen war schmerzhaft vertraut – nicht die Nase oder der Kiefer, aber die Form und Farbe seiner Augen, der Schwung seiner Lippen. Die Belustigung darin.
»Ich hatte schon gehört, dass eine gewisse Ähnlichkeit besteht«, bemerkte Ian mit einem Akzent, der genauso vornehm war wie seine Adresse. Er neigte den Kopf leicht zur Seite, eine Bewegung, die Jameson nur allzu gut kannte. »Möchtest du eine Führung?«
Jameson hob eine Augenbraue. »Möchtest du mir eine geben?« Nichts war von Bedeutung, außer man ließ es zu.
»Chapeau.« Ians Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Dafür hast du meinen Respekt.« Der Brite machte kehrt und schob die erste Glastür auf. »Drei Fragen. Die gewähre ich dir im Austausch für die Beantwortung einer von meinen.«
Ian Johnstone-Jameson hielt die Tür auf, wartete. Jameson ließ ihn kurz warten, bevor er gemächlich vorwärtsschlenderte.
»Du wirst deine Fragen zuerst stellen«, sagte Ian.
Werde ich das?, dachte Jameson, doch er war zu sehr Hawthorne, um das laut auszusprechen. »Und wenn ich keine Fragen an dich habe, bin ich gespannt, was du mir als Nächstes anbieten wirst.«
Ians Augen funkelten in einem lebhaften Grün. »Du hast das nicht als Frage formuliert«, bemerkte er.
Jameson zeigte seine Zähne. »Nein, habe ich nicht.«
Sie schritten den langen Flur hinunter, passierten weitere Glastüren und ein Matisse-Gemälde. Jameson wartete, bis sie in der Küche angelangt waren – ganz in Schwarz, von den Arbeitsflächen bis zu den Geräten und dem Granitboden –, bevor er seine erste Frage äußerte. »Was willst du, Ian Johnstone-Jameson?«
Man konnte nicht als Hawthorne aufwachsen, ohne zu begreifen, dass jeder etwas von einem wollte.
»Ganz einfach«, erwiderte Ian. »Ich will dir meine Frage stellen. Im Grunde ist es mehr eine Bitte um einen Gefallen. Aber als Zeichen meiner guten Absichten möchte ich dir entgegenkommen, indem ich die Frage auch in einem allgemeineren Sinn beantworte. Gemäß meinen Lebensregeln will ich drei Dinge: Vergnügungen. Herausforderungen.« Er lächelte. »Und gewinnen.«
Jameson hatte nicht erwartet, dass irgendwas von dem, was dieser Mann zu sagen hatte, ihn so treffen würde.
Konzentration. Er konnte die Ermahnung seines Großvaters förmlich hören. Verliert ihr die Konzentration, Jungs, verliert ihr das Spiel. Ausnahmsweise ließ Jameson sich in die Erinnerung zurückfallen. Er war Jameson Winchester Hawthorne. Er brauchte verdammt noch mal gar nichts von diesem Mann vor ihm.
Sie waren sich kein bisschen ähnlich.
»Was ist für dich Gewinnen?« Jameson wählte eine Frage, die ihm eine Einschätzung des Mannes erlauben würde. Kennst du einen Mann, dann kennst du seine Schwäche.
»Unterschiedlich.« Ian schien seine Antwort zu genießen. »Eine schöne Nacht mit einer attraktiven Frau. Ein Ja von einem Mann, der es liebt, Nein zu sagen. Und oftmals …« Er legte Nachdruck auf das Wort. »… ein siegreiches Blatt. Ich bin wohl ein Mann der Karten.«
Jameson durchschaute diese Aussage sofort. »Du zockst.«
»Tun wir das nicht alle?«, erwiderte Ian. »Aber, ja, von Berufs wegen bin ich Pokerspieler. Ich traf deine Mutter in Las Vegas, in dem Jahr, als ich einen besonders heiß umkämpften internationalen Titel gewann. Offen gesagt, hätte meine Familie es lieber gesehen, wenn ich einen respektableren Zeitvertreib gewählt hätte – Schach zum Beispiel oder, noch besser, Finanzen. Aber ich bin in dem, was ich tue, so gut, dass ich gemeinhin nicht am familiären Geldhahn hängen muss, daher sind ihre Präferenzen – vor allem die meines Vaters und meines ältesten Bruders – irrelevant.« Ian trommelte sanft mit den Fingern auf der Arbeitsfläche. »Meistens.«
Du hast Brüder? Jameson dachte die Frage, sprach sie aber nicht aus. Stattdessen bot er eine Feststellung. »Sie wissen also nicht von mir.« Jameson ließ den Blick über Ians Gesicht wandern. »Deine Angehörigen.«
Jeder Pokerspieler hatte einen Tell. Es ging nur darum, diesen verräterischen Hinweis zu finden.
»Das war keine Frage«, erwiderte Ian, ohne dass sich seine Miene im Mindesten regte. Und genau das ist sein Tell. Das hier war ein Mann, dessen Gesicht tausend verschiedene Arten kannte, um zu vermitteln, dass das Leben und alle Menschen darin nichts als Zeitvertreib waren. Tausende Wege – und er hatte sich gerade auf einen verlegt.
»Keine Frage«, bestätigte Jameson. »Aber ich habe meine Antwort.«
Ian Johnstone-Jameson liebte es zu gewinnen. Die Meinung seiner Familie war meistens irrelevant. Sie wussten nicht, dass er einen Bastard als Sohn hatte.
»Sei’s drum«, sagte Ian, »das war ein paar Jahre, bevor ich mir über mich selbst im Klaren wurde, und zu dem Zeitpunkt, nun ja …« Wozu sich die Mühe machen?, schien sein Schulterzucken zu sagen.
Jameson weigerte sich, das an sich ranzulassen. Ihm blieb noch eine Frage. Das Klügste wäre, sich ein Druckmittel zu verschaffen. Wie lautet die Handynummer deines ältesten Bruders? Der Privatanschluss deines Vaters? Welches ist die Frage, von der du hoffst, dass ich sie nicht stelle?
Aber Jameson war nicht der Hawthorne, der für seine klugen Entschlüsse bekannt war. Er ging Risiken ein. Folgte seinem Bauchgefühl. Das hier ist womöglich das einzige Gespräch, das wir je führen werden. »Schlafwandelst du?«
Was für eine banale Frage, belanglos und mit einer Silbe zu beantworten.
»Nein.« Für einen kurzen Moment wirkte Ian Johnstone-Jameson etwas weniger über den Dingen stehend.
»Ich schon«, sagte Jameson ruhig. »Also früher, als ich klein war.« Er zuckte mit den Achseln, so unbekümmert wie Ian selbst. »Drei Fragen, drei Antworten. Du bist dran.«
»Wie ich schon sagte, ich sehe mich genötigt, um einen Gefallen zu bitten, und du …« Da schwang etwas Wissendes mit in der Art, wie Ian das Wort sagte. »Nun, ich denke, du wirst mein Angebot durchaus verlockend finden.«
»Hawthornes lassen sich nicht so leicht verlocken«, entgegnete Jameson.
»Was ich von dir brauche, hat recht wenig damit zu tun, dass du ein Hawthorne bist, dafür aber sehr viel damit, dass du mein Sohn bist.«
Es war das erste Mal, dass er es ausgesprochen hatte, und das erste Mal, dass Jameson je einen Mann diese Worte zu ihm hatte sagen hören. Du bist mein Sohn.
Punkt an dich, Ian.
»Ich benötige einen Spieler«, sagte der Mann. »Jemand Cleveres, Gewieftes, gnadenlos, aber nie platt. Jemand, der Risiken kalkulieren kann, ihnen trotzt, Leute bearbeitet, einen Bluff verkauft, und – ganz gleich wie – als Sieger hervorgeht.«
»Und doch …« Jameson brachte ein Schmunzeln auf. »… spielst du die fragliche Partie nicht selbst.«
Und da war er wieder – Ians Tell. Punkt an mich.
»Ich wurde ersucht, gewissen heiligen Boden nicht mehr zu betreten.« Ian ließ dieses Geständnis wie eine weitere Belustigung klingen. »Meine Anwesenheit ist vorübergehend unerwünscht.«
Jameson übersetzte. »Du wurdest verbannt.« Aber von wo? »Fang ganz von vorne an und erzähl mir alles. Wenn ich dich dabei erwische, dass du etwas verschweigst – und ich werde dich erwischen –, dann wird meine Antwort auf deine Bitte Nein lauten. Klar?«
»Glasklar.« Ian stützte die Ellbogen auf die schwarz glänzende Arbeitsfläche. »Es gibt da ein gewisses Etablissement in London, dessen Name nie ausgesprochen wird. Sprich ihn aus und du ziehst womöglich die äußerst unerquickliche Aufmerksamkeit einiger der mächtigsten Männer dieses Landes auf dich. Aristokraten, Politiker, die außerordentlich Wohlbetuchten …«
Ian musterte Jameson so lange, bis er sicher sein konnte, dass er ihm wirklich zuhörte, dann drehte Ian sich um, öffnete einen schwarzen Schrank und holte zwei Whiskygläser aus geschliffenem Glas hervor. Er stellte sie auf der Kücheninsel ab, machte aber keine Anstalten, eine Flasche zu holen.
»Der fragliche Klub«, sagte Ian, »heißt Devil’s Mercy.«
Der Name blieb bei Jameson hängen, prägte sich in sein Gehirn, reizte ihn wie ein Zutritt-verboten-Schild.
»Das Mercy wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in der Regency-Epoche gegründet, doch während andere elitäre Spielhäuser jener Tage auf Bekanntheit setzten, war das Mercy eine andere Art von Unternehmen – Geheimgesellschaft wie Spielbank gleichermaßen.« Ian fuhr sanft mit dem Finger über den Rand eines der Gläser, den Blick nach wie vor auf Jameson gerichtet. »Du wirst das Devil’s Mercy nicht in Geschichtsbüchern erwähnt finden. Es kam und ging nicht mit Etablissements wie dem Crockfords und maß sich nicht mit den berühmten Gentlemen’s Clubs wie dem White’s. Von Anfang an agierte das Mercy im Geheimen, gegründet von jemandem so hoch oben in der Gesellschaft, dass bloß ein geflüstertes Wort von seiner Existenz reichte, damit jeder, der die Chance auf Mitgliedschaft bekam, beinahe alles dafür gab, sie auch wirklich zu erhalten. Die Örtlichkeiten wechselten häufig in jenen frühen Jahren, doch der gebotene Luxus, die Nähe zur Macht, die schiere Herausforderung … Es gab nichts wie das Mercy.« Ians Augen funkelten. »Es gibt nichts wie das Mercy.«
Jameson konnte weder mit dem Crockfords noch mit dem White’s oder der Regency-Epoche etwas anfangen, aber er erkannte die Geschichte hinter der Geschichte. Macht. Exklusivität. Geheimnisse. Spiele.
»Es gibt nichts wie das Mercy«, wiederholte Jameson, während er das Gesagte im Kopf wälzte. »Und du wurdest verbannt. Der Name darf nie ausgesprochen werden, doch hier bist du und erzählst mir seine ganze geheime Geschichte.«
»Ich habe was an den Tischen des Mercy verloren.« Ians Augen wurden stumpf. »Vantage – den Familiensitz meiner Mutter. Sie hinterließ ihn mir statt meinen Brüdern, und ich muss ihn zurückgewinnen. Oder besser gesagt, du musst ihn für mich zurückgewinnen.«
»Und warum sollte ich dir helfen?«, fragte Jameson mit leiser, seidenglatter Stimme. Dieser Mann war ein Fremder. Sie bedeuteten einander gar nichts.
»Ja, warum?« Ian ging zu einem anderen Schrank rüber und zog eine Flasche Scotch hervor. Er goss einen Fingerbreit in jedes Glas, dann schob er eines über den schwarzen Granit zu Jameson.
Vater des Jahres.
»Es gibt nur eine Handvoll Menschen auf diesem Planeten, die das tun könnten, worum ich dich bitte«, erklärte Ian mit elektrisiertem Tonfall. »In über zweihundert Jahren ist mir nur ein Mensch bekannt, der versuchte, sich seinen Eintritt in das Mercy zu erspielen, und Erfolg hatte. Und hineinzukommen, ist nur der Anfang dessen, was es braucht, um Vantage zurückzugewinnen. Warum also sollte ich irgendeine Hoffnung hegen, dass deine Antwort Ja lauten könnte?« Ian hob sein Glas zum Toast. »Weil du Herausforderungen liebst. Du liebst es zu spielen. Du liebst es zu gewinnen. Und egal, was du gewinnst …« Ian Johnstone-Jameson hob sein Glas an die Lippen, die unselige Intensität seiner Augen nur zu vertraut. »… du brauchst immer mehr.«
Kapitel 8
Jameson
Jameson sagte Nein und ging. Doch Stunden später suchten ihn Ians Worte immer noch heim. Du liebst es zu spielen. Du liebst es zu gewinnen. Und egal, was du gewinnst, du brauchst immer mehr.
Jameson blickte in die Nacht hinaus. Irgendwie hatten Dächer etwas an sich. Es war nicht nur die Tatsache, so weit oben zu sein, oder, wie es sich anfühlte, unmittelbar an den Rand zu treten. Vielmehr war es der Reiz, alles zu sehen und doch allein zu sein.
»Mir gehört nicht das ganze Gebäude, weißt du«, meldete sich Avery irgendwo hinter ihm. »Bin mir ziemlich sicher, dass das Dach einen anderen Besitzer hat. Wir könnten wegen unbefugten Zutritts verhaftet werden.«
»Sagt das Mädchen, das es irgendwie immer schafft, sich zu verdrücken, bevor die Polizei kommt«, merkte Jameson an und drehte sich so, dass er ihre Silhouette aus der Dunkelheit treten sah.
»Ich verfüge eben über Überlebensinstinkte.« Avery blieb neben ihm stehen. »Du hast nie gelernt, dich von Ärger fernzuhalten.«
Das musste er nie. Er war aufgewachsen mit der Welt als Spielplatz – mit dem Aussehen eines Hawthorne, dem Namen eines Hawthorne und einem Großvater, der reicher war als Könige.
Jameson nahm einen Atemzug, sog die Nachtluft in die Lunge und stieß sie wieder aus. »Ich habe heute meinen Vater getroffen.«
»Wie bitte?« Avery war nicht leicht zu überrumpeln. Sie zu überraschen, fühlte sich immer wie ein kleiner Sieg an, und obwohl Jameson es abgestritten hätte, brauchte er gerade einen Sieg.
»Ian Johnstone-Jameson.« Er ließ den Namen gemächlich über seine Zunge rollen. »Professioneller Pokerspieler. Schwarzes Schaf einer, wie es scheint, extrem reichen Familie.«
»Wie es scheint?«, wiederholte Avery. »Du hast den Namen nicht recherchiert?«
Jameson fing ihren Blick auf. »Und ich möchte auch nicht, dass du es tust, Erbin.« Er ließ Schweigen über das Dach sinken. Und dann, weil sie es war, die hier neben ihm stand, sagte er die Worte, die er seit Ians Bitte viel zu oft gedacht hatte. »Nichts ist von Bedeutung, außer du lässt es zu.«
»Ja, an den Jungen erinnere ich mich«, erwiderte Avery leise. »Mit nacktem Oberkörper im Wintergarten, heillos betrunken, nachdem wir das Rote Testament gesehen hatten. Fest entschlossen, dass nichts ihn verletzen würde.« Sie ließ die Worte seinen Schutzschild durchdringen, bevor sie fortfuhr. »Du warst damals wütend, weil wir Skye nach euren Zweitnamen fragen mussten. Nach euren Vätern.«
»Im Rückblick bin ich stark beeindruckt, dass Skye die Sache damals nicht gleich hat auffliegen lassen«, witzelte Jameson. Sie hatten sie nach den Zweitnamen gefragt – nicht nach den Rufnamen.
»Dein Vater hat dir damals was bedeutet.« Avery hielt mit der Wahrheit nie hinterm Berg. Auch jetzt nicht. »Und er bedeutet dir noch heute was. Deswegen bist du hier oben.«
Jameson schluckte. »Nachdem Gray sein Arschloch von Vater getroffen hat, habe ich mir gesagt, dass ich meinen nie kennenlernen will.«
Er hatte gewusst, dass der Familienname seines Vaters Jameson lautete, aber er hatte nie danach gesucht. Er hatte sich nicht mal erlaubt, Mutmaßungen anzustellen … bis zur Visitenkarte.
»Wie war es?«, fragte Avery.
Jameson blickte auf. Kein Stern am Himmel. »Er hat dich weder entführen lassen noch jemanden ermordet, das ist also schon mal ein Pluspunkt.« Was das betraf, hatte Graysons Vater die Messlatte tief gehängt. Es ins Lächerliche zu ziehen, erlaubte es Jameson überhaupt erst, Averys Frage zu beantworten. »Er will etwas von mir.«
»Scheiß auf ihn«, sagte Avery erbittert. »Er hat kein Recht, irgendetwas von dir zu verlangen.«
»Ganz genau.«
»Aber …?«
»Was bringt dich darauf, dass es ein Aber gibt?«, erwiderte Jameson.
»Das.« Avery strich mit den Fingerspitzen an seinem Kiefer entlang. Ihre andere Hand legte sich federleicht auf seine Stirn. »Und das.«
Jameson schluckte. »Ich schulde ihm nichts. Und es ist mir egal, was er von mir denkt. Aber …« Sie hatte recht. Natürlich hatte sie recht. »Ich kann nicht aufhören, über das nachzudenken, was er gesagt hat.« Jameson trat von der Dachkante zurück, und als Avery es ihm gleichtat, beugte er sich raunend zu ihrem Ohr runter. »Es gibt da ein Etablissement in London, dessen Name nie ausgesprochen wird …«
Jameson erzählte ihr alles, und je mehr er sagte, desto schneller kamen die Worte, desto mehr sirrte sein Körper vom Adrenalin, das durch seine Adern rauschte. Denn Ian Johnstone-Jameson hatte recht gehabt.
Er liebte es zu spielen. Er liebte es zu gewinnen. Und heute, mehr denn jemals zuvor, braucht er irgendwas.
»Du willst Ja sagen.« Avery las ihn wie ein offenes Buch.
»Ich habe Nein gesagt.«
»Und es nicht so gemeint.«
Hier musste es nicht darum gehen, was Ian Johnstone-Jameson verdiente. Hier musste es überhaupt nicht um ihn gehen. »Das Devil’s Mercy.« Jameson schloss die Augen, spürte einen Kitzel, nur wenn er den Namen sagte. Ein jahrhundertealtes Geheimnis. Eine unterirdische Spielhölle. Geld und Macht und hohe Einsätze.
»Du wirst es tun, nicht wahr?«, fragte Avery.
Jameson öffnete die Augen wieder, blickte in ihre, bevor er die Lunte zündete. »Nein, Erbin. Wir werden es tun.«
Kapitel 9
Grayson
Als Grayson aus dem Flugzeug stieg, erwarteten ihn acht Mailbox-Nachrichten, sieben davon von Xander. Bei der siebten war sein jüngster Bruder zu einer Gesangseinlage übergegangen, die nach einem opernhaften Heldenlied über brüderliche Sorge und Käse-Steaks klang.
Die letzte Nachricht, nur wenige Minuten alt, stammte von Zabrowski. »Ich habe Nachforschungen angestellt. Das Mädchen ist immer noch in Gewahrsam, es wurde aber keine Anzeige erstattet. Kein Papierkram. Keine Anklage. Wenn Sie mich fragen, hat da schon jemand anderes seinen Einfluss geltend gemacht. Lassen Sie mich wissen, wie Sie weiter verfahren wollen.«
Grayson löschte die Nachricht. Wenn sie nicht offiziell verhaftet ist, hat die Polizei keine juristische Handhabe, sie weiter festzuhalten. Das würde die Sache definitiv einfacher machen.
Aufgrund der Arrangements, die Grayson auf seinem Weg zum Londoner Flughafen gemacht hatte, stand bereits ein Wagen auf dem Langzeitparkplatz bereit, der Schlüssel unter der Matte. Grayson hatte die Milliarden zwar nicht geerbt, aber der Name Hawthorne bedeutete immer noch was, und er verfügte selbst über finanzielle Ressourcen – eben jene Ressourcen, die er benutzt hatte, um Zabrowskis Honorar zu bezahlen.
Wegen des Privatdetektivs wusste Grayson heute, dass Juliet unerklärlicherweise mit dem Namen Gigi gerufen wurde, dass sie der um sieben Minuten jüngere Zwilling war und dass ihre Schwester, Savannah, sich weitaus weniger wahrscheinlich in eine Lage begeben würde, die ein Eingreifen erforderte.
Sein Eingreifen.
Grayson schob den Schlüssel in die Zündung des Ferrari 488 Spider, den sein Kontakt ihm besorgt hatte. Was Autos anging, war das zwar mehr Jamesons Stil als seiner, aber manche Situationen erforderten ein gewisses Auftreten. Seine Gedanken auf die Strategie zu fokussieren, hielt Grayson davon ab, zu sehr über die Tatsache nachzudenken, dass Juliet und Savannah Grayson nicht einmal von seiner Existenz wussten.
Genauso wie sie nicht wussten, dass der Vater, den sie drei sich teilten, tot war.
Sheffield Grayson hatte den Fehler begangen, Avery zu entführen. Es hatte für ihn kein gutes Ende genommen. Was die Öffentlichkeit betraf, war der reiche Geschäftsmann aus Phoenix einfach so verschwunden. Die beliebteste Theorie besagte, dass er sich mit einer viel jüngeren Frau in ein tropisches Steuerparadies verdrückt hatte. Seitdem behielt Grayson Julie und Savannah im Auge.
Kurz und schmerzlos, ermahnte er sich. Er war nicht in Phoenix, um geschwisterliche Beziehungen zu knüpfen oder den Zwillingen zu verraten, wer er war. Es gab ein Problem, um das man sich kümmern musste. Und Grayson würde sich dessen annehmen.
Als er das Phoenix Police Department betrat, ließ er einen einzigen Gedanken in sein Bewusstsein treten: Stellst du deine Autorität nicht infrage, wird es auch sonst niemand tun.
»Habt ihr den Ferrari draußen gesehen?« Ein junger Polizist Anfang zwanzig kam hereingestürzt. »Heilige Sch…« Er brach ab und starrte Grayson an, der, genau wie der Wagen, wusste, wie man Eindruck machte.
Grayson ließ sich keine Spur seiner Belustigung anmerken. »Sie haben Juliet Grayson in Gewahrsam.« Das war keine Frage, aber Graysons Auftreten verlangte eine Antwort.
»Gigi?« Ein anderer Polizeibeamter stieß zu ihnen und reckte den Hals, als würde er erwarten, Graysons Ferrari irgendwie durch die Wände hindurch sehen zu können. »Oh, ja. Die ist bei uns.«
»Nun, dieser Sachverhalt lässt sich richtigstellen.« Es bestand ein Unterschied darin, Leuten zu sagen, was man wollte, und deutlich zu machen, dass es in ihrem besten Interesse war, es einem zu geben. Explizite Drohungen waren für Leute, die erst auf ihrer Macht insistieren mussten. Insistiere nie auf etwas, das man als gegeben voraussetzen kann, Grayson.
»Wer zum Henker sind Sie?«
Grayson wusste, ohne sich umzudrehen, dass der Mann, der gerade gesprochen hatte, älter war als die beiden Polizisten – und auch höherrangig. Ein Sergeant oder ein Lieutenant vielleicht. Das, plus die Tatsache, dass der Name Juliet Grayson seine Aufmerksamkeit geweckt hatte, verriet Grayson alles, was er wissen musste: Dieser Mann war der Grund dafür, dass nicht offiziell Anzeige erstattet wurde.
»Müssen Sie wirklich fragen?«, erwiderte Grayson. Er kannte die Macht einer gewissen Mimik, eine, die keine Spur von Aggression barg und dennoch ein Versprechen gab.
Der Lieutenant – Grayson konnte es nun an seiner Dienstmarke sehen – taxierte ihn. Den Schnitt seines sehr teuren Anzugs, das völlige Fehlen von Nervosität. Es war nicht allzu schwer, den Mann innerlich ringen zu sehen: War Grayson von derselben Person geschickt worden, die einen Gefallen bei ihm eingefordert hatte?
»Ich kann gerne unseren gemeinsamen Freund anrufen.« Grayson, wie alle Hawthornes, war exzellent im Bluffen. Er zog sein Handy aus der Tasche. »Oder Sie können mich von einem dieser Officers zu dem Mädchen bringen lassen.«
Kapitel 10
Grayson
Juliet Grayson wurde in einem Befragungszimmer festgehalten. Sie saß im Schneidersitz auf dem Tisch, die Handgelenke auf den Knien abgelegt, die Handflächen nach oben zeigend. Ihr Haar war, im Gegensatz zu Graysons hellem Blond, schokoladenbraun und locker gewellt, während seines glatt war. Sie trug es knapp bis unters Kinn, die geschwungenen Spitzen der Schwerkraft trotzend, ein wenig wild.
Sie starrte einen leeren Kaffeebecher an, wobei ihre Augen – heller als seine und blau – kein einziges Mal blinzelten.
»Klappt immer noch nicht mit der Telekinese?«, fragte der Cop, der Grayson hineingeführt hatte.
Die Gefangene grinste. »Vielleicht brauche ich mehr Kaffee?«
»Du brauchst definitiv nicht noch mehr Kaffee«, erwiderte der Cop.
Das Mädchen – Graysons Fleisch und Blut, auch wenn sie es nicht ahnen konnte und er selbst nicht näher darauf eingehen würde – hüpfte mit wippendem Haar vom Tisch. »Matilda von Roald Dahl«, klärte sie ihn auf. »Das ist ein Kinderbuch, in dem ein vernachlässigtes kleines Genie die Fähigkeit entwickelt, Gegenstände mithilfe ihres Geistes zu verschieben. Das Erste, was sie umwirft, ist ein Glas Wasser. Ich hab’s gelesen, als ich sieben war, und das hat mich für immer verkorkst.«
Grayson erwischte sich dabei, wie er lächeln wollte, vielleicht weil das Mädchen ihn so offen anstrahlte, als wäre das hier alles völlig normal. Ohne sich noch mal dem Polizisten zuzuwenden, sagte er: »Lassen Sie uns allein.«
Der Trick, Leute dazu zu bringen, etwas zu tun, bestand in der absoluten Gewissheit, dass sie es tun würden.
»Wow!«, sagte der menschliche Sonnenstrahl ihm gegenüber, sobald der Cop fort war. »Das war super!« Sie setzte eine tiefe, ernste Stimme auf. »Lassen Sie uns allein. Ich bin übrigens Gigi, und ich wette, du musstest nie einen Banktresor knacken. Du schaust die Dinger einfach nur an, und – bumm – schon sind sie offen!«
Banktresore knacken? Grayson hatte den Ort ihrer Verhaftung zwar erfahren, aber die Details waren vage geblieben.
»Beeindruckende Augenbrauenwölbung«, fuhr Gigi fröhlich fort. »Aber kannst du das hier?« Ihre blauen Augen wurden auf einmal ganz rund, ihre untere Lippe zitterte. Dann grinste sie und zeigte mit dem Daumen zu dem leeren Kaffeebecher, den sie versucht hatte umzuwerfen und um den fünf weitere auf dem Tisch herumstanden. »Groß gucken und heulen. Ich brauch bloß dieses Gesicht zu ziehen und sie bringen mir einfach noch mehr Kaffee! Und Schokolade, dabei mag ich die gar nicht.« Wie aus dem nichts zauberte sie einen Schokoriegel hervor und reichte ihn ihm. »Twix gefällig?«
Grayson verspürte den Drang, ihr zu sagen, dass dies hier kein Spiel war. Dass sie sich in Polizeigewahrsam befand. Dass das hier ernst war. Stattdessen unterdrückte er den Beschützerinstinkt und verlegte sich auf: »Du hast nicht gefragt, wer ich bin.«
»Also, ich hab schon Ich bin Gigi gesagt«, gab sie mit einem einnehmenden Lächeln zurück. »Dass du dich nicht vorgestellt hast, geht also auf deine Kappe, Kumpel.« Sie dämpfte die Stimme. »Hat Mr Trowbridge dich geschickt? Wurde auch Zeit. Ich hab ihn gestern Abend angerufen, kaum dass sie mich hergebracht haben.«
Trowbridge. Grayson speicherte den Namen ab und beschloss, dass sie besser so schnell wie möglich das Gebäude verließen, bevor noch jemand kapierte, dass ihn tatsächlich keiner geschickt hatte. »Lass uns gehen.«
Gigi sprang vor Aufregung fast aus der Haut, als sie den geparkten Spider sah. »Weißt du, ganz unter uns, ich war historisch betrachtet bisher nicht gerade die beste Fahrerin, aber Blau ist voll meine Farbe und …«
»Nein«, unterbrach Grayson. Bis er auf seine Seite herumgegangen war, hatte Gigi es sich schon auf dem Beifahrersitz bequem gemacht. Steig nie zu einem Fremden ins Auto, wollte er ihr sagen, hielt sich jedoch zurück. Kurz und schmerzlos. Er war hier, um sie zu Hause abzuliefern und sicherzustellen, dass man sich um die juristische Situation kümmerte, das war’s.
»Du arbeitest gar nicht für Mr Trowbridge, stimmt’s?«, fragte Gigi, nachdem sie ein paar Minuten gefahren waren.
»Hat Mr Trowbridge auch einen Vornamen?«, fragte Grayson zurück.
»Kent«, antwortete Gigi bereitwillig. »Er ist ein Freund der Familie. Und unser Anwalt. Anwaltsfreund. Ich hab meinen Anruf gestern Abend genutzt, um ihn statt meiner Mom anzurufen, weil sie kein Anwalt ist und ganz womöglich glaubt, dass ich die gestrige Nacht und den heutigen Tag bei einer Freundin verbracht habe, wo ich keinerlei Verbrechen beging und alle vorbildlichen Spaß hatten.«
Je mehr Worte Gigi hervorbrachte, desto schneller sprudelten sie heraus. Grayson bekam langsam das Gefühl, dass man ihr kein Koffein zuführen durfte. Gar keins.
»Wenn Mr Trowbridge dich nicht geschickt hat …« Gigis Stimme wurde leiser. »War es mein Dad?«
Grayson war dazu erzogen worden, seine Emotionen in Schach zu halten. Kontrolle war niemals nur eine Option gewesen. Und so fokussierte er seinen Geist auf das Hier und Jetzt. Er dachte keinen Moment an Sheffield Grayson.
»Er war’s, stimmt’s?« Gigi sprang zu der Schlussfolgerung wie eine Ballerina über die Bühne. »Kannst du dafür sorgen, dass mein Dad erfährt, dass ich nicht wirklich in die Bank eingebrochen bin? Ich bin quasi nur den Weg zu den ultrasicheren Bankschließfächern entlangspaziert. Aber nicht auf die schlimme Art!«
»Spaziert?« Grayson ließ seinen skeptischen Tonfall für sich sprechen.
Die Siebzehnjährige neben ihm grinste. »Ist nicht meine Schuld, dass ich so einen gewieften Schleichschritt habe.« Sie hielt inne. »Im Ernst jetzt, hast du in letzter Zeit mit meinem Dad gesprochen?«
Dein Vater ist tot. »Hab ich nicht.«
»Aber du kennst ihn?« Gigi wartete keine Antwort ab. »Hast du für ihn gearbeitet oder so? Geheim. An irgendwas, was sein Verschwinden erklärt?«
Grayson schluckte. »Ich kann dir nicht helfen.«
Die Energie, die sie bis dahin verströmt hatte, schien sich zurückzuziehen. »Ich weiß, dass er einen guten Grund gehabt haben muss zu gehen. Ich weiß, dass es da keine andere Frau gibt. Ich weiß über das Fach Bescheid.«
Offenbar glaubte Gigi, Grayson wäre klar, worüber sie da redete. Und dass er eigentlich für ihren Vater arbeitete. Ihr die Wahrheit zu sagen – egal welchen Teil –, wäre nur gnädig gewesen, aber es wäre eine Gnade, die er sich nicht leisten konnte.
Ich weiß, hatte sie gesagt, über das Fach Bescheid. »Das Bankschließfach«, stellte er in Anbetracht ihres Geständnisses von gerade eben fest.
»Ich habe den Schlüssel dazu«, sagte Gigi ernst. »Aber das Fach ist nicht unter seinem echten Namen registriert, und ich weiß nicht, welchen er benutzt hat. Du vielleicht?«
Sheffield Grayson hatte ein Schließfach unter einem anderen Namen. Grayson brauchte keine Sekunde, um das – samt der möglichen Implikationen – zu verarbeiten. »Juliet, dein Vater hat mich nicht geschickt. Und ich habe nicht für ihn gearbeitet.«
»Aber du kennst ihn«, sagte Gigi leise. »Nicht wahr?«
Graysons Erinnerung zuckte zurück zu einem Gespräch, einem unterkühlten Wortwechsel. Mein Neffe kam für mich einem Sohn an Nächsten und er ist tot wegen der Hawthornes. »Nicht gut.«
Er hatte Sheffield Grayson nur dieses eine Mal getroffen.
»Gut genug, um zu wissen, dass er nicht einfach fortgegangen ist?«, fragte Gigi mit einer Spur Hoffnung in ihrer Stimme. »Das hätte er nie getan«, fuhr sie erbittert fort. Die Tränen zurückblinzelnd, senkte sie ihren Blick, wobei die widerspenstigen Locken ihr ins Gesicht fielen. »Als ich fünf war, wurden mir die Mandeln entfernt, und mein Dad ließ das komplette Zimmer mit Luftballons füllen. Es waren so viele, dass die Krankenschwester ausflippte. Er sitzt bei jedem von Savannahs Spielen in der ersten Reihe – oder zumindest tat er das. Er würde Mom niemals betrügen.«
Grayson spürte jedes ihrer Worte wie einen Schnitt durch seine nackte Haut. Doch, er hat deine Mutter betrogen. Das konnte er ihr nicht sagen.