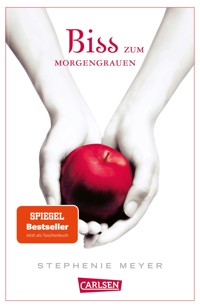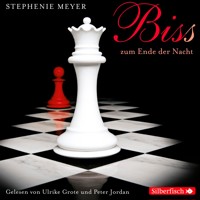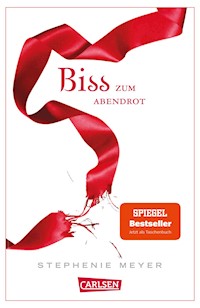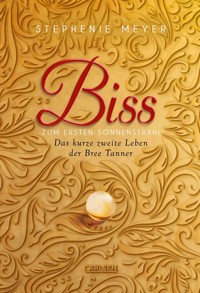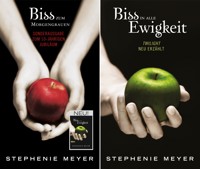9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Atemlose Spannung, kompromisslose Action und ganz große Gefühle Dr. Juliana Fortis hat für eine geheime Spezialeinheit der US-Regierung als Verhörspezialistin gearbeitet. Sie weiß Dinge. Zu viele Dinge. Deshalb wird sie jetzt selbst gejagt, bleibt nie länger an einem Ort, wechselt ständig Name und Aussehen. Drei Anschläge hat sie knapp überlebt. Die einzige Person, der sie vertraut hat, wurde umgebracht. Doch jetzt hat sie die Chance, wieder ein normales Leben zu führen. Dafür soll sie einen letzten Auftrag ausführen. Was sie dabei herausfindet, bringt sie jedoch in noch größere Gefahr, macht sie verwundbar. Denn zum ersten Mal in ihrem Leben gibt es einen Mann an ihrer Seite, der ihr wirklich etwas bedeutet. Und sie muss alles dafür tun, damit sie beide am Leben bleiben – mit ihren ganz eigenen Mitteln … »Ich wollte eine unverwechselbare Heldin erschaffen, die nicht mit Waffen und Muskeln kämpft, sondern mit ihrem Verstand.« Stephenie Meyer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Stephenie Meyer
The Chemist - Die Spezialistin
Roman
Über dieses Buch
Bevor sie mich gejagt haben, war mein Name Dr. Juliana Fortis. Jetzt habe ich keinen Namen mehr. Dreimal haben sie mich aufgespürt und fast getötet. Beim vierten Mal haben sie mir einen Deal vorgeschlagen: ein letzter Auftrag, dann bin ich für immer frei. Ich traue ihnen nicht, aber ich habe keine Wahl. Und ich habe meine Mittel: Auf meinem Gebiet bin ich Spezialistin. Und ich werde alles dafür tun, um am Leben zu bleiben. Nach dem sensationellen Welterfolg ihrer »Twilight«-Serie nun Mega-Bestsellerautorin Stephenie Meyers neuer Roman. »Ich wollte eine Heldin à la Jason Bourne erschaffen, eine unverwechselbare weibliche Hauptfigur, die nicht mit Waffen oder Muskeln kämpft, sondern mit ihrem Verstand.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Stephenie Meyer, geboren 1973 in Connecticut, ist Weltbestsellerautorin. Ihre vierbändige »Twilight«-Serie verkaufte sich weltweit über 155 Millionen Mal, erschien in 50 Ländern und wurde in 37 Sprachen übersetzt. Die Verfilmungen sind Hollywood-Blockbuster. Jetzt hat sie mit »The Chemist – Die Spezialistin« einen neuen großen Roman geschrieben. Sie lebt mit ihrem Mann und drei Söhnen in Phoenix, Arizona.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Dank
Dieses Buch ist
Jason Bourne und Aaron Cross gewidmet
(sowie Asya Muchnick und Meghan Hibbett,
die meine Obsession bejubelt und beklatscht haben)
Kapitel 1
Was heute auf dem Programm stand, war mittlerweile Routine für die Frau, die sich momentan Chris Taylor nannte. Sie war deutlich früher aufgestanden, als ihr lieb war, und hatte ihre nächtlichen Sicherheitsvorkehrungen abmontiert und verstaut. Es nervte ziemlich, jeden Abend alles aufzubauen, nur um es morgens wieder zu entfernen, doch wenn sie nachlässig wurde, setzte sie nicht weniger als ihr Leben aufs Spiel.
Danach war Chris in ihren unauffälligen Wagen gestiegen – einige Jahre alt, aber ohne größere Schäden, die sich hätten einprägen können – und stundenlang gefahren. Sie hatte diverse Städte, Countys und sogar Bundesstaaten durchquert, und als sie ungefähr die richtige Entfernung zurückgelegt hatte, doch eine Stadt nach der anderen verworfen. Die eine war zu klein, die nächste hatte nur zwei Zufahrtsstraßen, und eine dritte sah aus, als kämen dort so wenig Fremde vorbei, dass Chris trotz der Durchschnittlichkeit, mit der sie sich tarnte, sicherlich auffallen würde. Sie merkte sich einige Ziele, die sie vielleicht ein andermal aufsuchen würde – ein Geschäft für Schweißzubehör, einen Shop mit Militärausrüstung, einen Bauernmarkt. Bald war wieder Pfirsichzeit; sie musste ihren Vorrat aufstocken.
Am späten Nachmittag schließlich erreichte sie eine lebhafte Stadt, in der sie noch nie gewesen war. Selbst in der Leihbücherei herrschte reger Betrieb.
Wenn möglich, nutzte Chris gerne öffentliche Bibliotheken. Gratis war immer von Vorteil, hinterließ keine Spuren.
Sie parkte auf der Westseite des Gebäudes, wo die Kamera über dem Eingang sie nicht erfassen konnte. Die Computer im Lesesaal waren besetzt, mehrere Besucher warteten darauf, dass einer frei wurde; daher sah Chris sich ein wenig um, suchte bei den Biographien nach etwas Passendem. Sie stellte fest, dass sie schon alles gelesen hatte, was von Nutzen sein könnte. Deshalb stöberte sie das neueste Werk ihres bevorzugten Thrillerautors auf, eines ehemaligen Navy Seal, und nahm auch ein paar Romane rechts und links davon mit. Mit leichten Gewissensbissen machte sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Platz zum Warten; es war irgendwie schäbig, Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek zu klauen. Aber aus verschiedenen Gründen war es Chris nicht möglich, sich einen Benutzerausweis ausstellen zu lassen, und es bestand die geringe Chance, in diesen Büchern etwas zu finden, das zu ihrer Sicherheit beitragen könnte. Sicherheit siegte immer über Schuldgefühle.
Natürlich war ihr klar, dass ihre Hoffnung zu neunundneunzig Prozent unbegründet war – ziemlich abwegig, dass ihr etwas Fiktives von konkretem Nutzen sein könnte –, doch die einschlägigen Handbücher hatte sie längst durchforstet. Und so begnügte sie sich jetzt mit den weniger offensichtlichen Quellen. Wenn sie nicht zumindest irgendetwas recherchieren konnte, wurde Chris noch unruhiger, als sie ohnehin schon war. Bei ihrem letzten Beutezug hatte sie sogar einen Hinweis gefunden, der ihr praktikabel erschien, und ihn bereits in ihre täglichen Abläufe übernommen.
Sie wählte einen abgewetzten Sessel in einer entlegenen Ecke, von wo sie die Computerplätze gut im Blick hatte, und tat so, als lese sie das oberste Buch auf ihrem Stapel. Da viele Computernutzer ihre Habseligkeiten auf dem Tisch ausgebreitet hatten – einer hatte sogar seine Schuhe ausgezogen –, ging sie davon aus, dass es lange dauern würde, bis ein Platz frei würde. Am vielversprechendsten schien ihr eine Jugendliche mit gestresstem Gesichtsausdruck und einem Stapel Nachschlagewerke. Wie es aussah, surfte sie nicht auf Social-Media-Seiten, sondern notierte sich von der Suchmaschine ausgeworfene Autorennamen und Titel. Chris beugte sich in ihrem Sessel über den Roman, der in ihrer linken Armbeuge ruhte. Mit der in der rechten Hand verborgenen Rasierklinge schnitt sie säuberlich den aufgeklebten Magnetstreifen vom Buchrücken und stopfte ihn in den Spalt zwischen Polster und Armlehne. Dann tat sie, als sei das Buch uninteressant, und widmete sich dem nächsten auf ihrem Stapel.
Sie hatte die Romane, die sie bearbeitet hatte, schon in ihren Rucksack gepackt und war bereit, als die Jugendliche aufstand. In aller Seelenruhe erhob sich Chris und nahm den Platz am Computer ein, bevor einer der anderen Wartenden überhaupt bemerkt hatte, dass ihm eine Chance entgangen war.
Das Lesen der E-Mails dauerte normalerweise etwa drei Minuten.
Danach hatte sie, wenn sie keine Umwege machte, noch einmal vier Stunden Rückfahrt zu ihrer aktuellen Unterkunft vor sich, wo sie natürlich wieder ihre Schutzmaßnahmen aktivieren musste. Erst danach konnte sie schlafen gehen. E-Mail-Tage waren immer lang.
Obwohl es keine Verbindung zwischen ihrem jetzigen Leben und dem Mailaccount gab – keine verfolgbare IP-Adresse, keine Ortsnamen oder Personen –, würde sie, sobald sie ihre Nachrichten gelesen und, falls nötig, beantwortet hatte, die Bücherei und die Stadt schnellstens hinter sich lassen und so viele Kilometer wie möglich zwischen sich und diesen Ort bringen. Für alle Fälle.
Für alle Fälle war ungewollt zu Chris’ Wahlspruch geworden. Ihr Leben war geprägt von Vorsichtsmaßnahmen, aber ohne diese, rief sie sich immer wieder in Erinnerung, hätte sie überhaupt kein Leben mehr.
Lieber wäre sie gar nicht erst solche Risiken wie an E-Mail-Tagen eingegangen, aber das Geld würde nicht ewig reichen. Immer mal wieder nahm sie Aushilfsjobs in kleinen Familienbetrieben an, vorzugsweise in solchen, in denen noch alles handschriftlich erledigt wurde. Dort verdiente sie aber gerade genug, um ihr Essen und ihre Miete bezahlen zu können – für die teuren Dinge, die sie brauchte, reichte es nicht: gefälschte Ausweise, Laborgeräte und diverse Chemikalien. Deshalb blieb Chris möglichst unauffällig im Internet und fand immer mal wieder einen zahlenden Auftraggeber. Sie achtete streng darauf, mit ihren Jobs nicht die Aufmerksamkeit derer auf sich zu ziehen, die sie ausschalten wollten.
Die letzten beiden E-Mail-Tage waren unergiebig gewesen, deshalb war sie froh, dieses Mal eine Nachricht erhalten zu haben – ungefähr für den Bruchteil einer Sekunde. Dann registrierte sie den Absender:
Einfach so. Seine offizielle Mailadresse, ohne Probleme zurückzuverfolgen zu Chris’ ehemaligem Arbeitgeber. Ihre Nackenhaare richteten sich auf, der Adrenalinspiegel schnellte in die Höhe, und etwas in ihr rief: Schnell, schnell, bloß weg hier! Und doch war sie noch imstande, angesichts dieser Arroganz ungläubig zu staunen. Sie hatte schon immer unterschätzt, wie erstaunlich leichtsinnig diese Leute sein konnten.
Sie können noch nicht hier sein, redete Chris sich in ihrer wachsenden Panik ein, und doch wanderte ihr Blick bereits durch die Bibliothek. Waren hier Männer, deren Schultern zu breit für ihren dunklen Anzug waren? Mit Militärhaarschnitt? Bewegte sich jemand auf sie zu? Durchs Fenster schaute sie zu ihrem Auto hinüber. Es sah nicht so aus, als hätte sich jemand daran zu schaffen gemacht, allerdings hatte sie es auch nicht ständig im Auge gehabt, oder?
Sie hatten Chris also wieder gefunden. Aber niemand konnte wissen, wo sie heute ihre E-Mails abrufen würde. Sie achtete peinlich genau darauf, das immer dem Zufall zu überlassen.
In dieser Sekunde würde in einem ordentlichen grauen Büro ein Alarm ausgelöst, vielleicht auch in mehreren, möglicherweise blinkte ein rotes Lämpchen. Natürlich würde sofort die IP-Adresse ermittelt, von der sie die E-Mail abrief. Kräfte würden mobilisiert werden. Doch selbst wenn ihre Gegner – was durchaus in deren Macht stand – Hubschrauber einsetzten, blieben Chris noch mehrere Minuten. Genug, um zu sehen, was Carston wollte.
Die Betreffzeile lautete: Hast du die Flucht satt?
Der Wichser.
Sie öffnete die Mail. Der Text war nicht lang.
Neue Strategie: Wir brauchen dich. Was hältst du von einer inoffiziellen Entschuldigung? Können wir uns treffen? Ich frage nur, weil Leben auf dem Spiel stehen. Unzählige Menschenleben.
Sie hatte Carston immer gemocht. Er war ihr menschlicher erschienen als viele andere, für die sie gearbeitet hatte. Einige – besonders die in Uniform – waren ihr regelrecht unheimlich. Ein wohl ziemlich scheinheiliger Gedanke, wenn man bedachte, in welchem Metier Chris tätig gewesen war.
Natürlich musste Carston derjenige sein, der Kontakt zu ihr aufnahm. Sie wussten, dass Chris allein und verängstigt war, also schickten sie ihr einen alten Freund, der ihr Herz erwärmte. Gesunder Menschenverstand. Wahrscheinlich hätte sie die List selbst durchschaut, aber es hatte auch nicht geschadet, davon schon in einem gestohlenen Buch gelesen zu haben.
Chris erlaubte sich, tief durchzuatmen und dreißig Sekunden konzentriert nachzudenken. Sie musste ihren nächsten Schritt planen – so schnell wie möglich raus aus dieser Bücherei und diesem Ort, ja, aus diesem Bundesstaat – und überlegen, ob das reichte. War sie mit ihrer aktuellen Identität noch sicher, oder war es Zeit, wieder umzuziehen?
Die Hinterlistigkeit von Carstons Angebot lenkte sie immer wieder ab.
Was wäre, wenn …
Was, wenn dies wirklich eine Möglichkeit wäre, endlich in Ruhe gelassen zu werden? Was, wenn Chris’ Überzeugung, gerade eine Falle gestellt zu bekommen, lediglich ihrer Paranoia und der Lektüre zu vieler Thriller entsprang?
Wenn der Auftrag wichtig genug war, würde man ihr im Gegenzug vielleicht ihr Leben zurückgeben …
Schwer vorstellbar.
Dennoch war es sinnlos, so zu tun, als sei Carstons E-Mail nicht bei ihr angekommen.
Sie antwortete so, wie es ihr Gegenüber wahrscheinlich erhoffte, auch wenn ihr Plan erst in groben Zügen stand.
Ich habe so einiges satt, Carston. Wo wir uns kennengelernt haben, um zwölf, in einer Woche. Wenn du nicht allein bist, bin ich weg etc. pp. Du weißt, wie es läuft. Mach keinen Blödsinn.
Sie stand auf und lief im gleichen Moment los, eine fließende Bewegung, die sie trotz ihrer kurzen Beine perfektioniert hatte und die sehr viel lockerer aussah, als sie war. Im Kopf zählte Chris die Sekunden, rechnete aus, wie lange es dauern würde, bis ein Hubschrauber die Entfernung von Washington zu ihr zurückgelegt hatte. Natürlich konnten auch vor Ort Leute aktiviert werden, aber so arbeiteten ihre Gegner üblicherweise nicht.
Ganz und gar nicht, obwohl … Chris hatte das unbegründete, aber doch bedrückend unangenehme Gefühl, dass die Leute ihre übliche Arbeitsweise eventuell leid waren. Sie hatte nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, und diese Menschen waren nicht für ihre Geduld bekannt. Sie waren es gewöhnt, das zu bekommen, was sie wollten, und zwar genau dann, wann sie es wollten. Und seit drei Jahren wollten sie Chris tot sehen.
Diese E-Mail war in der Tat eine neue Strategie. Wenn sie denn eine Falle war.
Aber davon musste sie ausgehen. Diese Einstellung, diese Sicht auf die Welt, war der Grund, warum Chris noch atmete. Nur ein kleiner Teil ihres Gehirns hatte begonnen, entgegen jeder Vernunft zu hoffen.
Es war ein Spiel mit geringem Einsatz, das war ihr bewusst. Es ging nur um ein Leben. Ihr eigenes.
Dieses Leben, das sie allen Widrigkeiten zum Trotz bewahrt hatte, war nicht mehr als nacktes Überleben. Das absolute Minimum. Ein schlagendes Herz, zwei sich zusammenziehende und weitende Lungenflügel.
Sie war am Leben, ja, und sie tat alles dafür, damit es so blieb, doch in ihren dunkleren Nächten fragte sie sich manchmal, wofür genau sie eigentlich kämpfte. War das Leben, so wie sie es jetzt führte, all diese Mühe wert? Wäre es nicht eine Erleichterung, einfach die Augen zu schließen und sie nie wieder öffnen zu müssen? Wäre die schwarze Leere nicht angenehmer als unablässige Angst und nie enden wollende Anstrengungen?
Es gab nur eins, was sie davon abhielt, ihre Fragen mit Ja zu beantworten und einen der unauffälligen, schmerzlosen Auswege zu wählen, die ihr ohne weiteres zur Verfügung standen, und das war ihr übersteigerter Ehrgeiz. Während des Medizinstudiums hatte er sie nach vorn gebracht, und jetzt hielt er sie am Leben. Sie würde diese Leute nicht gewinnen lassen. Auf gar keinen Fall würde sie ihnen eine so einfache Lösung für ihr Problem bieten. Irgendwann würden sie Chris wahrscheinlich kriegen, aber dafür würden sie sich anstrengen müssen, jawohl, und sie würden dafür bluten.
Sie saß im Wagen, sechs Häuserblocks von der nächsten Auffahrt auf den Highway entfernt. Auf den kurzen Haaren trug sie eine dunkle Basecap, eine breite Sonnenbrille verdeckte einen Großteil ihres Gesichts, ein weit geschnittenes Sweatshirt überspielte ihre schlanke Figur. Wer nicht genau hinsah, hielt sie für einen jungen Mann.
Die Leute, die ihren Tod wollten, hatten bei ihren Bemühungen bereits Verluste einstecken müssen. Als Chris daran dachte, musste sie unvermittelt grinsen. Es war seltsam, wie wenig ihr das Töten mittlerweile ausmachte, wie befriedigend sie es fand. Sie war blutrünstig geworden, was irgendwie ironisch war, wenn man es recht bedachte. Sechs Jahre unter der Anleitung jener Menschen hatten nicht annähernd gereicht, um die Frau zu brechen, die sie gewesen war, oder sie gar dazu zu bringen, ihre Arbeit zu lieben. Drei Jahre auf der Flucht vor ihnen hatten hingegen vieles verändert.
Chris wusste, dass sie keinen Spaß daran hätte, einen Unschuldigen zu töten. So verkommen war sie noch nicht, würde sie auch nie sein. Sicherlich gab es Menschen in ihrem Beruf – ihrem ehemaligen –, die total gestört waren, doch sie bildete sich gerne ein, dass sie aus diesem Grund besser war als ihre Kollegen. Sie hatten die falsche Motivation. Der Hass auf die Arbeit verlieh Chris die Kraft, sie perfekt auszuführen.
In ihrem jetzigen Leben bedeutete Töten, den Krieg zu gewinnen. Nicht den gesamten Krieg, nur ein Gefecht nach dem anderen, aber es war trotzdem ein Sieg. Das Herz eines anderen hörte auf zu schlagen, ihr eigenes klopfte weiter. Man würde wieder jemanden zu ihr schicken, doch statt vor einem Opfer würde er vor einem wehrhaften Tier stehen. Vor einer Einsiedlerspinne, unsichtbar hinter ihrer Falle aus Spinnfäden.
Dazu hatte man sie gemacht. Chris fragte sich, ob ihr Gegner vielleicht stolz auf seine Leistung war oder ob er nur bedauerte, sie nicht schnell genug totgetreten zu haben.
Nachdem sie ein paar Kilometer auf der Interstate zurückgelegt hatte, fühlte sie sich schon besser. Ihr Auto war ein beliebtes Modell, es waren unzählige ähnliche Fahrzeuge unterwegs. Die gestohlenen Kennzeichen würde sie austauschen, sobald sie einen sicheren Ort zum Anhalten fand. Nichts verband Chris mit der Stadt, die sie gerade verlassen hatte. Sie war an zwei Ausfahrten vorbeigefahren, hatte erst die dritte genommen. Wenn sie den Highway sperren wollten, wüssten sie nicht, wo sie es tun sollten. Chris war noch immer im Verborgenen. Fürs Erste in Sicherheit.
Natürlich kam es nicht in Frage, auf direktem Weg nach Hause zu fahren. Sie dehnte die Rückfahrt auf sechs Stunden aus, wechselte von einem Highway auf den nächsten und nahm auch Landstraßen. Fortwährend überzeugte sie sich davon, dass sie nicht verfolgt wurde. Als sie schließlich ihr kleines Mietshaus erreichte – das architektonische Gegenstück zu einer Schrottkarre –, war sie hundemüde. Sie überlegte, Kaffee zu kochen, wog die Vorteile eines Koffeinschubs ab gegen die Mühe, das Getränk erst aufbrühen zu müssen, und beschloss, sich mit ihren eigenen Energiereserven durchzukämpfen.
Sie schleppte sich die beiden klapprigen Stufen zur Veranda hinauf, mied automatisch die morsche Stelle links auf dem ersten Brett und entsperrte den doppelten Schließriegel in der Sicherheitstür aus Stahl, die sie sofort in der ersten Woche eingebaut hatte; die Außenwände – lediglich Holzständerwerk, Gipskarton, Sperrholz und Vinylverkleidung – boten nicht dasselbe Maß an Sicherheit, aber statistisch gesehen, machten sich Eindringlinge zuerst an der Tür zu schaffen. Die Gitter vor den Fenstern waren auch kein unüberwindbares Hindernis, sollten aber reichen, um einen Gelegenheitsdieb zu überzeugen, sich ein leichteres Objekt zu suchen. Bevor Chris den Knauf drehte, drückte sie dreimal kurz auf die Klingel. Für einen etwaigen Beobachter wirkte es wie ein durchgängiges Schellen. Der Klang der Glocken von Westminster wurde von den dünnen Mauern nur leicht gedämpft. Schnell betrat sie das Haus – und hielt die Luft an, nur für den Fall. Aber es knirschten keine Glasscherben unter ihren Füßen. Chris atmete aus und schloss die Tür.
Die Sicherheitsmaßnahmen im Haus hatte sie alle selbst erfunden. Die Profis, die sie anfangs studiert hatte, besaßen ihre eigenen Methoden, aber natürlich verfügte keiner über Chris’ Spezialwissen. Genauso wenig wie die Autoren der Romane, die sie inzwischen als abwegige Ideengeber nutzte. Alles andere, was sie hatte wissen müssen, war problemlos auf YouTube verfügbar. Dazu ein paar Teile von einer alten Waschmaschine auf dem Schrottplatz, ein über Amazon bestellter Mikrokontroller, eine neue Türglocke und ein paar weitere, nicht besonders kostspielige Anschaffungen, und fertig war ihre verlässliche Falle.
Chris legte die Schließriegel wieder vor und drückte auf den Schalter, der der Tür am nächsten war, um das Licht anzumachen. In dem Rahmen befanden sich noch zwei weitere Schalter: Der mittlere saß auf einer Blinddose. Der dritte, am weitesten von der Tür entfernt, war an dasselbe Niedervoltkabel wie die Türglocke angeschlossen. Wie die Tür und die Klingel war der Schalterrahmen Jahrzehnte jünger als alles andere in dem kleinen Zimmer, das Wohnraum, Esszimmer und Küche zugleich war.
Alles sah noch genauso aus wie am Morgen: einige wenige billige Möbel – nichts, hinter dem sich ein Erwachsener verstecken konnte –, leere Arbeitsflächen, leerer Tisch, keine Kunstwerke oder Ziergegenstände. Steril. Trotz des senfgelben PVC-Bodens und der popcornfarbenen Decke sah es ein wenig aus wie im Labor.
Vielleicht lag es auch am Geruch. Das Zimmer war so zwanghaft hygienisch sauber, dass ein Eindringling den chlorähnlichen Badeanstaltsgeruch wahrscheinlich Putzmitteln zuschreiben würde. Jedoch nur, wenn er in das Haus kam, ohne das Sicherheitssystem zu aktivieren. Löste er es aus, bliebe ihm keine Zeit, viele Details wahrzunehmen.
Der Rest des Hauses bestand lediglich aus einem kleinen Schlafzimmer und einem Bad, direkt hinter dem Wohnraum in einer Flucht gelegen. Nichts, das Chris zum Stolpern bringen konnte. Sie löschte das Licht, damit sie nicht noch mal zurück zur Haustür musste.
Nachdem sie sich durch die einzige Tür ins Schlafzimmer getastet hatte, spulte sie ihr Programm wie im Schlaf ab. Durch die Jalousien fiel genug Licht von der roten Neonreklame der Tankstelle auf der anderen Straßenseite, so dass sie die Lampe nicht einschalten musste. Zuerst drückte sie zwei längliche Federkissen auf der Doppelmatratze, die den größten Teil des Zimmers einnahm, in die Form eines Körpers. Dann schob sie Plastikbeutel mit Theaterblut in den Bezug des Kopfkissens. Von nahem betrachtet, war das Blut nicht sehr überzeugend, aber es war für einen Angreifer bestimmt, der das Fenster einschlug, die Jalousie beiseiteschob und von dort aus schoss. Im Neonlicht wäre er nicht in der Lage, den Unterschied auszumachen. Als Nächstes war der Kopf dran – die Maske, die sie dafür nahm, hatte sie nach Halloween im Ausverkauf erstanden: das überzeichnete Gesicht eines gescheiterten politischen Kandidaten, dessen Haut eine halbwegs realistische Farbe hatte. Chris hatte die Maske so bearbeitet und ausgestopft, dass sie ungefähr die Größe ihres eigenen Kopfes hatte, und eine billige braune Perücke aufgenäht. Am wichtigsten jedoch war das kleine Kabel mit freigelegtem Draht am Ende, das zwischen Matratze und Lattenrost hindurchkam und in den Nylonhaaren verborgen war. Sein Gegenstück ragte aus dem Kopfkissen, auf das sie die ausgestopfte Maske jetzt legte. Sie zog die Bettdecke hoch und zwirbelte die ausgefransten Enden der beiden Drähte zusammen. Die Verbindung war äußerst sensibel. Wenn sie die Maske auch nur leicht berührte oder den Körper ein wenig verschob, lösten sich die Drähte voneinander.
Chris trat zurück und betrachtete den Köder durch halb geschlossene Augen. Er war nicht gerade ihr Meisterwerk, aber es sah durchaus so aus, als läge jemand im Bett. Selbst wenn ein Eindringling nicht glaubte, dass es Chris war, würde er den vermeintlich Schlafenden ausschalten müssen, bevor er sich auf die Suche nach ihr machte.
Zu müde, um den Pyjama anzuziehen, schlüpfte sie nur aus ihrer Jeans. Das musste reichen. Sie nahm das vierte Kopfkissen und holte ihren Schlafsack unter dem Bett hervor; beides erschien ihr heute größer und schwerer. Mit den Sachen unterm Arm schlurfte sie in das kleine Badezimmer, warf alles in die Wanne und beschränkte ihre Abendtoilette auf ein Minimum. Nur Zähne putzen, das Gesicht ließ sie diesmal aus.
Ihre Waffe und die Gasmaske lagen unter dem Waschbecken, versteckt unter einem Stapel Handtücher. Chris zog sich die Maske über den Kopf, zurrte die Bänder fest, hielt den Filter mit der Handfläche zu und atmete durch die Nase ein, um die Dichtigkeit zu prüfen. Die Innenmaske saugte sich an, alles gut. Das war jedes Mal so, doch Chris ließ diese Sicherheitschecks nie aus – egal, wie müde sie war oder wie vertraut ihr inzwischen jeder Handgriff war. Die Waffe legte sie in die an den Fliesen angebrachte Seifenschale, gut erreichbar. Chris war kein Waffennarr – sie konnte ganz gut schießen, verglichen mit einem untrainierten Bürger, aber spielte nicht in derselben Liga wie die Profis. Sie brauchte diese Möglichkeit jedoch, denn eines Tages würden ihre Feinde ihr System durchschauen. Die Leute, die dann kämen, würden ebenfalls Gasmasken tragen.
Eigentlich wunderte es sie, dass ihre Masche sie schon so lange schützte.
Mit einem Absorptionsfilter für Gase unter dem BH-Träger schlurfte sie zurück ins Schlafzimmer und kniete sich vor das Belüftungsgitter im Boden rechts neben dem Bett, in dem sie noch nie gelegen hatte. Das Abdeckgitter war wohl nicht so staubig, wie es sein sollte, die oberen Schrauben waren nur halb versenkt, die unteren fehlten ganz, aber Chris war überzeugt, dass das niemandem auffallen würde, der durchs Fenster sah, und wenn doch, würde er nicht begreifen, was das bedeutete. Sherlock Holmes war so ungefähr der einzige Mensch, den sie nicht im Verdacht hatte, ihr nach dem Leben zu trachten.
Sie löste die oberen Schrauben und entfernte das Gitter. Wenn jemand in den Schacht schaute, würden ihm sofort ein paar Dinge auffallen: Erstens war der Auslass verschlossen und damit nicht in Gebrauch. Zweitens gehörten die Batterie und der weiße Behälter wohl nicht dorthin. Chris hebelte den Deckel von dem Behälter. Sofort stieg derselbe Geruch auf, der das Wohn-Esszimmer durchdrang. Er war ihr so vertraut, dass sie ihn kaum bemerkte.
Sie griff in die Dunkelheit hinter dem Behälter und zog zuerst eine seltsame kleine Vorrichtung aus Ventil, Metallarmen und dünnen Drähten heraus, dann eine Ampulle von der Größe ihres Fingers und zuletzt einen Gummihandschuh. Das Magnetventil – aus einer Waschmaschine vom Sperrmüll ausgebaut – positionierte sie so, dass die beiden Metallarme halb in der farblosen Säure im Behälter versanken. Sie blinzelte zweimal, um sich zur Aufmerksamkeit zu zwingen, denn jetzt kam der komplizierte Teil. Rechts zog sie den Handschuh über, nahm den Gasfilter unter ihrem BH-Träger hervor und hielt ihn links bereit. Mit den behandschuhten Fingern setzte sie die gläserne Ampulle vorsichtig in eine Nut, die sie zu diesem Zweck in die Metallarme gebohrt hatte. So schwebte die Ampulle direkt unter der Oberfläche der Säure, das weiße Pulver in ihr träge und harmlos. Doch sobald der Strom, der durch die auf dem Bett nur leicht verbundenen Drähte lief, unterbrochen werden sollte, würde der Impuls das Magnetventil schließen, und das Glas würde zerspringen. Das weiße Pulver würde sich mit der Säure zu einem Gas verbinden, das weder träge noch harmlos war.
Im Grunde war es derselbe Aufbau wie im vorderen Zimmer, bloß war die Verdrahtung hier schlichter. Diese Falle stellte Chris nur auf, bevor sie schlafen ging.
Sie legte den Handschuh zurück und schraubte das Gitter wieder vor den Auslass, dann taumelte sie mit einem Gefühl, das nicht beschwingt genug war, um Erleichterung genannt werden zu können, zurück ins Badezimmer. Die Tür wie das Auslassgitter hätten vielleicht jemanden gewarnt, der so detailverliebt war wie Sherlock Holmes – die weichen Gummilippen rund um den Türrahmen waren gewiss kein Standard. Wenn sie das Bad auch nicht komplett vom Schlafzimmer abdichteten, gaben sie Chris doch zumindest etwas mehr Zeit.
Fast fiel sie in die Badewanne, sackte wie in Zeitlupe auf den wattigweichen Schlafsack. Sie hatte eine Weile gebraucht, um sich an das Schlafen mit Gasmaske zu gewöhnen, doch jetzt dachte sie nicht einmal mehr darüber nach, als sie dankbar die Augen schloss.
Sie ruckelte sich in ihrem Kokon aus Daunen und Nylon zurecht und wand sich, bis das harte Viereck ihres iPads sich in ihr Kreuz drückte. Es hing an einem Verlängerungskabel, das an den Strom im Wohnraum angeschlossen war. Wenn die Stromversorgung schwankte, vibrierte das iPad. Aus Erfahrung wusste Chris, dass sie davon aufwachte, selbst wenn sie so müde war wie an diesem Abend. Sie wusste ebenfalls, dass sie den Gasfilter in ihrer linken Hand – an die Brust gedrückt wie einen Teddybär – in weniger als drei Sekunden aufbrechen und in die Gasmaske schrauben konnte, selbst bei Dunkelheit, wenn sie nur halbwach war und die Luft anhalten musste. Sie hatte es unzählige Male geübt und es sich bei den drei Einsätzen bewiesen, die keine Übungen gewesen waren. Sie hatte überlebt. Ihr System funktionierte.
So erschöpft Chris auch war, im Kopf musste sie noch einmal die Ereignisse des Tages durchgehen, bevor sie einschlafen konnte. Die Gewissheit, wieder aufgespürt worden zu sein, war ein furchtbares Gefühl – wie Phantomschmerzen, die nicht von einem Körperteil ausgingen, aber trotzdem da waren. Auch mit ihrer Antwort auf die E-Mail war sie nicht zufrieden. Sie hatte sich den Plan zu spontan zurechtlegen müssen, um sich damit sicher zu fühlen. Und er zwang sie, viel schneller zu handeln, als ihr recht war.
Chris kannte die Theorie: Manchmal ließ sich der Angreifer mit der Pistole überrumpeln, wenn man direkt auf ihn zulief. Normalerweise war Flucht ihre bevorzugte Reaktion, diesmal sah sie jedoch keine andere Möglichkeit als den Angriff. Aber vielleicht morgen, wenn ihr müdes Gehirn sich erholt hatte.
Vergraben in ihrem Kokon, schlief sie ein.
Kapitel 2
Während sie auf Carston wartete, ließ sie die bisherigen Mordversuche des Dezernats Revue passieren.
Barnaby – ihr Mentor Dr. Joseph Barnaby, der letzte Freund, den sie gehabt hatte – hatte sie auf den ersten Anschlag vorbereitet. Doch bei all seiner Weitsicht und tiefsitzenden Paranoia war es pures Glück in Form einer Tasse Kaffee gewesen, das Chris das Leben gerettet hatte.
Sie hatte damals schlecht geschlafen. Seit sechs Jahren arbeitete sie bereits mit Barnaby zusammen, und nach etwas mehr als der Hälfte dieser Zeit hatte er sie ins Vertrauen gezogen. Zuerst hatte Chris es nicht glauben wollen. Sie machten doch nur, was ihnen gesagt wurde, und zwar gut. Die Arbeit hier ist nichts Langfristiges, hatte Barnaby immer wieder gesagt, obwohl er selbst schon seit siebzehn Jahren in der Abteilung war. Leute wie wir wissen Sachen, die eigentlich keiner wissen darf, und deshalb werden wir irgendwann zum Risiko. Man muss gar nichts falsch machen. Du kannst die Vertrauenswürdigkeit in Person sein. Aber denen kannst du keinen Zentimeter über den Weg trauen!
So viel zum Thema »für die Guten arbeiten«.
Barnabys Verdacht wurde immer konkreter und mündete in Vorbereitungen, die schließlich zu akuten Maßnahmen führten. Er plante immer alles akribisch, doch am Ende nutzte es ihm nichts.
Als das Datum für seinen Ausstieg näherrückte, nahm der Stress überhand, und Chris hatte, wenig überraschend, Schlafprobleme. An jenem Aprilmorgen hatte sie statt nur einer zwei Tassen Kaffee gebraucht, um ihr Gehirn in Gang zu setzen. Diese zweite Tasse in Kombination mit ihrer Schulmädchenblase und ihrem verhältnismäßig kleinen Körper führte dazu, dass sie nicht an ihrem Platz saß, sondern so hastig zum Klo eilte, dass sie sich nicht einmal ausloggte. Und dort war sie gewesen, als das tödliche Gas durch die Lüftungsschlitze ins Labor strömte. Barnaby hingegen war genau dort, wo er hatte sein sollen.
Seine Schreie waren sein letztes Geschenk an sie gewesen, seine letzte Warnung.
Beide waren überzeugt gewesen, dass es nicht im Labor passieren würde. Zu auffällig. Bei Leichen hob doch der eine oder andere die Augenbraue, und kluge Mörder versuchten immer, so weit wie möglich von Beweisen dieser Art entfernt zu sein. Sie schlugen nicht zu, wenn das Opfer zu Hause Fernsehen guckte.
Chris hätte wissen müssen, dass die Arroganz der Leute, die ihren Tod wollten, nicht zu unterschätzen war. Sie scherten sich nicht ums Gesetz, dazu kannten sie die Menschen zu gut, die diese Gesetze machten. Auch hätte sie voraussehen sollen, dass man einen klugen Menschen durch einen unlogischen Schachzug völlig überrumpeln konnte.
Bei den anderen drei Versuchen hatte man weniger Umschweife gemacht. Chris ging von Auftragskillern aus, da jeder allein gewesen war. Bisher ausschließlich Männer, aber eine Frau war ebenfalls eine Option. Einer hatte versucht, sie zu erschießen, einer wollte sie erstechen, und der dritte war mit dem Brecheisen auf sie losgegangen. Keiner hatte Erfolg gehabt, denn die Attacke traf jeweils ein Kissen. Der Angreifer war gestorben.
Lautlos war das unsichtbare, aber äußerst giftige Gas in ihr kleines Zimmer geströmt – wenn die Drahtverbindung unterbrochen wurde, dauerte es ungefähr zweieinhalb Sekunden. Danach blieb dem Eindringling noch eine Lebenserwartung von ungefähr fünf Sekunden, je nach Größe und Gewicht. Es konnten keine angenehmen fünf Sekunden gewesen sein.
Chris’ Hausrezeptur war nicht dieselbe, die bei Barnaby benutzt worden war, aber sehr nah dran. Sie kannte keine einfachere Art, jemanden schnell und schmerzhaft zu töten. Und die dafür benötigten Inhaltsstoffe waren leicht verfügbar, anders als viele ihrer Waffen. Chris brauchte nur ein Geschäft für Poolzubehör und einen Berg Pfirsiche. Die gab es ohne Zugangsbeschränkung und auch ohne Postanschrift, über die man sie hätte aufspüren können.
Es war wirklich zum Kotzen, dass es den Leuten wieder gelungen war, sie zu finden.
Seitdem sie am Vortag aufgewacht war, brodelte es in ihr, und während die Stunden vergingen und sie sich vorbereitete, wurde sie immer wütender.
Sie hatte sich gezwungen zu schlafen und war dann die folgende Nacht in einem unauffälligen Wagen durchgefahren, den sie mit dem nicht sehr überzeugenden Ausweis einer Taylor Golding und einer kürzlich erworbenen Kreditkarte auf denselben Namen gemietet hatte. Früh am Morgen hatte sie die Stadt erreicht, in der sie am wenigsten sein wollte, was ihre Laune noch weiter verschlechtert hatte. Sie war mit dem Wagen zur Hertz-Filiale in der Nähe des Ronald Reagan National Airport gefahren, hatte die Straßenseite gewechselt und war zur nächsten Autovermietung gegangen, wo sie sich ein neues Auto mit einem Nummernschild des District of Columbia besorgte.
Vor sechs Monaten hätte Chris noch anders gehandelt. Sie hätte ihre Habseligkeiten in dem kleinen Haus zusammengepackt, ihr aktuelles Auto übers Internet verkauft, unter der Hand ein anderes von einem Privatmann gegen Bargeld erworben und wäre einige Tage ziellos herumgefahren, bis sie eine mittelgroße Stadt gefunden hätte, die einen guten Eindruck machte. Dort hätte sie erneut alle Anstrengungen unternommen, am Leben zu bleiben.
Doch jetzt nährte sie die dumme Hoffnung, dass Carston die Wahrheit sagte. Eine sehr schwache Hoffnung, die allein wahrscheinlich nicht Motivation genug gewesen wäre. Chris hatte noch einen anderen Grund, auf Carstons Angebot einzugehen: die kleine, aber doch nagende Sorge, dass sie ihrer Verantwortung nicht nachgekommen war.
Barnaby hatte ihr das Leben gerettet. Nicht nur einmal. Jedes Mal, wenn Chris einen Mordanschlag überlebte, lag es an seinen Mahnungen, seiner Ausbildung, seinen Vorsichtsmaßnahmen.
Wenn Carston log – wovon sie zu siebenundneunzig Prozent ausging – und sie in einen Hinterhalt lockte, dann war alles, was er gesagt hatte, eine Lüge. Auch die Behauptung, sie würde gebraucht. Und wenn sie nicht gebraucht wurde, hatte das Dezernat jemand anderen für die Aufgabe gefunden. Jemanden, der genauso gut war wie sie.
Man mochte Chris, soweit sie wusste, schon vor langer Zeit ersetzt haben, eine ganze Reihe von Angestellten umgebracht haben, doch sie bezweifelte es. Das Dezernat verfügte zwar über Mittel und Möglichkeiten, aber es herrschte stets ein Mangel an Personal. Es dauerte einfach, einen Mitarbeiter wie Barnaby oder Chris zu finden, heranzuziehen und auszubilden. Menschen mit ihren Fähigkeiten konnte man nicht in Reagenzgläsern züchten.
Chris war von Barnaby gerettet worden. Doch wer half dem jungen, arglosen Menschen, der nach ihr eingestellt worden war? Ihr Nachfolger war sicherlich genial, genau wie sie, doch das Entscheidende würde er oder sie nicht erkennen. »Dem Land dienen«, »unschuldiges Leben retten«, »hochmoderne Labore«, »bahnbrechende Forschung«, »unbegrenztes Budget«? Alles unwichtig. Siebenstelliges Gehalt? Und wenn schon. Wie wäre es mit Überleben? Zweifelsohne hatte der Mensch, der jetzt ihre Stelle bekleidete, keine Ahnung, dass sein Leben in Gefahr war.
Gerne hätte Chris eine Möglichkeit gehabt, den Betreffenden zu warnen. Auch wenn sie nicht so viel Zeit investieren konnte wie Barnaby. Doch selbst wenn es nur ein kurzes Gespräch war: Das ist der Lohn für Mitarbeiter wie uns. Machen Sie sich darauf gefasst.
Aber das war nicht möglich.
Den Vormittag verbrachte Chris mit weiteren Vorbereitungen. Unter dem Namen Casey Wilson checkte sie im Brayscott ein, einem kleinen Boutique-Hotel. Der Ausweis, den sie dafür benutzte, war nicht viel überzeugender als der von Taylor Golding, aber an der Rezeption klingelten gerade zwei Telefone, so dass die überforderte Angestellte nicht so genau hinsah. Es wären zwar Zimmer zu der frühen Uhrzeit verfügbar, aber Casey müsse dafür einen Tag mehr zahlen, da man normalerweise erst ab drei einchecken könne. Casey fügte sich der Bedingung, ohne sich zu beschweren. Die Rezeptionistin schien erleichtert. Sie lächelte Casey an und nahm sie erstmals bewusst wahr. Casey kontrollierte ihr zuckendes Augenlid. Es machte nichts, wenn sich die junge Frau an sie erinnerte; in der nächsten halben Stunde würde sie sich sowieso unvergesslich machen.
Casey verwendete absichtlich Namen, die Männer wie Frauen tragen konnten. Es war ein Trick, den sie aus den ihr von Barnaby zur Verfügung gestellten Unterlagen hatte. Echte Spione arbeiteten so, aber es leuchtete ohnehin ein, und in den Romanen war man auch schon darauf gekommen. Wenn jemand in einem Hotel eine Frau suchte, würde er die Bücher zuerst nach einem Frauennamen durchforsten, zum Beispiel nach Jennifer oder Cathy. Es würde dauern, bis Casey, Terry oder Drew an der Reihe waren. Jede gewonnene Minute zählte. Sie konnte ihr Leben retten.
Als ein eifriger Page auf Casey zutrat und ihr seine Dienste anbot, schüttelte sie den Kopf und zog ihr Gepäckstück hinter sich her zum Fahrstuhl. Sie wandte das Gesicht von der Kamera über dem Bedienfeld ab. In ihrem Hotelzimmer angekommen, öffnete sie den Koffer und holte einen großen Aktenkoffer und eine schwarze Umhängetasche mit Reißverschluss heraus. Ansonsten war der Koffer leer.
Casey zog den Blazer aus, mit dem ihr dünner grauer Pulli und die schlichte schwarze Hose wie Bürokleidung wirkten, und hängte ihn auf. Hinten war der Pulli mit Sicherheitsnadeln zusammengezogen, damit er eng anlag. Casey nahm die Nadeln heraus, und der Pulli fiel weiter, was sie sofort kleiner und vielleicht auch jünger wirken ließ. Sie wischte ihren Lippenstift ab, entfernte die Schminke um die Augen und prüfte das Ergebnis im großen Spiegel über der Kommode. Sie sah jetzt jünger und verletzlicher aus. Der weite Pulli vermittelte den Eindruck, als wollte sie sich darin verstecken. Casey war zufrieden.
Wenn der Hotelmanager eine Frau gewesen wäre, hätte sie die Sache etwas anders aufgezogen. Dann hätte sie vielleicht versucht, sich mit blauem und schwarzem Lidschatten Hämatome aufzumalen. Auf dem Schild an der Rezeption unten hatte jedoch der Name William Green gestanden, darum vermutete Casey, sich den Mehraufwand sparen zu können.
Es war kein perfekter Plan, das störte sie. Sie hätte gern eine Woche mehr gehabt, um alle potentiellen Abläufe durchzuspielen. Aber bei der Zeit, die ihr zur Verfügung stand, gab es keine bessere Lösung. Möglicherweise war ihr Plan ein wenig zu kompliziert, doch das war jetzt nicht mehr zu ändern.
Casey rief die Rezeption an und verlangte, Mr Green zu sprechen. Sofort wurde sie verbunden.
»William Green. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Die Stimme war herzlich und überaus warm. Sofort stand ihr das Bild eines Walrosses mit buschigem Schnurrbart vor Augen.
»Ähm, ja, ich hoffe, ich störe Sie nicht …«
»Nein, natürlich nicht, Ms Wilson. Ich bin doch da, um Ihnen auf jede erdenkliche Art zu helfen.«
»Ich brauche tatsächlich Hilfe, also, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam … Ist schwer zu erklären.«
»Keine Sorge, ich kann Ihnen bestimmt weiterhelfen.« Mr Green klang so zuversichtlich, dass Casey sich fragte, welch seltsame Anliegen schon an ihn herangetragen worden waren.
»Oh, Mann.« Sie zauderte. »Unter vier Augen ist es vielleicht einfacher?« Es war nur eine Frage.
»Aber sicher, Ms Wilson. In einer Viertelstunde habe ich Zeit. Mein Büro ist im Erdgeschoss, direkt hinter der Rezeption. Wäre das in Ordnung?«
Flattrig und erleichtert antwortete sie: »Ja. Ich danke Ihnen!«
Casey stellte ihr Gepäck in den Schrank, zählte von ihrem Vorrat im Aktenkoffer gewissenhaft die Geldscheine ab, die sie brauchte, und schob sie in ihre Taschen. Dann wartete sie dreizehn Minuten. Wegen der Kameras im Aufzug nahm sie die Treppe.
Als Mr Green sie in sein fensterloses Büro holte, musste sie fast schmunzeln. Sie hatte mit ihrer Vorstellung von ihm gar nicht so falsch gelegen. Er hatte zwar keinen Schnurrbart – bis auf einen Flaum weißer Augenbrauen war er kahl –, aber ansonsten wirkte er sehr walrossartig.
Es fiel Casey nicht schwer, die Verängstigte zu spielen. Noch ehe die Geschichte über ihren aggressiven Exfreund, der den Familienschmuck gestohlen hatte, zu Ende erzählt war, wusste sie, dass sie Mr Green überzeugt hatte. Er reagierte mit typisch männlicher Empörung, setzte an, über diese Typen zu schimpfen, die zarte Frauen schlugen, aber riss sich zusammen und beschränkte sich auf Zusicherungen wie Wir kümmern uns um Sie, Sie sind hier sicher. Wahrscheinlich hätte er Casey auch ohne das großzügige Trinkgeld geholfen, aber es schadete bestimmt nicht. Mr Green versprach, nur die Angestellten einzuweihen, die Teil ihres Plans waren, und sie bedankte sich überschwänglich. Er wünschte ihr alles Gute und bot an, falls nötig, die Polizei hinzuzuziehen. Mit Enttäuschung in der Stimme vertraute Casey ihm an, wie wenig ihr die Polizei und die Kontaktverbote bisher geholfen hatten. Sie versicherte ihm, die Situation allein im Griff zu haben, solange sie Unterstützung von einem großen, starken Mann wie Mr Green hatte. Er fühlte sich geschmeichelt und eilte los, um alles in die Wege zu leiten.
Es war nicht das erste Mal, dass Casey diese Karte ausspielte. Anfangs war es Barnabys Idee gewesen, als ihr gemeinsamer Fluchtplan in die Phase der Feinjustierung überging. Zuerst hatte sie sich gegen seinen Vorschlag gesträubt, weil sie ihn irgendwie beleidigend fand, aber Barnaby war sehr praktisch veranlagt. Casey war eine zierliche Frau; in den Augen vieler Menschen machte sie das automatisch zur Unterlegenen. Warum sollte sie dieses Vorurteil nicht zu ihrem Zweck nutzen? Das Opfer spielen, um keins zu werden.
Sie ging zurück auf ihr Zimmer und zog die Kleidung an, die sie im Aktenkoffer verwahrte. Den Pulli tauschte sie gegen ein enganliegendes schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt und legte sich einen dicken schwarzen Gürtel aus geflochtenem Leder um. Alles, was sie auszog, musste in den Aktenkoffer passen, denn sie würde den großen Koffer im Hotel zurücklassen und nicht noch einmal wiederkommen.
Casey war bereits bewaffnet; nie ging sie ohne ein Minimum an Vorsichtsmaßnahmen vor die Tür. Nun jedoch galt die höchste Stufe ihrer persönlichen Schutzmaßnahmen. Sie bewaffnete sich buchstäblich bis an die Zähne – beziehungsweise bis zum Zahn: Sie setzte sich eine falsche Krone mit einer Substanz ein, die deutlich weniger schmerzhaft als Zyanid, aber ebenso tödlich war. Es war der älteste Trick der Welt, aus gutem Grund: Er funktionierte. Und manchmal bestand die letzte Freiheit darin, sich den Händen der Feinde durch den Tod zu entziehen.
Die große schwarze Umhängetasche hatte zwei Zierelemente aus Holz am höchsten Punkt des Riemens, oben auf der Schulter. In der Tasche befand sich in kleinen gepolsterten Kästchen Caseys Schmuck.
Jedes Teil für sich war einzigartig und unersetzlich. Nie wieder würde sie die Möglichkeit haben, derartige Preziosen zu erwerben, deshalb ging sie mit ihnen sehr vorsichtig um.
Es waren drei Ringe – aus Rotgold, Gelbgold und Silber. In jedem versteckte sich ein kleiner Widerhaken hinter einer winzigen Klappe. Die Farbe des Metalls verriet ihr, mit welchem Mittel der Haken präpariert war. Schlicht und einfach. Passte zu ihr.
Casey besaß auch Ohrringe, die sie mit besonderer Sorgfalt behandelte. Zu diesem Zeitpunkt würde sie sie noch nicht einsetzen; sie wollte warten, bis sie ihrem Ziel näher war. Wenn sie die Ohrringe trug, konnte sie den Kopf nur sehr vorsichtig bewegen. Sie sahen aus wie einfache Glaskugeln, waren aber so dünn, dass sie allein durch einen hohen Ton zerbrachen, denn das Glas stand von innen unter Druck. Wenn jemand Casey an den Hals oder den Kopf fasste, zersprang das Glas mit einem leisen Knacken. Sie würde den Atem anhalten – das konnte sie locker eine Minute fünfzehn – und wenn möglich die Augen schließen. Ihr Gegenüber würde nicht wissen, warum sie das tat.
Um den Hals legte sie sich eine Kette mit einem silbernen Medaillon. Es war so auffällig, dass es jedem ins Auge sprang, der Caseys wahre Identität kannte. Tödlich war an ihm allerdings nichts; es lenkte nur von den wahren Gefahren ab. Im Anhänger war das Foto eines entzückenden weizenblonden Mädchens. Sein voller Name war auf die Rückseite des Bildes geschrieben, es handelte sich um Carstons einzige Enkeltochter. Wenn es zu spät für Casey wäre, würde hoffentlich ein unbeteiligter Polizist ihre Leiche finden und mangels Möglichkeiten der Identifizierung gezwungen sein, dieses Beweismittel zu untersuchen. Dadurch würde der Mord mit demjenigen in Zusammenhang gebracht werden, der letztlich verantwortlich war. Wahrscheinlich würde es Carston nicht groß schaden, aber es könnte ihm Probleme bereiten, er könnte sich bedroht fühlen und Angst bekommen, dass Casey noch mehr Informationen weitergegeben hatte.
Denn sie wusste genug über vertuschte Katastrophen und Verschlusssachen, um Carston erhebliche Probleme zu bereiten. Doch selbst jetzt, drei Jahre nach ihrem ersten Todesurteil, hatte sie sich nicht zu einem Verrat oder der sehr reellen Möglichkeit überwinden können, eine Panik auszulösen. Es war nicht vorherzusehen, welchen Schaden ihre Enthüllungen anrichten und wie sehr unschuldige Bürger darunter leiden würden. Deshalb beschränkte sie sich darauf, Carston lediglich zu suggerieren, sie hätte so etwas Gewagtes getan. Vielleicht bekäme er vor Schreck eine Gehirnblutung. Ein hübsches kleines Medaillon mit einer kleinen Prise Rache, die das Verlieren versüßte.
Die Kette, an der das Medaillon hing, war hingegen durchaus tödlich. Im Verhältnis zu ihrer Dicke hatte sie die Zugfestigkeit eines Stahlseils und war ohne weiteres geeignet, jemanden zu erdrosseln. Sie wurde nicht mit einem Haken, sondern mit zwei Magneten geschlossen; Casey hatte nicht vor, sich mit ihren eigenen Waffen schlagen zu lassen. Die hölzernen Zierelemente am Trageriemen der Umhängetasche hatten Aussparungen, in die die Magnete eingehakt werden konnten; so wurden die Holzelemente zu Griffen. Körperliche Gewalt war nicht Caseys erste Wahl, aber sie könnte ihren Gegner damit überraschen. Das könnte ihr einen kleinen Vorsprung verschaffen.
Im komplizierten Flechtmuster ihres schwarzen Ledergürtels versteckten sich mehrere aufgezogene Spritzen. Sie konnte sie einzeln herausholen oder aber einen Mechanismus auslösen, der alle Nadelspitzen gleichzeitig freilegte, wenn ein Angreifer Casey an sich drückte. Die unterschiedlichen Substanzen in Kombination miteinander würden seinem Körper nicht guttun.
In ihren Taschen steckten Skalpelle mit zugeklebten Klingen.
In den Schuhen waren die üblichen Messer verborgen, eins sprang nach vorn heraus, eins nach hinten.
In der Umhängetasche hatte sie zwei Sprühdosen mit der Aufschrift »Pfefferspray«, doch nur eine enthielt es auch. Die andere war mit einem Mittel gefüllt, das ihr Opfer längere Zeit außer Gefecht setzen würde. Außerdem befand sich ein hübscher Parfümflakon in der Tasche, der keine Flüssigkeit enthielt, sondern Gas.
In der Hosentasche steckte etwas, das wie ein normaler Lippenstift aussah.
Und sie hatte noch ein paar weitere interessante Sachen bei sich, nur für den Fall. Dazu die kleinen Utensilien, die Casey für das unwahrscheinlichere Ergebnis dabeihatte: den Erfolg. Ein grellgelbes Plastikfläschchen in Zitronenform, Streichhölzer, einen Feuerlöscher für unterwegs. Und jede Menge Bargeld. Sie steckte die Magnetkarte ein; Casey würde zwar nicht in dieses Hotel zurückkehren, aber wenn alles gut lief, täte das jemand anderes.
Wenn sie voll ausgerüstet war wie jetzt, musste sie vorsichtig sein. Sie hatte jedoch genug geübt, um sich selbstsicher bewegen zu können. Zu wissen, dass es für jeden schlecht ausgehen würde, der sie zwang, ihre Vorsicht über Bord zu werfen, war ihr ein Trost.
Den Aktenkoffer in der Hand und die schwarze Schultertasche über dem Arm, verließ sie das Hotel und nickte der Rezeptionistin zu, bei der sie eingecheckt hatte. Sie stieg in ihr Auto und fuhr zu einem beliebten Park nahe dem Zentrum. Den Wagen ließ sie auf dem Parkplatz des im Norden angrenzenden Einkaufszentrums stehen, dann ging sie in den Park.
Dort kannte sie sich ziemlich gut aus. In der Südostecke war eine öffentliche Toilette, die Casey als Erstes ansteuerte. Wie erwartet, war sie an diesem Vormittag leer – es war Schule. Das nächste Outfit kam aus dem Aktenkoffer. Außerdem hatte Casey einen großen Rucksack und weitere Ausrüstungsgegenstände dabei. Sie zog sich um, verstaute die alten Sachen im Koffer und stopfte ihn zusammen mit der Schultertasche in den Rucksack.
Als sie die öffentliche Toilette verließ, war sie nicht mehr ohne weiteres als Frau erkennbar. Federnden Schrittes ging sie zur Südspitze des Parks und achtete darauf, in der Hüfte steif zu bleiben, um sich nicht zu verraten. Auch wenn Casey nicht das Gefühl hatte, beobachtet zu werden, war es immer klüger, so zu tun, als ob.
Als die Mittagspause näherrückte, wurde es, wie erwartet, voller. Keiner beachtete den androgynen jungen Parkbesucher, der im Schatten auf einer Bank saß und wie wild auf seinem Smartphone herumtippte. Niemand kam nahe genug heran, um zu merken, dass das Handy nicht eingeschaltet war.
Auf der anderen Straßenseite befand sich der Laden, in dem Carston gerne zu Mittag aß. Es war nicht der Treffpunkt, den Casey vorgeschlagen hatte. Außerdem war sie fünf Tage zu früh.
Ihre Augen hinter der Sonnenbrille suchten die Bürgersteige ab. Vielleicht klappte es nicht. Carston konnte seine Gewohnheiten geändert haben. Sie waren schließlich gefährlich. Genau wie das Gefühl, sich in Sicherheit zu wiegen.
Casey hatte alle Tipps zu Verkleidungen in Handbüchern und Romanen durchgearbeitet, immer mit dem Fokus auf Dingen, die ihr einleuchteten. Entscheide dich nicht für eine platinblonde Perücke und hohe Absätze, nur weil du klein und braunhaarig bist. Nicht das Gegenteil ist das Ziel, sondern absolute Unauffälligkeit. Überlege, was Aufmerksamkeit erregt – beispielsweise blonde Haare oder Stilettoabsätze –, und meide es. Nutze deine Stärken! Was du an dir selbst für unattraktiv hältst, ist vielleicht deine Lebensversicherung.
Damals, als ihr Leben noch normal war, hatte sie ihre knabenhafte Figur gehasst. Heute setzte Casey sie zu ihrem Vorteil ein. Wenn sie ein weites Trikot und eine zu große, abgewetzte Jeans trug, nahmen Augen, die Ausschau nach einer Frau hielten, Casey gar nicht wahr. Sie hatte einen männlichen Kurzhaarschnitt, der sich gut unter einer Basecap verstecken ließ. Ein zweites Paar Socken in den zu großen Reeboks verliehen ihr den typisch tapsigen Look eines männlichen Teenagers. Wenn jemand ihr Gesicht eingehender musterte, mochte er ein paar Unstimmigkeiten entdecken. Aber warum sollte sich jemand mit ihr beschäftigen? Der Park füllte sich mit Menschen aller Altersklassen. Casey fiel nicht weiter auf, und niemand rechnete dort mit ihr. Seit dem ersten Mordversuch des Dezernats war sie nicht mehr in Washington gewesen.
Dies war nicht gerade ihre Stärke: ihren Kokon verlassen, auf die Jagd gehen. Immerhin hatte sie lange darüber nachgedacht. Was sie an einem normalen Tag sonst tat, forderte nur einen kleinen Teil ihrer Aufmerksamkeit und Intelligenz. Der Rest ihres Kopfes spielte ständig Möglichkeiten durch, malte sich Szenarien aus. Das verlieh Casey nun ein wenig Zuversicht. Sie hielt sich an Strategien, die durch monatelanges Nachdenken entstanden waren.
Carston hatte seine Gewohnheiten nicht geändert. Um Punkt Viertel nach zwölf setzte er sich an einen Bistrotisch vor dem Café. Wie Casey erwartet hatte, entschied er sich für einen, an dem er im Schatten des Sonnenschirms sitzen konnte. Früher war Carston rothaarig gewesen. Jetzt war er so gut wie kahl, aber seine Haut noch immer empfindlich.
Die Kellnerin winkte ihm zu, wies mit dem Kopf auf den Block in ihrer Hand und ging hinein. Er bestellte also dasselbe wie immer. Noch eine Gewohnheit, die tödlich sein konnte. Wenn Casey Carston hätte umbringen wollen, hätte sie das tun können, ohne dass er überhaupt mitbekommen hätte, dass sie in der Nähe war.
Sie stand auf, stopfte sich das Handy in die Tasche und warf sich den Rucksack über die Schulter.
Der Weg führte hinter einem Hügel und an mehreren Bäumen entlang. Dort konnte Carston sie nicht sehen. Es war Zeit für die nächste Verkleidung. Casey veränderte ihre Körperhaltung. Sie nahm die Kappe ab, schlüpfte aus dem Trikot, zog den Gürtel enger und rollte die Beine ihrer Hose hoch, bis sie wie eine Boyfriend-Jeans aussah. Sie zog die Turnschuhe aus und tauschte sie gegen Sportballerinas aus dem Rucksack. All das machte sie ganz beiläufig, als ziehe sie sich um, weil ihr zu warm war. Das Wetter ließ einen solchen Rückschluss zu. Passanten würden sich vielleicht wundern, dass unter der männlichen Kleidung eine junge Frau zum Vorschein kam, aber sie bezweifelte, dass sich jemand dezidiert an sie erinnern können würde. Im Park waren viel auffälligere Menschen unterwegs. Bei Sonnenschein kamen in Washington immer die ganzen Freaks aus ihren Löchern.
Casey schlang sich die Umhängetasche wieder über die Schulter und legte den Rucksack, als gerade niemand guckte, hinter einen abseits stehenden Baum. Wenn ihn dort jemand fand und mitnahm, würde ihr nichts fehlen, das sie dringend zum Leben brauchte.
Hinlänglich überzeugt, dass sie niemand sah, stülpte Casey sich eine Perücke über und setzte als Letztes ganz vorsichtig ihre Ohrringe ein.
Sie hätte sich Carston in ihrem jungenhaften Outfit zeigen können, doch warum sollte sie ihm das verraten? Warum ihn darauf aufmerksam machen? Vielleicht musste sie bald wieder als Junge auftreten, deshalb wollte sie ihre Tarnung jetzt nicht unnötig preisgeben. Sicherlich hätte sie Zeit gespart, wenn sie dasselbe wie im Hotel getragen hätte, aber dann könnte das Bild, das die Sicherheitskameras dort von ihr aufgenommen hatten, problemlos mit den Aufnahmen aller öffentlichen und privaten Kameras verglichen werden, die sie jetzt filmten. Indem sich Casey viel Mühe mit ihrem Äußeren gab, zerstörte sie so viele Querverbindungen wie möglich; falls jemand versuchte, den Jungen, die Geschäftsfrau oder die Parkbesucherin ausfindig zu machen, die sie jetzt war, stände er vor erheblichen Schwierigkeiten.
In der Frauenkleidung war es kühler. Die leichte Brise trocknete den Schweiß, der sich unter dem Nylonstoff des Trikots gesammelt hatte. Casey ging auf die Straße.
Sie näherte sich Carston von hinten, über denselben Weg, den er wenige Minuten zuvor genommen hatte. Sein Essen war gekommen – Sandwich mit Parmesanhühnchen –, er schien vollkommen versunken in den Genuss. Doch Casey wusste, dass Carston besser als jeder andere Dinge vorgaukeln konnte.
Ohne großes Aufhebens setzte sie sich ihm gegenüber. Mit vollem Mund sah er sie an.
Sie wusste, dass er ein guter Schauspieler war. Deshalb ging sie davon aus, dass er seine wahre Reaktion verbarg und sich stattdessen so gab, wie es ihm ratsam erschien. Da er nicht im Geringsten überrascht wirkte, ging sie davon aus, dass sie ihn völlig überrumpelt hatte. Denn wenn er mit ihr gerechnet hätte, hätte er so getan, als würde ihr plötzliches Auftauchen ihn erschrecken. Doch sein starrer Blick über den Tisch, die nicht vergrößerten Augen und das gleichmäßige Kauen verrieten Casey, dass er seinen Schock überspielte. Davon war sie zu fast achtzig Prozent überzeugt.
Sie sagte nichts. Erwiderte nur seinen ausdruckslosen Blick, während er seinen Bissen hinunterschluckte.
»Es wäre wahrscheinlich zu leicht, sich einfach wie geplant zu treffen«, bemerkte er.
»Ja, zu leicht für deinen Heckenschützen.« Sie sagte es beiläufig, in derselben Lautstärke wie er. Jeder, der ihnen zuhörte, würde ihre Antwort für einen Witz halten. Die anderen beiden Gruppen von Mittagsgästen unterhielten sich laut lachend; die Passanten auf dem Bürgersteig konzentrierten sich auf ihre Handys und Kopfhörer. Niemanden interessierte, was sie sagte. Nur Carston.
»Das war nie mein Ding, Juliana. Das müsstest du wissen.«
Jetzt war sie es, die sich nichts anmerken ließ. Es war so lange her, dass jemand sie mit ihrem richtigen Namen angesprochen hatte, dass er ihr wie der einer Fremden erschien. Nach dem anfänglichen Schreck empfand sie eine gewisse Genugtuung. Es war gut so. Sie machte alles richtig.
Carstons Blick huschte zu ihrer Perücke – sie glich ihrer Naturhaarfarbe. Aber er argwöhnte bestimmt, dass sie darunter etwas komplett anderes versteckte. Dann zwang er sich, Casey wieder in die Augen zu schauen. Er wartete noch eine Weile auf eine Erwiderung, doch als sie nichts sagte, sprach er weiter, wählte seine Worte mit Bedacht.
»Die Kreise, die … ähm … beschlossen haben, dass du … aus dem Dienst … ausscheiden sollst … sind in … Ungnade gefallen. Die Entscheidung war von Anfang an umstritten, aber jetzt können diese Kreise die anderen nicht mehr unterdrücken.«
Möglich war es. Stimmte aber wahrscheinlich nicht.
Carston sah die Skepsis in Caseys Blick: »Gab es in den letzten neun Monaten irgendwelche … unangenehmen Störungen?«
»Und ich hab mir eingebildet, ich wäre besser im Versteckspielen geworden als ihr.«
»Es ist vorbei, Julie. Die Gerechtigkeit hat gesiegt.«
»Ende gut, alles gut.« Sie klang schwer sarkastisch.
Carston zuckte beleidigt zusammen oder tat zumindest so.
»Nein, leider nicht alles gut«, sagte er langsam. »Wenn dem so wäre, hätte ich mich nicht mit dir in Verbindung gesetzt. Dann wärst du einfach den Rest deines Lebens in Ruhe gelassen worden. Und dieses Leben wäre lang gewesen, wenn es nach uns ginge.«
Sie nickte, als würde sie zustimmen und ihm glauben. Früher hatte sie immer gedacht, Carston sei genau so, wie er nach außen hin wirkte. Lange war er das Gesicht der Guten gewesen. Auf verquere Weise machte es jetzt fast Spaß, zu entschlüsseln, was seine Worte tatsächlich bedeuteten.
Wenn da nur nicht diese leise Stimme gewesen wäre, die immer fragte: Und wenn es doch kein Spiel ist? Was ist, wenn es stimmt … wenn ich frei sein könnte?
»Du warst die Beste, Juliana.«
»Dr. Barnaby war der Beste.«
»Ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber du warst weitaus begabter.«
»Danke.«
Carston hob die Augenbrauen.
»Nicht für das Kompliment«, erklärte Casey. »Sondern dafür, dass du nicht versuchst mir vorzumachen, sein Tod wäre ein Unfall gewesen.« Ihr Ton war noch immer sachlich.
»Es war eine denkbar schlechte Entscheidung, ausgelöst durch Paranoia und Illoyalität. Wer jemanden hintergeht, nimmt immer an, dass der andere ebenso hinterhältig ist wie er selbst. Unehrliche Menschen glauben nicht, dass es ehrliche gibt.«
Sie verzog keine Miene.
Niemals hatte sie in den drei Jahren ihrer Flucht auch nur ein einziges Geheimnis verraten, in das sie eingeweiht gewesen war. Nicht ein einziges Mal hatte sie ihren Jägern Grund gegeben, sie für eine Verräterin zu halten. Selbst nach den Attentaten hatte sie nichts gesagt. Aber das hatte dem Dezernat nichts bedeutet, gar nichts.
Diese Leute hatten sowieso andere Prioritäten. Kurz war Casey abgelenkt von der Erinnerung daran, wie nah sie ihrem Ziel gewesen war, wie weit sie inzwischen mit ihrem wichtigsten Forschungsprojekt gekommen wäre, hätte man sie nicht unterbrochen. Auch das hatte offensichtlich niemanden interessiert.
»Aber jetzt sehen die Rädelsführer alt aus«, fuhr Carston fort. »Weil wir seither einfach niemanden finden konnten, der so gut ist wie du. Ach, nicht mal jemanden, der nur halb so gut ist wie Barnaby. Ich kann mich nur wundern, wie schnell manche Menschen vergessen, dass gute Leute rar sind.«
Er wartete, hoffte offenbar, dass sie antworten oder etwas fragen würde, das ihr Interesse verriet. Doch Casey sah ihn nur höflich an, so, wie man eine Kassiererin anschaut, die einem die zu zahlende Summe der Einkäufe nennt.
Seufzend beugte er sich vor, plötzlich angespannt. »Wir haben ein Problem. Wir brauchen Antworten, die nur du uns beschaffen kannst. Wir haben sonst keinen, der das könnte. Und wir dürfen es nicht verbocken.«
»Ihr, nicht wir«, sagte sie.
»Ich kenne dich, Juliana. Unschuldige sind dir nicht egal.«
»Früher waren sie das nicht. Man könnte sagen, der Teil von mir wurde umgebracht.«
Wieder zuckte Carston zusammen.
»Juliana, es tut mir leid. Es hat mir schon immer leidgetan. Ich habe versucht, die Sache aufzuhalten. Als ich hörte, dass du entkommen bist, war ich so erleichtert. Jedes Mal, wenn du entkommen bist.«
Sie konnte nicht anders: Sie war beeindruckt, dass er so einfach alles gestand. Kein Leugnen, keine Ausflüchte. Nichts von dem, was sie erwartet hatte: Das war doch nur ein Unfall im Labor. Oder: Das waren nicht wir, das waren Staatsfeinde. Keine Geschichten, sondern ein Bekenntnis.
»Und jetzt tut es allen leid.« Er senkte die Stimme, und Casey musste sich anstrengen, um ihn zu verstehen. »Weil wir dich nicht mehr haben und weil es Tote geben wird, Juliana. Tausende. Hunderttausende.«
Er wartete, während sie nachdachte. Sie brauchte eine Weile, um alle Eventualitäten abzuwägen.
Dann antwortete sie ebenfalls leise und achtete darauf, kein Gefühl oder Interesse in ihre Stimme dringen zu lassen. Sachlich bleiben, um weiterzukommen. »Ihr kennt jemanden, der lebenswichtige Informationen hat.«
Carston nickte.
»Ihr könnt ihn oder sie nicht ausschalten, weil dann andere wüssten, dass ihr über sie im Bilde seid. Und das würde nur beschleunigen, was ihr lieber verhindern wollt.«
Noch ein Nicken.
»Wir reden über etwas wirklich Schlimmes, ja?«
Ein Seufzen.
Nichts versetzte das Dezernat so in Alarm wie Terrorismus. Damals, als man Casey einstellte, hatte sich der emotionale Aufruhr um das Loch, wo vorher die Twin Towers gewesen waren, noch nicht vollkommen gelegt. Terrorismusbekämpfung war immer der Hauptgrund für ihre Arbeit gewesen – und die beste Rechtfertigung dafür. Doch die terroristische Bedrohung war so lange manipuliert, verdreht und verbogen worden, bis Casey am Ende nicht mehr überzeugt war, patriotische Arbeit zu leisten.
»Und etwas Großes.« Das war keine Frage. Die schlimmste Vorstellung war für alle, dass jemand, der die Vereinigten Staaten inbrünstig hasste, etwas Nukleares in die Hände bekam. Dieser dunkle Schatten machte Caseys Arbeit unersetzlich und für den Rest der Welt unsichtbar, so sehr sich der Normalbürger auch wünschte, dass es keine Menschen wie sie gab.
Und es war passiert, mehr als einmal. Spezialisten wie sie hatten dafür gesorgt, dass daraus keine unüberschaubaren menschlichen Tragödien wurden. Es war ein Kuhhandel. Kleine Schrecken gegen das große Morden.
Carston schüttelte den Kopf. Auf einmal wirkten seine blassen Augen gehetzt. Unwillkürlich erschauderte Casey innerlich, als ihr aufging, dass es Möglichkeit Nummer zwei war. Es gab nur zwei wirklich große Ängste.
Es ist biologisch. Sie sagte es nicht laut, sondern bewegte nur die Lippen.
Carstons trüber Gesichtsausdruck war die Antwort.
Kurz senkte sie den Blick, erinnerte sich an seine bisherigen Reaktionen und ordnete sie im Kopf in zwei Spalten, zwei Möglichkeiten. Nummer eins: Carston war ein begnadeter Lügner, der Casey mit seiner Geschichte an einen Ort locken wollte, wo man besser darauf vorbereitet war, Juliana Fortis endgültig aus dem Weg zu schaffen. Er war schnell im Kopf, sprach ihre empfindlichsten Schwächen an.
Nummer zwei: Jemand war im Besitz einer biologischen Massenvernichtungswaffe, und die herrschenden Mächte wussten nicht, wo sie war und wann sie eingesetzt würde. Aber sie kannten denjenigen, der es wusste.
Ihre Eitelkeit spielte mit hinein und verschob das Gleichgewicht ein wenig. Casey wusste, dass sie gut war. Wahrscheinlich traf es zu, dass man niemand Besseres gefunden hatte.
Dennoch würde sie eher auf die erste Möglichkeit wetten.
»Jules, ich möchte nicht, dass du stirbst«, sagte Carston leise. Offensichtlich hatte er ihre Gedanken erraten. »Wenn es so wäre, hätte ich dich nicht kontaktiert und dir kein Treffen angeboten. Denn ich bin mir sicher, dass du auch jetzt mindestens sechs Möglichkeiten bei dir trägst, mich umzubringen. Und du hättest allen Grund dazu.«
»Glaubst du wirklich, ich beschränke mich auf sechs?«
Kurz runzelte er nervös die Stirn, dann lachte er. »Meine Rede. Ich bin nicht lebensmüde, Jules. Ganz bestimmt nicht.«
Er betrachtete das Medaillon an ihrer Kette, sie unterdrückte ein Lächeln.
Dann sprach sie in leichtem Tonfall weiter. »Es wäre mir lieber, wenn du mich Dr. Fortis nennst. Ich finde, die Zeiten der Vertraulichkeit sind vorbei.«
Er wirkte verletzt. »Ich bitte dich gar nicht um Verzeihung. Ich hätte mich mehr für dich einsetzen sollen.«
Sie nickte, obwohl sie auch diesmal nicht seiner Meinung war. Sie wollte bloß das Gespräch vorantreiben.
»Ich bitte dich, mir zu helfen. Nein, nicht mir, sondern den Unschuldigen, die sonst sterben werden.«
»Wenn sie sterben, liegt es nicht an mir.«
»Ich weiß, Jul… Dr. Fortis. Ich weiß. Es ist meine Schuld. Aber den Opfern wird es egal sein. Die sind dann tot.«
Casey hielt seinem Blick stand. Sie würde nicht als Erste blinzeln.
Sein Gesicht verdüsterte sich. »Möchtest du wissen, wie sie sterben?«
»Nein.«
»Das könnte selbst für deinen Magen zu viel sein.«